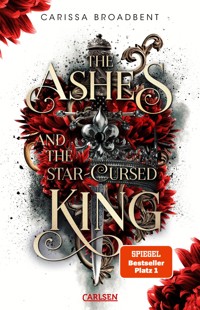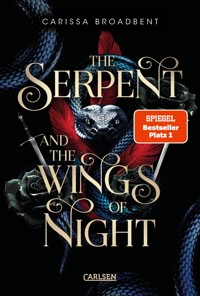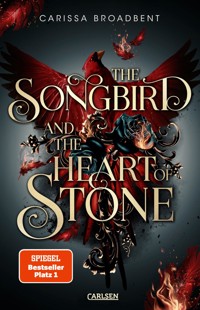12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Carlsen
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Sechs Rosen. Sechs Phiolen mit Blut. Sechs Besuche bei einem Vampir, der ihre Rettung sein könnte … oder ihre Verdammnis. Mit ihrem eigenen nahen Ende hat sie sich schon längst abgefunden, doch der Tod all derer, die sie liebt, ist eine andere Sache. Als ihr Dorf langsam in den Fängen einer mysteriösen, von Göttern verfluchten Krankheit dahin zu siechen droht, unternimmt sie einen verzweifelten Versuch, die Dinge zu ändern. In ihrer Not schließt Lilith einen Handel mit dem Einzigen ab, den die Götter noch mehr hassen als ihr Dorf: dem Vampir Vale. Sie bietet ihm sechs wertvolle Rosen im Tausch gegen sechs Phiolen Vampirblut – denn Vales Blut ist die einzige Hoffnung auf Heilung. Doch als sich aus dem einfachen Handel allmählich mehr entwickelt, gewinnt Lilith eine erschreckende Erkenntnis: Es ist gefährlich, sich in die Fänge eines Vampirs zu begeben. Und an einem Ort, der bereits unter dem Zorn eines Gottes leidet, ist es noch viel gefährlicher, sich in einen Vampir zu verlieben. Crowns of Nyaxia Six Scorched Roses ist eine eigenständige Romantasy-Novelle, die in der Welt der Crowns of Nyaxia-Reihe spielt. Perfekt für Fans von Sarah J. Maas oder Jennifer L. Armentrout und alle, die düstere und romantische Geschichten lieben. Knisternd, dunkel, fesselnd – der TikTok-Bestseller-Erfolg von Carissa Broadbent.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Carissa Broadbent
Six Scorched Roses
Aus dem Englischen von Heike Holtsch und Kristina Flemm
Sechs Rosen. Sechs Phiolen mit Blut. Sechs Besuche bei einem Vampir, der ihre Rettung sein könnte … oder ihre Verdammnis.
Mit ihrem eigenen nahen Ende hat sie sich schon längst abgefunden, doch der Tod all derer, die sie liebt, ist eine andere Sache. Als ihr Dorf langsam in den Fängen einer mysteriösen, von Göttern verfluchten Krankheit dahin zu siechen verdorren droht, unternimmt sie einen verzweifelten Versuch, die Dinge zu ändern.
In ihrer Not schließt Lilith einen Handel mit dem Einzigen ab, den die Götter noch mehr hassen als ihr Dorf: dem Vampir Vale. Sie bietet ihm sechs wertvolle Rosen im Tausch gegen sechs Phiolen Vampirblut – denn Vales Blut ist die einzige Hoffnung auf Heilung.
Doch als sich aus dem einfachen Handel allmählich mehr entwickelt, gewinnt Lilith eine erschreckende Erkenntnis: Es ist gefährlich, sich in die Fänge eines Vampirs zu begeben. Und an einem Ort, der bereits unter dem Zorn eines Gottes leidet, ist es noch viel gefährlicher, sich in einen Vampir zu verlieben.
WOHIN SOLL ES GEHEN?
Buch lesen
Vorbemerkung
Glossar
Triggerwarnung
Nachwort der Autorin
Danksagungen
Viten
VORBEMERKUNG
Liebe Leserin, lieber Leser,
dieser Roman enthält potenziell triggernde Inhalte. Aus diesem Grund befindet sich hier eine Triggerwarnung. Am Romanende findest du eine Themenübersicht, die Spoiler enthält.
Entscheide bitte für dich selbst, ob du diese Warnung liest. Gehe während des Lesens achtsam mit dir um. Falls du auf Probleme stößt und / oder betroffen bist, bleibe damit nicht allein. Wende dich an deine Familie und an Freunde oder suche dir professionelle Hilfe.
Wir wünschen dir alles Gute und das bestmögliche Erlebnis beim Lesen dieser besonderen Geschichte.
Carissa und das Carlsen-Team
KAPITEL EINS
Schon bei meinen ersten Atemzügen begegnete mir der Tod – oder wohl eher bei den ersten Atemzügen, die ich nicht tat. Ich war zu klein, zu kränklich, zu still.
Mein Vater sagte immer, er habe noch nie eine solche Stille erlebt wie bei meiner Geburt – schlimme Minuten lang, in denen niemand etwas sagte – und er sei noch nie so froh gewesen, jemanden schreien zu hören, als ich endlich einen Laut von mir gab.
Doch der Tod blieb mir auf den Fersen. Das war recht bald offensichtlich, auch wenn es niemand wahrhaben wollte.
Als meine Schwester geboren wurde, begegnete er mir ein zweites Mal. Im Gegensatz zu mir schrie sie vom ersten Moment an, als sie auf die Welt kam. Meine Mutter hingegen verstummte für immer.
Mein Vater hatte recht gehabt. Nichts war so schlimm wie eine solche Stille.
Als ich in dieser Lautlosigkeit den Handrücken an meinen Mund presste, um mein Husten und Weinen zu unterdrücken, musterte mich der Heiler mit einem sonderbaren Blick. Doch erst Tage später, nachdem meine Mutter bestattet worden war, nahm er mich beiseite.
»Wie lange schon stimmt etwas mit deiner Atmung nicht?«
Wie sich noch zeigen sollte, verfolgte mich der Tod.
Bald wurde klar, dass mir nur ein kurzes Leben beschieden war. Zunächst wollte man es mir verheimlichen, doch ich war von jeher an Wissen interessiert. Ich war nie gut darin gewesen, Leute zu durchschauen, aber umso besser war ich darin, mir Wissen anzueignen. Und so wurde mir der Tod vertraut, noch ehe ich ihn benennen konnte.
Als mir der Tod ein drittes Mal begegnete, kam er jedoch nicht meinetwegen.
Er senkte sich über die Stadt Adcova wie eine silberne Decke, die die Götter über unser aller Leben ausgebreitet hatten.
So verhält es sich nun einmal mit dem Gott der Fülle. Er hat mehrere Gesichter. Denn der Gott der Fülle ist auch der Gott des Verfalls. Ohne Tod kann es kein Leben geben, ohne Hunger kein Festmahl.
Wie alle anderen Gottheiten hat Vitarus ein wankelmütiges Wesen. Ob Überfluss oder Mangel hängt einzig und allein von seinen Launen ab. Ganze Leben – ganze Städte – kann er mit einem gedankenlosen Wedeln seiner Hand gedeihen lassen oder hinwegfegen.
Lange blickte Vitarus mit einem Lächeln auf Adcova herab. Wir waren ein aufstrebendes Städtchen auf einem fruchtbaren Fleckchen Erde. Wir huldigten allen Gottheiten des Weißen Pantheons, aber vor allem Vitarus, denn er war auch der Gott der Landwirtschaft. Und für lange Zeit wurde uns sein Wohlwollen zuteil.
Das änderte sich zunächst nur allmählich. Erst eine Saat, die nicht aufging, dann eine weitere. Wochenlanger, dann monatelanger Ernteausfall. Bis sich eines Tages auf einen Schlag alles ändern sollte.
Man spürt, dass etwas in der Luft liegt, wenn ein Gott sich ankündigt. Jedenfalls spürte ich es an jenem Tag. Schon als ich die Augen aufschlug, hätte ich schwören können, ich roch den Rauch von Feuerbestattungen.
Ich ging nach draußen. Es war so bitterkalt, dass mein Atem zu weißen Wölkchen kondensierte. Ich zitterte am ganzen Leib. Damals war ich fünfzehn Jahre alt, doch so abgemagert, wie ich war, hätte man mich für jünger halten können. Ganz gleich, wie viel ich aß, der Tod verleibte sich von jedem Bissen etwas ein, und in der letzten Zeit war er besonders hungrig gewesen.
Bis heute kann ich mir nicht erklären, warum ich hinausging. Und ich verstand nicht sofort, was ich dort sah. Mein Vater kniete auf einem der Felder, und zunächst dachte ich, er bearbeite seinen Acker. Doch anstelle wachsenden Grüns waren um ihn herum nur verdorrte Halme, von todbringendem Frost überzogen.
Ich war nie gut darin, jemandem etwas Unausgesprochenes anzusehen. Doch obwohl ich noch fast ein Kind war, wusste ich in dem Moment, als mein Vater mit hoffnungslos hängendem Kopf und nichts als toten Pflänzchen in seinen geballten Fäusten dort auf seinem Acker kniete: Er war ein gebrochener Mann.
»Vater?«, rief ich.
Er drehte sich zu mir um. Ich zitterte noch immer vor Kälte und zog mir meine Stola fester um die Schultern. Doch nun brach mir der Schweiß aus.
Denn mein Vater sah mich mit dem gleichen Blick an, mit dem er die verdorrten Halme angesehen hatte. Als sei auch ich eine vergebliche Hoffnung, die er würde begraben müssen.
»Geh zurück ins Haus«, sagte er.
Beinahe hätte ich es nicht getan.
Jahrelang wünschte ich, ich hätte es nicht getan.
Doch wie hätte ich ahnen können, dass mein Vater einen Gott verfluchte, der es uns mit seinem Zorn vergelten würde?
Damit fing diese Plage an. Mein Vater war als Erster dran. Alle anderen gingen schleichender. Jahre vergingen, in denen Adcova dahinsiechte wie die Saat auf den Feldern an jenem Morgen, als mein Vater uns alle ins Verderben stürzte.
Die Welt um sich herum welken zu sehen, ist sonderbar. Ich hatte stets vor allem auf Erkenntnisgewinn gesetzt. Sogar Gegebenheiten, über die man keine gesicherten Erkenntnisse gewinnen kann – die Macht der Götter etwa oder ungerechte, grausame Wendungen des Schicksals –, weisen immer bestimmte Merkmale auf, wiederkehrende Muster, die sich analysieren lassen.
Ich eignete mir alles Wissen über die Krankheit an. Wie sie die Luft aus den Lungen und das Blut aus den Adern stahl, wie sie die Haut Schicht für Schicht zu Staub zerrieb, bis die verrottenden Muskeln blank lagen. Doch da war noch etwas – etwas, das ich nicht verstand. Jedenfalls nicht ganz.
In dieser Kluft lag so viel Leben verborgen – in der Kluft, die sich zwischen meinen Erkenntnissen und meiner Unkenntnis auftat. Doch sie barg auch so viel Tod – ganz gleich, welche Medizin ich zusammenbraute oder wie viele Heilmittel ich ausprobierte.
Sie hatte so scharfe Zähne, diese Kluft, wie die Vampire an der anderen Küste des Ozeans. Und mit diesen Zähnen fraß sie uns alle bei lebendigem Leibe auf.
Fünf Jahre vergingen. Zehn. Fünfzehn. Immer mehr Menschen erkrankten.
Letzten Endes machte die Krankheit vor niemandem von uns halt.
KAPITEL ZWEI
Ich achtete immer darauf, dass mein Arbeitsplatz ordentlich war, doch an jenem Abend räumte ich ihn besonders sorgfältig auf. Im schwächer werdenden Licht der Abendsonne, das meinen Schreibtisch in rosiges Blutrot tauchte, sortierte ich meine Aufzeichnungen und Utensilien, bis alles so übersichtlich bereitlag, dass auch jemand nicht Eingeweihtes sich nur hätte zu setzen brauchen, um meine Arbeit fortzuführen. Es waren rein praktische Überlegungen für den Fall, dass ich nicht zurückkehren würde. Ich war verzichtbar, meine Arbeit jedoch nicht.
Nach einem letzten kritischen Blick ging ich hinaus in das Gewächshaus. Es war kein schöner Ort – nicht bestückt mit bunten Blumen, sondern nur mit Glasgefäßen, die dornige Laubblätter und Ranken enthielten. Viel wollte hier derzeit nicht wachsen. Nur draußen hinter der Glastür, die zu den Feldern führte, schimmerte ein Farbtupfer. Dass die Felder Früchte getragen hatten, war lange her. Lediglich auf einem kleinen Stückchen Erde gedieh etwas – eine Ansammlung von Rosenbüschen mit schwarzen Blüten zwischen smaragdgrünen, leuchtend rot geränderten Blättern.
Vorsichtig knipste ich eine Blüte ab und steckte sie mit größter Sorgfalt in meine Tasche. Dann ging ich in den Garten.
Mina saß in der Abendsonne. Es war noch warm, doch sie hatte sich eine Decke über die Beine gelegt. Sie drehte sich zu mir um und kniff im Gegenlicht der untergehenden Sonne die Augen zusammen. »Wohin gehst du?«
»Nur ein paar Besorgungen machen«, antwortete ich.
Stirnrunzelnd sah sie mich an. In dem Wissen, dass ich gelogen hatte.
Ich blieb eine Weile neben ihr stehen – sah ihre zarten dunkel verfärbten Fingernägel und hörte ihren rasselnden Atem. Doch am deutlichsten fiel mir die feine Schicht hautfarbenen Staubs auf, die sich auf ihren Stuhl und ihre Decke gelegt hatte. Verlassen von ihrer eigenen Haut, je mehr der Tod sich näherte.
Ich legte meiner Schwester eine Hand auf die Schulter, und für einen Moment überlegte ich, ob ich ihr sagen sollte, wie sehr ich sie liebte.
Natürlich sagte ich es nicht.
Denn hätte ich es getan, hätte sie gewusst, wohin ich gehen wollte, und versucht, mich davon abzuhalten. Außerdem wären Worte angesichts dessen, was ich vorhatte, sinnlos gewesen. Meine Liebe zu ihr manifestierte sich in der Wissenschaft, in Mathematik und Medizin. Nicht in einer Umarmung – was hätte ihr die denn auch genutzt?
Und hätte ich sie in meine Arme genommen, dann hätte ich sie vielleicht nie wieder loslassen wollen.
»Lilith …«, begann sie.
»Ich bin gleich zurück«, sagte ich.
VERSCHWITZT UND AUSSER ATEM stand ich auf der Schwelle vor den Doppeltüren und musste mich erst einmal sammeln. Ich wusste nicht, was mich erwartete, aber ich wollte nicht den Eindruck eines schäbigen Straßenköters machen. Ich warf einen Blick über die Schulter auf die Dutzende von Marmorstufen, die ich gerade hinaufgegangen war, und auf den darunter liegenden Wald. Mein Städtchen war von hier oben aus nicht mehr zu sehen. Es war ein sehr langer Weg gewesen.
Nächstes Mal würde ich ihn zu Pferd zurücklegen.
Ich legte den Kopf in den Nacken und betrachtete das Haus, das vor mir aufragte. Es bestand aus einer kuriosen Mischung architektonischer Elemente – Strebepfeilern, Bogenfenstern und Marmorsäulen –, die zusammengenommen eigentlich absurd hätten wirken müssen, jedoch ein stoisch herrschaftliches, furchterregendes Gebäude darstellten.
Ich holte tief Luft und stieß sie wieder aus.
Dann betätigte ich den Türklopfer und wartete.
Nichts geschah.
Nach ein paar Minuten klopfte ich ein weiteres Mal, lauter diesmal.
Und wartete.
Nichts.
Ich klopfte ein drittes und ein viertes Mal. Schließlich sagte ich mir: Es ist ohnehin das unsinnigste Unterfangen, das ich mir je habe einfallen lassen, und versuchte, einen der Türflügel aufzustoßen.
Zu meinem Glück – oder Pech – war die Tür unverschlossen, und sie quietschte in den Angeln, als sei sie schon sehr, sehr lange nicht mehr geöffnet worden. So fest ich konnte, musste ich mich dagegenstemmen, damit der schwere Mahagoniflügel sich überhaupt ein Stückchen bewegte.
Im Inneren des Hauses war es absolut still. Staubig. Düster. Nur das Mondlicht schien durch den Türspalt hinter mir und tauchte zahllose Objekte in silbriges Licht – Skulpturen, Gemälde, Artefakte, die ich, je mehr sich meine Augen an die Dunkelheit gewöhnten, erst nach und nach ausmachen konnte. Es waren so viele, in einer ebenso wilden Mischung wie das Äußere des Hauses, dass es mir unmöglich war, sie alle zu erfassen. Bei den Göttern, ich stand da wie gebannt.
»Ist hier jemand?«, rief ich schließlich.
Doch es war nichts zu hören. Keinerlei Bewegung, bis auf das leise Rascheln der mottenzerfressenen Vorhänge.
Vielleicht war er längst tot. Seit Jahrzehnten hatte ihn niemand mehr gesehen. Was für eine Enttäuschung, wenn ich den ganzen Weg hierhergekommen war, nur um einen verwesten Leichnam anzutreffen. Verwesten solche wie er überhaupt? Oder …?
»Na, so etwas«, ertönte eine tiefe Stimme. »Da hat sich ein kleines Mäuschen in mein Haus geschlichen.«
KAPITEL DREI
Hier ist nichts, wovor ich Angst haben müsste, versuchte ich mir zu sagen. Trotzdem standen mir die Haare zu Berge.
Ich drehte mich um.
Und obwohl ich damit gerechnet hatte, zuckte ich zusammen, als er im Dunkeln oben auf der Treppe stand.
Meine Augen brauchten einen Moment, um auch jenseits des Mondlichts etwas zu erkennen. Er stand auf dem oberen Treppenabsatz und sah mit dem unbestimmten Interesse eines Falken auf mich herab. Er hatte langes, dunkelbraunes Haar, etwas gewellt, und einen gepflegten Bart. Gekleidet war er in ein weißes Hemd und eine schwarze Hose, unspektakulär, wenn nicht sogar ein wenig altmodisch. Er war groß, aber nicht riesig. Und irgendwelche Hörner oder Flügel konnte ich beim besten Willen nicht entdecken.
Ich war fast ein wenig enttäuscht, weil er … so normal aussah.
Lediglich seine Art, sich zu bewegen, verriet, dass er kein menschliches Wesen war – besser gesagt, seine Art, sich nicht zu bewegen. Reglos wie aus Stein. Kein Zucken eines Muskels, kein Heben und Senken der Schultern, nicht die Spur eines Blinzelns, als er mich musterte. So etwas fällt einem erst auf, wenn es nicht vorhanden ist, und sofort schrie alles in mir: Du hast einen Fehler gemacht!
Er kam die Treppe herunter. Im Mondlicht schimmerten bernsteinfarbene Augen und, als sich langsam ein Lächeln auf seinen Lippen ausbreitete, zwei spitze Eckzähne.
Sogleich schwand meine Furcht und wich schlichter Neugier.
Spitze Eckzähne. Richtig spitze Eckzähne, wie in den Geschichten. Ich fragte mich, wie das funktionierte. Enthielt sein Speichel eine Art Gerinnungshemmer oder …?
»Würdest du mir verraten, was du in meinem Haus willst?«
Er hatte einen Akzent, sprach die T und D hart aus und zog die A und O melodisch in die Länge.
Interessant. Ich hatte noch nie einen obitraeischen Akzent gehört. Wie auch? Die meisten Leute in den Menschennationen waren noch nie einem Vampir begegnet. Immerhin verließen Vampire nur selten ihre Heimat, und taten sie es doch, war man gut beraten, wenn man ihnen aus dem Weg ging.
»Ich will zu Euch«, sagte ich.
»Und deshalb kommst du einfach ungebeten herein?«
»Es wäre leichter gewesen, wenn Ihr die Tür geöffnet hättet.«
Er blieb am Fuß der Treppe stehen. Wieder in der Reglosigkeit eines Vampirs, bis auf einen trägen Wimpernschlag. »Weißt du überhaupt, wo du hier bist?«
Was für eine dämliche Frage.
Er mochte ja gewohnt sein, dass man vor ihm zurückwich. Ich jedenfalls tat es nicht. Warum auch? Ich war dem Tod schon dreimal begegnet. Und dieses vierte Mal verlief bislang eher enttäuschend.
»Ich habe Euch ein Geschenk mitgebracht«, erklärte ich.
Seine Brauen zogen sich kaum merklich zusammen. »Ein Geschenk?«, wiederholte er.
»Ein Geschenk.«
Er neigte den Kopf ein wenig, mit einem leichten Grinsen auf den Lippen. »Bist du das Geschenk?«
»Nein«, antwortete ich.
»Diesmal nicht«, korrigierte er, worauf ich keine Antwort parat hatte.
»Das Geschenk ist etwas Besonderes. Etwas Einzigartiges. Wie ich gesehen habe, wisst Ihr Einzigartiges zu schätzen.« Ich machte eine ausladende Geste auf die mit unzähligen Kunstwerken behangenen Wände. »Im Tausch dagegen will ich Euch um einen Gefallen bitten.«
»Dann ist es kein Geschenk«, stellte er klar. »Dann ist es Bezahlung. Und ich biete keine käuflichen Dienste an.«
»Unbedeutende Details«, sagte ich. »Hört Euch mein Angebot erst einmal an. Mehr verlange ich gar nicht.«
Stirnrunzelnd musterte er mich. Schweigend. Ich fragte mich, ob jemand, der besser Mimik lesen konnte als ich, seinen Gesichtsausdruck hätte deuten können. Ich jedenfalls konnte es nicht.
Als sich das Schweigen in die Länge zog, wurde mir unbehaglich und ich räusperte mich.
»Können wir uns irgendwo setzen?«, fragte ich.
»Setzen?«
»Ja, hinsetzen. Hier gibt es doch sicher eine Menge Sitzgelegenheiten. Tag und Nacht allein in diesem großen Haus tut man vermutlich nichts anderes, als herumzusitzen.«
»Mache ich den Eindruck, als täte ich nichts anderes, als herumzusitzen?«
Er kam einen Schritt näher, und unwillkürlich sah ich ihn mir genauer an.
Nein, er schien mir nicht wie jemand, der nur herumsaß, sondern eher wie jemand, der sich viel bewegte. Manchmal wahrscheinlich sogar schwere Sachen hob.
Ich stieß einen gequälten Seufzer aus. »Wie Ihr wollt. Wir können auch hier im Stehen weiterreden.«
Er schien zu überlegen, dann sagte er: »Komm mit.«
ER FÜHRTE MICH in ein Wohnzimmer, das noch voller war als die Eingangshalle. Immerhin war es beleuchtet, wenn auch nur spärlich von Laternen, in denen merkwürdige blaue Flammen züngelten. Gemälde, Schilde, Schwerter und Schriftrollen hingen an den Wänden. Überbordende Bücherregale waren in jede Ecke geschoben worden – sogar vor die Fenster – und die Mitte des Raums war vollgestellt mit nicht zusammenpassendem feinem Mobiliar. Statuen ragten neben uns auf, als wir das Zimmer betraten – auf der einen Seite blickte eine grüne Jadekatze auf uns herab, von der anderen starrte uns eine vollkommen nackte Frau aus schwarzem Marmor mit misstrauischem Blick grimmig an. Die Vorhänge waren aus himmelblauer Seide, und Streifen aus demselben Stoff waren an der gegenüberliegenden Wand um ein Ensemble aus Gemälden herumdrapiert.
Es war das reinste Durcheinander und gleichzeitig der atemberaubendste, schönste Ort, den ich je gesehen hatte.
Innerhalb weniger Sekunden entdeckte ich Kunstwerke aus vier verschiedenen Ländern in weit entfernten Regionen der Welt. Was sich in diesem Raum an geballtem Wissen angesammelt hatte – es schien mir unvorstellbar.
Ich musste wohl die Augen ein wenig aufgerissen haben, denn er gab ein Geräusch von sich, das fast einem leisen Lachen glich.
»Gibt es an meiner Einrichtung etwas auszusetzen?«
Etwas auszusetzen?
Etwas so Beeindruckendes habe ich noch nie gesehen, hätte ich ihm beinahe gesagt. Doch noch war nicht der richtige Zeitpunkt für solche Schmeicheleien.
»Welchem Haus gehört Ihr an?«, fragte ich stattdessen.
Ein weiterer Wimpernschlag. »Wie bitte?«
Offenbar dachte er, er hätte sich verhört.
»Welchem Herrscherhaus? In Obitraes.« Ich zeigte auf die Wand. »All das scheint viel zu farbenfroh, als dass es aus dem Haus des Schattens stammen könnte. Und für das Haus des Blutes seht Ihr viel zu gesund aus. Also kommt Ihr aus dem Haus der Nacht?«
Wieder senkten sich seine Augenbrauen, diesmal so tief, dass seine bernsteinfarbenen Augen wie zwei dunkel eingefasste Juwelen aussahen.
Die Frage, ob er irritiert war, erübrigte sich. Gut so, sollte er doch. Vielleicht überraschte es ihn, dass sich ein Mensch für die drei Königshäuser in Obitraes interessierte und damit auskannte. Aber ich hatte es mir nun einmal zum Ziel gesetzt, mir Wissen anzueignen. Es war das Einzige, was ich gut konnte, und wenn man nicht viel Zeit auf dieser Welt hat, will man zumindest so viel wie möglich über sie in Erfahrung bringen.
Nach einer Weile fragte er mich: »Hast du gar keine Angst, dass ich dich verschlinge?«
Ein bisschen, flüsterte eine Stimme in meinem Hinterkopf.
»Nein«, antwortete ich. »Wenn Ihr das vorhättet, hättet Ihr es längst getan.«
»Vielleicht will ich ja vorher noch etwas ganz anderes«, sagte er provokativ, womit er vermutlich schon des Öfteren eine deutlichere Reaktion erzielt hatte.
Ich seufzte nur erschöpft. »Können wir uns jetzt setzen und reden?«, fragte ich. »Wir haben nicht viel Zeit.«
Er schien etwas enttäuscht, aber dann zeigte er auf die Sitzgelegenheiten. Ich setzte mich kerzengerade auf einen verstaubten, mit rotem Samt bezogenen Stuhl, und er nahm in lässiger Haltung auf einem ledernen Sofa mir gegenüber Platz.
»Sagt Euch Adcova etwas?«, fragte ich.
»Sagt mir genug.«
»Die Stadt wird von einer Krankheit heimgesucht.«
Seine Mundwinkel verzogen sich. »Ich habe schon gehört, dass einer eurer flatterhaften Götter ein wenig Anstoß an diesem Ort genommen hat. Pech.«
Als ob Nyaxia, die im Exil befindliche Göttin, umgänglicher wäre als unsere Gottheiten! Ja, die Gottheiten des Weißen Pantheons waren mitunter gnadenlos und unberechenbar, aber Nyaxia – die abtrünnige Göttin, die sich vor zweitausend Jahren vom Pantheon losgesagt und die Vampire geschaffen hatte – stand ihnen an Unbarmherzigkeit in nichts nach.
»Die Krankheit breitet sich immer weiter aus«, erklärte ich. »Sie greift auf die umliegenden Regionen über. Wir haben Tausende von Toten zu verzeichnen, mit steigender Tendenz.«
Vor meinem geistigen Auge sah ich all den Staub – diesen widerwärtigen Staub, der aus den Krankenhäusern, von den Straßen und aus den Betten gekehrt wurde. Fünf-, sechsmal am Tag wurde er von den Böden der Kirchen gekehrt, wenn die Bestattungen sich aneinanderreihten.
Ich sah den Staub vor mir, den ich auf dem Boden von Minas Schlafzimmer zusammenkehrte, eine dickere Schicht mit jedem Tag. Den Staub, von dem wir beide vorgaben, wir sähen ihn nicht.
Ich räusperte mich. »Sämtliche führende Wissenschaftler und Ärzte in Adcova und Baszia arbeiten an einem Heilmittel.«
Priester, Magiekundige und Hexenmeister natürlich ebenso. Doch ich glaubte längst nicht mehr daran, dass sie uns retten konnten. Schließlich war es auch ihr Gott, der uns alle verdammt hatte.
»Ich glaube, dass Ihr, Lord …« Nun geriet ich ins Stocken; erst jetzt wurde mir bewusst, dass ich ihn gar nicht nach seinem Namen gefragt hatte.
»Vale«, sagte er ganz ruhig.
»Lord Vale.« Ich faltete meine Hände und beugte mich ein Stück vor. »Ich glaube, dass Ihr möglicherweise den Schlüssel zu einer Lösung habt.«
Mit einem amüsierten Lächeln sah er mich an. »Gehörst du zu den ›führenden Wissenschaftlern und Ärzten‹ dieses Landes?«
Ich presste die Lippen aufeinander. So schlecht ich darin war, Mimik zu lesen, fiel selbst mir auf, dass er sich über mich lustig machte. »Ja. Das tue ich.«
Seine Augenbrauen zogen sich weit zusammen, sodass eine Furche entstand.
»Was denn?«, fragte ich ungehalten. »Sollte ich vielleicht bescheidener sein? Geht Ihr etwa bescheiden mit Euren Errungenschaften um?«
Vale machte nicht den Eindruck, als ließe er in irgendeiner Hinsicht Bescheidenheit walten.
»Wie heißt du?«, fragte er. »Nur für den Fall, dass ich deine Referenzen einholen muss.«
»Lilith.«
»Lilith …?«
»Einfach nur Lilith. Ihr habt mir nur Euren Vornamen gesagt, also sage ich Euch auch nur meinen Vornamen.«
Er zuckte mit den Schultern, als könne er dem nichts entgegenhalten. »Also, Lilith. Wie gedenkst du denn, die Welt zu retten?«
Und wieder: dieser amüsierte Tonfall und dieser leicht spöttische Gesichtsausdruck, so eindeutig, dass es nicht einmal mir entgehen konnte.
»Ich brauche Euer Blut«, sagte ich.