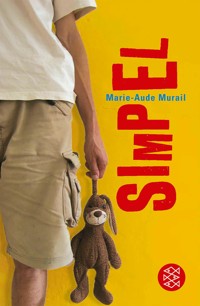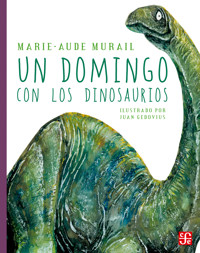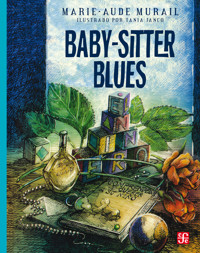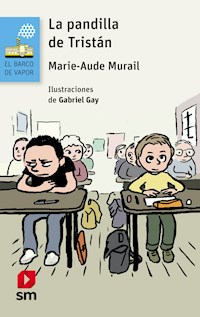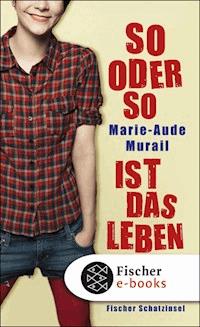
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Erstens kommt es anders … Violaine ist schön und gelangweilt. Ihr Vater ist arrogant und berufsmüde, die Mutter ständig gestresst. Ihr fünfzehnjähriger Bruder ist blöd und oberflächlich, die kleine Schwester ziemlich clever. Vaters junger Assistenzarzt ist süß, doch ein bisschen schwer von Begriff … Und dann wird Violaine schwanger. Klar, dass das ihr Leben durcheinanderbringt. Aber nicht nur ihres, sondern auch das der gesamten Familie! Ein Buch zum Denken und Fühlen, Weinen und Lachen über die Liebe und das Leben
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 205
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Marie-Aude Murail
So oder so ist das Leben
Aus dem Französischen von Tobias Scheffel
Fischer e-books
Glück ergibt nur leere Seiten.
Aber eine Herausforderung meistern
füllt schon ein ganzes Kapitel …
Boris Cyrulnik
Für Dounia
Mit herzlichem Dank
an Laurence Wittke und Anne Vaudoyer
1Herzlich willkommen in Schweinchenland!
Jeden Abend unter der Woche erlebte Doktor Baudoin einen – allerdings recht kurzen – Glücksmoment, wenn er den Fahrstuhl nahm. Während die kleine verglaste Kabine zu seiner luxuriösen Wohnung emporschwebte, gab er zusammen mit seinem Lederköfferchen einen tiefen Seufzer von sich. So, wieder ein Arbeitstag beendet.
An diesem Abend kam er früh nach Hause. Er würde mit der Familie zu Abend essen können, mit seiner Frau Stéphanie und den drei Kindern, seinem eigen Fleisch und Blut, seinen Augensternen Violaine, siebzehn, Paul-Louis, fünfzehn, und Mirabelle, acht. Fünfter Stock, bitte alles aussteigen.
»Ach, hallo, Papa! Sixtus lädt mich zu seiner Nobelparty nächsten Monat ein.« Paul-Louis fuchtelte mit seinem Handy vor ihm herum, um ihm klarzumachen, dass er gerade telefonierte.
»Aber ich brauch einen Anzug.«
Doktor Baudoin sah seinen Sohn an, und ihm fiel nicht die geringste Antwort ein, nicht einmal das klassische: Wie schön, so begrüßt zu werden. Er betrat das Wohnzimmer, in dem die Jungs von Miami Vice gerade unter Sirenengeheul aufs Sofa feuerten.
»Bist du taub?«, brüllte Doktor Baudoin seiner ältesten Tochter zu.
Violaine hielt sich ein Kissen als kugelsichere Weste vor die Brust, machte »Hä?« und begnügte sich damit, weiterzuzappen, ohne den Fernseher leiser zu drehen.
»Geht das klar mit dem Anzug?«, erkundigte sich Paul-Louis von hinten.
»Ist eure Mutter da?«, fragte Doktor Baudoin.
Da er wusste, dass er keine Antwort bekommen würde, begab er sich auf die Suche nach Stéphanie und stieß im Flur mit seiner Jüngsten zusammen.
»Oh, Papa!«, rief Mirabelle. »Ich weiß, das ist nicht echt, und es gibt im Leben andere Gründe zum Heulen, aber gerade hatte ich endlich zwei Schweine gewonnen, und die waren außerdem kurz davor, ein Baby zu kriegen! Aber irgendjemand ist bei mir rein und hat einen Wolf da ausgesetzt, der meine Schweinefrau gefressen hat. Und jetzt hat mein armes Schwein keine Freude mehr am Leben.«
Sie war den Tränen nahe.
»Sag mal, wovon redest du?«, rief ihr Vater entsetzt.
»Von Schweinchenland«, erklärte die Kleine schniefend. »Im Internet.«
»Papa«, jammerte Paul-Louis, »was sag ich jetzt Sixtus?«
Doktor Baudoin verdrehte die Augen. Kaum zu glauben, dass er diesen Jungen vergöttert hatte, als er drei war und sie ihn Pilou nannten!
»Sag ihm, dein Vater leiht dir seine Kreditkarte«, antwortete er, ohne zu überlegen, dass sein Sohn ihn beim Wort nehmen würde.
Ziemlich abrupt schlug er seinen Kindern die Küchentür vor der Nase zu. Stéphanie schreckte auf. Sie leckte sich gerade die Finger ab.
»Oh, so früh schon! Ich mach nur schnell eine Bechamelsoße … mit cholesterinarmer Butter.«
Auch seine Frau hatte er vergöttert. Als er sie geheiratet hatte, war sie zehn Jahre jünger gewesen als er. Na, inzwischen war sie immer noch zehn Jahre jünger als er, aber seit ihrem kleinen Problem in der Brust hatte sie auch zehn Kilo zugenommen. Ihr Mann küsste sie auf die Wange.
»Heilige Supernanny, bete für uns!«, sagt er in jenem weltmännischen Ton, der ihm so gut stand. »Was habe ich dem lieben Gott nur getan, dass er mir eine am Sofa klebende Schnecke, einen Modejunkie und eine virtuelle Schweinehirtin anhängt?«
»Sprichst du von deinen Kindern?«
»Mir wär lieber, es wären die vom Nachbarn.«
»Warum sagst du das? Wenn man dich so hört, könnte man denken, du liebst sie nicht.«
»Ich liebe sie ja … Aber trotzdem hätte ich sie nach der Geburt ertränken sollen.«
Stéphanie war den Humor ihres Mannes zwar gewohnt, dennoch runzelte sie die Stirn.
»Du bekommst Falten«, bemerkte Jean und glättete ihr mit dem Zeigefinger die Stirn. »Na gut, nächstes Wochenende fahren wir nach Deauville, und zwar nur wir zwei.«
Eine leichte Röte überzog Stéphanies Gesicht und Dekolleté. Sie wiederum vergötterte ihren Mann noch immer. Seine Geste gerade oder seine Art, sich an die Spüle zu lehnen, machten sie noch immer verrückt, als seien sie frisch verheiratet.
»Kannst du dich von Chasseloup vertreten lassen?«, fragte sie.
Doktor Chasseloup war seit einem halben Jahr der junge Praxiskollege von Doktor Baudoin.
»Ich brauch ihn nur zu bitten.«
»Bist du immer noch zufrieden mit ihm?«
»Ja, warum nicht?«
»Er wirkt ein bisschen wie der ›Ritter von der traurigen Gestalt‹. Er sieht aus, als hätte ihm was auf den Magen geschlagen.«
Jean lachte und schloss leichthin:
»Armer Chasseloup!«
Beim Abendessen war zunächst die Rede von dem gemeinen Kerl, der sich unter dem Namen anderer Leute einloggte, um deren Schweine zu fressen.
»Ich weiß nicht, wie der mein Passwort rausbekommen hat«, fragte sich Mirabelle.
»Es lautet ›Apfel‹«, erwiderte ihr Bruder
»Woher weißt du das?«, fragte die Kleine empört.
»Das ist doch dein MSN-Nickname!«
»Dann werd ich’s ändern«, murrte Mirabelle.
»Nimm aber nicht ›Pflaume‹«, empfahl ihr Vater.
»Ich find das besonders gemein, weil sie gerad’ ein Baby bekommen sollten«, murmelte das Mädchen, erneut den Tränen nah. »Ich hatte noch nie ein Schweinchenbaby.«
Es war kurz still am Tisch, jeder hielt sich mit Lachen zurück.
»Ach übrigens«, fragte Paul-Louis plötzlich seinen Vater, »könntest du mir deine Kreditkarte gleich morgen leihen?«
Jean hörte einen Augenblick auf zu kauen, als versuche er herauszufinden, was die Frage wohl bedeuten sollte, dann sagte er:
»Das war ein Scherz.«
»Ach so?«
Paul-Louis war auf dem Stuhl zusammengezuckt, als hätte er einen Stromschlag bekommen. Er war gezwungen, seine Gefühle zu spielen, denn ganz allgemein empfand er keine.
»Aber das ist ’ne schicke Party, da werden wir rausgeschmissen, wenn wir keinen Anzug haben!«
»Und eine Krawatte«, erinnerte ihn Mirabelle.
»Das klären wir noch«, bemerkte Stéphanie rasch, um eine Auseinandersetzung zwischen Vater und Sohn zu verhindern.
Paul-Louis begriff, dass er die Kreditkarte seiner Mutter bekommen würde.
»Na, Violaine, du bist so still?«, bemerkte Doktor Baudoin. »Hast du heute deinen Stundenplan bekommen?«
Violaine zu heißen mag schwierig sein. Wie durch ein Wunder hatte Violaine das Aussehen, das ihr Vorname forderte. Tiefdunkles, braunes Haar, sehr weiße Haut und blaue Augen mit einem Stich ins Violette. Trotz einer gewissen jugendlichen Trägheit, die sie häufig Schultern und Hals hängen ließ, war sie sehr hübsch.
»Stundenplan?«, wiederholte sie, als würde sie das Wort zum ersten Mal hören.
»Ja, Stundenplan«, sagte ihr Vater, der sich allmählich aufregte. »Da steht drauf: Montag, Dienstag, Mittwoch …«
»Ist ja gut«, brummelte sie. »Ist noch derselbe.«
Violaine war im Gymnasium gerade in die Abschlussklasse gekommen – im naturwissenschaftlichen Zweig.
»Ich pack’s sowieso nicht. Ich glaub, ich mach eher den sprachlichen Zweig. Das ist nützlicher.«
»Was?«, rief Doktor Baudoin. »Aber du hast doch dieses Jahr deine Abiprüfung!«
»Ich will auf eine Journalistenschule«, fuhr Violaine fort, scheinbar ohne den Einwand ihres Vaters zu bemerken.
»Das ist megateuer«, bemerkte ihr Bruder zustimmend, der offenbar den Auftrag hatte, seine Eltern zu maximalen Ausgaben zu nötigen.
Jean warf seiner Frau einen erschütterten Blick zu, und sie versuchte erneut, dazwischenzugehen:
»Mit einem naturwissenschaftlichen Abi kann man Wissenschaftsjournalismus machen …«
»Ja, also nein«, unterbrach Violaine sie mit ihrer trägen Stimme. »Also was ich machen will, das sind so Reportagen wie über den Wirbelsturm in Louisiana …«
Es war derart jämmerlich, dass nicht einmal ihre Mutter etwas darauf zu antworten wusste. Jean wandte sich der kleinen Mirabelle zu:
»Im Grunde genommen ist es gut, dass dein Schweinebaby gefressen wurde. Denn sonst wäre es gewachsen, hätte später einen Anzug mit Krawatte anziehen und in Katastrophenfilmen spielen wollen.«
»Verzweifelter Versuch von Humor«, bemerkte Paul-Louis zu seinem Teller.
Sein Vater zog es vor, nicht darauf einzugehen.
Nach dem Essen machte sich jeder rasch an seine persönlichen Dinge. Mirabelle war knapp vorm Nervenzusammenbruch, sie musste ihrem Küken auf chickentofight Kampfsport beibringen, den Mist ihres Drachens in ziehdendrachenauf.com beseitigen, Schulbedarf für die Bärchen von bearslife kaufen und auf my-e-farm die Kühe melken. Zum Glück steckte ihre Mutter den Kopf zur Tür herein und befreite sie von der letzten Bürde:
»Mach sofort den Computer aus! Hast du deinen Ranzen gepackt?«
Im Nachbarzimmer war Paul-Louis, der brillante Elftklässler, mit Sixtus Beaulieu de Lassalle, seinem Freund aus den reichen Vierteln, per MSN in ein philosophisches Gespräch vertieft:
pilou <[email protected]>
pilou sagt:
gibs bei deiner party mädels?
sissi <[email protected]>
sissi sagt:
nur schlampen bring tüten mit
Tüte war das Codewort für Kondom. Die beiden Jungs prahlten umso mehr mit ihren künftigen Heldentaten, als sie noch nicht viele davon hatten verbuchen können.
Auf der anderen Seite der Wand war Violaine dabei, ihre Flatrate auszureizen, indem sie mit Adelaide Beaulieu de Lassalle telefonierte, der älteren Schwester von Sixtus, die gerade sagte:
»Er ist voll verrückt nach dir, aber er traut sich nicht, dich anzusprechen. Jonathan, mit dem waren wir in der Zehnten. Weißt du nicht, wen ich meine?«
»Ja, doch, also nein, ich bin aber sowieso mit Domi zusammen.«
»Hast du den nicht abgeschossen?«
Beide lachten, Adelaide aufgeregt, Violaine müde.
Die Tochter von Doktor Baudoin fand Anklang, sie fand viel zu viel Anklang, und sie hatte den Eindruck, dass Anklang-Finden Verpflichtungen mit sich brachte. Sie willigte ein, mit dem Jungen auszugehen. Dann nahm sie die Entscheidung wieder zurück. Ja, doch, schon, also nein. Sie hatte keinen allzu guten Ruf. Einige sagten, sie würde alle anmachen. Andere sagten, sie sei verklemmt.
»Manchmal hab ich den Eindruck, ich hab genug davon.«
»Eins ist sicher, sie wollen alle dasselbe.« Adelaide setzte noch eins drauf.
Sie war die Einzige, die erneut lachte. Violaine hätte ihr etwas zu sagen gehabt, etwas, das sie nicht herausbekam. Am nächsten Tag wäre aber auch noch Zeit, darüber zu reden. Als sie ordentlich rote Ohren vom Tratschen hatte, beschloss sie, schlafen zu gehen.
Sie kuschelte sich unter die Decke und spürte so etwas wie kleine Fieberschauder entlang der Wirbelsäule und ein leichtes Ziehen in den Zähnen. Und wenn es Grippe war? Am liebsten wäre sie sofort eingeschlafen, wie als sie noch so klein war wie ihre Schwester. Sie wollte nicht Schäfchen zählen, um einzuschlafen. Bloß nicht zählen. 28, 29, 30. War sie bei 30 oder bei 31? Nein, doch nicht schon 32! Sie schob ihre feuchten Hände unter das Kopfkissen. Sie wollte ihren Körper nicht berühren. Ihre harten, aufgerichteten Brüste. Und diese Faust, die ihr auf die Blase drückte. Schon wieder der Drang zu pinkeln. Oh, nein, das war doch nicht möglich. Sie täuschte sich, sie musste sich doch täuschen. Domi hatte aufgepasst, er hatte es gesagt. Und außerdem, bei einem Mal, einem einzigen Mal … Violaine hatte sich reglos tief in ihrem Bett vergraben und war hellwach. Am liebsten hätte sie sich in ein winziges Tier verwandelt und Winterschlaf gehalten.
Am anderen Ende der Wohnung stellte sich Doktor Baudoin laut die Frage:
»Also wirklich, was machen wir nur mit Violaine?«
Er stand mit nacktem Oberkörper da, legte gerade den Gürtel ab und hielt inne, um besser nachdenken zu können. Seine Frau lag bereits im Bett, blätterte den Ärztlichen Tagesanzeiger durch und hob von Zeit zu Zeit den Blick zu ihrem Mann. Sie war von diesem ehelichen Striptease, den Jean ihr gedankenlos darbot, immer ein wenig peinlich berührt.
»Sie müsste eine gute Partie machen«, fuhr er fort. »Ist sie denn nicht zu dieser Fete eingeladen?«
»Sie hat abgelehnt, sie mag solche Feste nicht.«
»Eigentlich sollte eher sie mit Sixtus Beaulieu de Lassalle verkehren«, sagte Jean und betonte eindringlich jede Silbe des Namens, während er die Hose auszog. »Schade, dass dieser kleine Idiot erst sechzehn ist.«
»Ach, übrigens, laden wir Domi ein?«
»Wer ist denn das?«
»Dominique. Sie nennt ihn jetzt Domi.«
Das war der Junge, mit dem Violaine seit zwei Monaten zusammen war, ein Junge, der auf demselben Gymnasium die Vorbereitungsklasse für eine Eliteuniversität besuchte. Sollten sie ihn für das Wochenende in Deauville einladen oder nicht?
»Wenn Violaine ihn Domi nennt, wird er bald verschwinden«, bemerkte Jean.
»Verschwinden?«, fragte Stéphanie erstaunt.
Jean breitete die Arme aus, als wolle er seine Blöße besser zur Schau stellen, und rief:
»Er wird implodieren! Erinnerst du dich noch an Alexandre?«
»Das war letztes Jahr …«
»Violaine hat ihn erst Alexandre genannt, dann Alex, dann Al. Und danach ist er verschwunden. Dann durften wir Sébastien erleben, der zu Bastien wurde und dann zu Seb. Und danach? Nie mehr von ihm gehört.«
Stéphanie lachte. Jean hatte eine sehr eigene Art, die Dinge zu sehen.
»Dominique hat sie Domino genannt. Jetzt ist es Domi. Sparen wir das Geld, Liebling, laden wir ihn nicht ein«, schloss Jean und legte sich neben Stéphanie.
Verzweifelter Versuch von Humor, dachte er. Verzweifelt? Er?
2Wir begegnen einem Esel, der den Fahrstuhl verlässt
Jeden Morgen unter der Woche erlebte Doktor Baudoin einen Glücksmoment, der zwischen einer Minute zehn und einer Minute dreißig dauerte, wenn er die Rue du Château-des-Rentiers hinaufging. Am Fuß der hohen Gebäude wucherte das Unkraut; Dutzende von Spatzen flatterten herum, kamen aus den Büschen geflogen und verschwanden wieder aufgeregt darin wie Menschen, die ihre Brieftasche zu Hause vergessen haben. Wenn er die Kirchturmuhr acht schlagen hörte, glaubte Jean sich in das Dorf seiner Großeltern zurückversetzt.
Das kurze Zwischenspiel war beendet, sobald er bei einem luxuriösen Wohngebäude eintraf, an dem eine beerdigungsschwarze Tafel darauf hinwies, dass im dritten Stock Doktor Jean Baudoin, Doktor Vianney Chasseloup, Allgemeinmediziner, Sprechstunde nach Vereinbarung hielten.
»Guten Tag, Herr Doktor!«, rief ihm Josie Molette zu, die seit acht Uhr treu auf ihrem Posten war.
»Guten Tag, Josie.«
Zwanzig Jahre saß sie jetzt dort hinter ihrer Theke.
»Wie geht’s den Patienten?«, fragte Jean gewohnheitsmäßig.
»Um acht Uhr fünfzehn Madame Swan. Wegen ihrer Tochter Magali.«
Die kleine mit ADHS, dachte Baudoin.
»Um acht Uhr dreißig Monsieur Bonpié.«
»Der war ja lange nicht mehr da«, kommentierte Jean.
»Um acht Uhr fünfundvierzig Monsieur Lespelette.«
Neues Rezept für sein Schlafmittel, sagte sich Jean.
»Um neun Uhr Madame Clayeux.«
Der Doktor zog eine Braue hoch.
»Doch, sie war schon mal bei Ihnen«, sagte Molette, als ob ihr Chef ihr eine Frage gestellt hätte. »Das ist die Dame, die sich im Wartezimmer eine Zeitschrift auf den Kopf gesetzt hat.«
»Ach ja!« Doktor Baudoin erinnerte sich.
Er runzelte die Stirn.
»Warum haben Sie den Termin nicht für meinen Kollegen ausgemacht?«
»Sie hatten mir nichts gesagt.«
»Sie hätten sich denken können, dass das eine Patientin für Chasseloup ist«, schimpfte Jean vor sich hin. »Vielleicht hat er am Vormittag noch was frei?«
Sie sahen im Terminkalender des jungen Kollegen nach, und Jean legte den Finger zwischen zwei Termine:
»Da, um neun Uhr dreißig.«
Mademoiselle Molette erlaubte sich einen leicht vorwurfsvollen Blick.
»Madame Clayeux wird warten«, sagte Jean. »Dafür ist ein Wartezimmer ja da. Warum abonniere ich die Zeitschriften, wenn die Leute keine Zeit haben, sie sich aufzusetzen?«
Die Sprechstundenhilfe lachte ein rostiges Lachen, das in einem Hustenanfall endete.
»Wann hören Sie auf zu rauchen?«
Jean öffnete eine gepolsterte Tür und betrat sein Sprechzimmer. Noch vor ein paar Jahren hatte er ein Gefühl der Macht empfunden, wenn er sich in seinen beeindruckenden rotbraunen Ledersessel setzte. Jetzt sah er all die Zeichen des Erfolgs um sich herum nicht mehr, die abstrakten Gemälde an der Wand, die ultramodernen medizinischen Geräte, den leuchtenden Flachbildschirm im Halbdunkel. Er zog die Jalousien hoch, ließ sich in den Sessel fallen und warf einen trübsinnigen Blick auf die erste E-Mail.
Das Labor Ferrier wollte ihm unbedingt sein allerneuestes Produkt vorstellen, das den Planeten revolutionieren und nebenbei auch noch Magengeschwüre behandeln würde.
»Gut«, seufzte er, »auf geht’s …«
Aber er blieb sitzen, die Augen starrten ins Leere, bevor sein Blick auf ein gerahmtes Foto fiel. Ein von ihm persönlich in Deauville aufgenommenes Foto. Darauf war Stéphanie zu sehen, sehr hübsch in einem kurzen Kleid zwischen Violaine und Pilou. Doktor Baudoin empfand Wehmut. An jenem Tag, an dem das Foto aufgenommen wurde, waren sie glücklich gewesen. Was war danach geschehen?
»Madame Swan?«
Er hatte die Tür zum Wartezimmer einen Spalt geöffnet. Außer Magali und ihrer Mama saß dort eine sehr alte Dame mit Glockenhut und Persianermantel, bereit, der Härte des Winters zu trotzen, während die Quecksilbersäule draußen über zwanzig Grad anzeigte. Jean nickte ihr etwas distanziert zu. Eine Patientin für Chasseloup. Er wandte sich an Magalis Mutter.
»Treten Sie ein, Madame Swan, setzen Sie sich!«
Magali schlurfte an Doktor Baudoin vorbei. Beim letzten Mal war sie gehüpft.
»Guten Tag, Magali«, begrüßte Jean sie.
Sie starrte ihn mit ihren etwas vorstehenden dunklen Augen an.
Beim letzten Mal hatte sie kaum gesessen, da hatte sie schon drauflosgeplappert, das Gespräch der Erwachsenen ständig unterbrochen und grundlos gelacht und geheult.
»Na, wie fühlst du dich?«
Magali begnügte sich damit, mit einem Bein zu wippen, ohne zu antworten.
»Sie scheint bedächtiger, nicht wahr?«, bemerkte der Doktor und wandte sich der Mutter zu.
»Ich erkenne sie nicht wieder!«, rief Madame Swan fast in Tränen aufgelöst. »Ich sag ihr ›Geh schlafen‹, sie geht schlafen. Ich sage ihr: ›Komm, putz dir die Zähne‹, und sie putzt sich die Zähne …«
»Hörst du, Magali? Deine Mama ist sehr zufrieden mit dir.«
»Ich sage ihr: ›Räum deine Schuhe auf‹, und sie räumt ihre Schuhe auf, ›Zieh deinen Pulli an‹, und sie …«
»Ja, ja, das Prinzip habe ich verstanden«, unterbrach der Doktor.
Das Mädchen war wegen eines Verhaltensproblems in Behandlung, sie hatte ADHS, wie die Ärzte sagten, eine Aufmerksamkeitsstörung, gepaart mit Hyperaktivität. Jean hatte sie unter Methylphenidrid gesetzt, ein neues Arzneimittel des Labors Ferrier, das ihm Murielle, eine Pharmavertreterin in Minirock, lang und breit und begeistert angepriesen hatte. Jean erinnerte sich ziemlich gut an den Minirock.
»Es bedarf einer Langzeitbehandlung«, murmelte er, den Blick auf den Bildschirm geheftet. »Und die muss jedem individuellen Fall angepasst werden. Eine Frage der Dosierung.«
Murielle hatte ihm eine neue, sehr teure Praxis-Software geschenkt, zusammen mit einem Dutzend Probepackungen Methylphenidrid. Großzügig zu verschreiben an Kinder, die die Wand hochgehen. Jean wandte sich wieder Madame Swan zu:
»Da ist die Lehrerin sicher zufrieden?«
»Sehr. Sie hört nichts mehr von ihr.«
»Sehr gut, Magali«, lobte der Doktor erneut.
»Ich zieh Striche«, flüsterte das Mädchen.
Jean sah die Mutter mit hochgezogenen Brauen fragend an.
»Ja, sie führt ihre Hefte ordentlicher. Früher war das ein ziemliches Geschmiere.«
Jeans Gesicht hellte sich auf:
»Ach, so! Sie zieht Striche. Aber ja, das ist sehr gut. Im Leben muss man einen Strich ziehen können.«
Er unterdrückte ein Grinsen und verharrte ein paar Sekunden nachdenklich, als würde die Benommenheit des Kindes auch ihn ergreifen. Kopfschüttelnd rappelte er sich wieder auf.
»Gut. Eine Unterbrechung der Behandlung …«
Er fing den panischen Blick von Madame Swan auf und endete mit:
»… sollten wir vielleicht erst in den Ferien um Allerheiligen ins Auge fassen. Fährt sie in den Ferien weg?«
»Zu ihrer Oma.«
»Ist die Oma geduldig?«
»Wissen Sie, sie geht auf die achtzig zu.«
»Sie wird schnell müde …«, schloss der Doktor. »Gut, wir setzen die Behandlung fort, aber reduzieren die Dosis.«
Er griff nach seinem Rezeptblock und schrieb Methylphrene …, nein, das war es nicht, phedi … phenedri …
Er kritzelte etwas Unleserliches in der berüchtigten Ärzteschrift hin, die zu entschlüsseln nur Apotheker befähigt sind.
»So, einen Löffel morgens und abends. Und in einem Monat sehen wir uns wieder.«
Madame Swan zog ein Scheckheft aus der Tasche.
»Nein«, erinnerte sie der Doktor, »Sie bezahlen bei meiner Sprechstundenhilfe, wenn Sie den nächsten Termin ausmachen.«
Er stand auf und geleitete Magali und ihre Mutter zur Tür. Die ärztliche Beratung hatte auf die Sekunde genau fünf Minuten gedauert. Er ging zurück an den Schreibtisch und setzte sich mit verärgertem Gesicht in seinen Sessel. Er würde Murielle vom Labor Ferrier anrufen und ihr den Marsch blasen. Genau in dem Moment, als er sich entschieden hatte, klingelte das Telefon.
»Was ist denn?«, fragte er verärgert.
»Das Institut für Labordiagnostik«, erwiderte seine Sprechstundenhilfe barsch, denn die schlechte Laune ihres Chefs war ansteckend. »Ich verbinde Sie mit Madame Sol.«
Der Doktor gab ein Brummen von sich. Madame Sol war niemand anderes als seine Frau Stéphanie.
»Jean? Ich habe die Biopsieergebnisse von Madame Bonnard.«
Sie las ihm vor: »Invasive adeno-karzinomatöse Proliferation mit überwiegend trabekulärem Aufbau.«
Der Doktor nahm es schweigend hin.
»Jean, hast du mich gehört?«
»Ja, danke.«
»Siehst du sie demnächst?«
»Weiß nicht«, brummte er. »Ich frage Josie.«
Er legte auf. Madame Bonnard war eine junge Mutter, die seit etwa zehn Jahren Patientin bei ihm war.
»Josie? Kommt Madame Bonnard diese Woche?«
»Heute Abend um neunzehn Uhr.«
Eine reizende Art, den Praxistag zu beschließen – wenn man bedenkt, dass ein Allgemeinmediziner statistisch nur einen halben Krebs pro Jahr diagnostiziert und er nun zum Feierabend einen ganzen zu verkünden hatte. Jean begann, auf einem Post-it zu kritzeln, während er sich Madame Bonnard in Erinnerung rief. Sie war die Art Frau, die er schätzte, zierlich und vornehm, ohne wirklich schön zu sein. Er betrachtete erneut das Foto auf seinem Schreibtisch. Wie lange lag die letzte Mammographie von Stéphanie zurück? Er nahm sich vor, noch am selben Abend mit ihr darüber zu reden, dann sah er auf die Uhr. Vorsicht, nicht gleich zu Beginn in Verzug kommen.
»Monsieur Bonpié?«
Ein etwa sechzigjähriger, recht rüstiger Mann kam auf ihn zu und schüttelte dem Arzt die Hand.
»Na, immer gut drauf?«, scherzte Doktor Baudoin.
»Oh, eigentlich schon«, antwortete Monsieur Bonpié und nahm auf der anderen Seite des Schreibtischs Platz. »Aber ich bin erschöpft.«
Jean zuckte zurück. Ach, ein Rentner, der erschöpft war …
»Ein bisschen depressive Stimmung?«
Monsieur Bonpié gab eine Art befriedigtes Glucksen von sich.
»An meiner Stelle wären Sie auch erschöpft«, sagte er und zwinkerte mit einem Auge. »Seit drei Wochen habe ich eine Freundin. Um die vierzig. Eine ganz wilde. Und da meine Frau nichts wissen darf …«
Er zwinkerte erneut, und Jean drückte sich tief in seinen Sessel. Er hatte schon immer den Eindruck gehabt, dieser Bonpié habe etwas Krankhaftes an sich, ohne es sich eingestehen zu wollen. Übrigens roch er stark. Bonpié gluckste erneut.
»Ich bräuchte ein bisschen was zum Anregen, also … Sie wissen schon?«
Er machte eine eindeutige Geste, und Jean verspürte das Bedürfnis, ihn so schnell wie möglich loszuwerden. Er sah in die Patientenakte auf dem Bildschirm.
»Gut, keine kardiologischen Probleme«, murmelte er, während er versuchte, seine Würde als Arzt zu wahren. »Nehmen Sie im Augenblick auch keine Medikamente? Nun, also, Sie brauchen Viagra. Eine Tablette vor dem Verkehr. Das führt zu hervorragenden Ergebnissen … und wir sehen uns in einem Monat wieder.«
Er griff nach dem Rezeptblock und kritzelte die Verordnung darauf, während sein Gegenüber vor Zufriedenheit auf seinem Stuhl herumzappelte.
Fort, du Ferkel, dachte Baudoin, als er ihm die Hand schüttelte.
»Monsieur Lespelette?«
Der saß da, mit trockenen Lippen, fiebrigen Augen und von Schlaflosigkeit gezeichnet. Er sprang fast von seinem Sitz auf. Als Doktor Baudoin ihn begrüßen wollte, entdeckte er Violaine, seine Tochter, die auf dem Rand des Sofas saß wie ein Vogel am Ende eines Astes.
Spontan rief er:
»Ja, was machst du denn …«
Aber er fing sich wieder:
»Einen Augenblick, Monsieur Lespelette. Ich muss rasch etwas mit Mademoiselle besprechen.«
Sofort zog er sich in sein Sprechzimmer zurück, um sich dem Unmut seiner Patienten zu entziehen.
»Mach die Tür zu«, sagte er zu seiner Tochter. »Was ist mit dir los?«
»Hast du nicht eine Abtreibpille?«
»Abtreibungspille«, verbesserte er unwillkürlich.
Dann schien er zu begreifen, wonach seine Tochter gerade gefragt hatte.
»Eine was? Doch nicht für dich?«
»Doch.«
Vater und Tochter starrten sich an.
»Aber nein«, stammelte er, »du … du musst dich täuschen.«
Violaine, sein kleines Mädchen.
»Wie viele Tage bist du über der Zeit?«
»Ein paar Tage.«
»Wirklich sehr präzise!«
Er ging zum Fenster, um sich zu beruhigen, dann kam er zu Violaine zurück.
Er merkte, dass er sie am liebsten ohrfeigen würde, und verschränkte die Hände hinter dem Rücken.
»Zunächst muss man mal sicher sein. In deinem Alter bleibt die Regel oft aus oder kommt später. Da brauchen wir deine Mutter nicht mit einer Blutprobe zu nerven. Schwangerschaftstests funktionieren sehr gut.«
Er kramte fieberhaft in seinem Medikamentenschrank, ließ dabei Schachteln zu Boden fallen, regte sich noch ein bisschen mehr auf, warf seiner Tochter, die wie angewurzelt mitten im Raum stand, einen Blick zu, bemühte sich, nicht zu brüllen, und fand schließlich einen Schwangerschaftstest des Labors Ferrier.
»Da. Babytest. Damit weißt du Bescheid.«
Er hielt Violaine die Schachtel hin. Sie sah sie an und streckte nicht einmal die Hand aus.
»Wie funktioniert das?«, fragte sie mit ihrer trägen Stimme.
Erneut riss Jean sich zusammen, um nicht zu brüllen: Du weißt, wie man Babys macht, da ist es doch auch kein Hexenwerk, zu überprüfen, ob man eins im Kasten hat! Er atmete tief durch und antwortete, als würde er von einem Videospiel reden:
»Da ist eine Gebrauchsanweisung dabei.«
Violaine brachte ein armseliges Kopfnicken zustande. Ja, was für eine dumme Gans!
»Das Ding sieht aus wie ein Fieberthermometer«, erklärte er ihr. »Du ziehst die Kappe ab und pinkelst auf so eine Art Wattestäbchen.«
Er zögerte, bevor er doch noch präzisierte:
»Das machst du über der Kloschüssel.«