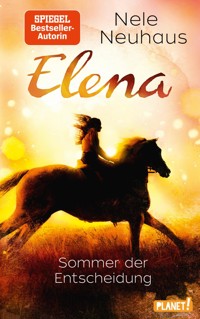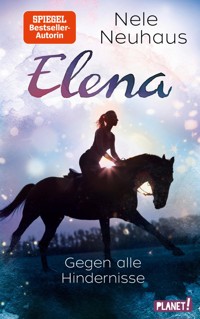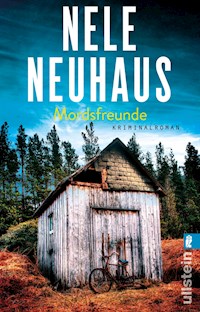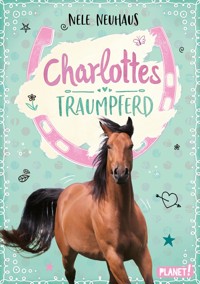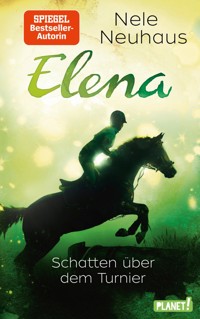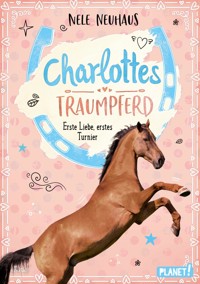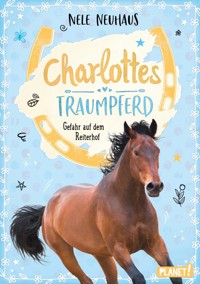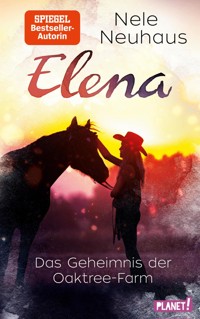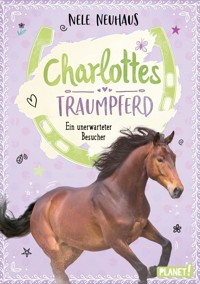9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Nele Neuhaus entführt uns in ihrem Bestsellerroman in das atmosphärische Farmleben: fesselnd, tiefgründig und mitreißend! »Nach langer Zeit wieder ein Buch, dass ich einfach inhalieren musste.« Amazon Kundin Wenn ein Sommer dein ganzes Leben verändert Nebraska, Anfang der 1990er Jahre: Sheridan Grant wächst auf einer Farm inmitten von Maisfeldern bei ihrer Adoptivfamilie auf. Das monotone Farmleben und die strenge Hand ihrer Adoptivmutter machen ihr schwer zu schaffen. Doch Sheridan findet Trost bei ihrer liebevollen Tante Isabella und in ihrer Leidenschaft für die Musik. Der Farmarbeiter Danny, der Rodeoreiter Nick und der Künstler Christopher machen ihr den Hof, und sie stößt auf die Tagebücher der geheimnisvollen Carolyn, die vor vielen Jahren spurlos verschwand. Das Leben ist plötzlich aufregend, bis in einer schicksalhaften Halloween-Nacht etwas Schreckliches geschieht, das alles verändert. Nun zeigt sich, wem Sheridan wirklich vertrauen kann ... *** Die perfekte Urlaubslektüre! Für alle, die Familienromane lieben und Nele Neuhaus Fans. ***
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 695
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Das Buch
»Ich werde dich nie vergessen, Sheridan Grant. Niemals, solange ich lebe.« Mit diesen Worten verabschiedet sich Jerry an einem Sommermorgen und bricht Sheridan das Herz. Abwechslung und Zerstreuung gibt es kaum auf der Willow Creek Farm in Nebraska, auf der Sheridan mit ihren Adoptiveltern und vier Brüdern inmitten von endlosen Maisfeldern und meilenweit entfernt von der nächsten Stadt lebt. Doch dann kommt die belesene und lebenserfahrene Tante Isabella auf die Farm und eröffnet Sheridan eine aufregende neue Welt. Trotz der ständigen Schikanen ihrer gehässigen Adoptivmutter Rachel entdeckt Sheridan die Liebe. Da gibt es Danny, den Farmarbeiter, der ihr offen zeigt, wie begehrenswert er sie findet, und den Schriftsteller Christopher, der für einen Sommer ein kleines Haus in der Nähe der Farm mietet. Auf dem Dachboden findet Sheridan die Tagebücher der geheimnisvollen Carolyn, die dreißig Jahre zuvor in diesem Haus lebte und auf geheimnisvolle Weise verschwand. Plötzlich ist das Leben auf der Willow Creek alles andere als langweilig. Sheridan spielt mit dem Feuer – und ahnt nicht, worauf sie sich einlässt …
Die Autorin
Nele Neuhaus, geboren in Münster / Westfalen, lebt seit ihrer Kindheit im Taunus. Sie ist die erfolgreichste Krimiautorin Deutschlands, ihre Bücher erscheinen außerdem in über 30 Ländern. Neben den Taunuskrimis schreibt die passionierte Reiterin auch Pferde-Jugendbücher und Unterhaltungsliteratur, die sie zunächst unter ihrem Mädchennamen Nele Löwenberg veröffentlichte. Ihre Saga um die junge Sheridan Grant stürmte auf Anhieb die Bestsellerlisten.
Von Nele Neuhaus sind in unserem Haus bereits erschienen:
In der Serie »Ein Bodenstein-Kirchhoff-Krimi«:
Eine unbeliebte Frau • Mordsfreunde • Tiefe Wunden • Schneewittchen muss sterben • Wer Wind sät • Böser Wolf • Die Lebenden und die Toten • Im Wald • Muttertag
Außerdem: Unter Haien
In der »Sheridan-Grant«-Serie:
Sommer der Wahrheit
Straße nach Nirgendwo
Zeiten des Sturms
Nele Neuhaus
Sommer der Wahrheit
Roman
Ullstein
Dieses Buch ist ursprünglich unter dem Autorennamen Nele Löwenberg erschienen.
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein-buchverlage.de
Wir wählen unsere Bücher sorgfältig aus, lektorieren sie gründlich mit Autoren und Übersetzern und produzieren sie in bester Qualität.
In diesem Buch befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
ISBN 978-3-8437-2324-4
Neuausgabe im Ullstein Taschenbuch© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2014Umschlaggestaltung: zero-media.net, MünchenTitelabbildung: © FinePic®, München (Haus); Getty Images / E+ / © timnewman (Feld, Himmel); mauritius images / © Jason Rambo / Alamy (Windrad)
E-Book: Pinkuin Satz und Datentechnik, Berlin
Alle Rechte vorbehalten.
Für Catrinund für Matthias,den besten Mann der Welt
Fairfield in Nebraska
1994
Der Tag, an dem ich zum ersten Mal in meinem Leben im Gefängnis landen sollte, war ein sonniger Freitagnachmittag Anfang Mai. Die Schule war um kurz nach drei aus gewesen, und Pam, Luke und ich hatten den Schulbus wegfahren lassen, um mit Red Christie in seinem 79er Ford Bronco zu unserem liebsten Treffpunkt zu fahren.
Langdons alte Getreidemühle war nicht viel mehr als eine dem Zerfall preisgegebene Ruine. Ein rostiger Maschendrahtzaun zog sich um das Gelände, auf dem seit den achtziger Jahren des 19. Jahrhunderts Generationen von Männern aus Fairfield und Umgebung ihr tägliches Brot verdient hatten. Vor zwanzig Jahren hatte die Genossenschaft eine neue Getreidemühle auf der anderen Seite der Stadt gebaut, da man es nicht für rentabel gehalten hatte, den alten Bau zu modernisieren. Ein Abriss war allerdings auch zu teuer, und so hatte man die alte Mühle einfach stehen lassen und nur das Tor abgeschlossen.
Wir hatten die verbotenen Reize der alten Gebäude, der riesigen kirchenartigen Hallen und Lagersilos im vergangenen Herbst entdeckt. Nirgendwo in ganz Fairfield konnte man so ungestört Musik hören, tanzen, quatschen, rauchen und heimlich Alkohol trinken. Die Jungs hatten an der Seite, die an den Fluss grenzte, ein Loch in den Zaun geschnitten, und so konnten wir unbemerkt über die längst stillgelegten, von Unkraut überwucherten Gleise in die Gebäude gelangen.
Jerry, der als Einziger von uns allen nicht mehr zur Schule ging, wartete an jenem Nachmittag schon auf uns, als wir uns durch den zerlöcherten Zaun quetschten. In unserer Clique war er eine Art Anführer. Er war der Sohn von Tom Brannigan, einem rothaarigen Iren, der von der besseren Gesellschaft Fairfields verachtet wurde, weil er zum Pöbel gehörte. Jerry arbeitete wie sein Vater bei Fairfield Ready Mix, dem Betonwerk, seine Mutter bewirtschaftete allein die winzige Farm, die diese Bezeichnung eigentlich nicht verdiente, und schuftete sich auf den paar Morgen Land beinahe zu Tode. Als Kind war mir die Armseligkeit ihrer Behausung nie aufgefallen, denn Tom Brannigan war ein unterhaltsamer und lustiger Zeitgenosse, wenn er nicht gerade getrunken hatte. Nach ungefähr fünf Gläsern Bier wurde er übellaunig, nach ein paar weiteren streitsüchtig, und man ging ihm besser aus dem Weg.
Jerry war der Älteste von sechs Geschwistern, er hatte nach der zehnten Klasse die Schule verlassen müssen, um Geld zu verdienen. Das war bitter für ihn, denn er war viel intelligenter als die meisten anderen Jungs, löste mühelos komplizierte Rechenaufgaben und war für sein Alter ungewöhnlich belesen. Ich schwärmte heimlich für ihn, seitdem ich acht oder neun Jahre alt war, und es stand für mich felsenfest, dass ich ihn eines Tages heiraten würde. Jerry war genauso rothaarig, wild und impulsiv wie sein Vater, jedoch ohne dessen irische Fröhlichkeit geerbt zu haben. Er haderte mit seinem Schicksal und war oft mürrisch, aber ich bewunderte ihn kritiklos. In meinen Augen war er ein Held, und obwohl er mir nie einen Beweis dafür geliefert hatte, glaubte ich an eine liebenswerte, großzügige und mitfühlende Seite seines Charakters unter seiner rauen Schale. Jerry verehrte seine Mutter und hasste seinen Vater, und genauso hasste er die Leute aus Fairfield. Auch die anderen aus unserer Clique stammten aus Familien, die meine Mutter mit der ihr eigenen Überheblichkeit als »Pack« bezeichnete. Mir war das gleichgültig. Obwohl ich damit gegen ein strenges Verbot meiner Eltern verstieß, traf ich mich regelmäßig mit Jerry, Red, Pam, Ronnie, Sandy, Luke und Karla in der alten Getreidemühle. Wir alle langweilten uns in Fairfield zu Tode und waren uns einig, dass die beste Straße unserer Stadt diejenige war, die aus ihr hinausführte. Niemand von uns konnte es erwarten, alt genug zu sein, um Fairfield und Nebraska hinter sich zu lassen.
Jerry hatte Bier besorgt und neue Batterien für unseren CD-Player. An diesem Nachmittag war er ganz besonders aufgebracht, und wir hörten geduldig zu, wie er ohne Punkt und Komma seinem aufgestauten Zorn Luft machte. Er schimpfte abwechselnd auf seinen Chef, den er für einen kleinkarierten Idioten hielt (womit er nicht ganz unrecht hatte), auf seine geistig minderbemittelten Kollegen (womit er ganz sicher recht hatte), auf seinen Vater, die Leute aus Fairfield, die Polizei, den Gouverneur und den Präsidenten.
Wir hörten ihm wie immer nur mit einem Ohr zu, warteten, bis er Dampf abgelassen hatte und wieder vernünftig war. Dann schmiedeten wir gemeinsame Zukunftspläne, hörten Musik, tranken lauwarmes Keystone light und machten uns über die Leute in der Schule und in der Stadt lustig, die wir verachteten.
Nach einer halben Stunde ging Jerry endlich die Luft aus. Er ließ sich auf das von weißem Mehlstaub überzogene Sofa fallen, das wir in einem der ehemaligen Büros entdeckt und in die große Halle geschleppt hatten, und versank in dumpfes Brüten, aus dem er nur hin und wieder auftauchte, um den einen oder anderen zynischen Kommentar von sich zu geben.
»Mann, du bist ja mal wieder mies drauf«, sagte Karla ungehalten, nachdem Jerry ihr einmal mehr über den Mund gefahren war.
»Du redest ja auch nur blödes Zeug«, entgegnete er gereizt.
»Du etwa nicht?« Sie funkelte ihn wütend an, aber bevor es zu einem Streit kommen konnte, drehte Red den CD-Player lauter.
Jerry schenkte mir eines seiner seltenen Lächeln, als ich nun mit Whitney Houston im Duett sang, und mein Herz machte einen glücklichen Satz. Er bevorzugte Bruce Springsteen, Huey Lewis und John Cougar Mellencamp und behauptete immer, den aktuellen Mist aus den Charts könne er nur ertragen, wenn ich dazu sang. Auch die anderen fanden, dass ich eine tolle Stimme besaß, und die Akustik in der Haupthalle der Mühle war einfach grandios. Ich schloss die Augen, sang aus voller Kehle und stellte mir vor, ich stünde auf der Bühne im Madison Square Garden in New York City vor ausverkauftem Haus.
»Die Bullen!«, rief Luke plötzlich, der an einem der fast blinden Fenster saß, und sprang auf.
»Scheiße!«, fluchte Jerry, schaltete die Musik aus und rüttelte mich an der Schulter. Ich brauchte ein paar Sekunden, um in die Realität zurückzufinden, und begriff erst, was los war, als das Tor mit einem quietschenden Ächzen aufging und das Auge des Gesetzes von Fairfield in Person von Sheriff Lucas Cyrus Benton mit dem Streifenwagen durch den mehligen Staub rauschte. Als Verstärkung hatte er seine gesamte Polizeiarmee aufgeboten: Alle vier Polizeiautos, die es im Madison County gab, fuhren hinter ihm her.
»Haut ab!«, schrie Jerry, und wir spurteten sofort los, während sich die Polizisten noch aus ihren Autos schälten. Wir kannten uns gut aus in der alten Getreidemühle, es gab einige Fluchtwege, die wir sicherheitshalber schon vor längerem ausgekundschaftet hatten. Hinter uns schrie Sheriff Benton Zeter und Mordio und schickte seine jüngeren und schlankeren Kollegen aus, uns einzufangen.
Obwohl mein Herz raste, musste ich lachen. Ich war noch nie mit dem Gesetz in Konflikt geraten und kannte die Polizei nur als Freund und Helfer, deshalb fand ich, dass die ganze Situation nicht einer gewissen Komik entbehrte: Sieben bewaffnete Polizeibeamte keuchten mit grimmiger Entschlossenheit hinter einer Handvoll harmloser Jugendlicher her, als seien sie einer Horde gefährlicher Bankräuber auf der Spur. Pam und ich quetschten uns kichernd durch einen schmalen Lüftungsschacht und kletterten im Inneren des Schachtes nach oben auf das Dach des Hauptgebäudes. Von hier aus hatten wir einen guten Ausblick und beobachteten mit wachsender Fassungslosigkeit, wie zwei Polizisten Red und Jerry überwältigten. Sie stießen die Jungs zu Boden und legten ihnen Handschellen an. Da erst begriffen wir, dass es für Benton und seine Leute kein Spaß war, sondern bitterer Ernst. Wir hörten auf zu lachen.
»Scheiße, Sheridan!« Pam starrte mich aus aufgerissenen Augen ängstlich an. »Wie kommen wir hier weg? Mein Alter bringt mich um, wenn die Bullen bei uns auftauchen!«
Bentons Leute hatten die Getreidemühle umstellt. Sie führten einen nach dem anderen von uns ab, Pam und ich waren die Einzigen, die sie nicht erwischt hatten. Ich dachte fieberhaft über eine Fluchtmöglichkeit nach. Am besten erschien es mir, so lange in irgendeinem Versteck auszuharren, bis die Polizisten aufgeben und abziehen würden. Ich zerrte Pam von der Brüstung weg, aber es war zu spät, sie hatten uns bemerkt.
»Da oben sind noch welche!«, rief jemand, und Sekunden später knarzte Sheriff Bentons Stimme durchs Megaphon.
»Kommt runter! Sofort! Wir kriegen euch doch, also macht jetzt keine Scherereien.«
Pams Dad war streng, das wusste ich. Aber verglichen mit meinen Eltern war er die Güte in Person. Ich hatte weitaus Schlimmeres zu erwarten als Pam und dachte nicht daran, mich so einfach fangen und nach Hause fahren zu lassen.
»Komm«, zischte ich, aber Pam schüttelte meine Hand ab und blieb stehen – entweder aus Feigheit oder aus Vernunft. Also rannte ich allein los. Meine Chancen standen nicht schlecht, denn ich kannte mich bestens aus. Zwei Polizeibeamte kamen die rostige Metalltreppe hoch, einer ergriff Pam am Arm, der andere lief mir nach.
»Bleib stehen, Mädchen!«, rief er.
Ich dachte nicht daran. Flink wie ein Wiesel rannte ich zur anderen Seite des Gebäudes zu dem Schacht, aus dem früher das Korn in das Mahlwerk gelaufen war. Es gab kein Mahlwerk mehr, dafür aber die Möglichkeit, zu entkommen. Ich hörte die Schritte des Mannes und sein Keuchen hinter mir und riskierte einen Blick über die Schulter. Zu meinem Schrecken stellte ich fest, dass der Polizist schnell aufgeholt hatte und nur noch ein paar Meter von mir entfernt war. Das obere Geschoss der Getreidemühle war tückisch. Überall unter dem Staub und dem Schutt des verfallenen Gemäuers lauerten Löcher im Boden. Plötzlich ertönte ein gellender Schrei, und mein hartnäckiger Verfolger war verschwunden.
Das war nun wirklich kein Spaß mehr! Mir brach der Schweiß aus allen Poren, mein Herz raste vor Angst, aber ich lief weiter. Unten ertönte das Heulen der Polizeisirene, der Sheriff schrie irgendetwas durch sein Megaphon. Ich hatte den rostigen Förderschacht erreicht, kletterte hinein und hangelte mich fünf oder sechs Meter an dem wackligen Gerüst hinunter. Dabei zerriss meine Jeans am Knie. Unten in der Halle tauchten drei oder vier Männer auf, sehr viel eher, als ich erwartet hatte. Während ich auf den alten, porösen Förderbändern zum Ausgang der Mühle rannte, folgten sie mir und kamen bedrohlich rasch näher. Endlich war ich an der frischen Luft!
Ich blinzelte für ein paar Sekunden in das grelle Sonnenlicht, von links näherte sich ein Streifenwagen mit Sirene und zuckendem Rotlicht auf dem Dach, ein zweiter folgte ihm, hinter mir schnauften meine Verfolger heran. Ich musste alles auf eine Karte setzen. Mit einem wagemutigen Satz sprang ich drei Meter in die Tiefe, missachtete den Schmerz, als ich mit dem Knöchel umknickte, und rannte so schnell ich konnte im Zickzack über den Hof, auf dem das Unkraut in hohen Büschen durch den Beton gewuchert war.
Die Streifenwagen gaben Vollgas. Plötzlich stand wie aus dem Boden gewachsen einer der Beamten vor mir. Zwei Meter vor dem rettenden Loch im Maschendrahtzaun versetzte er mir einen so groben Stoß, dass ich das Gleichgewicht verlor und stürzte. Innerhalb von Sekunden waren sie über mir, drei erwachsene Männer, außer sich vor Wut. Ich trat und schlug nach ihnen, aber sie waren stärker, zerrten meine Arme nach hinten, Handschellen schnappten um meine Gelenke. Ich lag auf dem Boden, meine Wange auf den heißen Beton gepresst, und schnappte nach Luft.
»Wen haben wir denn da?«, knautschte der Sheriff, der die Eigenart hatte, beim Sprechen den Mund nicht richtig aufzumachen. Mit seiner Spiegelbrille und dem weißen Stetson wirkte er sehr martialisch. Breitbeinig stellte er sich vor mich hin, schlenkerte seinen Gummiknüppel drohend hin und her und drehte mich mit der Fußspitze um. Zwei Polizisten zerrten mich auf die Füße.
»Ach nein!« Sheriff Benton nahm die Sonnenbrille ab und starrte mich aus seinen kleinen Schweinsaugen bösartig an. »Wenn das nicht die kleine Grant ist! Wie kannst du deinen Eltern so eine Schande machen und mit diesem Pack herumlungern?«
»Was geht Sie das an?«, fauchte ich wütend.
»Bringt sie zu den anderen kleinen Mehlratten«, befahl er seinen Leuten, die mich grob vor sich her stießen.
»Warum machen Sie so eine Staatsaffäre daraus, dass wir hier ein bisschen Musik gehört haben?«, schrie ich dem Sheriff erbost hinterher.
Das erste Mal in meinem Leben sah ich Polizisten mit anderen Augen, nicht als Helfer und Beschützer, sondern als Unterdrücker. Sheriff Benton blieb wie angewurzelt stehen und drehte sich zu mir um.
»Hüte deine Zunge, Fräulein.« Er ließ den Gummiknüppel unsanft gegen mein Schlüsselbein sausen. »Widerstand gegen die Staatsgewalt ist eine ernste Angelegenheit. Genauso wie unbefugtes Betreten eines Privatgrundstücks. Außerdem kannst du zu Gott beten, dass sich mein Kollege nicht ernsthaft verletzt hat, als er durch die Decke gebrochen ist. Denn dann bist du auch noch wegen fahrlässiger Körperverletzung dran. Hast du das verstanden, he?«
Ich schwieg trotzig. Die anderen Polizisten kamen näher und bildeten drohend einen Ring um uns.
»Ob du mich verstanden hast?«, wiederholte Sheriff Benton.
»Ich hab nur verstanden, dass Sie uns schikanieren«, erwiderte ich störrisch. »Wir haben doch nichts anderes getan als Musik gehört. Waren Sie denn nie jung?«
»Ihr habt Bier getrunken und geraucht!«, brüllte der Sheriff unversehens. Sein feistes Gesicht war krebsrot, sein Doppelkinn schwabbelte. »In einem Gebäude, das wegen Einsturzgefahr seit Jahren gesperrt ist! Das ist verboten! Von Schikane kann keine Rede sein! Und wenn du nicht abgehauen, sondern sofort brav mitgekommen wärst, dann hätte ich es vielleicht bei einer Verwarnung belassen. Aber so kommst du mit und bleibst im Kittchen.«
Er drehte sich um.
»So«, rief er laut. »Schluss mit dem Theater. Bringt das Pack auf die Wache. Miss Grant fährt mit mir!«
Unversehens fand ich mich auf der anderen Seite des Gesetzes wieder und erfuhr am eigenen Leib, wie erniedrigend es war, der höhnischen Willkür eines Sheriff Benton ausgesetzt zu sein. In diesem Moment verstand ich die Lieder von Bruce Springsteen und Jerrys hilflosen Zorn erst wirklich. Zähneknirschend ergab ich mich in mein Schicksal.
Fairfield war ein Städtchen mit etwa tausendfünfhundert Einwohnern – wenn man die umliegenden Farmen und Höfe mitzählte – im sogenannten Maisgürtel der Vereinigten Staaten, im Nordosten des Staates Nebraska, und gehörte unserer Ansicht nach zu den ödesten Flecken auf der ganzen Welt. Es gab eine methodistische Kirche (wer kein Methodist war, musste nach Madison fahren, wenn er in die Kirche gehen wollte), einen landwirtschaftlichen Supermarkt, zwei Tankstellen, ein Kino, ein paar Kneipen, den Big Dipper Drive In und natürlich den Farmers Ranchers Co-op, das Fairfield Ready-Mix-Betonwerk, das »Stadion«, in dem Footballspiele und andere Sportveranstaltungen ausgetragen wurden, die neue Getreidemühle und diverse Landmaschinenwerkstätten, denn in Fairfield lebte jeder direkt oder indirekt von der Landwirtschaft.
Das kulturelle und soziale Leben wurde hauptsächlich von der Kirche bestimmt, an die Kindergarten und Grundschule angeschlossen waren und die die einzigen, ausgesprochen bescheidenen Freizeitvergnügungen bot, die es in Fairfield für Jugendliche gab, mal abgesehen vom Schulsport. Nach der sechsten Klasse mussten alle Kinder ins dreiundzwanzig Meilen entfernte Madison, wenn sie auf die Junior und nach der achten Klasse auf die Senior High School gehen wollten. Einige Jugendliche verließen die Schule jedoch früher, um Geld zu verdienen. Hatten sie Glück, so fanden sie einen Job in der Gegend, und wenn sie noch mehr Glück hatten, einen, der ihnen die Möglichkeit gab, aus Nebraska zu verschwinden. In diesem menschenleeren Land am Rande und doch mitten im Herzen Amerikas schien vor hundert Jahren die Zeit stehengeblieben zu sein, und in Fairfield kannte jeder jeden, Familiengeheimnisse gab es nicht. Das dachte ich auf jeden Fall.
Mich hatte eine tragische Fügung des Schicksals nach Fairfield verschlagen. Ich war knapp drei Jahre alt, als meine Eltern bei einem Unfall ums Leben kamen und ich von Vernon und Rachel Grant adoptiert wurde. Es hätte mich schlechter treffen können. Die Familie Grant war in ganz Nebraska bekannt und hochangesehen, denn der Urahn meines Adoptivvaters war vor hundertfünfzig Jahren, lange bevor Nebraska zu einem Territorium der Vereinigten Staaten wurde, einer der ersten weißen Siedler in diesem Landstrich gewesen. Nachdem seine erste Frau gestorben war, hatte er eine Sioux geheiratet, und die Grants waren in allen Generationen Freunde der indianischen Ureinwohner geblieben.
Mein Adoptivvater Vernon Grant war ein großer, gutaussehender Mann, besonnen und schweigsam, immer umgeben von einer rätselhaften Aura der Schwermut. Er arbeitete von früh bis spät auf den mehreren Millionen Morgen Land, die zur Willow Creek Farm gehörten; die Abende verbrachte er oft an seinem Konzertflügel in der Bibliothek oder lesend in seinem Arbeitszimmer. Sonntags fuhr er mit zur Kirche, aber mir war nie klar, ob er gläubig war oder nicht. Er tat es wohl einfach, weil meine Adoptivmutter es von ihm erwartete. Sie stammte aus einer ultramethodistisch geprägten Familie, ihr Vater war Wanderprediger gewesen, bevor er sich nach einem Schlaganfall mit seiner Familie in Fairfield niedergelassen und bei den Grants um Obdach gebeten hatte. Der Mangel an Humor mochte ihrer strengen Erziehung geschuldet sein, ebenso ihre Pedanterie und ihr altmodisches Verständnis von Moral und Disziplin. Rachel Grant führte nicht nur die Geschäfte der Willow Creek Farm mit fester Hand, sie organisierte nebenbei den Haushalt, zog fünf Kinder groß und hatte außerdem in jedem sozialen oder kirchlichen Gremium der Stadt irgendeinen führenden Posten inne. Der Name Grant und seine Geschichte war für sie Verpflichtung. Meine Adoptivmutter war keine hässliche Frau, aber sie legte keinen großen Wert auf Äußerlichkeiten wie modische Kleidung, Schmuck oder einen schicken Haarschnitt. Seitdem ich mich erinnern konnte, trug sie ihr Haar zu einem strengen Knoten im Nacken frisiert und bevorzugte praktische Kleidung.
In der Ehe meiner Adoptiveltern spielte die Liebe offenbar keine zentrale Rolle, nie hatte ich sie Gesten der Zuneigung austauschen sehen. Ihre Gespräche beschränkten sich ausschließlich auf die rein funktionalen Aspekte des Lebens auf einer so gigantischen Farm wie der Willow Creek. Ich hatte vier Brüder, von denen der jüngste, Esra, ein Nachzügler und nur ein Jahr älter war als ich. Malachy, Hiram und Joseph waren so groß, gutaussehend und wortkarg wie ihr Vater, und obwohl sie von Kindesbeinen an wussten, dass Malachy nach der Tradition in Nebraska eines Tages die Farm erben würde, rackerten sich Hiram und Joseph ebenso ab wie er. Esra hingegen war völlig anders, charakterlich wie äußerlich. Er war blond und plump, besaß eine ausgeprägte Neigung zur Boshaftigkeit und fühlte sich grundsätzlich benachteiligt und missachtet, dabei war er im Gegensatz zu meinen anderen Brüdern faul. Esra mochte es, Menschen gegeneinander aufzubringen, und er konnte nur dann von Herzen lachen, wenn jemandem in seiner Gegenwart ein Missgeschick widerfuhr.
Ich passte so wenig in die Familie Grant wie ein Eisbär in die Wüste. Der liebe Gott hatte mich mit einem leidenschaftlichen Temperament, einem starken Freiheitsdrang und Humor bedacht, mit Musikalität und einer wilden Phantasie. Meine Mutter hielt all meine Talente für unnütz. Sie erzog mich streng, und ich lernte wohl oder übel, mich in die Familie einzufügen, wenn mir das auch bisweilen schwerfiel. Manchmal bemerkte ich ihren kritischen Blick und war mir insgeheim sicher, dass sie oftmals gewünscht hat, sie hätte ein anderes Kind als mich adoptiert. Zwischen den vierschrötigen Kindern in der Elementary School stach ich schon mit fünf Jahren hervor, und die Unterschiede wurden deutlicher, je älter ich wurde.
Als Kind liebte ich es ganz besonders, mit meinem Vater durch die Natur zu streifen. Ich lernte die Bäume und Pflanzen, die Jahreszeiten und die Tiere kennen, ich konnte früh schwimmen und reiten, schießen und Traktor fahren, und da ich neugieriger und wendiger war als meine Brüder, war ich ihnen immer um ein paar Nasenlängen voraus, was sie, bis auf Esra, gutmütig und neidlos akzeptierten.
Meine Kindheit war geregelt, aber nicht unglücklich. Das Leben auf einer Farm, zwölf Meilen von der nächsten Ortschaft entfernt, hatte es mit sich gebracht, dass ich nie richtige Freundinnen hatte, aber ich zog sowieso von klein auf männliche Gesellschaft vor. Zu meinem zwölften Geburtstag hatte ich ein eigenes Pferd bekommen. Waysider war ein wunderhübscher Falbe mit ungewöhnlichen goldbraunen Augen, ein Mix zwischen einem Quarterhorse und einem Lusitano und das schnellste Pferd auf der Farm. Eine ganze Weile trainierte ich mit ihm für Wettkämpfe, aber Malachy verlor das Interesse, nachdem er mich und mein Pferd ein paarmal zu Turnieren in der Umgebung gefahren hatte. Ihn faszinierten Maschinen eben mehr als Pferde.
Schon bevor ich in die Schule kam, konnte ich lesen und schreiben und verschlang jedes Buch, das mir in die Hand fiel, so dass mein Vater in unserer umfangreichen Bibliothek die Literatur, die Mutter als anrüchig bezeichnete, auf ihr Drängen in die obersten Regale verbannte. Natürlich war das kein Hindernis für mich, und schon mit zwölf Jahren las ich Vom Winde verweht, Jenseits von Eden, Früchte des Zorns, Die Straße der Ölsardinen und andere Werke, die meine ohnehin lebhafte Phantasie manchmal zum Überschnappen brachten. Bei meiner Mutter und meinen Brüdern, die als einzige Lektüre die Kirchen- und die Landwirtschaftszeitung oder anspruchslose Groschenromane kannten, erntete ich völliges Unverständnis, wenn ich von den fiktiven Gestalten sprach, als seien es Freunde oder Bekannte. Mein Vater grinste manchmal verstohlen, wenn Mom Caleb Trask für den Kassierer aus dem Farmers Ranchers Co-op oder Scarlett O’Hara für eine meiner Klassenkameradinnen hielt, und damals kam mir bereits der Verdacht, dass hinter Dads verschlossenem Gesicht mehr steckte, als er es andere sehen ließ. Genauso befremdlich wie meine Lesewut fand meine Mutter meine Vorliebe für die Musik. Ich kannte jedes der schmalzigen Country-Lieder auswendig, die von morgens bis abends im Landfunk liefen, und hin und wieder gab ich unseren Arbeitern im Gesindehaus Vorstellungen, die mir donnernden Applaus einbrachten, worauf ich mich wie eine Primaballerina würdevoll vor ihnen verbeugte. John White Horse, der indianische Farmhelfer, begleitete mich auf der Geige oder der Mundharmonika und behauptete, aus mir würde eines Tages eine großartige Sängerin werden. In meiner Phantasie sah ich mich schon auf den großen Bühnen der Welt, aber Mom sorgte regelmäßig dafür, dass ich nach solchen Höhenflügen wieder unsanft auf dem Boden der Tatsachen landete, indem sie mich an meine häuslichen Pflichten erinnerte. Sie sah meine Gesangsauftritte nicht gerne, weil sie es für unziemlich hielt, sich vor Männern so zur Schau zu stellen, aber Dad duldete es genauso stillschweigend wie meine Kaperfeldzüge in den oberen Regalen seiner Bibliothek. Er tat so, als ob er es nicht bemerkte, und erst viel später erfuhr ich, dass er all die Jahre von meinen Bemühungen gewusst und sie amüsiert verfolgt hatte. Oft ließ er mir sogar die Rollleiter stehen, weswegen ich ihn eine ganze Weile für einfältig gehalten hatte.
Die feste Belegschaft auf der Farm setzte sich aus etwa zwanzig Leuten zusammen: Neben unserer Familie waren das Martha Soerensen, die Haus und Küche beherrschte, der Vorarbeiter George Mills mit seiner Frau Lucie, die zwar von schlichtem Gemüt, aber ebenso fleißig wie fruchtbar war. Sie hatte in zwanzig Jahren zehn Söhne geboren, von denen acht noch am Leben waren, und in dem Verwalterhäuschen war immer viel los. Die jüngsten – Jim, Bob und Fred – waren ein paar Jahre älter als Esra und ich, freundlich und von einer geistigen Schwerfälligkeit, wie sie in dieser Gegend häufig war. Die Älteren arbeiteten zum Teil auf der Willow Creek, einige waren aber auch weggezogen.
John White Horse war ein Sioux vom Stamm der Lakota unbestimmbaren Alters, dessen Vater mit Dads Vater John Lucas Grant aufgewachsen war. Er war mit Mary-Jane, einer Halbindianerin, verheiratet, deren wirklich spannende Lebensgeschichte ich dank Martha kannte, denn offen wurde nie darüber gesprochen. John Lucas’ älterer Bruder Sherman Grant, Dads Onkel also, hatte bis zu seinem spektakulären Ende wie ein absolutistischer König im Madison County geherrscht, sein Appetit auf junge Mädchen war nahezu unstillbar gewesen. Zwar hatte er nie geheiratet, aber er hatte auf seine Art und Weise für eine wahre Bevölkerungsexplosion gesorgt, denn er hatte einen Haufen unehelicher Kinder in der Gegend von Fairfield hinterlassen. Besonders delikat war die Tatsache, dass er die damals knapp sechzehnjährige Mary-Jane Walker und ihre achtzehnjährige Schwester Sarah-Ann kurz hintereinander geschwängert hatte – sie bekamen ihre Kinder Nicholas und Dorothy beinahe gleichzeitig. Sarah-Ann hatte später Allister Woodward, den fleißigen Werkstattleiter des Farmers Ranchers Co-op, geheiratet und noch ein paar Kinder mehr bekommen, ihre uneheliche Tochter Dorothy war nach einem Studium nach Fairfield zurückgekehrt, um an der Madison Junior High School als Lehrerin zu arbeiten und Sheriff Benton zu heiraten. Dann gab es noch Sven Bengtson mit seiner Frau Rhonda sowie Lyle Patchett, Walter Morrisson und Hank Koenig. Sie lebten im Gesindehaus, arbeiteten hart und zuverlässig, gingen sonntags in die Kirche, aber danach fuhren sie nach Madison in den Strip Club oder in eine Kneipe, wie es unverheiratete Männer eben taten. In den Treibhäusern, in denen Gemüse und Salat angebaut wurden, arbeiteten viele Frauen aus Fairfield und Umgebung, und zur Erntezeit stellte Dad zusätzlich jede Menge Saisonarbeiter ein, um die anfallende Arbeit zu bewältigen.
In diesem Mikrokosmos war ich das einzige Mädchen unter Männern, was mir aber nie wirklich bewusst war. Ich mochte alle Leute und wuchs in dem Gefühl auf, von allen gemocht zu werden – abgesehen von meiner Mom, die, wenn sie sich über mich ärgerte, keinen Hehl daraus machte, dass sie mich für unnützes Unkraut mit unheilvollen Genen hielt.
Auf der Farm hatte ich meine Pflichten zu erfüllen, aber trotz der Bücher in Dads Bibliothek langweilte ich mich fürchterlich. Meine Mom hielt nichts vom Fernsehen und erlaubte meinen Brüdern höchstens mal, ein Footballspiel zu schauen, was mich aber nicht sonderlich interessierte. Die Schule ödete mich an, denn die Lehrer waren ihren Schülern geistig kaum voraus. Häufig versank ich in Tagträumen. Besonders dann, wenn ich mich wieder einmal von meiner Mutter ungerecht behandelt fühlte, stellte ich mir vor, dass meine echten Eltern noch lebten und ich sie durch Zufall wiederfand. In meiner Phantasie sah ich ein herrliches Schloss mit einem weitläufigen Park, in dem sie wohnten und auf mich warteten. In anderen Träumen war ich eine berühmte Sängerin, die in allen Ländern der Welt in den größten Hallen und Stadien auftrat. Ich wünschte mich an irgendeinen Ort, an dem etwas los war. Natürlich dauerte es nicht lange, bis ich mich mit genau den Leuten zusammentat, die die Langeweile und Tristesse genauso empfanden wie ich, und so verbrachten wir unsere Stunden in der Getreidemühle damit, uns auszumalen, was wir später einmal machen wollten, wenn wir Fairfield erst einmal entronnen waren.
Sheriff Benton und seine Männer eskortierten uns im Triumphzug ins Sheriff’s Office an der Main Street und sperrten uns in zwei Zellen – die Mädchen in eine, die Jungs in eine andere. Bis zu diesem Moment hatte ich nichts als Zorn über die ungerechte Behandlung empfunden, aber die Gitterstäbe vor den Zellen ernüchterten mich sehr schnell. Mir wurde klar, dass ich etwas wirklich Schlimmes getan hatte. Ich hatte nicht nur gegen ein ausdrückliches Verbot meines Vaters verstoßen, indem ich mich mit Jerry und der Clique getroffen hatte, nein, ich war vor der Polizei geflüchtet, und einer der Beamten hatte sich meinetwegen so schwer verletzt, dass er nach Madison ins Krankenhaus gebracht worden war.
Mein Vater war eine Stunde später da. Ich beobachtete mit vor Angst pochendem Herzen und schweißfeuchten Handflächen, wie er mit Sheriff Benton sprach. Seine Miene war undurchdringlich, er ließ sich seinen Zorn nicht anmerken, aber als er in Begleitung des Sheriffs zu meiner Zelle kam, schlug ich die Augen nieder, weil ich seinem Blick nicht standhalten konnte.
»Komm mit, Sheridan«, sagte er nur.
Ich zitterte am ganzen Körper und blieb zwischen Pam und Karla sitzen.
»Geh lieber«, flüsterte Karla und stieß mich mit dem Ellbogen an. »Sonst wird’s noch schlimmer.«
Hatte sie eine Ahnung! Ihre Eltern würden es womöglich so wenig wie die von Jerry merken, dass sie nicht nach Hause kam, aber in diesem Kaff, in dem es von engstirnigen Moralaposteln nur so wimmelte, war mein Vater mit Abstand der strengste von allen, das war allgemein bekannt. Ich stand mit weichen Knien auf.
»Schau mich an«, sagte mein Vater.
Ich hob vorsichtig den Blick. Die Ohrfeige kam so plötzlich, dass mir die Luft wegblieb. Ungläubig starrte ich meinen Vater an und presste die Hand auf meine brennende Wange. Er hatte mich noch niemals geschlagen, nicht einmal, als ich mit dem Traktor die Wand der großen Scheune in Kleinholz verwandelt hatte, weil ich vergessen hatte, den Gang herauszunehmen. Er hatte mich nicht geschlagen, als ich beim Schulschwänzen erwischt worden war, und nicht, als ich mit vierzehn Jahren heimlich Auto gefahren war, aber jetzt hatte er mich geschlagen, und das ausgerechnet vor dem Sheriff und meinen Freunden, und dafür hasste ich ihn aus tiefstem Herzen. Ich hasste es, so gedemütigt zu werden, und ich hasste es, wie mein Vater mich abführte, als sei ich eine Bankräuberin.
Er umfasste mein Handgelenk wie ein Schraubstock und zog mich quer durch das Büro des Sheriffs, der selbstgefällig grinste. Mit hocherhobenem Kopf und tränenblinden Augen marschierte ich neben meinem Vater her, die Stufen hinunter zu seinem Auto. Längst hatte sich in Fairfield herumgesprochen, was sich bei der alten Getreidemühle abgespielt hatte, und die ersten Schaulustigen versammelten sich vor der Polizeiwache.
»Du tust mir weh«, beschwerte ich mich, aber er reagierte nicht.
»Steig ein.«
Endlich ließ er mich los. Ein paar Sekunden spielte ich mit dem Gedanken, einfach wegzurennen. Vierzehn Meilen weiter östlich, am Highway 81, kamen die Trucks vorbei, und einer würde mich sicher mitnehmen. Irgendwohin, nur weg von hier.
»Einsteigen habe ich gesagt«, wiederholte er.
Ich gehorchte trotzig, ohne ihn anzusehen. Ein paar Meilen fuhren wir stumm, bevor mein Vater endlich den Mund aufmachte.
»Ich habe noch nie eines meiner Kinder aus einer Gefängniszelle holen müssen«, sagte er, ohne den Blick von der Straße abzuwenden. »Du kannst dir nicht vorstellen, wie maßlos enttäuscht ich von dir bin. Wie kommst du dazu, dich mit diesem Gesindel abzugeben?«
Ich starrte aus dem Fenster.
»Ich habe dich etwas gefragt!« Seine Stimme klang eher deprimiert als wütend, und das ärgerte mich aus irgendeinem Grund noch mehr.
»Das sind meine Freunde«, erwiderte ich heftig. Ich hätte ihn am liebsten angeschrien, aber ich verspürte keine Lust auf eine zweite Ohrfeige. »Wir haben nur Musik gehört und gequatscht. Was ist denn daran so schlimm?«
»Schlimm daran ist, dass ich dir den Umgang mit Jerry Brannigan verboten hatte. Noch schlimmer ist, dass du Bier trinkst und Zigaretten rauchst. Und das ausgerechnet in der Getreidemühle, die nicht ohne Grund gesperrt ist.«
»Ich habe nicht geraucht, und ich hab auch kein Bier getrunken«, begehrte ich auf.
Mein Gesicht brannte von der Ohrfeige, aber viel mehr schmerzte die Erkenntnis, dass mein Dad keinerlei Verständnis für mich aufbrachte.
»Man kann im Leben nicht immer tun, was einem gerade gefällt«, fuhr er fort. »Es gibt Regeln, an die man sich halten muss, damit eine Gesellschaft funktioniert.«
»Der blöde Sheriff hat uns behandelt wie Schwerverbrecher«, entgegnete ich wütend. »Sie haben uns mit vorgehaltenen Waffen abgeführt!«
»Wenn ich Sheriff Benton richtig verstanden habe, dann habt ihr versucht wegzulaufen. Nur deshalb musste er zu härteren Mitteln greifen.«
»Hättest du dich etwa einfach verhaften lassen?«, begehrte ich auf.
Er beachtete meinen Einwand nicht.
»Sheriff Benton hat sich vollkommen richtig verhalten, und wenn er ein paar Jugendliche, die widerrechtlich in ein abgesperrtes Gebäude einbrechen, um dort verbotenerweise Alkohol zu konsumieren, auf diese Art einschüchtert, dann ist das seine Sache.«
Ich traute meinen Ohren kaum, der Zorn drückte mir die Kehle zu.
»Du hältst zu ihm?«, fragte ich ungläubig.
»Ja, allerdings.«
Da war es aus mit meiner Beherrschung.
»Du bist genauso ein Arsch wie dieser Sh …«
Weiter kam ich nicht, denn die zweite Ohrfeige meines Lebens traf mich auf den Mund. Ich keuchte vor Empörung auf und presste die Hand auf meine aufgesprungene Lippe.
»Ich hasse dich!«, schrie ich meinen Vater wütend an, und es gelang mir nur unter Aufbietung aller Kraft, vor ihm nicht auch noch in Tränen auszubrechen. Dad warf mir nur einen kurzen Blick zu und erwiderte nichts.
»Ich wünsche, dass du dich in Zukunft nicht mehr mit diesen Leuten triffst«, sagte er stattdessen mit einer Stimme, die so kalt war wie die Antarktis. »Hast du mich verstanden?«
Ich starrte durch die staubige Windschutzscheibe vor mir und hing wilden Rachegedanken und Fluchtplänen nach.
»Ob du mich verstanden hast, Sheridan?«
»Ich bin nicht taub.«
»Vielleicht gelingt es mir zu verhindern, dass Anzeige gegen dich erstattet wird«, sagte er. »Aber um eine Strafe wirst du nicht herumkommen.«
Wir hatten die Abfahrt zur Willow Creek Farm erreicht, und ich nahm mir vor, nie wieder auch nur ein einziges Wort mit meinem Vater zu wechseln. Ich würde ihn spüren lassen, was er davon hatte, dass er sich gegen mich und auf die Seite von Sheriff Benton gestellt hatte. Und in meinem ganzen Leben würde ich ihn nicht mehr »Daddy« nennen. Mein echter Vater, davon war ich fest überzeugt, hätte zu mir gehalten. In jeder Situation.
»Bis du dich für dein Verhalten bei mir entschuldigt hast, bleibst du auf deinem Zimmer«, sagte er noch, als er vor dem Haus bremste.
»Lieber verhungere und verdurste ich«, entgegnete ich dramatisch, stieg aus und knallte die Tür zu, bevor er mir noch eine weitere Ohrfeige verpassen konnte.
Ich stapfte die Stufen zur Veranda hoch, als die Tür aufgerissen wurde. Meine Mutter erwartete mich wie ein Racheengel. Natürlich wusste sie schon Bescheid.
»Das musste ja eines Tages so kommen«, sagte sie gehässig. »Schlechtes Blut kommt immer durch. Da nützt die beste Erziehung nichts.«
Ich biss mir auf die Lippen und wollte an ihr vorbeigehen, aber da ergriff sie mein Handgelenk und zerrte mich in ihr Arbeitszimmer neben der Küche. Insgeheim wartete ich darauf, dass Dad mir irgendwie zu Hilfe kommen würde, aber das tat er nicht. Er ging einfach über den Hof davon und überließ mich meiner Mutter, die natürlich die lang ersehnte Gelegenheit erkannte, mich endlich nach Herzenslust bestrafen zu können.
»Du hast Schande über unseren Namen gebracht«, fauchte sie. »Und wie du aussiehst! So schmutzig und vergammelt wie das Pack, mit dem du dich herumtreibst!«
»Lass mich los«, fuhr ich sie an. »Du tust mir weh!«
»Du bist respektlos und undankbar!« Sie schüttelte mich so heftig, dass sie mir dabei beinahe den Arm ausrenkte. »Es ist dir völlig egal, was wir sagen! Nimm dir ein Beispiel an deinen Brüdern! Keiner von ihnen ist jemals von der Polizei verhaftet worden!«
Ihre Augen funkelten zornig, und ich wusste, sie lauerte nur auf ein falsches Wort von mir, um mich noch ärger zu bestrafen.
»Du benimmst dich wirklich wie der letzte Abschaum! Ich schäme mich, dass du unseren Namen trägst, du … du … niederträchtiger, schlechter Mensch! Von mir aus hätte dein Vater dich ruhig über Nacht im Gefängnis lassen können.«
Da wäre ich jetzt auch viel lieber, dachte ich, hütete mich aber, diesen Gedanken laut auszusprechen. Meine Mutter redete sich immer mehr in Rage, bedachte abwechselnd mich, meine Freunde und deren Familien mit Ausdrücken, für die sie mir den Mund mit Kernseife ausgewaschen hätte. Ihr lang aufgestauter Zorn entlud sich über mir wie ein Tornado, und ich zog das Genick ein und ließ sie toben.
»Und jetzt verschwinde und wasch dich!« Sie war völlig außer Atem, als ihr endlich die Adjektive ausgingen. »Nach dem Abendessen werden dein Vater und ich dir deine Strafe verkünden! Hast du das verstanden?«
Ich hatte auf jeden Fall verstanden, dass ich in diesem Moment nicht in der Position war, trotzige Antworten zu geben, und nickte stumm.
Sie versetzte mir noch einen groben Stoß, und ich prallte mit der Schulter schmerzhaft gegen den Türrahmen.
In meinem Zimmer warf ich mich aufs Bett und vergrub mein Gesicht im Kopfkissen. Wie ich sie hasste, meine Eltern und diese ganze Familie! Hätte ich die Wahl gehabt, ich hätte sie mir wahrhaftig niemals ausgesucht! Noch immer war ich empört darüber, wie Sheriff Benton uns behandelt hatte, aber allmählich wurde mir bewusst, was ich getan hatte. Wahrscheinlich wäre es erheblich klüger gewesen, sich widerstandslos gefangen nehmen zu lassen. Ein paar reumütige Tränen beim Sheriff wären auch nicht schlecht gewesen, aber das hatte ich einfach nicht über mich gebracht.
Mein Magen knurrte. Ich stand auf und ging ins Badezimmer, das auf der anderen Seite des Flurs lag. Als einziges Mädchen der Familie hatte ich ein eigenes Bad; meine Brüder teilten sich zwei andere Bäder. Das Haus bot wahrhaftig Platz genug für eine so große Familie wie unsere. Es war keines der schlichten, gesichtslosen Farmhäuser, wie sie für den Mittelwesten typisch waren, sondern eine gewaltige Kuriosität im Queen-Anne-Stil, das einer der exzentrischen Vorfahren meines Vaters Anfang des 20. Jahrhunderts hatte errichten lassen. Die roten Backsteine, aus denen es erbaut war, waren eigens von der Ostküste nach Nebraska transportiert worden. Es war ein ausgesprochen ungewöhnliches Haus mit seinen Erkern und Türmchen, den Schornsteinen und unterschiedlich hohen Spitzdächern. Besucher bestaunten gerne die Veranden und Balkone im Obergeschoss, die weiß eingefassten Sprossenfenster und die üppigen Holzverzierungen an der Fassade. Martha schimpfte oft, weil es so groß, unpraktisch und schwer sauber zu halten war, aber auch wenn sie mit meiner Mutter selten einer Meinung war, liebte sie das Haus mit derselben Inbrunst wie sie.
Ich wusch mir Gesicht und Hände und flocht mein langes Haar zu zwei straffen Zöpfen, weil ich hoffte, dass eine ordentliche Frisur meine Mutter milder stimmen würde. Meine aufgeplatzte Lippe tat weh, jeder Knochen in meinem Körper schmerzte, aber ich hatte es wenigstens geschafft, nicht zu heulen. Die Genugtuung, mit verweinten Augen bei Tisch aufzutauchen, gönnte ich meiner Mutter nicht.
Der Geruch nach gebratenem Fleisch und Kartoffeln stieg mir verführerisch in die Nase, ich hörte unten die Schritte und Stimmen meiner Brüder. Bevor Mutter Esra schicken konnte, um mich zu holen, schlüpfte ich in einen sauberen Pullover und frische Jeans und lief die Treppe hinunter. Sicherlich hatten meine Brüder und Martha längst von meiner Missetat gehört, wahrscheinlich entrüstete sich schon jede Menschenseele auf der Willow Creek Farm und in ganz Fairfield darüber, aber das war mir herzlich gleichgültig. Ich huschte ins Esszimmer und setzte mich auf meinen Platz zwischen Hiram und Esra. Meine Mutter sprach mit gesenktem Kopf so andächtig das Tischgebet, als wären ihr niemals im Leben bösartige Flüche über die Lippen gekommen.
Kaum jemand sprach, wie üblich. Teller und Besteck klapperten, die Schüsseln mit Kartoffeln, Fleisch und Blumenkohl gingen herum. Obwohl mein Magen wie verrückt geknurrt hatte, brachte ich nur mit Mühe zwei Kartoffeln und eine halbe Scheibe Schweinebraten herunter.
Mein Bruder Joseph zwinkerte mir zu. Auch Hiram schien die ganze Angelegenheit ziemlich komisch zu finden.
»Wie ist es denn so im Gefängnis?«, erkundigte er sich grinsend. »Gab’s wenigstens Wasser und Brot?«
Joseph prustete los.
»Ich verbiete euch, darüber zu lachen!«, herrschte meine Mutter die beiden an.
»Warum denn nicht? Ich find’s albern, dass der Sheriff ein paar Kinder verhaftet und in eine Zelle sperrt«, entgegnete Hiram. »Hat er sonst nichts zu tun?«
»Genau«, pflichtete Joseph ihm bei. »Ist doch lächerlich, so ein Fass aufzumachen, nur weil …«
»Haltet euch aus dieser Angelegenheit raus«, unterbrach Dad ihn scharf. »Ich will an diesem Tisch kein Wort mehr davon hören.«
Meine Brüder verstummten, nur Esra konnte es nicht lassen und machte abfällige Bemerkungen über meine Freunde, bis Dad auch ihm den Mund verbot. Das Abendessen verlief in einer angespannten Atmosphäre, meine Brüder räumten das Feld, kaum dass sie ihre Teller leer gegessen hatten, und ich fand mich unversehens allein mit meinem Vater und meiner Mutter am Tisch wieder.
»Dein Vater und ich sind uns einig, dass du eine Strafe verdient hast«, begann meine Mutter. Ihre Stimme bebte – ob vor echter Empörung oder ebenso echter Genugtuung, war kaum zu unterscheiden. »Du hast unser Vertrauen enttäuscht und unsere Familie vor der ganzen Stadt bis auf die Knochen blamiert.«
Bevor sie mit ihrer Strafpredigt loslegen konnte, blickte mein Vater auf die Uhr und erhob sich.
»Ich muss los«, sagte er und verließ das Esszimmer, ohne mich eines weiteren Blickes zu würdigen. Ich konnte nicht fassen, dass er mich so schmählich im Stich ließ.
»Ab sofort wirst du keine Ausritte mehr unternehmen und hast Hausarrest«, redete meine Mutter unbeirrt weiter. »Bisher haben wir gesagt, wir wünschen nicht, dass du dich mit diesem … diesem Pack herumtreibst. Aber jetzt verbieten wir es dir. Hast du das verstanden?«
Ich nickte stumm.
»Und damit du endlich lernst, unsere Verbote zu respektieren, wirst du jeden Tag nach dem Abendessen eine Stunde laut aus der Bibel lesen und danach eine halbe Stunde im Gebet Gott um Verzeihung für dein schändliches Verhalten bitten. Bis du begriffen hast, was du unserer Familie angetan hast, und dich bei uns in ernsthafter Reue entschuldigt hast, verstanden?«
Mir kamen auf Anhieb eine paar freche Bemerkungen in den Sinn.
»Ob du mich verstanden hast?«, zischte sie.
»Ja, Mom«, knirschte ich. »Ich habe dich verstanden.«
Sie runzelte irritiert die Stirn. Wahrscheinlich hatte sie wilden Protest erwartet und schien fast ein wenig enttäuscht, dass ich ihr keinen Anlass zu einer weiteren Tirade bot.
»Gut«, sagte sie nach ein paar Sekunden. »Dann räum jetzt den Tisch ab und mach die Küche sauber. In einer Viertelstunde erwarte ich dich in meinem Arbeitszimmer.«
Ich konnte den Triumph in ihrer Stimme hören, doch ich war zu erschöpft und zu verletzt über die abgrundtiefe Feigheit meines Vaters, um an Widerworte zu denken. Mit Tränen des Zorns und der Enttäuschung in den Augen räumte ich den Tisch ab und trug das schmutzige Geschirr hinüber in die Küche. Mehr denn je hatte ich das Gefühl, eine Gefangene in diesem Haus zu sein.
Im Vorbeigehen fiel mein Blick in den Spiegel, der im Flur zwischen Esszimmer und Küche an der Wand hing. Noch immer waren die Abdrücke von Dads Fingern auf meiner Wange deutlich zu sehen. Sein Verhalten heute hatte mich zutiefst gekränkt. Mochte er auch noch so enttäuscht von mir gewesen sein, er hätte mich nicht vor allen Leuten demütigen müssen.
Ich räumte die Spülmaschine ein und stellte sie an, dann ließ ich Spülwasser einlaufen und schrubbte die Pfannen und Töpfe.
Eigentlich hatte sich unser Verhältnis bereits im letzten Jahr gravierend verschlechtert, und zwar zu dem Zeitpunkt, als ich mir beim Farmers Co-op von meinem mühsam zusammengesparten Taschengeld einen Discman gekauft hatte. Leider hatte ich nur ein paar Tage meine Freude an dem Gerät, denn meine Mutter hatte den Discman in meinem Zimmer entdeckt. Vielleicht wäre es nicht zu einem solchen Drama gekommen, hätte sich nicht ausgerechnet eine CD der Punkband Bad Religion in dem Gerät befunden. Meine Mutter war völlig hysterisch geworden, und der harmlose Discman war mitsamt der CD, die ich mir nur von Red Christie ausgeliehen hatte, in der Jauchegrube gelandet. Tagelang hatte Gewitterstimmung geherrscht, und mein Vater, von dem ich mir wenigstens moralischen Beistand erhofft hatte, hatte zu der ganzen Angelegenheit kein Wort gesagt. Damals hatte er gerade irgendein politisches Amt übernommen, das ihn manchmal tage- und wochenlang von zu Hause fernhielt. Wahrscheinlich hatte ihn das mehr beschäftigt als ein in seinen Augen lächerlicher Discman, aber ich hatte mich von ihm schnöde im Stich gelassen gefühlt. Meine kritiklose Bewunderung für ihn hatte damals erste Risse bekommen.
Auch sein Verhalten mir gegenüber hatte sich in jenen Tagen verändert. Als Kind hatte ich oft auf seinem Schoß oder seinen Schultern gesessen, er hatte mich das Reiten und die Liebe zur Natur gelehrt. Stundenlang war ich früher mit ihm auf dem Traktor, zu Pferde, in einer der beiden Cessnas, die zur Ausstattung der Willow Creek Farm gehörten, oder zu Fuß unterwegs gewesen und hatte ihn neugierig Löcher in den Bauch gefragt. Er hatte mich hin und wieder mit an die Ostküste genommen, wenn er dort seine Tante Isabella und ihren Mann Frank besuchte, hatte mir New York, Baltimore, Boston, Washington und die Niagarafälle gezeigt und geduldig die unzähligen Fragen beantwortet, mit denen ich ihn unentwegt bombardiert hatte. Meine großen Brüder hatten mir dieses enge Verhältnis zu meinem Vater nie geneidet, aber Esra war deswegen schrecklich eifersüchtig gewesen.
Von einem Tag auf den anderen war es damit vorbei gewesen. Es hatte keine Gute-Nacht-Küsse mehr gegeben, keine vertrauten Spaziergänge, ja, kaum noch eine Unterhaltung. Dafür hatte ich immer häufiger bemerkt, wie Dad mich stumm und prüfend ansah, um sofort den Blick abzuwenden, wenn ich ihn erwiderte. Die Atmosphäre im Hause Grant war ohnehin nicht gerade von Herzlichkeit geprägt, und mit dreizehn Jahren hatte ich angefangen, die Kälte und Sprachlosigkeit zu bemerken. Bis dahin war ich ein mehr oder weniger glückliches und zufriedenes Kind gewesen, aber nach dieser Discman-Affäre hatte es angefangen mit der Langeweile und den rebellischen Gedanken, die ich in selbstkomponierten Liedern auszudrücken begann. Meine Mutter nervte es, wenn ich stundenlang an Dads Flügel saß, und sie schloss das Musikzimmer ab, sobald er das Haus verlassen hatte. Ich hatte längst die Bücher aus der Schulbibliothek und sämtliche Bücher, die es im Haus gab, gelesen, und meine Mutter genehmigte mir als Lesestoff nur noch Bücher aus der Kirchenbibliothek – kindische, erbauliche Heiligengeschichten. Der Fernseher wurde nur von meinen Brüdern benutzt, wenn sie sich die Übertragungen irgendwelcher Footballspiele ansehen wollten, abgesehen davon war das Fernsehprogramm noch langweiliger als die Landwirtschaftszeitung.
Freundinnen, mit denen ich mich hätte treffen können, gab es nicht, und die Gesprächsthemen am Mittagstisch, die sich nur auf die Arbeit auf der Farm oder den neuesten Tratsch aus Fairfield beschränkten, ödeten mich an. Das Kino in der Stadt war für uns genauso tabu wie der Drive-in am Highway 81. Die von der Kirchengemeinde organisierten Barbecues, Jugendgruppen und Picknicks waren mit einem Mal fad und spießig. In der Schule langweilte ich mich zu Tode, denn ich konnte schneller rechnen, besser lesen und schöner singen als alle anderen, und irgendwann regte sich in mir ein bohrendes Gefühl der Unzufriedenheit. Ganz eindeutig war ich hier am falschen Platz, ich sehnte mich danach, aus vollem Herzen zu lachen, zu tanzen, zu leben. Immer öfter geriet ich mit meiner Mutter aneinander, die es sich endgültig mit mir verdarb, als sie zu mir sagte, ich sei wahrhaftig eine Missgeburt. Ich hatte schon lange aufgehört, um ihre Gunst zu buhlen, und war auf Konfrontationskurs gegangen, zog jedoch dabei regelmäßig den Kürzeren.
Ich hatte mir nicht erklären können, woher meine Unzufriedenheit und die regelmäßig wiederkehrenden Anfälle tiefster Verzweiflung kamen, bis ich merkte, dass ich nicht der einzige Mensch in Fairfield war, der mit seinem Leben haderte. Jerry und den anderen erging es ähnlich wie mir, das hatte ich mit einer Mischung aus Erleichterung und Staunen festgestellt. Mit Vorliebe hörten wir die Songs von Bruce Springsteen und John Cougar Mellencamp, die ich bald besser kannte als alle Kirchen- und Countrylieder, und in ihren Texten fand ich mich wieder.
»Wo bleibst du?« Mutters Stimme riss mich aus den Gedanken.
»Ich komme sofort!« Mit Schwung knallte ich die gespülten Töpfe in den Küchenschrank, dass es nur so schepperte, dann marschierte ich hinüber in Mutters Arbeitszimmer. Sie saß hinter ihrem Schreibtisch, die Lesebrille auf der Nasenspitze, und musterte mich kurz.
»Setz dich«, wies sie mich an. »Schlag die Psalmen auf.«
Ich gehorchte und nahm die abgegriffene Bibel zur Hand, die schon auf dem Stuhl bereitlag.
»Fang an«, befahl sie, und ich begann zu lesen.
Am nächsten Morgen bestand meine Mutter darauf, dass ich mir zwei Zöpfe flocht. Ich war seit der dritten Klasse nicht mehr mit Zöpfen zur Schule gegangen, aber ich gehorchte widerspruchslos, um ihr keinen Vorwand für weitere Schikanen zu liefern. In der Nacht hatte ich beschlossen, jede Strafe stolz und schweigend zu erdulden und in dieser Zeit die Kommunikation mit meinen Eltern auf ein absolutes Minimum zu reduzieren. Ich flocht mir also die Haare und nahm mir vor, sie spätestens auf dem Weg zum Schulbus wieder aufzumachen, doch daraus wurde nichts, denn mein Vater brachte Esra und mich höchstpersönlich zur Schule. Ich saß hinten im Auto, starrte aus dem Fenster und sagte die ganze Fahrt über keinen Ton.
Zu meinem Erstaunen blieb das befürchtete Spießrutenlaufen in der Schule aus. Natürlich hatte sich längst herumgesprochen, was gestern passiert war, und für meine Freunde und die meisten meiner Schulkameraden war ich eine Heldin. Eine coole Heldin, die vor der Polizei geflüchtet war.
Nach Schulschluss musste ich mit dem Betreuungslehrer auf meinen Vater warten, der mich wieder abholte und direkt von der Schule aus zur Polizeiwache kutschierte.
»Hübsch siehst du aus«, bemerkte Sheriff Benton spöttisch und zog an einem meiner Zöpfe. Dann verkündete er mir, dass sein Deputy, der bei der Verfolgungsjagd durch ein Loch im Boden sieben Meter in die Tiefe gestürzt war, mehrere Knochenbrüche erlitten hatte und für Wochen und Monate nicht würde arbeiten können.
Pech gehabt, dachte ich trotzig. Was hatte er auch hinter mir herrennen müssen, der Idiot? Natürlich sagte ich das nicht laut. Ich sagte überhaupt nichts.
Natürlich gab es keine Anzeige. Mein Vater hatte das ganze Gewicht seines Namens in die Waagschale geworfen, und niemand in Madison County würde etwas gegen einen Grant unternehmen. Ich hasste ihn noch mehr dafür, dass er mit allem, was der blöde Sheriff sagte, einverstanden zu sein schien. Und ich hasste sie alle beide, weil sie über mich in der dritten Person sprachen, als sei ich gar nicht anwesend.
»Noch ist es nicht zu spät für das Mädchen«, sagte der Sheriff schließlich mit geheucheltem Verständnis. »Jeder macht mal einen Fehler, und die Kleine ist jung genug, um wieder auf den rechten Weg zurückzufinden. Sie braucht eine feste Hand, Vernon. Ich erinnere mich noch gut an die Sache mit Carolyn. Die ist ja damals auch …«
»Wir sorgen dafür, dass Sheridan sich nicht mehr mit diesen Leuten trifft«, unterbrach mein Vater den Sheriff eilig. »Und sie wird sich selbstverständlich bei Deputy McMahon entschuldigen.«
Der Sheriff schien noch etwas sagen zu wollen, besann sich dann jedoch anders.
»In Ordnung.« Er zuckte die fetten Schultern. »Dann ist die Sache für mich erledigt.«
»Danke, Luke«, sagte mein Vater zu allem Überfluss. Wofür zum Teufel bedankte er sich? Die beiden Männer gaben sich die Hand, dann tätschelte der Sheriff meine Schulter. Ich zuckte vor seiner Berührung zurück, am liebsten hätte ich ihn angespuckt.
»Das soll eine Warnung für dich sein, Mädchen«, sagte er selbstgefällig. »Ein zweites Mal kommst du nicht so glimpflich davon, das kann ich dir versprechen.«
Da ich mir fest vorgenommen hatte, vorübergehend nicht mit ihm zu sprechen, konnte ich meinen Vater nicht fragen, weshalb er die dreiundzwanzig Meilen zurück nach Madison fuhr, statt zur Willow Creek Farm abzubiegen. Offenbar wollte er die ganze unerfreuliche Angelegenheit auf der Stelle abschließen und setzte eine Viertelstunde später den Blinker, um auf den Parkplatz des Madison Medical Center einzubiegen. In meinem Innern sträubte sich alles dagegen, diesen Polizisten zu sehen und mich auch noch bei ihm zu entschuldigen, aber jeglicher Protest wäre zwecklos gewesen. Aus Erfahrung wusste ich, dass mein Vater gegen heftige Gefühlsausbrüche immun war, außerdem hatte er Sheriff Benton sein Wort gegeben. Ich beschloss also, diesen unerfreulichen Krankenbesuch würdevoll und so schnell wie möglich hinter mich zu bringen, und folgte meinem Vater mit hocherhobenem Kopf ins Krankenhaus. An der Information erfuhren wir, auf welcher Station und in welchem Zimmer Deputy Curt McMahon lag.
»Bring es hinter dich. Ich warte hier«, sagte mein Vater, ohne mich anzuschauen, und wandte sich dem Kaffeeautomaten neben der Rezeption zu. Ich wandte mich zum Gehen, doch eine Stimme hielt mich zurück.
»Stopp!«
Die Empfangsdame, eine energische Schwarze, deren Namensschild sie als Schwester Loretta auswies, warf mir einen mitleidigen Blick zu und schnalzte ungehalten mit der Zunge. Dann erhob sie sich schwerfällig von ihrem Drehstuhl und schob sich hinter dem Tresen hervor.
»Hey, Sie da!«, sprach sie meinen Vater an. »Sie wollen doch wohl das Mädchen nicht allein in ein Zimmer mit drei kranken Männern gehen lassen?«
Noch nie zuvor in meinem Leben hatte ich jemanden so unerhört respektlos mit Vernon Grant sprechen hören und war prompt fasziniert.
»Reden Sie mit mir?«, erkundigte mein Vater sich denn auch verblüfft.
»Allerdings!« Schwester Loretta baute sich drohend vor ihm auf und stemmte ihre Hände in die Hüften. Sie war so groß wie Dad, aber mehr als doppelt so dick – ein Trumm von einer Frau, der man ansah, dass mit ihr nicht zu spaßen war. »Es ist ja wohl nicht Ihr Ernst, das Püppchen allein auf die Männerstation zu schicken! Was denken Sie sich denn dabei?«
Eigentlich war es mir ganz recht gewesen, die peinliche Entschuldigung ohne Anwesenheit meines Vaters rasch hinter mich bringen zu können, und zu jedem anderen Zeitpunkt hätte ich es mir vehement verbeten, als ›Püppchen‹ bezeichnet zu werden. Aber in diesem Moment gefiel es mir außerordentlich, ja, ich genoss mit geradezu gehässiger Schadenfreude, wie die Entschlossenheit meines Vaters unter Lorettas empörtem Blick bröckelte. Er versuchte gar nicht erst, mit seinem Namen zu punkten, denn er ahnte wohl, dass Loretta sich davon nicht im Geringsten beeindrucken lassen würde. Auch wenn er nicht bereit war, seine Entscheidung kampflos aufzugeben, geriet er schnell in die Defensive, denn er argumentierte, wo er normalerweise höflich befahl und Gehorsam erwartete. Loretta schüttelte nur unnachgiebig den Kopf und sagte: »Nein. Nein. Nein.«
Ich nutzte die Gelegenheit und machte mich heimlich auf den Weg, um die dem Sheriff versprochene Entschuldigung hinter mich zu bringen.
Station vier befand sich im ersten Stock. Vor der Tür von Zimmer acht zögerte ich kurz, aber dann drückte ich entschlossen die Klinke hinunter und betrat den Raum, in dem es unerträglich nach den Körperausdünstungen von drei Männern roch.
»Hey, was kommt denn da für eine nette Überraschung hereingeschneit?« Der Mann im ersten Bett richtete sich auf und stieß einen Pfiff aus. »Bist du die neue Schwester?«
Der andere, ein zahnloser Alter mit ungepflegtem Bart, kicherte und fragte mich, ob ich seinen Katheter auswechseln könne.
Ich beachtete beide nicht und ging mit starrem Blick zu dem Bett am Fenster, in dem der verletzte Polizeibeamte lag.
Curt McMahon musterte mich von Kopf bis Fuß aus wässrigen Augen. Er hatte fettige Haare, einen dicken Schnauzbart und getrockneten Speichel in den Mundwinkeln. Sein rechtes Bein war eingegipst, nur die Fußzehen mit den gelben Fußnägeln schauten hervor. Ich schauderte, als ich ihm die Hand geben musste. Seine Handflächen waren schwitzig, sein unsteter Blick wanderte über mein Gesicht und blieb auf meinen Brüsten hängen. Etwas unsanft befreite ich meine Hand aus seinem Griff und verschränkte die Arme vor der Brust.
»Tut mir wirklich leid, dass Ihnen das passiert ist«, brachte ich hervor. »Ich … das … das hab ich nicht gewollt. Ich hatte nur auf einmal echt Panik, als Sie hinter mir hergelaufen sind.«
Die anderen beiden Kerle starrten zu mir herüber und machten anzügliche Witze.
»Nimm dir doch den Stuhl und setz dich einen Moment zu mir«, schlug Deputy McMahon vor. »Ich krieg nur selten Besuch und schon gar nicht von so ’ner hübschen jungen Lady.«
Ich war heilfroh, als die Tür aufgerissen wurde und Schwester Loretta mit unheilverkündender Miene im Türrahmen auftauchte. Sofort verstummten McMahons Zimmergenossen und gaben sich uninteressiert.
»Also, noch gute Besserung«, stotterte ich und trat eilig den Rückzug an.
»Komm mich wieder mal besuchen!«, rief der Deputy mir nach. »Würde mich echt freuen.«
»Lass das Mädchen in Ruhe!«, blaffte Schwester Loretta ihn an, dann streckte sie die Hand nach mir aus und zog mich aus dem Zimmer.
Draußen auf dem Flur atmete ich erleichtert auf.
»Das hättest du nicht allein machen müssen, meine Kleine«, sagte Schwester Loretta mitfühlend und legte einen ihrer gewaltigen Arme um meine Schulter. »Ich hab deinem Dad ganz schön die Leviten gelesen.«
»Das war toll von Ihnen«, murmelte ich. »Sonst traut sich niemand, was gegen ihn zu sagen.«
»Ich hab keine Angst vor niemandem. Und wenn er der Präsident persönlich wäre – so was verlangt man nicht von seinem Kind«, erwiderte Schwester Loretta, noch immer verärgert. Sie begleitete mich zurück ins Foyer des Krankenhauses, wo Dad auf mich wartete.
Als ich mich bei ihr bedankte, schloss sie mich in die Arme und zog mich an ihren großen Busen, unter dem ein noch größeres Herz schlug. Nie zuvor in meinem Leben hatte ich mich derart beschützt und geborgen gefühlt, und ich wünschte mir nichts sehnlicher, als genauso mutig und unerschrocken zu sein wie Schwester Loretta.
Drei Wochen lang erduldete ich die Höchststrafe, die darin bestand, dass mein Vater mich täglich in die Schule eskortierte und mich auch wieder abholte, als hätte er sonst nichts Besseres zu tun. Natürlich war auch Esra immer mit von der Partie, hämisch und gleichzeitig eifersüchtig. Ihm entging natürlich nicht, dass ich in der Schule als Heldin betrachtet wurde. Auf diesen Fahrten – dreiundzwanzig Meilen Schotterpiste und Landstraße hin und dreiundzwanzig Meilen in umgekehrter Reihenfolge zurück – sprach ich während dieser drei Wochen keinen einzigen Ton und wechselte keinen Blick mit meinem Vater, strafte ihn und Esra mit höflicher Missachtung.
Ich vermisste Jerry schmerzlich, und auch in der Schule fand ich keine Gelegenheit, mit meinen Freunden zu sprechen, denn die Lehrer waren wohl genau instruiert worden, mit wem ich reden durfte und mit wem nicht. Das erste Mal in meinem Leben bekam ich eine echte Ahnung davon, wie mächtig mein Vater in dieser Gegend war, die im Volksmund auch ›Grant-County‹ genannt wurde, denn sämtliche Lehrer und selbst der verblödete Direktor gehorchten ihm aufs Wort.
Bis zum Ende des Schuljahres musste ich im Unterricht allein in der ersten Bank sitzen und meine Pausen unter Aufsicht des Betreuungslehrers Jamison Reese verbringen, der mit geradezu missionarischem Eifer versuchte, mit mir Gespräche anzufangen. Um nicht noch zusätzlich Ärger mit einem Lehrer zu bekommen, ließ ich mich zum Schein auf seine Moralpredigten ein und gab mich reumütig.
Ich fühlte mich wie eine Straftäterin in der Besserungsanstalt und zählte die Tage, bis die Sommerferien begannen.
Jeden Abend musste ich die Küche aufräumen, danach meiner Mutter aus der Bibel vorlesen und anschließend eine halbe Stunde vor dem Kreuz in ihrem Arbeitszimmer knien. Von Tag zu Tag wuchs mein Groll auf sie, und es fiel mir immer schwerer, ihre boshaften Provokationen zu ignorieren, aber ich vermied alles, was sie dazu hätte bringen können, die gegen mich verhängten Sanktionen zu verlängern.
Meine echten Eltern hätten mich niemals so grausam behandelt. Und irgendwann während dieser endlosen Stunden des Bibellesens und Schweigens beschloss ich, mehr über meine eigentliche Herkunft herauszufinden. Selbst wenn meine Eltern tot waren, so gab es vielleicht noch irgendwo auf dieser Welt eine Tante oder einen Onkel, die mich all die Jahre verzweifelt gesucht hatten und sich unbändig darüber freuen würden, mich in die Arme zu schließen. Diese Vorstellung lenkte mich von meinen düsteren Gedanken ab.