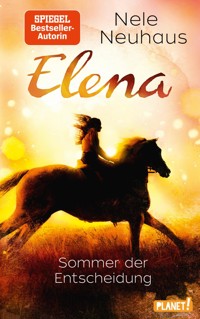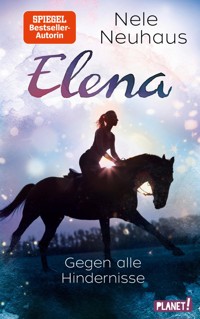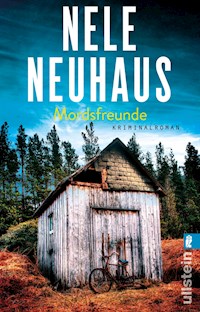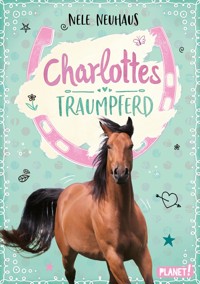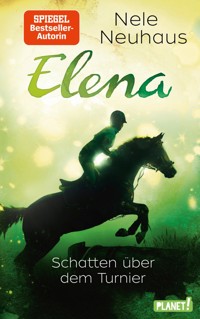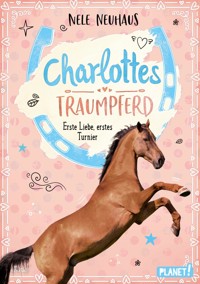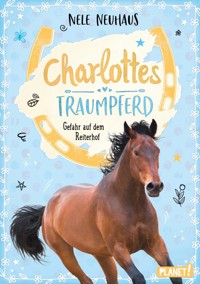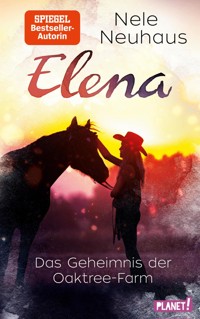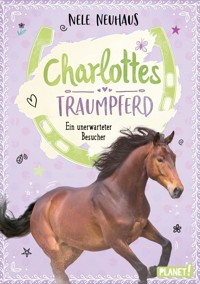10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Das große Finale der erfolgreichen Sheridan Grant-Trilogie: mitreißend und packend von der ersten bis zur letzten Seite! »Die drei Romane um Sheridan-Grant sind so super geschrieben, spannend, einfühlsam und man ist leider viel zu schnell am Ende angelangt. Ein ganz großes Kompliment an die Autorin .« Amazon Kundin »Ich bin total begeistert und geflasht von den drei Sheridan Romanen! Absolut lesenswert!« Amazon Kundin Die Weite Nebraskas. Ein Herz voller Sehnsucht. Der Traum eines Lebens. Sheridan Grant wollte alles hinter sich lassen, um von vorn zu beginnen – an der Seite von Paul Sutton, der sie liebt und auf Händen trägt. Fernab der Willow Creek Farm und weit weg von dem Mann, der ihr Herz einst in tausend Stücke brach. Doch kurz vor der Hochzeit kommen Zweifel auf. Sie kehrt nach Nebraska zurück und erhält unerwartet die Möglichkeit, ihren größten Lebenstraum zu verwirklichen. Doch ihre Vergangenheit lässt sie nicht los: Ein dunkles Geheimnis droht alles zu zerstören, was sie sich aufgebaut hat … *** Pflicht für Nele Neuhaus Fans! Diesen spannenden Roman werden Sie nicht aus der Hand legen können! ***
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 711
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Zeiten des Sturms
Die Autorin
NELE NEUHAUS, geboren in Münster / Westfalen, lebt seit ihrer Kindheit im Taunus. Sie ist die erfolgreichste Krimiautorin Deutschlands, ihre Bücher erscheinen außerdem in über 30 Ländern. Neben den Taunuskrimis schreibt die passionierte Reiterin auch Pferde-Jugendbücher und Unterhaltungsliteratur, die sie zunächst unter ihrem Mädchennamen Nele Löwenberg veröffentlichte. Ihre Saga um die junge Sheridan Grant stürmte auf Anhieb die Bestsellerlisten.
Das Buch
Der dritte Teil der Sheridan-Grant-Serie
Im idyllischen Neuengland-Städtchen Rockbridge hat Sheridan Grant in Paul Sutton endlich einen Menschen gefunden, dem sie rückhaltlos vertrauen kann und der sie liebt. Sheridan ist fest entschlossen, all ihre schrecklichen Erlebnisse hinter sich zu lassen und ein neues Leben zu beginnen. Nur ihr Herz wehrt sich mit aller Kraft dagegen.
Kurz vor ihrer Hochzeit wird Sheridan auf brutale Weise von ihrer Vergangenheit, von der Paul nichts ahnt, eingeholt. Sie erkennt, dass sie ausgerechnet die Menschen verleugnet hat, die immer zu ihr gehalten haben: ihre Familie und ihre engsten Freunde auf der Willow Creek Farm. Und dass sie ihren Lebenstraum, Sängerin zu werden, nicht einfach aufgeben will. Sie fährt nach Nebraska zurück, ohne zu ahnen, dass ihre Heimkehr erst der Beginn ihrer größten Reise sein wird: erst zu ihren Wurzeln, dann zum Gipfel des Ruhms und schließlich zu sich selbst.
Nele Neuhaus
Zeiten des Sturms
Roman
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein-buchverlage.de
Dieses Buch ist ein Roman. Die Geschichte ist fiktiv, alle Figuren und die Handlung sind von mir frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder bereits verstorbenen Personen sind zufällig und nicht von mir beabsichtigt. Das betrifft insbesondere Auswirkungen zeitgeschichtlicher Ereignisse, die ich in meinem Roman erwähnt habe.
Originalausgabe im Ullstein Paperback1. Auflage August 2020© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2020Umschlaggestaltung: www.zero-media.netTitelabbildung: © FinePic, München; © gettyimages / Pete Ryan; © mauritius images / Panther Media GmbH / Alamy und © mauritius images / Jason Rambo / AlamyAutorenfoto: © Gaby GersterE-Book-Konvertierung powered by pepyrus.comAlle Rechte vorbehalten. ISBN 978-3-8437-2293-3
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Titelei
Die Autorin / Das Buch
Titelseite
Impressum
Massachusetts
Rockbridge
San Juan Bautista, Kalifornien
Rockbridge
Los Angeles
Auf der Fahrt nach Westen
Nebraska
New York City, Februar 2001
Fairfield
Long Island
New York City
Kansas City
Fairfield, Nebraska
Im ADX, Florence
Fairfield, Nebraska
Auf dem Rückflug
Fairfield, Nebraska
Im Flugzeug nach Kansas City
Kalifornien
Los Angeles
Wyoming
Los Angeles, Vier Wochen später
Los Angeles
Nebraska
Los Angeles, Ende September
Los Angeles, Januar 2002
Los Angeles – Vier Wochen später
Sieben Monate später
Anhang
Nachwort
Quellenangaben:
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
Massachusetts
Widmung
Ich widme dieses Buch allen Buchhändlerinnen und Buchhändlern, die in der Corona-Krise im Frühjahr 2020 tapfer durchgehalten und mit tollen Ideen und großem persönlichen Einsatzdafür gesorgt haben, dass die Menschen weiterhin Bücher lesen konnten.Danke!
Rockbridge
Mit der Gewalt eines Schmiedehammers setzte mein Herzschlag wieder ein. Kurz atmete ich erleichtert auf, bis mir schockartig klar wurde, dass es dafür absolut keinen Grund gab. Der Mann mit dem glatt rasierten Schädel und der randlosen Brille, der mich aus kalten blauen Augen fixierte, war alles andere als ein Freund. In den vergangenen Monaten hatte ich völlig verdrängt, was in Savannah geschehen war, aber jetzt kehrten die Erinnerungen an den Albtraum, den ich auf Riceboro Hall erlebt hatte, mit aller Macht zurück, und mir wurde übel vor Angst.
»Hallo, Ethan«, erwiderte ich und konnte nicht verhindern, dass meine Stimme zitterte.
Meine Vergangenheit hatte mich eingeholt. Die Vergangenheit, in der ich mich Carol-Lynn Cooper genannt hatte und Ethan Dubois, dem ich seiner Ansicht nach zweihundertfünfzigtausend Dollar schuldete, mein Boss und mein Liebhaber gewesen war. Paul hatte ich nie von Savannah erzählt. Er wusste nicht, dass ich die Geliebte eines brutalen Zuhälters gewesen und nur deshalb einem schrecklichen Schicksal entgangen war, weil meine Mitbewohnerin und Freundin Keira einem von Ethans Schlägertypen die Kehle durchgeschnitten hatte, als er mich in ein Bordell verschleppen wollte. Irgendwie war es Ethan gelungen, meine Fährte aufzunehmen und mich ausfindig zu machen. Und jetzt war ich in seiner Gewalt.
Der Kerl, der mich überwältigt hatte und links von mir saß, hieß Rusco. Meistens arbeitete er als Türsteher im Southern Cross, Ethans Bordell in der Altstadt von Savannah. Er war ein bulliger Typ mit kurz geschorenem Haar und eng zusammenstehenden Augen. Trotz der Kälte trug er nur ein T-Shirt. Seine muskulösen Unterarme waren mit Knasttattoos übersät, und im schummerigen Licht der Innenbeleuchtung wirkte es so, als trüge er ein langärmeliges blaues Unterhemd darunter. Ich kannte ihn aus dem Taste of Paradise, der Bar, in der ich als Barpianistin gearbeitet hatte.
»Hi, Rusco«, sagte ich zu ihm.
»Hi, Carol-Lynn«, erwiderte er kaugummikauend und ohne eine Miene zu verziehen.
Der Mann am Steuer, ein Afroamerikaner, hieß Calvin. Er war riesig, mindestens zwei Meter groß und 150 Kilo schwer, ein ehemaliger Footballspieler. Ethans Mann fürs Grobe, der vor nichts zurückschreckte. Keira und die anderen Mädchen, die im Southern Cross ihr Geld als Prostituierte verdienten, hatten vor ihm noch mehr Angst gehabt als vor Mickey und Rusco.
»Lasst Carol-Lynn und mich mal kurz allein, Jungs«, befahl Ethan, ohne mich aus den Augen zu lassen. Calvin und Rusco gehorchten und stiegen aus. Der Motor des Autos brummte im Leerlauf, die Heizung lief auf vollen Touren. Mein Puls hämmerte mir in den Ohren, ich schwitzte vor Angst. Ich hörte, wie der Kofferraum geöffnet wurde. Metall klirrte auf Metall, dann wurde die Kofferraumklappe wieder zugeschlagen.
»Was machst du hier?« Ich versuchte, furchtlos zu klingen.
Ethan lächelte, aber in seinen Augen blitzte etwas Zorniges auf.
»Du warst so unhöflich, dich nicht von mir zu verabschieden, als du Savannah verlassen hast.« Seine Stimme blieb seidenweich. »Und vielleicht hast du vergessen, dass du deinem alten Freund Ethan noch etwas schuldest. Dabei hast du mit deinem Zukünftigen einen so guten Fang gemacht.«
»Ich schulde dir gar nichts.«
Die Kabelbinder schnitten mir schmerzhaft in die Handgelenke. Schweißtropfen rannen mir in die Augen, aber ich konnte sie nicht abwischen, denn meine Arme waren unter dem Sicherheitsgurt fixiert.
»Nun ja, das sehe ich anders.« Ethan schlug lässig die Beine übereinander und musterte mich. »Fragst du dich eigentlich gar nicht, wie ich dich gefunden habe?«
»Nein«, erwiderte ich, obwohl es mich natürlich brennend interessierte.
»Ich sage es dir trotzdem.« Ethan lächelte böse. »Damit du weißt, wie dumm du bist.«
Mit seinem echsenförmigen Kopf und den kalten, von farblosen Wimpern umkränzten Augen erinnerte er mich an ein Reptil. Wie hatte ich mich jemals in diesen Mann verlieben können? Weshalb hatte ich nicht gleich erkannt, was sich hinter seiner höflichen und kultivierten Fassade verbarg?
Ethan zog eine zusammengerollte Illustrierte hervor, schlug sie auf und hielt sie mir hin. Ich schluckte, als ich das Foto von Paul und mir sah, das im Dezember bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung an der Harvard University, Pauls Alma Mater, aufgenommen worden war. Es war unser erster gemeinsamer Auftritt in der Öffentlichkeit gewesen.
»Doktor Paul Ellis Sutton und seine schöne Verlobte, Miss Sheridan Grant«, las Ethan die Bildunterschrift vor, wobei er unsere Namen höhnisch betonte. »Wie leicht du es mir gemacht hast! Das ist beinahe schon eine Beleidigung meiner Intelligenz.«
Er griff wieder neben sich und förderte ein paar Fotos zutage. Sie zeigten Paul und mich auf dem Weihnachtsmarkt in Rockbridge, Arm in Arm in Albany beim Verlassen eines Restaurants, vor dem Black Lion Inn im Gespräch mit anderen Leuten und sogar in Pauls Haus am See. Sie waren aus größerer Entfernung mit einem Teleobjektiv gemacht und zum Teil körnig und ziemlich unscharf, aber wir waren unzweifelhaft zu erkennen. Bei der Vorstellung, dass uns irgendjemand verfolgt und aufgelauert hatte, wurde mir erneut übel.
»Du warst sogar zu dämlich, deine alte Schrottkarre umzumelden. Dich zu finden war lächerlich einfach.« Ethan ließ die Fotos achtlos in den Fußraum fallen. »Rockbridge – was für ein beschissenes Kaff. Bist du wirklich so verzweifelt, dass du diesen Hinterwäldler heiraten willst? Warum? Weil er Kohle hat? Weil er hier eine große Nummer ist? Ist es das, was du willst? Dem Onkel Doktor lauter kleine Hinterwäldler-Bälger werfen und eine waschechte Hinterwäldler-Mom werden, mit einem fetten Arsch?«
Seine brutalen, verächtlichen Worte trafen mit Präzision in die offene Wunde meiner Zweifel. Es zu denken war etwas völlig anderes, als es aus dem Mund eines anderen zu hören. Noch nie zuvor hatte ich eine solch heftige Abscheu gegen einen Menschen empfunden wie gegen Ethan Dubois. Ich war voller Panik vor ihm aus Savannah geflohen und hatte wochenlang in meinem Auto geschlafen, aus Angst, dass seine Leute mich finden, mit Gewalt zurück nach Georgia bringen und auf Riceboro Hall einsperren könnten.
»Lässt du dich jede Nacht von ihm bespringen, ja? Bist du vielleicht schon trächtig?« Ethan gluckste gehässig und fasste grob an meinen Bauch. »Das ist doch der Trick von kleinen, hinterhältigen Schlampen wie dir.«
»Bitte, Ethan«, fiel ich ihm ins Wort. Obwohl ich vor Angst bebte, durfte ich keine Schwäche zeigen. »Jetzt hast du mich gefunden. Ich hab’s dir leicht gemacht. Du bist sauer auf mich. Und was nun?«
»Du glaubst, ich bin sauer auf dich?« Ethans Augenbrauen zuckten hoch, und er lachte höhnisch auf. »Das trifft es nicht ganz, meine Teuerste!«
Mit einer blitzschnellen Bewegung packte er mein Haar und zerrte meinen Kopf zu sich heran. Ich unterdrückte einen Schmerzensschrei und schauderte, als ich den Zorn in seinen Augen sah.
»Das, was du getan hast, untergräbt meine Autorität und ist schlecht für mein Geschäft«, zischte er mir ins Ohr. »Andere kleine Schlampen verlieren den Respekt vor mir, wenn ich dir das durchgehen lasse. Wir hatten nämlich einen Vertrag, Baby, falls du dich daran erinnerst. Mit Handschlag und vor Zeugen besiegelt. Ich habe viel Geld in dich investiert. Du schuldest mir zweihundertfünfzigtausend Dollar, plus Zinsen und den Kosten, die mir entstanden sind, um dich zu finden, du miese kleine Nutte.«
»Ich habe keins von deinen Geschenken mitgenommen«, widersprach ich. »Und für mein Zimmer habe ich Miete bezahlt.«
Ich bewegte meine Handgelenke und merkte, dass die Kabelbinder nicht ganz festgezogen waren. Mit Daumen und Zeigefinger meiner rechten Hand ertastete ich die kleine Plastiknase, die in die Verzahnung griff. Ich versuchte, sie mit dem Fingernagel herunterzudrücken, aber sie war so winzig und meine Finger zitterten so sehr, dass ich immer wieder abrutschte.
»Hast du deinem Onkel Doktor erzählt, wie scharf du drauf warst, von mir gevögelt zu werden?« Ethans Speichel sprühte mir ins Gesicht.
»Nein, das habe ich ihm nicht erzählt.« Ich senkte meine Stimme. »Und ich sage dir auch, warum: Ich würde mich nämlich zu Tode schämen, wenn er wüsste, dass ich so blöd war, auf einen miesen Zuhälter reinzufallen, der mich unter Drogen gesetzt hat und von seinem Kumpel, Senator Charles Manning aus Alabama, hat vergewaltigen lassen.«
Ich sah den Schlag nicht kommen. Mein Kopf flog nach hinten. Unter dem Siegelring, den er an seinem linken Ringfinger trug, platzte meine Lippe auf. Ich schmeckte Blut. Aber es war mir gelungen, die winzige Plastiknase des Kabelbinders einzudrücken, und meine Fesseln lösten sich.
»Ich weiß nicht, ob du Mumm hast oder einfach zu dämlich bist, zu begreifen, in welcher Situation du dich befindest.« Ethan presste die Lippen zu einem schmalen Strich zusammen.
Wir starrten uns an.
»Ich habe dich wirklich geliebt«, flüsterte ich. »Ich konnte nicht fassen, dass du mich von fremden Männern vergewaltigen lässt.«
»Ach, wie rührend!«, spottete Ethan. »Mir kommen gleich die Tränen!«
»Du hast doch gesagt, dass du mich liebst und dass wir zusammengehören!« Ich blickte durch die Windschutzscheibe. Mein Magen krampfte sich vor Angst zusammen, als ich erkannte, was Rusco und Calvin im Lichtkegel der Scheinwerfer taten. Sie schaufelten ein Loch.
»Weißt du, zu wie vielen Mädchen ich das schon gesagt habe? Ihr seid viel williger, wenn ihr glaubt, ihr könntet eines Tages Mrs. Dubois werden.« Ethan lachte spöttisch und ließ meine Haare los. Seine Stimme wurde nüchtern und geschäftsmäßig. »Es ist deine Sache, wenn du in diesem Drecksnest versauern willst. Aber ich will das Geld zurück, das ich in dich investiert habe. Es gibt drei Möglichkeiten. Du könntest deinen Onkel Doktor bitten, es dir zu leihen. Dann müsstest du ihm allerdings von mir und von all den schönen Dingen erzählen, die wir zusammen erlebt haben. Du könntest aber auch zurück nach Savannah kommen. In ein paar Jahren hast du deine Schulden abgearbeitet und dann kannst du machen, was du willst.«
»Und was ist die dritte Möglichkeit?« Mein Blick fiel auf den Zündschlüssel, den Calvin hatte stecken lassen. Wenn es mir gelang, den Sicherheitsgurt zu öffnen, konnte ich es vielleicht schaffen, auf den Fahrersitz zu klettern und das Auto zu starten.
»Tja. Du wirst verstehen, dass ich das hier nicht einfach auf sich beruhen lassen kann«, fuhr Ethan im Plauderton fort. »Das, was du getan hast, spricht sich herum. Und bevor andere Mädchen auf solche dummen Ideen kommen, muss ich ein Exempel statuieren. Deine Freundin, die kleine blonde Nutte, hat uns übrigens ganz bereitwillig erzählt, dass sie dir geholfen hat, abzuhauen, bevor Calvin seinen Spaß mit ihr hatte.«
Eine eisige Hand griff mir ums Herz. Keira! Oh, mein Gott!
»W… was hast du mit Keira gemacht?«, fragte ich mit zittriger Stimme.
»Keira, genau, so hieß die Schlampe.« Ethan wühlte wieder in seiner Aktentasche und ich wusste, dass ich seine Unaufmerksamkeit nutzen musste. Mein Herz klopfte zum Zerspringen, als ich die Kabelbinder abstreifte und meine linke Hand unauffällig zum Verschluss des Sicherheitsgurtes gleiten ließ. Es war meine einzige und letzte Chance, denn Ethan hatte längst beschlossen, mich zu töten. Mit dem Gerede über die verschiedenen Möglichkeiten wollte er sich nur die Zeit vertreiben, bis Rusco und Calvin mein Grab geschaufelt hatten.
Jetzt! Ich warf mich nach vorne, duckte mich und rutschte mit den Knien über die Mittelkonsole. Irgendwie gelang es mir, auf den Fahrersitz zu kommen und meine Beine in den Fußraum zu schieben. Ethan, der noch angeschnallt war, schrie irgendetwas, aber ich sah mich nicht zu ihm um, sondern konzentrierte mich darauf, das Auto in Gang zu bringen. Gerade als ich den Schalthebel von P nach D zog, wurde die hintere linke Tür aufgerissen. Ich ignorierte die Panik, die in mir tobte, und gab Vollgas. Der Motor röhrte auf und das tonnenschwere Fahrzeug machte einen gewaltigen Satz nach vorne. Rusco, der versucht hatte, ins Fahrzeuginnere zu gelangen, flog in den Schnee. Ethan brüllte herum, doch die Fliehkraft machte es ihm unmöglich, zu mir nach vorne zu gelangen. Plötzlich tauchte direkt vor mir im grellen bläulichen Licht der Xenonscheinwerfer eine Gestalt auf. Calvin hob beide Arme mit der Schaufel, wohl um mich zu stoppen, aber selbst wenn ich gewollt hätte, hätte ich den schweren Wagen auf dem verschneiten Untergrund nicht mehr anhalten oder zur Seite lenken können. Ich sah das Weiß seiner weit aufgerissenen Augen in seinem dunklen Gesicht, dann gab es einen dumpfen Schlag. Calvin war verschwunden.
»Bist du völlig bescheuert, du dämliche Kuh?«, schrie Ethan mit sich überschlagender Stimme. »Halt sofort an!«
Ich beachtete ihn nicht. Mit beiden Händen umklammerte ich das Lenkrad, das sich selbstständig zu machen drohte, und gab immer mehr Gas. Der Navigator pflügte durch den Schnee und sprang über Bodenwellen wie ein bockendes Pferd, ein paarmal rutschte mein Fuß vom Gaspedal, weil ich vom Sitz hochgeschleudert wurde. Verschneite Bäume umschlossen wie eine weiße Wand die Lichtung. Endlich fand ich die Lücke, durch die wir gekommen sein mussten, und lenkte das schlitternde Auto in die Fahrspuren, die es vorhin hinterlassen hatte. Meine Hände taten weh, meine Schultern verkrampften sich vor Anstrengung. Ich hockte auf dem vordersten Rand des Sitzes, der für die langen Beine von Calvin eingestellt war, aber ich hatte keine Zeit, den Sitz zu verstellen oder mich anzugurten. Der Tacho zeigte fünfunddreißig Meilen an. Es ging steil bergab und es war purer Selbstmord, so durch den Wald zu rasen, aber ich musste unter allen Umständen verhindern, dass Ethan mich überwältigte. Ich biss die Zähne zusammen und lenkte den Lincoln den schmalen Waldweg abwärts. Ethan kreischte ohne Unterlass wie eine in die Enge getriebene Ratte. Ein rascher Schulterblick zeigte mir, dass er noch immer auf seinem Platz saß, sich an den Türgriff klammerte, der Feigling. Er hatte sich noch nie selbst die Finger schmutzig gemacht und die Drecksarbeit immer anderen überlassen.
»Halt an, Carol-Lynn!«, schrie Ethan, und die nackte Angst in seiner Stimme ernüchterte mich etwas. »Wir können doch über alles reden!«
Endlich erreichten wir eine Straße. Ich trat heftig auf die Bremse und riss das Lenkrad scharf nach rechts. Das Auto schlingerte, schrammte an einer Leitplanke entlang. Blech kreischte auf Blech, ein Funkenregen stob durch die Dunkelheit. Schnell hatte ich das Fahrzeug wieder unter Kontrolle und raste die kurvige Straße, die aufwärts führte, entlang. Mit der linken Hand tastete ich nach der elektrischen Sitzverstellung und es gelang mir, den Sitz nach vorne zu fahren. Dann fand ich den Sicherheitsgurt und legte ihn mir um. Ich hatte keine Ahnung, wo ich mich befand. Aus dem Augenwinkel nahm ich eine Bewegung wahr. Ethans kreidebleiches Gesicht tauchte zwischen den Vordersitzen auf. Er versuchte, ins Lenkrad zu greifen. Ich hämmerte mit der Faust auf seine Hand.
»Halt an!«, keuchte er. »Sofort!«
Er wollte mein rechtes Bein vom Gaspedal ziehen und ich versuchte, ihn abzuwehren. Eine Viertelmeile lang kämpften wir verbissen, und ich merkte, dass meine Kräfte nachließen. Plötzlich stand ein Elch mitten auf der Fahrbahn und glotzte ins Scheinwerferlicht. Ein heißer Schreck fuhr mir in die Glieder, ich ließ Ethans Arm los, packte mit beiden Händen das Lenkrad und trat mit aller Kraft auf die Bremse, aber das Auto reagierte nicht. Es drehte sich um die eigene Achse und schoss wie von einem Katapult abgefeuert von der Straße. Für ein paar Sekunden fühlte ich mich schwerelos, der Motor röhrte auf und ich sah nur noch Baumstämme. Dann hörte ich das infernalische Kreischen von berstendem Blech, Holz brach krachend und Glas splitterte, ein heftiger Ruck schleuderte mich nach vorne, es knallte ohrenbetäubend laut und etwas prallte mir heftig gegen Gesicht und Oberkörper. Im nächsten Moment war es völlig still, und alles um mich herum wurde schwarz.
Es roch nach Benzin. Meine Beine taten weh. Etwas Warmes, Klebriges lief mir übers Gesicht. Blut! Bis auf das Rauschen des Windes in den Bäumen ringsum war es totenstill. Ich öffnete die Augen und blickte mich benommen um. Ohne einen Zusammenhang herzustellen, registrierte mein Gehirn den Airbag, der schlaff aus dem Lenkrad hing, die Glassplitter überall und den Schnee, der ins Innere des Autos wehte, weil die Windschutzscheibe fehlte. Die Motorhaube war verschwunden und die Wucht der Kollision mit den Bäumen hatte den Motorblock auseinandergerissen. Etwas Dunkles ragte ins Auto hinein. Dort, wo vorher der Beifahrersitz gewesen war, steckte ein schlanker Baumstamm. Ich hob mühsam die rechte Hand und berührte den Stamm, der sich unter meinen Fingern rau und sehr real anfühlte. Eine ganze Weile saß ich reglos da und versuchte mich daran zu erinnern, was passiert war. Der Lunch bei Pauls Mutter. Die Brautkleidanprobe. Ethan und seine Gorillas! Die rasende Fahrt durch den Wald. Der Elch mitten auf der Straße! Oh Gott, ich hatte einen Unfall gehabt! Wie lange war ich bewusstlos gewesen? Wo war Ethan? Ich roch den Qualm, bevor ich das Feuer sah. Möglicherweise war die Kraftstoffleitung beschädigt worden und Benzin tropfte auf den heißen Katalysator. Ich musste raus aus dem Auto, bevor der Tank in die Luft flog. Nicht zum ersten Mal in meinem Leben half mir meine Fähigkeit, in einer Krise einen kühlen Kopf zu bewahren.
»Ganz ruhig, Sheridan«, murmelte ich, um meine aufsteigende Panik niederzukämpfen. Meine Finger waren steif von der Kälte, aber es gelang mir, das Gurtschloss zu öffnen und den Sicherheitsgurt loszuwerden. Ich stemmte meine linke Schulter gegen die Fahrertür, aber sie bewegte sich keinen Millimeter. Das Innere des Wagens füllte sich mit beißendem Rauch. Da hörte ich hinter mir ein Stöhnen und fuhr erschrocken zusammen.
»Hilfe«, röchelte Ethan. »Bitte, hilf mir.«
Ich wandte mühsam den Kopf und sah im Schein der Flammen, was geschehen war. Ethan war zwischen dem Baumstamm und den Sitzen eingeklemmt. Er hatte seine Brille verloren, was ihn hilflos und verletzlich wirken ließ.
»Im … im Handschuhfach ist eine … Pistole«, flüsterte er. »Erschieß mich bitte. Ich will nicht … verbrennen.«
Keuchend vor Angst und Anstrengung wand ich mich hinter dem Lenkrad hervor und kletterte zwischen dem Fahrersitz und dem Baumstamm in den Fond. Trotz allem, was Ethan mir angetan hatte, brachte ich es nicht fertig, ihn bei lebendigem Leib verbrennen zu lassen. Ich griff unter seinen Armen hindurch und zog mit aller Kraft. Er stöhnte vor Schmerzen. Der Qualm ließ meine Augen tränen.
»Du musst mithelfen!«, keuchte ich verzweifelt. »Alleine schaffe ich es nicht!«
»Es … geht … nicht. Ich habe kein Gefühl in den Beinen«, flüsterte er heiser. Obwohl mich all meine Instinkte anschrien, auf der Stelle das brennende Auto zu verlassen und so weit wie möglich wegzurennen, tastete ich hustend den Baumstamm ab. Auf allen vieren hockte ich mich über den Körper des Mannes, der mich hatte töten wollen, und stemmte meinen Rücken gegen den Stamm. Er bewegte sich! Es gelang mir, erst Ethans linkes Bein unter dem Stamm hervorzuziehen, dann sein rechtes. Ich schaffte es, die linke Tür zu öffnen und schob mit den Füßen Ethans schlaffen Körper ins Freie. Mit einem Schrei verschwand er in der Dunkelheit. Ich folgte ihm und sprang aus dem Auto. Mein Fuß berührte den Boden, aber gleich dahinter gähnte das Nichts. Ich prallte mit dem Kopf gegen etwas Hartes und stürzte einen steilen Abhang hinunter, rollte durch Schnee und Laub, bis ein kräftiger Baumstamm unsanft meinen Sturz bremste. Jede Faser meines Körpers schmerzte, mein Kopf brummte, ich sah alles doppelt und rang verzweifelt nach Luft. Reglos blieb ich liegen, bis die Benommenheit nachließ und das Karussell in meinem Kopf zum Stehen kam. Vorsichtig bewegte ich Arme und Beine. Wenigstens schien ich mir nichts gebrochen zu haben.
»Ethan?«, krächzte ich.
Fünfzig Meter über mir schoss eine Stichflamme aus dem geborstenen Benzintank des Lincoln. Mühsam richtete ich meinen Oberkörper auf und lehnte mich an den Baumstamm. Der Feuerschein des brennenden Autos erhellte die Nacht und der Schnee reflektierte die orangefarbenen Flammen. Ich befand mich am Fuß eines steilen Abhangs. Felsbrocken und Bäume ragten aus dem Schnee, und mir wurde klar, wie viel Glück ich gehabt hatte, bei meinem Sturz nicht gegen einen Felsen geschmettert worden zu sein. Ethan lag etwa zwanzig Meter oberhalb von mir. Ein Felsbrocken musste seinen Fall gebremst haben. Mit einem Ächzen kam ich erst auf die Knie, dann auf die Füße, musste mich aber am Baumstamm festhalten, weil meine Beine unter mir nachzugeben drohten. Blut strömte aus einer Platzwunde über meiner linken Augenbraue und rann mir übers Gesicht. Bei jedem Atemzug schmerzte meine linke Seite, außerdem war das linke Hosenbein meiner Jeans aufgerissen und blutdurchtränkt, aber ich musste irgendwie hoch zur Straße kommen. Hier in den Berkshire Hills gab es zwar keine Pumas oder Grizzlys, dafür aber Schwarzbären und Kojoten, die Blut aus mehreren Meilen Entfernung wittern konnten. In Rockbridge kursierten jede Menge Geschichten über Leute, die sich in den tiefen Wäldern verirrt hatten und von Bären gefressen oder deren skelettierten Leichen Jahre später zufällig von Wanderern gefunden worden waren. Ich machte mich hustend und keuchend an den mühsamen Aufstieg. Ein paar Minuten später war ich bei Ethan. Er hatte die Augen geschlossen, Blut rann ihm aus der Nase. Ich legte zwei Finger an seinen Hals, spürte seinen unregelmäßigen Herzschlag. Da ich nichts für ihn tun konnte, kämpfte ich mich durch dichtes Unterholz hangaufwärts. Ich kletterte über umgefallene Baumstämme und stolperte immer wieder über Wurzeln, die sich unter dem schneebedeckten Laub verbargen wie heimtückische Fußangeln. Zweige zerschrammten mir das Gesicht, und mein linkes Bein schmerzte höllisch. Außer Atem und mit heftigen Seitenstichen blieb ich stehen, lehnte mich an einen Baumstamm, entlastete mein linkes Bein und presste meine Hand auf das schmerzende Zwerchfell. Da explodierte schräg über mir der zweite, mit Gas gefüllte Tank des Navigators mit einem dumpfen Knall. Ich duckte mich und legte schützend die Arme über meinen Kopf. Glühende Metallteile flogen wie Schrapnelle durch die Gegend und landeten zischend im Schnee. Ich wartete eine Weile, dann schleppte ich mich weiter, bis ich endlich die Straße erreicht hatte. Meine Zähne klapperten, ich zitterte vor Erschöpfung am ganzen Körper und musste mich zwingen, einen Fuß vor den anderen zu setzen. Die Orientierung und jegliches Zeitgefühl waren mir abhandengekommen. Meine Stiefel waren völlig durchnässt und schwer wie Blei. Mit den glatten Sohlen rutschte ich bei jedem Schritt. Ich durfte auf gar keinen Fall stehen bleiben. Wenn man sich nicht mehr bewegte, trat schnell eine Unterkühlung ein. Die Kälte betäubte die Enden der Nervenbahnen, man spürte nicht mehr, dass man fror, und irgendwann schlief man ein, um nie mehr aufzuwachen.
Es fing wieder an zu schneien. Kein einziges Auto kam die Straße entlang. Ich lief weiter. Immer wieder glitt ich aus und fiel in den Schnee, und immer wieder arbeitete ich mich hoch. Meine von Blut und Schnee durchnässte Jeans gefror auf meiner Haut und wurde hart wie ein Panzer. Ich biss die Zähne zusammen und marschierte weiter. Ethan würde erfrieren, wenn er nicht bald Hilfe bekam! Als ich schon fast die Hoffnung aufgegeben hatte, sah ich in der Ferne rote und blaue Blinkleuchten, die sich langsam näherten. Ich blieb mit hängenden Armen stehen und blinzelte in das Scheinwerferlicht. Ein Crown Victoria, weiß und gold lackiert, mit der Aufschrift CPD für Clarksville Police Department, bremste neben mir. Ein Mann stieg aus. An seiner schwarzen Jacke glänzte ein Sheriffstern. Er zückte eine Stablampe, leuchtete mir direkt ins Gesicht.
»Miss? Sind Sie okay?«, fragte er mich besorgt.
Ich kniff die Augen zusammen und schlang meine Arme um den Oberkörper. War ich okay? Nein. Ganz sicher nicht.
»Miss, hören Sie mich?« Der Cop, ein stämmiger Kerl Mitte vierzig mit dunklem Teint, kurzem pechschwarzem Haar und Schnauzbart, nahm die Lampe herunter und kam vorsichtig näher. »Ich bin Sheriff Coronato vom Clarksville PD. Ich habe einen Anruf bekommen. Jemand hat eine Explosion gehört. Was ist passiert?«
»Mein … mein Kopf tut weh«, stammelte ich. »Da … da war ein Elch auf der Straße. Ich … ich konnte nicht mehr brem-sen.«
»War außer Ihnen noch jemand im Fahrzeug?« Der Blick des Sheriffs war besorgt, seine Stimme klang mitfühlend. Plötzlich wurde mir schwindelig, meine Beine knickten weg. Der Sheriff griff mir rasch unter die Arme.
»Kommen Sie, steigen Sie erst mal ein.« Er öffnete die Beifahrertür des Streifenwagens und half mir beim Einsteigen. Ich starrte auf meine blutverschmierten Hände, dann wieder in das Gesicht des Sheriffs. Er hatte freundliche Augen.
»Da war noch ein Mann im Auto«, flüsterte ich. »Ich … ich habe ihn rausgezogen, bevor … bevor der Tank explodiert ist.«
Wenig später saß ich in eine Decke gehüllt auf dem Beifahrersitz des Streifenwagens und presste eine Rolle Verbandmull, die der Sheriff mir gegeben hatte, gegen die Wunde an meiner Stirn. Im Auto roch es nach Kaffee und Zigarettenrauch. Der Motor tuckerte im Leerlauf vor sich hin, die Heizung lief auf Hochtouren und blies angenehm warme Luft gegen meine Beine, trotzdem zitterte ich immer noch am ganzen Körper.
Der Sheriff fuhr bis zur Unfallstelle, stieg aus und leuchtete mit seiner MagLite in den Wald. Als er zurückkehrte, brachte er einen Schwall eisiger Luft mit ins Innere des Autos. Unter seinem Gewicht senkten sich die ausgeleierten Stoßdämpfer. Er griff nach dem Funkgerät und teilte der Zentrale mit, dass er bei einem Verkehrsunfall sei, drei Meilen vor Clarksville auf der MA-8 North. Fahrzeugbrand. Vermutlich mit Personenschaden.
»Ich brauche jeden verfügbaren Mann«, sagte er. »Außerdem die Feuerwehr und zwei Rettungswagen.«
Dann wandte er sich mir zu. Seine Stimme klang weit entfernt und verschwommen, als hätte ich Watte in den Ohren.
»Miss, wie heißen Sie? Wo wohnen Sie? Kann ich jemanden benachrichtigen?«
Ich versuchte, mich zu erinnern, aber in meinem Kopf blitzten nur wirre Bilder auf, wie bei einem Kaleidoskop. Gedankenfragmente wirbelten umher, verbanden sich zu flüchtigen Bildern, rissen wieder auseinander. Ich hatte ein weißes Kleid anprobiert, das sich kalt und unangenehm auf meiner Haut angefühlt hatte. Ich war aus dem Laden gerannt und hatte geweint. Aber warum?
»Lassen Sie sich Zeit«, sagte der Sheriff freundlich. »Ist Ihnen warm genug? Ich bin gleich da vorne, wenn irgendetwas ist. Okay?«
Ich nickte schwach. Er stieg wieder aus, das Handy am Ohr. Mein erschöpfter Körper entspannte sich etwas. Ich zitterte und schwitzte gleichzeitig.
Als ich die Augen wieder öffnete, war die ganze Straße voller Menschen und Autos. Blinklichter zuckten. Die Unfallstelle war von Scheinwerfern taghell erleuchtet. Ich saß allein im Streifenwagen. Das Funkgerät gab ein statisches Knistern von sich. Ich hörte verzerrte Stimmen. In einer Halterung über der Mittelkonsole steckte ein aufgeklapptes Notebook, das eine GPS-Karte anzeigte. Ein blinkender blauer Punkt befand sich im Nirgendwo zwischen zwei Ortschaften mit den Namen Middleton und Clarksville, ungefähr dreißig Meilen nördlich von Rockbridge. Die Staatsgrenze von Vermont war nur ein paar Meilen entfernt. Mein Blick fiel auf die Uhr im rot beleuchteten Armaturenbrett. Sie zeigte zehn Minuten nach Mitternacht. Ob Ethan noch am Leben war? Und was war mit Rusco und Calvin? Mein Körper wärmte sich allmählich wieder auf und mit der Wärme kam die Müdigkeit. Ich versuchte, meinen Kopf gegen die Seitenscheibe zu lehnen, aber ich zitterte zu stark und konnte kaum atmen. Jeder Muskel in meinem Körper schmerzte.
Der Sheriff kehrte zurück, begleitet von zwei Sanitätern in orangefarbenen Uniformen. Sie halfen mir vorsichtig aus dem Auto, legten mich auf eine Tragbahre und deckten mich mit einer knisternden Folie zu. Ein dumpfer Schmerz pochte hinter meiner Stirn. An der Peripherie meines Gesichtsfeldes wurde es dunkel.
»Sheriff«, flüsterte ich. »Irgendwo im Wald sind noch zwei Männer. Ich glaube, einer von ihnen ist tot.«
»Wo im Wald?«
»Auf einer Lichtung auf einem Berg. Ein paar Meilen von hier die Straße runter. Da, wo die Leitplanke ist.«
Sheriff Coronato gab einen weiteren Funkspruch durch und wies seine Leute an, nach einem verletzten oder toten Mann zu suchen.
Ich wurde festgeschnallt und in einen Rettungswagen geschoben. Eine Frau beugte sich über mich. Sie war ungefähr Mitte dreißig, schlank und ziemlich hübsch. Das blonde Haar trug sie kurz.
»Hey«, sagte sie mitfühlend. »Ich bin Doktor Childs, die Notärztin. Wie geht es Ihnen?«
»Ich weiß nicht«, murmelte ich. »Mein Kopf tut weh.«
Dr. Childs leuchtete mir mit einer Lampe in beide Augen. Dann spürte ich einen scharfen Piks in meiner linken Armbeuge.
»Wir bringen Sie jetzt nach Williamsburg ins Krankenhaus. Kann ich irgendjemanden für Sie anrufen?«
Ich starrte sie an. Da war jemand, dem ich Bescheid sagen wollte, dass es mir gut ging, aber der Name fiel mir nicht ein.
»Können Sie mir Ihren Namen sagen?«, versuchte es die blonde Notärztin. »Ihr Geburtsdatum? Oder Ihre Telefonnummer?«
Sie blickte mir forschend ins Gesicht.
Ich konzentrierte mich, aber es fiel mir schwer, einen klaren Gedanken zu fassen. Mir war schwummerig und elend zumute, und in meinem Innern wuchs die Gewissheit, dass nach dieser Nacht nichts mehr so sein würde wie zuvor.
»Paul«, flüsterte ich. »Paul Sutton aus Rockbridge. Können Sie ihn anrufen?«
»Der Doktor Sutton?«, fragte Dr. Childs erstaunt.
»Ja. Mein Verlobter.« Ich war auf einmal sehr müde. »Ich heiße Sheridan … Cooper.«
Mir fielen die Augen zu. Die Türen des Rettungswagens wurden geschlossen, das Fahrzeug setzte sich langsam in Bewegung. Dr. Childs sagte noch etwas, aber ich konnte sie nicht verstehen. Dafür hörte ich, wie jemand leise meinen Namen rief.
Komm nach Hause, Sheridan! Komm heim!
›Ich bin auf dem Weg‹, dachte ich.
Mein Geist löste sich von meinem Körper. Schmerzen und Angst verschwanden, und mit einem Mal erfüllte mich ein so warmes und wunderbares Glücksgefühl, dass ich hätte weinen können vor Freude. Es war, als würde ich ein paar Meter über mir schweben. Ich blickte hinunter und sah mich selbst in dem Rettungswagen liegen. Meine Haare waren dunkel von der Nässe, das Blut leuchtete rot auf meiner weißen Haut. Ich lag friedlich und still da. Wie Schneewittchen in seinem gläsernen Sarg.
Es war nicht das erste Mal in meinem Leben, dass ich in einem Krankenhauszimmer aufwachte und ein Mann neben meinem Bett saß. Damals war es Dad gewesen. Diesmal war es Paul, der auf einem Stuhl saß, das Kinn in die Hände gestützt, und mich ansah. Unter seinen Augen lagen violette Schatten, und seine Traurigkeit tat mir im Herzen weh. Dennoch wartete ich vergeblich darauf, irgendetwas für ihn zu empfinden, was über bloße Sympathie hinausging.
Vor den Fenstern war es dunkel. Wie spät mochte es sein?
»Paul«, flüsterte ich heiser.
Sein Kopf flog hoch, er sprang auf und trat an mein Bett. »Sheridan! Wie fühlst du dich?«
»Ich weiß nicht«, erwiderte ich matt. »Ganz gut, glaube ich. Wo bin ich?«
Das Sprechen fiel mir schwer, weil mir ein Schlauch in der Nase steckte.
»Bei mir in der Klinik.« Paul zog den Stuhl neben mein Bett, setzte sich und ergriff so vorsichtig meine linke Hand, als sei sie aus Glas. »Du hattest einen Unfall, erinnerst du dich daran?«
Einen Unfall?
Ich dachte angestrengt nach. Bruchstückhafte Erinnerungen blitzten in meinem Kopf scheinbar ohne Zusammenhang auf. Eine rasende Fahrt durch die Dunkelheit. Ein Elch mitten auf der Straße. Der Geruch nach Benzin. Eine Explosion. Ethan Dubois! Die aufgerissenen Augen von Calvin vor der Kühlerhaube. Feuer! Eine Kapuze über meinem Kopf … Ich keuchte erschrocken auf.
»Schon gut, schon gut«, beruhigte Paul mich. Er beugte sich vor, strich mir sanft über die Wange.
»Warum bin ich hier?«, wollte ich wissen.
»Du hast eine schwere Gehirnerschütterung«, sagte er leise.
Ich musste mich räuspern. Mein Hals war ganz rau. »Da war ein Elch. Ich wollte bremsen, aber es war so glatt …«
Paul nahm vom Rollschränkchen neben dem Bett einen Becher mit einem Strohhalm und hielt ihn mir an die Lippen. Dankbar trank ich ein paar Schlucke lauwarmes Wasser.
»Was ist mit meinem Gesicht?«
»Nur Platzwunden.« Er lächelte, aber es fiel ihm offensichtlich schwer. »Mach dir keine Sorgen. Wenn sie verheilt sind, bleibt nichts zurück.«
Wir schwiegen einen Moment. Paul streichelte meine Hand.
»Schlaf noch ein bisschen.« Seine Stimme klang brüchig. »Ich bin hier und passe auf dich auf.«
»Danke«, flüsterte ich. »Danke für alles, was du für mich tust.«
»Das ist doch selbstverständlich.« Er blickte auf, sein Gesicht war gezeichnet von Erschöpfung und von Sorge um mich. Es bestürzte mich, diesen unerschütterlichen, starken Mann so zu sehen. Ich war noch zu benommen, um klar denken zu können, aber durch mein Bewusstsein irrlichterte der vage Gedanke, dass ich seine Liebe und Fürsorge nicht verdiente.
Die Tage vergingen, und ich erholte mich allmählich von der Gehirnerschütterung. Die Prellungen und Quetschungen an meinem Körper heilten ab, ebenso die tiefe Risswunde an meinem linken Oberschenkel und meine Gesichtsverletzungen. Meine Erinnerung an die Ereignisse war teilweise zurückgekehrt, aber Paul war es gelungen, die Polizei, die dringend mit mir sprechen wollte, noch für eine Weile fernzuhalten. Er schaute mehrmals am Tag bei mir vorbei, aber wir wussten beide nicht, worüber wir sprechen sollten. Ich hatte ihm das, was geschehen war, zwar in groben Zügen geschildert, dennoch stand etwas Unausgesprochenes zwischen uns, das mich quälte, und je mehr Paul sich um mich sorgte und bemühte, desto elender fühlte ich mich. Ich konnte nicht einfach so weitermachen. Mein Herz schmerzte vor Sehnsucht nach Nebraska, nach Nicholas und Mary-Jane, nach Rebecca, meinen Brüdern, nach Dad und nach Waysider, meinem Pferd. Und auch nach Horatio, der nach wie vor jede Nacht durch meine Träume geisterte. Es war unfair, Paul noch länger hinzuhalten. Wenn ich ihm wenigstens eines schuldete, dann war es Ehrlichkeit.
Es war schon spät, als er an einem Abend mein Zimmer betrat und die Tür hinter sich schloss. Stumm setzte er sich auf den Besucherstuhl neben meinem Bett. Das schlechte Gewissen, das mich bei seinem Anblick überfiel, fraß mich beinahe auf. Er hatte einen langen Tag im OP hinter sich, sah abgekämpft aus und hätte es verdient, nach Hause zu kommen und sich zu entspannen, statt hier bei mir sitzen zu müssen.
»Morgen kommen die Polizei und der Bezirksstaatsanwalt«, verkündete er mir. »Ich kann sie nicht länger hinhalten.«
»Schon in Ordnung«, erwiderte ich.
Unsere Blicke trafen sich. Ihm lag etwas auf der Seele, und ich ahnte, was es war.
»Diese … diese Typen, die dich entführt haben«, begann er schließlich zögernd. »Hast du die … gekannt?«
Ich sah ihm an, wie sehr er hoffte, ich würde Nein sagen, aber ich musste ihn enttäuschen. Der Zeitpunkt war gekommen, ehrlich zu sein.
»Ja«, antwortete ich deshalb.
»Die Polizei konnte alle drei Männer anhand ihrer Fingerabdrücke identifizieren. Sie kamen aus Georgia, einer von ihnen war mehrfach vorbestraft.«
»Was ist mit ihnen?« Mein Herz begann zu klopfen. »Leben sie noch?«
»Ein Mann wurde tot auf einer Waldlichtung gefunden«, erwiderte Paul. »Er wurde von dem Auto überrollt. Ein anderer hatte nur leichte Verletzungen. Die Polizei hat festgestellt, dass er vor drei Jahren aus dem Gefängnis geflohen ist und dahin wird er wohl zurückgehen. Und der dritte wurde in eine Spezialklinik gebracht. Bei dem Unfall ist seine Wirbelsäule mehrfach gebrochen.«
Ich empfand nichts außer Erleichterung. Calvin, dieses Monster in Menschengestalt, war tot, seine Leiche lag irgendwo in einem Kühlfach. Rusco würde zurück in den Knast wandern. Niemand musste sich mehr vor ihnen fürchten.
»Woher kennst du solche Leute, Sheridan?«, wollte Paul wissen.
Obwohl ich seit Tagen darüber nachgrübelte, wie ich ihm das erklären sollte, wusste ich nicht, wie und wo ich anfangen sollte.
»Das ist eine längere Geschichte«, wich ich aus.
»Ich habe Zeit.«
»Okay.« Ich setzte mich vorsichtig auf. »Nach dem Amoklauf meines Adoptivbruders war ich in Florida. Ich wollte abwarten, bis Gras über die ganze Sache gewachsen ist.«
»Das hast du mir erzählt«, bestätigte Paul.
»Nach zwei Jahren hat es mir gereicht. Ich wollte zu meiner Tante Isabella nach Connecticut fahren und eine Weile bei ihr wohnen, vielleicht den Highschool-Abschluss nachholen. Auf dem Weg dorthin habe ich in einem Motel in Georgia übernachtet. Ich war völlig pleite, deshalb habe ich nach einem Job gefragt. Der Geschäftsführer, Ethan Dubois, sagte, er suche noch eine neue Pianistin für seine Bar in Savannah.«
Ich machte eine kurze Pause.
»Der Job war in Ordnung. Ich konnte Klavier spielen und singen und meine eigenen Songs ausprobieren. Und die Trinkgelder waren ziemlich gut. Ich hatte ein Zimmer in einem Haus, in dem noch drei andere Mädchen wohnten. Studentinnen, die sich ihr Studium finanzierten, indem sie für Ethan Dubois arbeiteten. Ihm gehörten nicht nur die Motels, sondern auch einige Clubs, Bars und … Bordelle in Atlanta und Savannah. Ein Dreivierteljahr war alles gut, aber eines Abends … eines Abends hat Dubois mich zu sich nach Hause bringen lassen.«
Paul war ganz blass geworden. Ich brachte es nicht übers Herz, ihm zu gestehen, dass ich Ethan geliebt und sogar gehofft hatte, er würde mich heiraten.
»Er hatte Besuch. Einen Senator aus Alabama, von dem sich Dubois irgendeinen Gefallen versprach. Ich musste …«
»Hör auf!«, unterbrach Paul mich heftig. »Ich will es nicht wissen! Bitte, sprich nicht weiter!« Seine Stimme klang gepresst. »Es gibt Dinge, die behält man besser für sich. Ehrlichkeit kann manchmal mehr kaputt machen als eine Lüge.« Er sprang vom Stuhl auf, trat ans Fenster und blickte eine Weile hinaus in die Dunkelheit.
»Es tut mir leid, aber du solltest die Geschichte erfahren«, sagte ich zu seinem Rücken. »Weil ich sie wohl morgen auch der Polizei erzählen muss. Es war nämlich Ethan Dubois, der mich entführt hat, als ich aus Eunice Rodins Laden gekommen bin. Er hatte mich auf einem Foto mit dir in einer Illustrierten erkannt und einen seiner Leute nach Rockbridge geschickt, um zu überprüfen, ob ich es wirklich bin. Und dann ist er mit zwei von seinen Gorillas gekommen.«
Paul wandte sich wieder zu mir um. Das Unbehagen in seiner Miene verwandelte sich in Entsetzen, als er begriff, dass durch mich das Böse über seine heile Welt hereingebrochen war.
»Sie haben mir aufgelauert. Mir von hinten eine Kapuze über den Kopf gezogen und mich ins Auto gestoßen. Dann sind sie mit mir in den Wald gefahren. Ethan war wütend auf mich, weil ich mich damals einfach aus dem Staub gemacht hatte. Er wollte an mir ein Exempel statuieren.«
Paul blieb am Fenster stehen, die Arme vor der Brust verschränkt. Ich sprach mit tonloser Stimme weiter, ohne ihn anzusehen.
»Calvin und Rusco, die beiden Schlägertypen, haben auf der Lichtung ein Loch ausgehoben. Ein Grab für mich. Ich wusste, wozu Ethan Dubois fähig ist. Ich hatte es am eigenen Leib erlebt.« Ich schauderte. »An dem Morgen nach dieser Sache mit dem Senator hatte er Mickey, einen seiner Männer geschickt, um mich zu holen. Mir war klar, dass ich nie mehr da rausgekommen wäre. Sie hätten mich mit Drogen gefügig gemacht. Ich habe mich gewehrt. Keira, meine Mitbewohnerin, wollte mir helfen, aber Mickey hat sie zusammengeschlagen und mich fast in der Badewanne ertränkt. Ich hatte Todesangst. Keira hat ihm mit einem Küchenmesser die Kehle durchgeschnitten, dann hat sie mir geholfen, meine Sachen ins Auto zu packen und zu verschwinden. Und jetzt … jetzt ist sie wahrscheinlich auch tot. Weil … weil sie mir geholfen hat.«
Paul ließ sich schwer auf den Stuhl sacken und rieb sich mit beiden Händen das Gesicht. Er machte den Eindruck, als könnte er nicht viel mehr ertragen, aber ich konnte ihn nicht schonen.
»Ich war vor Angst halb verrückt. Meine Tante war auf einer Europareise, ich musste im Auto schlafen. Dann ging mir das Geld aus, weil ich mich nicht traute, mir irgendwo einen Job zu suchen. Nach Hause zurück konnte ich auch nicht. Deshalb war ich vollkommen pleite, als ich nach Rockbridge gekommen bin.«
Paul brauchte einen Moment, um das alles zu verarbeiten.
»Und wie ist es zu dem Unfall gekommen?«, fragte er.
»Ethan hat seine Männer auf der Waldlichtung aussteigen lassen, um das Grab auszuheben«, erzählte ich weiter. »Als er kurz nicht aufgepasst hat, bin ich auf den Fahrersitz geklettert. Der Zündschlüssel steckte und der Motor lief noch. Einen der beiden Typen habe ich überfahren, als er mir in den Weg gesprungen ist. Ich konnte nicht mehr ausweichen.«
»Du bist gefahren?« Paul war völlig entgeistert. Er sprang wieder auf, lief in dem kleinen Zimmer hin und her, wie ein Tiger im Käfig.
»Ich hatte keine andere Wahl! Sie wollten mich umbringen!«, erinnerte ich ihn. Paul hörte mit versteinerter Miene zu, als ich ihm den Rest der Geschichte erzählte.
»Du hast diesem Verbrecher das Leben gerettet«, stellte er fest. »Obwohl er dir so schreckliche Dinge angetan hat. Wieso?«
Ich zuckte die Schultern. »Hättest du ihn bei lebendigem Leib verbrennen lassen?«
»Nein. Ich … ich weiß nicht.« Paul hob beide Arme, dann schüttelte er den Kopf und schaute mich mit einer Mischung aus Fassungslosigkeit und Abscheu an. »Du erzählst mir das alles, als ob es dich gar nicht berühren würde! Ich kann nicht fassen, wie abgebrüht du bist.«
»Du denkst, ich wäre abgebrüht?«, flüsterte ich ungläubig.
»Nein!«, antwortete er schnell, relativierte das aber sofort. »Oder doch. Ja, das denke ich! Dein Verhalten ist … nicht normal, Sheridan! Ach, verdammt, ich weiß nicht, was ich denken soll! Du bist entführt worden. Du hast ein Menschenleben auf dem Gewissen! Du hattest einen schweren Autounfall. Warum … warum weinst du nicht?«
In diesem Augenblick erkannte ich mit deprimierender Klarheit, warum es mit uns niemals funktionieren würde. Paul Suttons Realität war die kleine Welt von Rockbridge. Er war in eine wohlhabende, liebevolle Familie hineingeboren worden, hatte immer Glück gehabt im Leben. Abgesehen vom Scheitern seiner ersten Ehe gab es keine nennenswerten Brüche in seiner Biografie. Er hatte nie Todesangst verspürt und nie in die mitleidslosen Augen eines Psychopathen blicken müssen. Er hatte nie gehungert, nie flüchten müssen, man hatte ihm nie gegen seinen Willen Gewalt angetan oder schlecht über ihn geredet. Paul lebte seit sechsunddreißig Jahren auf der Sonnenseite des Lebens, und deshalb konnte er die Schatten, mit denen ich zu kämpfen hatte, weder sehen noch verstehen. Er war arglos. Rechtschaffen. Das komplette Gegenteil von mir.
»Glaub mir, ich wünschte, ich hätte nichts davon erlebt.« Ich konnte die Bitterkeit in meiner Stimme nicht unterdrücken. »Ich wäre auch gerne bei Eltern aufgewachsen, die mich geliebt und gefördert hätten, irgendwo in einem friedlichen Städtchen, mit netten Nachbarn, einem süßen Hund und freundlichen Großeltern in der Nähe. Ich hätte gerne meinen Highschool-Abschluss gemacht und danach an einer tollen Uni studiert, ich war nämlich sehr gut in der Schule. Ich habe mir immer Freundinnen gewünscht, so wie normale Mädchen sie haben. Aber immer, wenn ich glaube, dass endlich alles in Ordnung ist, passiert irgendetwas und mein Leben ist wieder ein einziges beschissenes Trümmerfeld. Und weißt du was? Es hat mir noch überhaupt nie etwas genützt, wenn ich geweint habe!«
Paul sah mich betroffen an.
»Es … es tut mir leid, Sheridan«, sagte er leise. »Das war unbedacht von mir. Ich wollte dich nicht verletzen.«
»Nein, mir tut es leid.« Ich schüttelte den Kopf. »Es war mein Fehler. Ich hätte ehrlich zu dir sein müssen. Aber ich war so dumm zu glauben, ich könnte einfach neu anfangen. Hier. Mit dir.«
Plötzlich überkam mich eine bleierne Müdigkeit. Ich wollte nicht mehr reden, mich nicht rechtfertigen müssen. Ich wollte mir einfach nur die Bettdecke über den Kopf ziehen und schlafen. Nicht an den nächsten Tag und die Polizei denken. Alles vergessen und morgen früh aufwachen und feststellen, dass es nur ein irrer Traum gewesen war. Paul sagte so lange nichts, dass ich schon glaubte, er sei gegangen.
»Sheridan.« Seine Stimme schreckte mich aus dem Halbschlaf.
»Ja?«
»Wer ist Nicholas?«
»Warum fragst du das?«, wollte ich überrascht wissen.
»Du … du hast … im Schlaf nach ihm gerufen. Immer wieder.«
Ich biss mir auf die Lippen. Wie musste sich das für ihn angefühlt haben?
»Nicholas ist der Sohn von Mary-Jane und Sherman Grant, dem Onkel meines Adoptivvaters. Früher war er ein erfolgreicher Rodeoreiter«, erklärte ich. »Er war der einzige Mensch, der zu mir gehalten hat, als es mir sehr schlecht gegangen ist.«
»War er … war er dein Freund?«
»Oh nein!« Ich schüttelte den Kopf. »Nicholas ist fast so alt wie mein Dad. Als ich sechzehn war, habe ich mal für ihn geschwärmt, aber ich hatte keine Chancen bei ihm. Er ist nämlich schwul.«
Erleichterung blitzte in Pauls Augen auf, und ich war heilfroh, dass ich im Fieber nur von Nicholas und nicht von Horatio Burnett gesprochen hatte.
Die beiden Kriminalpolizisten von der Massachusetts State Police trafen am Samstagmorgen pünktlich um neun in Begleitung des Staatsanwalts ein. Ethan hatte zugegeben, dass er mich entführt und bedroht hatte und auch, dass ich ihn aus dem brennenden Autowrack gezogen und damit sein Leben gerettet hatte. Ich schilderte den beiden Detectives und dem Staatsanwalt in knappen Worten, woher ich Ethan Dubois kannte und warum er mich entführt hatte. Meine Verletzungen und natürlich Ethans Geständnis untermauerten meine Geschichte, außerdem hatte die Polizei das ausgehobene Grab auf der Waldlichtung und die Schaufeln gefunden. Ich erzählte, was Ethan Dubois über Keira Jennings gesagt hatte und dass ich vermutete, er habe sie umbringen lassen, weil sie mir geholfen hatte zu verschwinden. Einer der Polizisten schrieb etwas in sein Notizbuch. Der Staatsanwalt entschied, keine Anklage wegen Totschlags, fahrlässiger Tötung oder gefährlicher Körperverletzung gegen mich zu erheben, weil seiner Meinung nach eine eindeutige Notwehrsituation vorgelegen hatte. Die Polizisten nickten, und damit war die Angelegenheit erledigt. Nach einer Stunde war die Befragung beendet. Ich würde nur noch ein Protokoll unterschreiben und meine Adresse angeben müssen, falls ich bei einem möglichen Prozess gegen Ethan Dubois wegen Freiheitsberaubung und Nötigung als Zeugin aussagen müsste. Der Albtraum war vorbei.
Paul begleitete die Polizisten und den Staatsanwalt hinaus. Nach ein paar Minuten kehrte er zurück, schloss die Tür hinter sich und kam zu mir. Er setzte sich auf den Stuhl neben meinem Bett und sah mich prüfend an.
»Es tut mir so leid, Paul.« Ich streckte meine Hand nach ihm aus, aber er ergriff sie nicht, deshalb ließ ich sie wieder sinken.
»Mir auch, Sheridan«, erwiderte er nüchtern. »Mir tut es auch leid.«
»Wissen die Leute, was passiert ist?«, wollte ich wissen. »Deine Familie?«
»Natürlich.« Er stand auf, ging zum Fenster und lehnte sich an die Fensterbank. »Jeder weiß es. Und jeder weiß, dass du dein Brautkleid zerrissen hast und weinend aus dem Laden gerannt bist. Warum hast du das getan?«
Ich biss mir auf die Unterlippe und blickte auf meine Hände.
»Ich … ich weiß auch nicht, warum«, flüsterte ich.
»Mehr hast du dazu nicht zu sagen?« Er sprach leise, aber ich konnte hören, wie verletzt er war. Ich hob den Kopf und sah ihn an. Seine Miene war abweisend.
»Vielleicht sollte es mich nach allem, was ich in den letzten vierundzwanzig Stunden über dich erfahren habe, nicht wundern, dass du mir nicht vertraust«, sagte er. »Und vielleicht sollte ich sogar froh sein, dass diese Kerle hierhergekommen sind, bevor ich den Fehler gemacht und dich geheiratet hätte.«
Jedes seiner Worte war wie eine Ohrfeige. Mir dämmerte, dass dies unser letztes Gespräch war. Es war vorbei.
»Als es dir so schlecht ging, wollte ich dir deine Lieblingsmusik ins Krankenhaus bringen«, sagte Paul. »Dabei habe ich zufällig diese CD gefunden. Rock your life. Ich habe sie mir angehört.«
»Wirklich?« Ich musste lächeln.
»Ich weiß ja, dass du sehr musikalisch bist, aber da habe ich erst begriffen, wie sehr. Weshalb hast du mir nie erzählt, wie wichtig die Musik für dich ist?«, wollte Paul wissen. »Als wir einmal darüber gesprochen haben, hast du es abgetan, so, als würde dir die Singerei nichts mehr bedeuten. Warum?«
Ich erinnerte mich an den goldenen Oktobertag, als wir auf dem Gipfel des Mount Greylock gestanden und die herbstliche Farbenpracht der Wälder bewundert hatten. Vor lauter Freude über den schönen Tag hatte ich die Arme ausgebreitet und I believe I can fly von R. Kelly gesungen. Paul hatte meine Stimme bewundert, und ich hatte ihm verraten, dass ich davon geträumt hatte, Sängerin zu werden. Kurz vorher hatte er mir erzählt, dass seine erste Ehe gescheitert war, weil seiner Frau ihre eigene Karriere wichtiger gewesen sei als das Leben an seiner Seite. Deshalb hatte ich meinen Traum als Spinnerei bezeichnet.
»Wegen Frances«, sagte ich.
»Was?« Paul hob die Augenbrauen und sah mich ungläubig an. »Wegen meiner Exfrau? Was hat sie denn damit zu tun?«
»Ich … ich wollte nicht, dass du so etwas wie mit ihr eines Tages mit mir erleben würdest.«
Paul sah mich fassungslos an.
»Hast du etwa auch meinetwegen den Kontakt zu deiner Familie abgebrochen und keinen von ihnen zu unserer Hochzeit einladen wollen?«
»Hm, ja. Du hast immer so verärgert reagiert, wenn ich mal irgendetwas über mein früheres Leben gesagt habe. Und da dachte ich, es wäre … besser so.« Ich kämpfte mit den Tränen. »Aber seitdem … seitdem muss ich dauernd an zu Hause denken. An mein Pferd. Und wie es allen wohl geht. Wie meine Nichten und Neffen aussehen. Ich habe meinen Dad zuletzt gesehen, als er im Koma lag.«
Paul stieß einen tiefen Seufzer aus.
»So, wie du mir die Geschichte erzählt hattest, hatte ich den Eindruck, dass deine Familie dich schmählich im Stich gelassen hat. Das hat mich wütend gemacht. Aber ich hätte doch niemals von dir verlangt, dass du den Kontakt abbrichst! Du hast schlimme Dinge erlebt, und ich wollte dich unterstützen und für dich da sein.«
Offensichtlich hatte ich völlig falsche Schlüsse aus seinen Äußerungen gezogen, doch statt mit ihm zu reden, hatte ich mich selbst in die Rolle der Ausgestoßenen manövriert.
»Das bist du ja auch«, murmelte ich beschämt. »Es ist allein meine Schuld. Ich war nicht ehrlich zu dir.«
»Stimmt, das warst du nicht«, entgegnete er. »Aber ich habe auch unterschätzt, was du durchgemacht hast – dieser Amoklauf und die Folgen für dich in der Öffentlichkeit. Du warst nicht einmal achtzehn Jahre alt. Das alles muss dich tief traumatisiert haben.«
Er verschränkte die Arme vor der Brust.
»Ich habe sehr viel nachgedacht in den letzten Tagen. Über dich. Über mich. Und über uns. Ich habe mich in dich verliebt, als du im Büro hinter der Bäckerei die Augen aufgemacht und mich angesehen hast. Aber ich habe denselben Fehler gemacht wie schon einmal zuvor, denn ich habe alles nur aus meiner Perspektive betrachtet. Ich habe dich viel zu früh bedrängt, mich zu heiraten. Wir hätten uns erst besser kennenlernen, mehr Alltag miteinander erleben sollen. Ich habe von dir verlangt, zum katholischen Glauben zu konvertieren und all diese Einladungen wahrzunehmen, obwohl ich hätte sehen müssen, dass dich das überfordert. Und dann habe ich auch noch zugelassen, dass meine Mutter sich einmischt und eine Hochzeit für uns plant, die du so nie wolltest. Ich habe überhaupt nicht bedacht, dass du erst einundzwanzig bist und womöglich ganz andere Träume haben könntest als ich. Und ich habe mir auch keine Gedanken darüber gemacht, wie es sich für dich anfühlen muss, dich in mein Leben einzufügen und den Erwartungen aller Leute hier gerecht zu werden, statt deinen eigenen Weg zu finden.«
Paul blickte mich nachdenklich an.
»Willst du mir sagen, dass … dass es vorbei ist mit uns?« Meine Stimme klang piepsig, was mich ärgerte, aber ich konnte nichts daran ändern.
»Ich glaube, ich spreche nur aus, was du dich nicht zu sagen traust«, drehte Paul den Spieß um. »Du hast das Brautkleid zerrissen. Du isst seit Wochen kaum noch etwas. Du sitzt stundenlang am Fenster und starrst auf den See. Du spielst nicht mehr auf dem Flügel. Die Arbeit in der Klinik macht dir keinen Spaß. Wir haben seit Silvester nicht mehr miteinander geschlafen. Du machst nicht gerade den Eindruck einer glücklichen Braut.« Ein trauriges Lächeln zuckte um seine Mundwinkel. »Weißt du, Sheridan, um gemeinsam glücklich zu werden, muss man sich ergänzen, ähnliche Ziele und Träume haben. Ich habe hier meinen Platz, meine Arbeit, meine Familie. Mein Beruf ist meine Berufung, ich liebe, was ich tue. Wahrscheinlich werde ich auch eines Tages hier auf dem Friedhof liegen, wie alle meine Vorfahren. Aber meine Welt ist nicht deine und wird es wohl auch nie sein, selbst wenn du dich noch so sehr bemühst. Du würdest hier unglücklich werden.« Pauls Gesichtszüge wurden weich. »Du bist wie ein … wunderschönes, grünäugiges Einhorn, das unverhofft in meinem Leben aufgetaucht ist und mich beglückt und fasziniert hat. Wie könnte ich ein Wesen wie dich einfangen und zwingen, seine wahre Bestimmung zu verleugnen?«
Die Tränen schossen mir in die Augen. Ich verbarg mein Gesicht in den Händen und schluchzte. Die Matratze senkte sich unter Pauls Gewicht, er legte seine Arme um mich und zog mich an sich.
»Ich spüre doch, dass du hier nicht glücklich bist«, sagte er sanft. »Du musst zu Menschen, denen du vertraust. Die dir helfen können, all das, was du erlebt hast, zu verarbeiten. Ich bin nicht der Richtige dafür. Deshalb rate ich dir: Fahr nach Hause, zu deinen Leuten. Das ist die einzige Medizin gegen Heimweh.«
Heimweh! In der Sekunde, in der er das Wort aussprach, wusste ich, dass er recht hatte. Ich hatte es schon die ganze Zeit gewusst, mir diesen Gedanken aber nie gestattet. Mir wurde schwindelig vor Erleichterung. Ich schlang meine Arme um Pauls Hals, presste mein Gesicht an seine Brust und weinte, bis ich keine Tränen mehr hatte, weil dieser kluge, gütige und großherzige Mann und ich nicht füreinander bestimmt waren.
Wir redeten bis spät in die Nacht und spürten beide, dass sich zwischen uns etwas verändert hatte. Seltsamerweise brachten uns diese Stunden einander näher als die fünf Monate vorher. Ich erzählte Paul von meiner Familie, von Dad, von meinen Brüdern Malachy, Joe und Hiram, von Rebecca und Nellie, Mary-Jane, John White Horse und von Nicholas Walker. Erst jetzt merkte ich, wie sehr ich mich danach sehnte, sie alle wiederzusehen. Es war schon weit nach Mitternacht, als es nichts mehr zu reden gab. Ich würde Rockbridge verlassen, das wussten wir beide. Paul blieb bei mir in dieser Nacht. Eng aneinandergeschmiegt lagen wir in dem schmalen Krankenhausbett und Paul schlief irgendwann ein. Während ich seinen gleichmäßigen Atemzügen lauschte, schweiften meine Gedanken dreizehnhundert Meilen nach Westen. Nach Hause! Wie würde es sein, auf die Farm zurückzukehren? War ich dort überhaupt noch willkommen, nachdem ich mich vier Jahre lang nicht hatte blicken lassen und seit November gar nicht mehr gemeldet hatte? Ich stieß einen tiefen Seufzer aus. Es spielte keine Rolle, ob ich willkommen war oder nicht, und in Wirklichkeit ging es auch nicht um meine Familie, sondern um Horatio. Ich musste ihn sehen, mit ihm sprechen, um mein Herz von den Fesseln, in die er es gelegt hatte, endgültig zu befreien.
In medizinischer Hinsicht sprach nichts dagegen, mich aus dem Krankenhaus zu entlassen, aber Paul drängte mich nicht, mit ihm nach Hause zu kommen. Er wusste, wie sehr mir vor einer Begegnung mit seiner Mutter, seinen Schwestern oder Freunden graute, denen wir sagen mussten, dass unsere Hochzeit nicht stattfinden würde. Seitdem die Entscheidung gefallen war, dass ich nach Hause fahren würde, wirkte Paul wieder so entspannt wie damals, als ich ihn kennengelernt hatte, und ich erkannte, dass die vergangenen Monate nicht nur für mich schwierig gewesen waren. Wahrscheinlich war es so wirklich besser für ihn, denn welcher Mann wollte schon eine Frau mit einer solchen Vergangenheit, wie ich sie hatte? Dabei hatte ich ihm noch längst nicht alles erzählt, und das war auch besser so.
Vor den Fenstern war es schon dunkel, das Abendessen war längst gebracht und wieder abgeholt worden, als es an der Tür meines Krankenzimmers klopfte.
»Ja?«, rief ich.
Die Tür ging auf. Ein Mann betrat das Zimmer und blieb im Halbdunkel stehen. Das helle Licht im Flur bewirkte, dass sein Gesicht im Schatten lag und ich erkannte ihn zuerst nicht. Doch dann schloss er die Tür hinter sich, und ich sah die enge verwaschene Jeans, Cowboystiefel und eine abgenutzte Lederjacke. Ich richtete mich auf und starrte den Mann ungläubig an. Er erwiderte meinen Blick aus ungewöhnlich hellblauen Augen. Ein Dreitagebart bedeckte Kinn und Wangen seines hageren, scharf geschnittenen Gesichts. Von der Schläfe zog sich eine schmale weiße Narbe über seine rechte Wange bis zur Oberlippe. Träumte ich?
»Hey, Sheridan«, sagte der Mann nun.
»Nicholas!«, hauchte ich fassungslos.
»Wie mir scheint, spielen sich unsere großen Momente immer in Krankenhäusern ab«, sagte Nicholas Walker lächelnd.
Ich schleuderte die Bettdecke zur Seite, sprang aus dem Bett und flog in seine ausgebreiteten Arme. Er hielt mich fest an sich gedrückt und ich weinte vor Glück und Freude. Seitdem sich Nicholas an einem Januartag vor fünf Jahren in einem anderen Krankenzimmer von mir verabschiedet hatte und aus meinem Leben verschwunden war, hatte ich von diesem Augenblick geträumt. Es hatte Zeiten gegeben, in denen ich nicht geglaubt hatte, dass ich diesen Mann, der in den dunkelsten Stunden meines Lebens für mich da gewesen war, jemals wiedersehen würde. Umso überwältigender war es nun für mich, dass er hier war, in diesem Zimmer, wirklich und leibhaftig. Als meine erste überschwängliche Wiedersehensfreude abgeflaut war, setzten wir uns auf die Kante meines Bettes, hielten einander an den Händen und sahen uns an. In Nicholas’ Blick lagen Wärme und Zuneigung, und ich fühlte mich allein durch seine Anwesenheit zum ersten Mal seit Ewigkeiten geborgen und sicher.
»Ich hab dich ganz schön vermisst, Sheridan.« Nicholas ließ meine Hand los und strich mir sanft über die Wange.
»Ich dich auch«, flüsterte ich. Erst jetzt wurde mir bewusst, welchen Anblick ich bieten musste: bleich, abgemagert, mit strähnigem, ungewaschenem Haar. »Entschuldigung. Ich sehe sicher furchtbar aus.«
»Stimmt nicht«, widersprach er mir. »Du bist wunderschön.«
Ich wandte verlegen den Blick ab.
»Wieso bist du hier?«, wollte ich wissen.
»Mary-Jane meinte vorgestern beim Frühstück, dass du nach Hause kommen wirst«, erwiderte er und lächelte. »Du weißt ja, wie sie ist.«
»Ja.« Ich nickte. »Das weiß ich.«
Nicholas’ Mutter Mary-Jane, zur Hälfte eine Sioux vom Stamm der Oglala, besaß hellseherische Fähigkeiten. Manchmal erwähnte sie beiläufig irgendetwas, was dann wenig später eintraf.