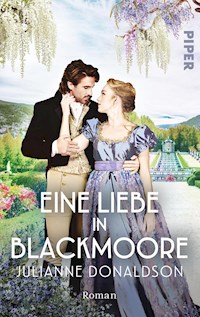5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper Schicksalsvoll
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein romantischer Regency-Roman, um eine Heldin, die der Liebe über Umwege begegnet. Für alle LeserInnen, die nicht genug von viktorianischen Romanzen à la »Bridgerton« kriegen können»Ich sah ihr in die Augen und entdeckte darin mehr Kraft, Nervenstärke und Moral als je bei einer anderen Frau. Eine Falle schloss sich um mein Herz und in diesem Augenblick war ich hilflos.«Marianne Daventry würde alles dafür geben, der Langweile in Bath zu entkommen, wo ein lästiger Verehrer immer wieder versucht, sie für sich zu gewinnen. Deswegen zögert sie nicht, als sie eines Tages eine Einladung von ihrer Zwillingsschwester Cecily erhält, sie auf dem großen Landsitz Edenbrooke zu besuchen. Marianne hofft, dort in aller Ruhe entspannen und die schöne Landschaft erkunden zu können, während ihre Schwester damit beschäftigt ist, den attraktiven Erben von Edenbrooke zu umwerben – doch spätestens, als sie dem sehr unfreundlichen, aber sehr gut aussehenden Sir Philip in die Arme läuft, wird Marianne allmählich klar, dass man manche Dinge einfach nicht planen kann. Denn der geheimnisvolle Mann wird nicht nur ihr Herz in Aufruhr versetzen, sondern auch ihr ganzes Leben durcheinanderwirbeln ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Sammlungen
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher: www.piper.de
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Sommer in Edenbrooke« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.
Dieses E-Book beinhaltet auch die Novelle »Der Erbe von Edenbrooke«Übersetzung aus dem Englischen von Heidi Lichtblau© Julianne Donaldson 2012
Die englische Originalausgabe erschien 2012 unter dem Titel »Edenbrooke« bei Shadow Mountain, Salt Lake City, UtahDeutschsprachige Ausgabe:© Piper Verlag GmbH, München 2017, 2021
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Covergestaltung: Alexa Kim "A&K Buchcover"
Covermotiv: Period Images und Shutterstock.com
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich der Piper Verlag die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Cover & Impressum
Widmung
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
Der Erbe von Edenbrooke
Spanien
Edenbrooke
London
Danksagung
Julianne Donaldson – Fragen und Antworten
Für Seelenverwandte all überall
1. Kapitel
Bath, England, 1816
Letztlich war es die Eiche, durch die ich gedanklich auf Abwege geriet. Denn während ich unter ihrer ausladenden, grünen Baumkrone entlangschritt, sah ich zufällig empor. Der Wind fuhr in ihre Blätter und ließ sie auf ihren Stielen herumwirbeln, und da ging mir jäh auf, wie lange ich selbst nicht mehr vor Freude herumgewirbelt war. Ich blieb stehen und sann darüber nach, wann mir das letzte Mal auch nur im Geringsten danach zumute gewesen war.
Just in diesem Augenblick pirschte sich Mr Whittles heran.
»Miss Daventry! Was für eine unerwartete Freude!«
Erschrocken fuhr ich zusammen und sah mich verzweifelt nach Tante Amelia um, die auf dem Kiesweg weitergegangen sein musste, während ich im Schatten des Baumes verweilt hatte.
»Mr Whittles! Ich … ich habe Sie gar nicht kommen hören.« Gewöhnlich horchte ich immer mit zumindest einem Ohr, ob er mir nachstellte. Doch die Eiche hatte mich vollkommen in Anspruch genommen.
Er strahlte mich an und verbeugte sich so tief, dass sein Korsett knarzte. Mein Blick fiel auf sein schütteres Haar, das er sich mit Pomade über den Schädel drapiert hatte, und auf sein breites, schweißglänzendes Gesicht. Dieser Mann war mindestens doppelt so alt wie ich und von unerträglicher Lächerlichkeit. Aber keine von all seinen abstoßenden Eigenschaften löste ein solch fasziniertes Entsetzen in mir aus wie sein Mund. Wenn er sprach, flatterten seine Lippen derart, dass sich darauf ein Speichelfilm bildete, der sich sodann in seinen Mundwinkeln sammelte. Ich bemühte mich, diese Stelle nicht ungebührlich anzustarren.
»Ein prachtvoller Morgen, nicht wahr? Eigentlich fühle ich mich sogar bewogen zu sagen: ›Oh, welch prachtvoller Morgen, oh, welch prachtvoller Tag, und welch prachtvolle Lady habe ich vor mir, ganz ohne Frag!‹« Er verbeugte sich, als würde er Applaus erwarten. »Aber heute kann ich mit etwas Besserem als diesem Verslein aufwarten. Ich habe ein neues Gedicht geschrieben, eigens für Sie.«
Ich ging einen Schritt in die Richtung, in der ich Tante Amelia vermutete. »Meine Tante wäre entzückt, sich Ihr Gedicht anhören zu dürfen, Mr Whittles. Sie ist uns bestimmt nur ein paar Schritte voraus.«
»Aber Miss Daventry, ich hoffte doch, Sie mit meiner Dichtung zu erfreuen.« Er bewegte sich immer weiter auf mich zu. »Die Verse gefallen Ihnen doch, nicht wahr?«
Für den Fall, dass er meine Hand ergreifen wollte, verbarg ich sie hinter meinem Rücken. Eine unerfreuliche Erfahrung dieser Art reichte vollauf. »Ich fürchte, ich habe nicht dasselbe Verständnis für Dichtung wie meine Tante …« Ich sah mich um und atmete beim Anblick von Tante Amelia erleichtert auf, die auf der Suche nach mir den Weg entlangeilte. Meine unverheiratete Tante war eine ausgezeichnete Anstandsdame – eine Tatsache, die ich bis zu diesem Augenblick nie so recht zu schätzen gewusst hatte.
»Marianne! Da bist du ja! Ach, Mr Whittles, aus der Ferne habe ich Sie gar nicht erkannt. Wissen Sie, mein schlechtes Augenlicht …« Sie lächelte ihn glückstrahlend an. »Wollen Sie ein weiteres Gedicht zum Besten geben? Ich schätze Ihre Dichtung wirklich sehr. Sie sind so überaus wortgewandt!«
Meine Tante war das perfekte Gegenstück zu Mr Whittles. Durch ihr schlechtes Sehvermögen wurde die abstoßende Natur seiner Gesichtszüge abgemildert. Und da sie mehr Haare hatte als Verstand, entsetzten sie seine Abgeschmacktheiten im Gegensatz zu mir nicht. Tatsächlich hatte ich schon seit einiger Zeit versucht, Mr Whittles’ Aufmerksamkeit von mir auf sie umzulenken, wenn auch bislang vergebens.
»Ein neues Gedicht habe ich tatsächlich.« Er zog ein Schriftstück aus seiner Rocktasche, strich zärtlich darüber und leckte sich die Lippen. Dabei blieb ein großer Speicheltropfen an der Unterlippe hängen. Unwillkürlich starrte ich darauf. Als Mr Whittles zu lesen anfing, wackelte der Tropfen, fiel aber nicht ab.
»Gar schmuck ist Miss Daventry anzuschaun, die Augenfarbe ziert sie sehr! Nicht ganz grün, durchaus nicht braun, sind sie vom Tone wie das Meer, äh, und sie sind rund.«
Ich riss meinen Blick von dem zitternden Speicheltropfen los. »Was für eine entzückende Idee – vom Ton des Meeres! Allerdings wirken meine Augen oft eher grau als blau. Daher würde mir ein Gedicht zusagen, in dem meine Augen grau sind.« Ich lächelte unschuldig.
»J-ja, natürlich. Ich habe mir selbst schon viele Male gedacht, dass Ihre Augen eher grau wirken.« Er legte seine Stirn in Falten. »Ah, ich hab’s!«, rief er. »Ich werde sagen, dass sie den Ton eines stürmischen Meeres haben, da ein stürmisches Meer oft grau wirkt, wie Sie wissen. Das lässt sich leicht abändern, und ich muss das Gedicht deswegen nicht völlig umschreiben wie die letzten fünf Male.«
»Wie klug von Ihnen«, murmelte ich.
»Allerdings!«, bekräftigte Tante Amelia.
»Es geht noch weiter: Gar schmuck ist Miss Daventry anzuschaun, das gilt durchaus auch für ihr Haar! Von einem warmen, goldnen Braun, schimmert’s im Kerzenschein gar wunderbar.«
»Bravo!«, lobte ich ihn. »Nur war mir bisher nicht bewusst, dass meine Haare einen goldenen Braunton haben.« Ich sah zu meiner Tante. »Ist dir dieser Gedanke schon einmal gekommen, Tante Amelia?«
Sie legte den Kopf schräg. »Nein. Noch nie.«
»Sehen Sie? Verzeihen Sie, dass ich Ihre Meinung nicht teile, Mr Whittles, aber ich möchte Sie gern zu Bestleistungen anspornen.«
Er nickte. »Fanden Sie es besser, als ich die Farbe Ihres Haares mit der meines Pferdes verglichen habe?«
»Ja«, seufzte ich. »Das war unendlich viel besser.« Allmählich hatte ich von meinem Spielchen genug. »Vielleicht sollten Sie sich schnurstracks auf den Heimweg begeben und das Gedicht umschreiben.«
Meine Tante hob einen Finger. »Aber ich habe schon oft gedacht, dass deine Haare dieselbe Farbe wie Honig haben.«
»Honig! Ja, das trifft es genau.« Mr Whittles räusperte sich. »Von einem warmen Honigbraun, schimmert’s im Kerzenschein gar wunderbar.« Sein Grinsen lenkte meine Aufmerksamkeit wieder auf seinen feuchten Mund.
Ich schluckte krampfartig. Wie in aller Welt konnte eine einzelne Person so viel Speichel erzeugen?
»Nun ist es perfekt. Am Freitag werde ich es auf der Dinnerparty der Smith’ vortragen.«
Mich schauderte. »Oh, Mr Whittles, das würde die Sache gänzlich verderben. Als Herzensangelegenheit behält man ein so schönes Gedicht doch für sich!« Ich griff nach dem Schriftstück. »Dürfte ich es bitte haben?« Nach kurzem Zögern reichte er es mir. »Vielen Dank!« Die Worte kamen aus tiefstem Herzen.
Nun erkundigte sich Tante Amelia nach dem Befinden seiner Mutter. Sobald Mr Whittles sich an die Schilderung der schwärenden Wunde am Fuß seiner Mutter machte, drehte sich mir der Magen um. Wie abstoßend! Um mich abzulenken, entfernte ich mich ein Stück von den beiden und sah in die Krone der Eiche hinauf, die schon zuvor meine Aufmerksamkeit erregt hatte.
Es war ein herrlicher Baum, und mich packte eine frische Sehnsucht nach dem Land. Noch immer wirbelten die Blätter im Wind, und ich stellte mir die Frage, die mich vorhin hatte innehalten lassen: Wannwar ich denn das letzte Mal richtig herumgewirbelt?
Einst war das Herumwirbeln eine Gewohnheit von mir gewesen, auch wenn Großmutter es als eine schlechte Angewohnheit bezeichnet hätte. Das wilde Herumwirbeln hatte sich zu meinen anderen schlechten Neigungen gesellt, wie stundenlang mit einem Buch im Obstgarten zu sitzen oder auf dem Rücken meiner Stute durch die Landschaft zu streifen.
Es musste über vierzehn Monate her sein, seit ich das letzte Mal vor Freude herumgewirbelt war. Vor vierzehn Monaten hatte ich, noch in unmittelbarer Trauer, mein Zuhause verlassen müssen. Ich war an der Türschwelle meiner Großmutter in Bath abgesetzt worden, während sich mein Vater für seine eigene Art der Trauerbewältigung nach Frankreich aufgemacht hatte.
Vierzehn Monate – das waren zwei Monate länger, als ich anfänglich befürchtet hatte, in dieser stickigen Stadt bleiben zu müssen. Ich hatte gehofft, ein Jahr der getrennten Trauer sei Strafe genug, auch wenn man mir nie einen Anlass zu dieser Annahme gegeben hatte. Daher hatte ich vor zwei Monaten, als sich der Todestag meiner Mutter zum ersten Mal jährte, den ganzen Tag die Rückkehr meines Vaters erwartet. Immer und immer wieder hatte ich mir vorgestellt, wie ich sein Klopfen an der Tür vernehmen und mein Herz vor Freude hüpfen würde. Ich hatte mir ausgemalt, wie ich zur Tür laufen und sie aufreißen würde. Hatte schon vor mir gesehen, wie Vater mir mit einem Lächeln verkünden würde, dass er gekommen sei, um mich wieder mit nach Hause zu nehmen.
Und doch war er an jenem Tag vor zwei Monaten nicht erschienen. Ich hatte die Nacht bei Kerzenschein aufrecht sitzend in meinem Bett verbracht und auf das Klopfen an der Tür gewartet, das mich aus meinem goldenen Käfig befreien würde. Doch der Morgen dämmerte, und noch immer war nichts dergleichen geschehen.
Seufzend sah ich wieder zu den im Wind tanzenden grünen Blättern empor. Schon seit geraumer Zeit hatte ich keinen Grund mehr zum Herumwirbeln gehabt – und das im Alter von siebzehn! Das war in der Tat ein Problem.
»Es sickert«, forderte Mr Whittles meine Aufmerksamkeit zurück. »Es sickert richtiggehend heraus.«
Tante Amelia, die ein bisschen grün um die Nase wirkte, hielt sich die behandschuhte Hand vor den Mund. Ich beschloss einzuschreiten. »Meine Großmutter wartet. Bitte entschuldigen Sie uns.«
»Selbstverständlich.« Wieder verbeugte er sich unter dem unvermeidlichen Knarzen des Korsetts. »Ich hoffe auf ein baldiges Wiedersehen, Miss Daventry. Vielleicht in der Wandelhalle?«
Natürlich schlug er ausgerechnet den gesellschaftlichen Mittelpunkt von Bath für eine weitere »zufällige« Begegnung vor. Wie gut er meine Gewohnheiten doch kannte! Ich lächelte höflich und machte mir im Geiste eine Notiz, mindestens eine Woche lang keinesfalls in der Wandelhalle Tee zu trinken. Dann zog ich Tante Amelia zu der ausgedehnten grünen Rasenfläche, die den Kiesweg vom Royal Crescent trennte. Das aus buttergelben Steinen errichtete Gebäude beschrieb – gleich einem Paar ausgestreckter Arme – einen anmutigen Halbkreis. Großmutters Wohnung innerhalb des Royal Crescent befand sich unter den schönsten, die Bath zu bieten hatte. Doch Luxus machte die Tatsache nicht wett, dass man in Bath städtischem Leben der übelsten Art ausgesetzt war. Ich vermisste das Landleben so sehr, dass ich mich Tag und Nacht danach verzehrte.
Ich entdeckte Großmutter in ihrem Salon, wo sie auf ihrem Sessel thronte und einen Brief las. Noch immer trug sie Trauer. Bei meinem Eintreten sah sie auf und beäugte mich kritisch von Kopf bis Fuß. Ihren scharfen, grauen Augen entging nichts.
»Wo warst du den ganzen Vormittag? Bist du wieder wie eine dahergelaufene Bauerngöre auf dem Land herumgestrolcht?«
Als ich diese Frage zum ersten Mal vernahm, hatten mir die Knie geschlottert. Nun lächelte ich in dem Wissen, dass es sich dabei um ein Spielchen handelte: Großmutter genoss es einfach, sich mindestens einmal am Tag einen guten Schlagabtausch mit mir zu liefern. Zudem war mir klar, wenngleich ich ihr das niemals vorgehalten hätte, dass ihre raue Schale das verbarg, was sie als größte aller Schwächen betrachtete – einen weichen Kern.
»Nein, Großmutter, das tue ich nur an ungeraden Tagen. Die geraden verbringe ich damit, das Melken zu lernen.« Ich beugte mich zu ihr hinunter und drückte ihr einen Kuss auf die Stirn. Einen Augenblick hielt sie mich am Arm fest. Für ihre Verhältnisse ein Ausdruck höchster Zuneigung.
»Ich schätze, du hältst dich für amüsant«, bemerkte sie.
»Eigentlich nicht. Um eine Kuh melken zu können, bedarf es fleißiger Übung. Derzeit betrachte ich mich noch als blutige Anfängerin.«
Ich sah, dass es um ihre Mundwinkel zuckte, was bedeutete, dass sie ein Lächeln zu verbergen suchte. Sie zupfte an ihrem spitzenbesetzten Schultertuch und bedeutete mir, mich auf den Sessel neben sie zu setzen.
Ich spähte zum Briefstapel auf dem Beistelltisch. »Habe ich heute Post bekommen?«
»Solltest du dich nach einem Brief von deinem gedankenlosen Vater erkundigen, dann leider nein.«
Um meine Enttäuschung zu verbergen, wandte ich den Blick ab. »Vermutlich reist er gerade umher und hat keine Gelegenheit zu schreiben.«
»Oder vielleicht hat er während seines egoistischen Trauerns seine Kinder vergessen«, murmelte sie. »Und überträgt seine Aufgaben an eine Person, die nie darum gebeten hat, schon gar nicht in ihrem hohen Alter.«
Ich zuckte zusammen. Manche von Großmutters spitzen Bemerkungen trafen mehr als andere. Gerade hatte sie ein besonders schmerzliches Thema angeschnitten, da ich mich nur ungern als Last betrachtete. Doch ich kam nun mal nirgendwo anders unter.
»Möchtest du, dass ich bei dir ausziehe?«, kam ich nicht umhin zu fragen.
Großmutter sah mich finster an. »Jetzt stell dich nicht dümmer, als du bist! In dieser Hinsicht bin ich mit Amelia weiß Gott schon genug geschlagen.« Sie faltete den Brief zusammen, den sie gerade gelesen hatte. »Mir sind weitere schlechte Nachrichten von meinem Neffen zu Ohren gekommen.«
Ah, der Ruchlose Neffe! Das hätte ich mir denken können. Nichts versetzte meine Großmutter mit solcher Gewissheit in schlechte Laune, wie von dem letzten Skandal zu hören, in den ihr Erbe, Mr Kellet, verwickelt war. Er war ein Schwerenöter und Schurke, der all sein Geld verspielt hatte und nun darauf wartete, an das ansehnliche Vermögen seiner Tante zu gelangen.
Meine Zwillingsschwester Cecily hielt ihn für fesch und romantisch, ich hingegen fand ihn alles andere als das. Einer der vielen Punkte, in denen sie und ich verschiedener Meinung waren.
»Was hat Mr Kellet denn diesmal angestellt?«
»Nichts, was für deine unschuldigen Ohren bestimmt wäre.« Sie seufzte und fuhr dann in sanfterem Ton fort: »Marianne, ich glaube, ich habe einen Fehler begangen. Er rennt ins Verderben. Der Schaden, den er dem Namen der Familie damit zufügt, ist beträchtlich und nicht wiedergutzumachen.« Sie hob eine zitternde Hand an ihre Stirn. Plötzlich wirkte sie gebrechlich und matt.
Ich starrte sie überrascht an. Nie zuvor hatte Großmutter mir gegenüber solch eine Verletzlichkeit an den Tag gelegt. Das sah ihr überhaupt nicht ähnlich. Ich beugte mich zu ihr und ergriff ihre Hand. »Großmutter? Fühlst du dich nicht gut? Kann ich dir irgendetwas bringen?«
Sie schüttelte meine Hand ab. »Kind, hör auf, mich so zu beglucken. Du weißt, dass ich das nicht ausstehen kann. Ich bin einfach müde.«
Ich verkniff mir ein Lächeln. Wenn sie in dieser Weise reagierte, konnte es ihr so schlecht nicht gehen. Normalerweise sah sie über Mr Kellets schlechtes Benehmen hinweg und rief sich ins Gedächtnis, warum er immer einer ihrer Lieblinge gewesen war. (Vermutlich mochte sie ihn, weil er keine Angst vor ihr hatte.) Doch ich hatte sie bisher weder so besorgt noch so niedergeschlagen erlebt wie jetzt.
Großmutter deutete auf den Briefstapel. »Dort befindet sich ein Brief an dich. Aus London. Lies ihn dir durch und lass mich ein paar Minuten allein.«
Ich nahm den Brief, ging ans Fenster und ließ das Sonnenlicht auf die vertraute Handschrift fallen. Mich hatte Papa nach Bath gebracht, doch für meine Zwillingsschwester Cecily hatte er eine noch besser geeignete Unterkunft aufgetan: Sie hatte die vergangenen vierzehn Monate bei unserer Cousine Edith in London verbracht und schien jede Sekunde dort zu genießen.
Cecily und ich waren dafür, dass wir Zwillinge waren, bemerkenswert unterschiedlich. Sie übertraf mich in sämtlichen weiblichen Fertigkeiten. Sie war viel schöner und kultivierter. Sie spielte auf dem Pianoforte und sang engelsgleich. Mit einem Gentleman konnte sie mühelos flirten. Ihr gefiel das Stadtleben, und sie träumte davon, einen Mann mit einem Titel zu heiraten. Sie war ehrgeizig.
Mir stand der Sinn nach ganz anderen Dingen. Ich wollte auf dem Land leben, auf meinem Pferd ausreiten, in einem Obstgarten sitzen und malen, mich um meinen Vater kümmern, das Gefühl haben, irgendwo dazuzugehören und mit meiner Zeit etwas Nützliches und Gutes anzustellen. Im Vergleich zu Cecilys Träumen wirkten meine bieder und langweilig. Mitunter befürchtete ich, dass ich selbst neben Cecily auch beschränkt und langweilig wirken könnte.
In letzter Zeit hatte Cecily von nichts anderem mehr geschrieben als von ihrer liebsten Freundin Louisa Wyndham und deren gut aussehendem adeligem Bruder, den Cecily fest entschlossen war zu heiraten. Seinen Namen hatte Cecily nie genannt – in ihren Briefen hieß er schlicht »der Bruder«.
Vermutlich befürchtete sie, ihre Zeilen könnten von jemand weniger Diskretem als mir gelesen werden. Vielleicht hatte sie dabei meine Zofe Betsy im Hinterkopf. In der Tat war mir noch nie eine so unverbesserliche Plaudertasche begegnet wie sie.
Das hatte ich Cecily gar nicht erzählt, aber kürzlich hatte ich Betsy nach dem Namen des ältesten Wyndham-Sohnes gefragt, und sie hatte herausgefunden, dass es sich dabei um einen gewissen Charles handelte. Sir Charles und Lady Cecily – wenn das nicht gut klang! Natürlich verstand es sich von selbst, dass Cecily, wenn sie sich denn zu einer Heirat mit ihm entschloss, ihren Entschluss auch in die Tat umsetzen würde. Bislang hatte sie noch alles erreicht, was sie sich in den Kopf setzte.
Ehe ich das Briefsiegel erbrach, schickte ich mit geschlossenen Augen einen stummen Wunsch gen Himmel: Bitte mach, dass sie sich nicht wieder in einem fort über die liebe Louisa und ihren gut aussehenden Bruder auslässt! Gegen die Wyndhams an sich hatte ich nichts einzuwenden – schließlich waren unsere Mütter als Kinder Busenfreundinnen gewesen, und ich konnte mich genauso auf diese Bekanntschaft berufen wie Cecily –, aber ich hatte von meiner Schwester in den vergangenen zwei Monaten kaum etwas anderes zu hören bekommen und fragte mich allmählich, ob ihr die Wyndhams nicht wichtiger waren als ich. Ich öffnete den Brief und las.
Liebste Marianne,
es tut mir so leid, dass Dir Bath wie ein Gefängnis vorkommt. Nachdem ich London so liebe, kann ich dieses Gefühl gar nicht recht nachvollziehen. Vielleicht schlägt von uns Zwillingen mein Herz ja ganz und gar für das Urbane und Deines für die Natur. In dieser Hinsicht wurden wir ungleich bedacht, nicht wahr?
(Als Deine Schwester kann ich Dir, nebenbei bemerkt, verzeihen, dass Du Dinge schreibst wie: »Mir ist es lieber, wenn mein Haupt von Sonnenschein, Wind und Himmel geschmückt wird, denn von einer hübschen Haube.« Aber ich flehe Dich an, solche Dinge bitte nicht gegenüber anderen zu äußern. Ich fürchte, es würde sie ziemlich schockieren.)
Da ich Deinen gegenwärtigen Kummer kenne, werde ich Dich nicht mit alldem behelligen, was ich in der vergangenen Woche getrieben habe. Nur eines sei gesagt: Meine erste Saison in London ist genauso amüsant, wie ich es mir erhofft hatte. Aber ich stelle Deine Geduld heute nicht auf die Probe, indem ich diesen Punkt weiter ausführe, denn womöglich würdest Du in der Folge diesen Brief zerreißen, ehe Du die wichtige Neuigkeit liest, die ich Dir sende.
Meine liebste Freundin Louisa Wyndham hat mich eingeladen, sie auf ihrem Landsitz zu besuchen. Wenn ich es recht verstehe, ist er sehr herrschaftlich, nennt sich Edenbrooke und liegt in Kent. In zwei Wochen brechen wir dorthin auf. Doch nun kommt das Wichtigste: Du bist ebenfalls eingeladen! Lady Caroline hat die Einladung nämlich auf Dich ausgeweitet, da wir beide Töchter der »liebsten Freundin« ihrer Kindheit sind.
Oh, sag bitte, dass Du kommst! Wir werden die herrlichste Zeit haben, die man sich vorstellen kann. Möglicherweise werde ich sogar Deine Unterstützung in meinem Bestreben brauchen, »Lady Cecily« zu werden (klingt das nicht großartig?), denn natürlich wird auch der Bruder anwesend sein – meine Chance, ihn mir zu angeln! Außerdem bekommst Du auf diese Weise die Gelegenheit, meine zukünftige Familie kennenzulernen.
Hingebungsvoll
Cecily
Das Gefühl der Hoffnung erfasste mich mit solcher Wucht, dass mir die Luft wegblieb. Ich würde wieder auf dem Land sein! Und damit Bath und seinen grauenvollen Einschränkungen entfliehen! Und ich würde nach der langen Trennung wieder mit meiner Schwester zusammen sein! Es war zu viel, um alles in mich aufzunehmen. Ich las den Brief abermals durch, bedächtiger diesmal, und kostete dabei jedes Wort aus. Eigentlich benötigte Cecily gar nicht meine Hilfe, um Sir Charles’ Zuneigung zu gewinnen. Ich vermochte ihr nichts anzubieten, was sie selbst nicht besser machen konnte, wenn es darum ging, jemandes Gunst zu gewinnen. Dieser Brief war jedoch ein Beweis, dass ich ihr immer noch wichtig war – und dass sie mich nicht vergessen hatte. Oh, was für eine Schwester! Vielleicht waren nun alle meine Probleme gelöst. Und es gab womöglich einen Grund, wieder herumzuwirbeln.
»Nun? Was schreibt deine Schwester?«, erkundigte sich Großmutter.
Ich wandte mich freudig zu ihr um. »Sie hat mich eingeladen, zusammen mit ihr auf den Landsitz der Wyndhams in Kent zu reisen. In zwei Wochen verlässt sie London.«
Großmutter schürzte die runzligen Lippen, sah mich forschend an, schwieg jedoch. Mir wurde bang zumute. Sie würde sich doch nicht etwa weigern, mich reisen zu lassen? Nicht, wenn sie wusste, wie viel es mir bedeutete?
Ich drückte den Brief an meine Brust, und mein Herz schnürte sich bei dem Gedanken zusammen, mir würde dieses unerwartete Geschenk Gottes verwehrt werden. »Wirst du mir deine Erlaubnis geben?«
Sie sah auf den Brief, den sie noch immer in Händen hielt – denjenigen, der die schlechte Neuigkeit über Mr Kellet enthielt. Dann warf sie ihn auf den Tisch und richtete sich auf ihrem Sessel gerade auf.
»Du darfst hinfahren, doch nur unter einer Bedingung. Du musst deine wilden Gewohnheiten ablegen. Jetzt ist Schluss damit, den ganzen Tag im Freien herumzustreunen! Du musst lernen, dich wie eine elegante junge Dame zu benehmen. Nimm Unterricht bei deiner Schwester. Sie weiß, wie man sich in der Gesellschaft zu verhalten hat. Ich kann nicht zulassen, dass sich meine Erbin wie ein wildes Kind benimmt. Ich möchte durch dich nicht in Verlegenheit gebracht werden, wie mein Neffe es getan hat.«
Ich starrte sie mit großen Augen an. Ihre Erbin? »Wie meinst du das?«
»Genau so, wie du denkst, dass ich es meine. Ich enterbe Mr Kellet und lasse stattdessen dir den Großteil meines Vermögens zuteilwerden. Derzeit beläuft sich dein Anteil auf etwa vierzigtausend Pfund.«
2. Kapitel
Ich wusste, mir stand der Mund offen, doch ich fand nicht die Kraft, ihn zuzuklappen. Vierzigtausend Pfund! Wer hätte gedacht, dass Großmutter so wohlhabend war?
»Du wirst zwar kein Anwesen erben«, fuhr sie fort, »doch hoffe ich, du heiratest in eine Familie mit Grundbesitz. Das Mindeste, was du mit meinem Vermögen tun könntest, wäre, dich um eine großartige Partie zu kümmern.« Sie stand auf und ging zu ihrem Schreibtisch. »Ich kenne die Wyndhams. Ich werde Lady Caroline persönlich schreiben und ihre Einladung in deinem Namen annehmen. Zwei Wochen werden uns gerade genug Zeit geben, um dir neue Kleider schneidern zu lassen. Wir müssen unverzüglich mit den Vorbereitungen beginnen.«
Sie nahm an ihrem Schreibtisch Platz und zog einen Bogen Papier zu sich her. Ich stand da wie angewurzelt. Aus heiterem Himmel hatte sich mein Leben grundlegend geändert.
Sie blickte auf. »Nun? Was hast du zu sagen?«
Ich schluckte. »Ich … Ich weiß nicht, was ich sagen soll.«
»Zunächst mal könntest du dich bedanken.«
Ich lächelte schwach. »Natürlich bin ich dir dankbar, Großmutter, ich bin nur vollkommen … überwältigt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich einer solchen Verantwortung gerecht werde.«
»Genau das bezweckt dieser Besuch in Edenbrooke – dich darauf vorzubereiten. Die Wyndhams sind eine äußerst angesehene Familie. Du könntest durch das Beisammensein mit ihnen viel lernen. Genau genommen ist das sogar meine Auflage. Ich möchte, dass eine anständige junge Dame aus dir wird, Marianne. Während deines Aufenthalts dort wirst du mir schreiben und mir erzählen, was du lernst, andernfalls rufe ich dich wieder hierher und unterrichte dich selbst.«
Meine Gedanken überschlugen sich so heftig, dass es mir nicht gelingen wollte, einen davon zu packen und zu begreifen.
»Du wirkst blass«, sagte Großmutter. »Geh hoch und leg dich hin. Du wirst dein Gleichgewicht bald wiederfinden. Gegenüber deiner Zofe verlierst du bitte kein Wort über diese Erbschaft. Das ist nichts, was andere zu diesem Zeitpunkt erfahren sollten. Wenn du schon einen Einfaltspinsel wie Mr Whittles nicht fortschicken kannst, dann wirst du anderen, gewitzteren Männern, die hinter deinem Vermögen her sind, hilflos ausgeliefert sein. Überlass mir die Entscheidung, wann wir diese Neuigkeit bekannt geben. Meinen Neffen muss ich darüber ja auch noch in Kenntnis setzen.«
Ich schüttelte den Kopf. »Natürlich werde ich niemandem davon erzählen.« Ich kaute auf meiner Unterlippe. »Aber was ist mit Tante Amelia? Und mit Cecily?«
Großmutter machte eine wegwerfende Handbewegung. »Amelias Anteil hat mit deinem nichts zu tun. Mach dir um sie keine Sorgen. Und Cecily braucht kein Vermögen, um eine gute Partie zu machen – du hingegen schon.«
Hatte nur Mitleid meine Großmutter veranlasst, mir einen so großen Teil vom Erbe zugutekommen zu lassen? Dachte sie, ich würde sonst nicht unter die Haube kommen? Eigentlich hätte mich diese Erkenntnis peinlich berühren müssen, doch ließ sie mich seltsam kalt, als wäre eine wichtige Verbindung zwischen meinem Verstand und meinem Herzen gekappt worden. Langsam ging ich auf die Tür zu. Vielleicht musste ich mich ja tatsächlich ein Weilchen hinlegen.
Beim Öffnen der Tür wäre ich um ein Haar mit Mr Whittles zusammengestoßen. Er musste sich an die Tür gelehnt haben, denn nun stolperte er, aus dem Gleichgewicht gebracht, ins Zimmer.
»Verzeihen Sie bitte!«, rief er aus.
»Mr Whittles!« Rasch wich ich zurück, um jeglichen Körperkontakt mit ihm zu vermeiden.
»Ich … ich bin wegen meines Gedichts zurückgekehrt. Damit ich die von Ihnen vorgeschlagenen Änderungen vornehmen kann.«
Ich sah an ihm vorbei und entdeckte Tante Amelia, die im Korridor wartete. Zumindest erklärte das seine Anwesenheit im Haus. Ich nahm sein Gedicht aus meiner Tasche und reichte es ihm, wobei ich sorgfältig darauf achtete, seine Hand nicht zu berühren. Er verneigte sich viermal vor mir und bewegte sich dann rückwärts aus dem Raum und den Gang entlang zur Eingangstür. Was für eine Witzfigur!
Dennoch erfasste mich bei seinem Anblick ein Hochgefühl, das die eigentümliche Kluft zwischen meinem Verstand und meinem Herzen überbrückte. Erbschaft hin oder her, mit der würde ich mich später befassen. Zunächst einmal zählte, dass ich Bath schon bald verlassen konnte und Mr Whittles hoffentlich nie wiedersehen würde! Lächelnd wandte ich mich um und eilte die Treppe hinauf. Ich musste einen Brief schreiben.
—
Cecily schrieb ich, dass ich die Einladung annehmen würde, erwähnte die Erbschaft aber mit keinem Wort. Trotz Großmutters Versicherungen konnte ich mir nicht vorstellen, dass Cecily die Nachricht, dass sie kein Vermögen erben würde, mit derselben Gleichgültigkeit hinnähme, mit der Großmutter beschlossen hatte, ihr keines zu hinterlassen. Natürlich würde ich die vierzigtausend Pfund nicht allein für mich behalten können, wenn meine Zwillingsschwester nur mit einer kleinen Mitgift abgespeist wurde. Ich fühlte mich nicht wohl, dass wir so ungleich bedacht werden sollten.
Doch nachdem ich mir ein paar Tage darüber den Kopf zerbrochen hatte, entschied ich, dass mir künftig noch genügend Zeit zu einer Klärung mit Cecily bliebe. Schließlich wurde mir das Vermögen ja nicht sofort ausgehändigt. Großmutter war noch immer rüstig. Es konnte viele Jahre dauern, bis das Geld in meinen Besitz überging. Für meinen Teil würde ich niemandem davon erzählen, bis es tatsächlich so weit war.
Die darauffolgenden zwei Wochen vergingen in einem Nebel aus hektischen Besuchen bei Schneiderinnen und Hutmacherinnen. Eigentlich hätte ich all die Einkäufe genießen sollen, doch der Gedanke, in Edenbrooke aller Augen ausgesetzt zu sein, verwandelte meine Freude in Besorgnis. Was, wenn ich Cecily vor ihrer künftigen Familie in Verlegenheit brachte? Vielleicht würde sie es ja bedauern, mich eingeladen zu haben. Und würde ich die Schicklichkeit an den Tag legen können, die meine Großmutter von mir erwartete? Derlei Gedanken hing ich nach, bis es Zeit wurde, Bath zu verlassen.
Am Morgen meiner Abreise warf Großmutter beim Frühstück einen Blick auf mich und erklärte: »Kind, du bist eindeutig grün im Gesicht. Was ist denn nur los mit dir?«
Ich zwang mich zu einem kleinen Lächeln. »Ich bin wohlauf. Nur ein wenig aufgeregt, nehme ich an.«
»Dann isst du besser nichts. Du siehst mir nach jemandem aus, dem bei langen Kutschfahrten übel wird.«
An die Fahrt nach Bath erinnerte ich mich noch gut. Während der Reise hatte ich mich dreimal übergeben müssen, einmal davon auf meine Stiefeletten. In solch einem Zustand wollte ich gewiss nicht in einem fremden Haus erscheinen.
»Vielleicht hast du recht.« Ich schob meinen Teller weg. Appetit hatte ich sowieso keinen.
»Bevor du abreist, möchte ich dir noch etwas geben«, sagte Großmutter. Sie griff mit zitternder Hand unter ihren Spitzenschal, holte ein Medaillon hervor und reichte es mir.
Behutsam öffnete ich den Verschluss und schnappte im nächsten Augenblick nach Luft. In dem filigranen ovalen Rahmen befand sich ein Miniaturgemälde meiner Mutter. »Oh, Großmutter«, hauchte ich. »Das kenne ich ja gar nicht! Wie alt ist sie da?«
»Achtzehn. Es wurde vor der Hochzeit mit deinem Vater angefertigt.«
So hatte meine Mutter also in meinem Alter ausgesehen. Mühelos konnte ich mir den Aufruhr vorstellen, für den sie in London gesorgt hatte, denn sie war von seltener Schönheit gewesen. Es war das einzige Bild, das ich von meiner Mutter hatte, da ihre anderen Porträts noch immer in den stillen Hallen meines Elternhauses in Surrey hingen. Ich legte mir die Kette um den Hals und spürte, wie sich das Medaillon mit angenehmer Schwere an meine Haut schmiegte. Sofort legte sich meine Nervosität, und ich atmete gleichmäßiger.
Ein Dienstbote verkündete, dass die Kutsche bereitstünde. Ich stand auf, und Großmutter musterte mich noch einmal kritisch von Kopf bis Fuß, bevor sie schließlich zustimmend nickte.
»So, und nun möchte ich, dass du dich daran erinnerst, was du dem Namen deiner Familie schuldig bist. Tue nichts, was mich blamiert. Denk daran, deine Haube aufzusetzen, wenn du ins Freie gehst, sonst bekommst du Sommersprossen. Und noch etwas …« Mit todernster Miene deutete sie auf mich und wackelte mit ihrem knochigen Finger. »Bitte sing niemals vor Publikum!«
Ich kniff die Lippen zusammen und funkelte sie an. »Dieser letzte Ratschlag wäre wirklich überflüssig gewesen!«
Großmutter gluckste. »Nun, das habe ich mir schon gedacht. Wer könnte das Entsetzen vergessen, das du ausgelöst hast, als du das letzte Mal ein Lied vorgetragen hast?«
Ich merkte, wie ich beim Gedanken an diese Schmach errötete. Selbst wenn inzwischen vier Jahre vergangen waren, seitdem ich öffentlich ein Lied zum Besten gegeben hatte, verspürte ich bei der Erinnerung daran jedes Mal tiefste Beschämung.
Ich verabschiedete mich von Großmutter und Tante Amelia, da ich endlich aufbrechen wollte, doch als ich hinaustrat, rief eine vertraute Stimme nach mir. Ich schauderte. Musste ich Mr Whittles wirklich noch ein letztes Mal ertragen?
Er kam auf mich zugehastet und schwenkte ein Blatt Papier. »Ich bringe Ihnen das überarbeitete Gedicht. Sie reisen doch noch nicht sofort ab, oder?«
»Ich fürchte doch. Es heißt also Abschied nehmen, Mr Whittles.«
»Aber … aber mein Neffe trifft heute ein und hat sein Interesse daran ausgedrückt, Sie kennenzulernen. Genau genommen ist das sogar der Grund seines Besuchs.«
Ich pfiff darauf, einen Verwandten von Mr Whittles kennenzulernen. Ich wollte dieser Stadt den Rücken kehren und ihn nie wiedersehen.
»Es tut mir leid.« Ich deutete auf die Kutsche, an der ein Diener bereits den Schlag für mich öffnete. »Ich kann nicht warten.«
Er zog ein langes Gesicht, und kurz flackerte in seinen Augen tiefe Enttäuschung auf. Dann schnappte er sich meine Hand und führte sie an seine Lippen. Er drückte einen derart feuchten Kuss darauf, dass auf dem Handschuh tatsächlich ein Abdruck zurückblieb. Um zu verbergen, dass ich mich vor Ekel schüttelte, wandte ich mich von ihm ab. Ein mir fremder Kutscher nickte mir zu, als ich in die Kutsche stieg, wo Betsy – darauf wettete ich – schon mit so viel Klatsch und Tratsch auf mich wartete, dass es mindestens für eine Stunde reichen würde.
»Wo ist Großmutters Kutscher?«, fragte ich sie.
»Der liegt schon seit einer Woche mit einer Gicht darnieder, weshalb Ihre Großmutter diesen hier eingestellt hat.« Sie wies mit dem Kinn zum Kutschbock. »James heißt er.«
Eigentlich war ich ganz erleichtert zu sehen, dass während der zwölfstündigen Fahrt kein gebrechlicher alter Mann auf dem Kutschbock sitzen würde. Dieser Kutscher hier wirkte wesentlich robuster, und vermutlich würde er uns auch schneller ans Ziel bringen. Betsy kniff ihre Lippen jedoch missbilligend zusammen.
»Stimmt etwas nicht?«, erkundigte ich mich.
»Ich möchte ja nicht schlecht über Ihre Verwandten reden, Miss Marianne, aber Ihre Großmutter hätte, was diese Reise angeht, nicht so knauserig sein dürfen. Meiner Meinung nach hätte sie zu diesem Kutscher noch einen weiteren einstellen sollen.«
Ich zuckte die Achseln. In diesem Punkt konnte ich nichts tun, und solange wir unseren Bestimmungsort sicher erreichten, würde ich mich nicht beschweren. Schließlich reisten wir über Land und auf keiner der Hauptrouten, wo Gefahren vorherzusehen waren.
Während die Kutsche durch die Straßen rollte, betrachtete ich die Stadt durchs Fenster ein letztes Mal. Nun, da ich Bath verließ, konnte ich widerwillig zugeben, dass der Ort durchaus seine Reize hatte, nicht zuletzt durch all die aus demselben goldgelben Gestein der nahegelegenen Hügel errichteten Gebäude. Die Räder der Kutsche ratterten über das Kopfsteinpflaster, während wir an frühmorgendlichen Kurgästen vorbeikamen, die unterwegs waren, um das Heilwasser zu kosten.
Plötzlich lehnte sich Betsy vor. »Ist das nicht Mr Kellet?«
Tatsächlich, es war der Ruchlose Neffe, der in seiner nachlässigen und unbekümmerten Haltung an der Trinkhalle vorbeischlenderte. Als wir an ihm vorbeifuhren, sah er zufällig in unsere Richtung, und wenngleich ich den Kopf schnell zurückzog, hatte er mich offenbar schon entdeckt, denn er lüpfte den Hut und grinste in meine Richtung – seine übliche Art, mich zu begrüßen.
Zum Glück war er erst heute eingetroffen und nicht am Vortag, denn sonst wäre ich Zeuge seiner Reaktion auf Großmutters Nachricht geworden, dass sie ihn aus dem Testament gestrichen hatte. Ich war gerade noch rechtzeitig entflohen. Betsys Geplauder entkam ich allerdings nicht.
»Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie sehr ich mich auf den Besuch in Edenbrooke freue! Ich habe gehört, es soll ein so prachtvoller Landsitz sein, und ich bin froh, aus Bath rauszukommen, wen gibt’s hier denn schon, über den es sich zu unterhalten lohnte, außerdem wage ich zu behaupten, dass wir in Kent eine sagenhafte Zeit haben werden.«
Derart plapperte sie unermüdlich weiter, während wir Bath hinter uns ließen und durch hügelige Landschaften fuhren. Mit Erleichterung stellte ich fest, dass das Geheimnis meiner Erbschaft noch immer sicher war: Hätte Betsy davon gehört, hätte sie sich über nichts anderes mehr ausgelassen.
Während sie sich über den letzten Klatsch verbreitete, den sie aufgeschnappt hatte, und ihre Erwartungen, was dieses »wunderbare Abenteuer« anging, warf sie gelegentlich einen Blick auf das Polsterkissen zu ihrer Rechten. Jedes Mal, wenn sie das tat, stutzte sie kurz, was für ihre Verhältnisse so merkwürdig war, dass ich mich beiläufig fragte, warum sie sich gerade für diesen Teil der Kutsche so interessierte. Doch ich brachte nicht die Energie auf, mich danach zu erkundigen, da mir ausgesprochen flau im Magen war.
Um die Mittagszeit hielten wir bei einem Gasthaus an, doch auch hier nahm ich lieber nichts zu mir. Der nächste Abschnitt unserer Reise entfernte uns von der Hauptroute, und auch im Laufe des Nachmittags revoltierte mein Magen. Großmutters Kutsche war alt und schlecht gefedert, weshalb man jede Bodenwelle und jedes Schlagloch in der Straße zu spüren bekam.
An diesem Nachmittag wechselte das Wetter von sonnig zu verhangen, und der Himmel war so grau wie ein eiserner Kochtopfdeckel. Meine Stimmung änderte sich dementsprechend, und ein Gefühl des Unbehagens breitete sich in mir aus. Ich berührte mein Medaillon und ermahnte mich, Ruhe zu bewahren. Ein aufregendes Abenteuer stand mir bevor! Und ganz gleichgültig, wie die Wyndhams sein mochten, gab es keinen Grund zur Sorge, da ja Cecily dort sein würde. Betsys Geplapper verstummte und wich leisen Schnarchtönen, als sie auf dem Platz mir gegenüber eindöste. Ich blickte aus dem Fenster und musste wieder an Cecily denken.
Vor dem Unfall, der mir meine Mutter geraubt hatte, glich mein Leben einem Märchen, das folgendermaßen hätte beginnen können: Es waren einmal ein Mann und eine Frau, die sich seit Jahren nach einem Kind sehnten. Eines Tages wurden ihnen Zwillinge geboren. Diese Mädchen waren für sie wie Sonne und Mond.
Cecily war die Sonne und ich der Mond. Obgleich wir Zwillinge waren, ähnelten wir uns nicht mehr, als Schwestern es mitunter tun. Schon früh war klar, dass Cecily mehr als ihren gerechten Anteil an Schönheit abbekommen hatte, weshalb sie auch mehr als ihren gerechten Anteil an Aufmerksamkeit genoss. Und während ich mir bisweilen etwas mehr Licht gewünscht hätte, in dem ich leuchtend zur Geltung gekommen wäre, war ich es doch gewohnt, Cecilys Licht zu reflektieren. Ich war damit aufgewachsen, von ihr in den Schatten gestellt zu werden. Und wenn mir meine Rolle als geringeres Licht auch nicht immer schmeckte, so kam ich damit doch zumindest gut zurecht. Ich wusste, wie ich Cecily leuchten lassen konnte. Ich kannte meinen Platz in der Welt.
Doch alles, was ich über mich und meinen Platz wusste, änderte sich in dem großen Aufruhr nach dem Tod meiner Mutter von Grund auf. Nach dem Begräbnis reiste Cecily nach London. Dort hatte sie schon immer leben wollen, und Edith hieß sie mit offenen Armen willkommen. Ich hätte meinen Vater nie verlassen. Cecilys Abreise fühlte sich an wie eine Fahnenflucht.
Kurz darauf hatte mein Vater abrupt verkündet, ich würde zu meiner Großmutter nach Bath ziehen. Alle meine Einwände stießen auf taube Ohren. Er verließ das Land, reiste nach Frankreich und hielt sich seitdem dort auf. Unsere Familie war entzweigerissen. Doch ich hoffte, der Aufenthalt in Edenbrooke böte Gelegenheit, alles wieder ins rechte Lot zu bringen. Ich würde wieder mit meiner Schwester zusammen sein, und vielleicht könnten wir Papa gemeinsam zu einer Heimkehr bewegen.
Ich drückte das Medaillon fest an mein Herz, und Hoffnung keimte in mir auf. Sicher hatte das Porträt meiner Mutter magischen Einfluss darauf. Vielleicht ja auch auf meinen Magen, der sich alsbald beruhigte. Kurz darauf ließ das gleichmäßige Schwanken und Schaukeln der Kutsche auch mich wegdämmern.
Ich wusste nicht, wie lange ich geschlafen hatte, als ich schlagartig erwachte. In dem dämmrigen Licht war ich einen Augenblick desorientiert. Ich sah mich um und versuchte auszumachen, was mich geweckt hatte. Betsy schnarchte laut, doch dieses Geräusch konnte mich nicht aus dem Schlaf gerissen haben, denn meine Zofe hatte bereits geschnarcht, bevor ich eingeschlummert war. Dann begriff ich, dass die Kutsche angehalten hatte. Ich spähte aus dem Fenster und fragte mich, ob wir schon in Edenbrooke angekommen seien. Ich sah keine Lichter, kein herrschaftliches Haus, nicht einmal einen Gasthof. Nur der Vollmond erhellte den Schauplatz.
Ein lauter Schuss zerriss die Stille. Erschrocken zuckte ich zusammen. Ein Mann schrie auf, die Kutsche machte einen Satz nach vorn und blieb dann wieder stehen.
Betsy regte sich. »Was war das?«, murmelte sie.
Ich drückte das Gesicht ans Fenster. Hinter der Scheibe starrte ein Augenpaar zurück, und ich kreischte auf. Der Kutschenschlag wurde aufgerissen, und ein großer, dunkler Schatten erfüllte die Türöffnung.
»Überfall! Alle rauskommen!« Die Stimme klang tief und gedämpft.
Von Straßenräubern hatte ich schon gehört und wusste, was von mir erwartet wurde. Ich sollte aussteigen und dem Mann meinen Schmuck und mein Geld aushändigen. Doch beim Klang der bedrohlichen Stimme warnte mich ein Instinkt, dass es töricht wäre, den Schutz der Kutsche zu verlassen.
Ich tastete nach meinem Retikül und warf es aus der offenen Tür. »Da. Da ist mein Geld. Nehmen Sie es, und verschwinden Sie!«
Doch der Mann, dessen Gesicht von einer Maske bedeckt war, beachtete das Geld nicht und packte mich stattdessen am Nacken.
Ich kreischte auf und wich vor ihm zurück. Da hörte ich ein Geräusch, als würde etwas reißen. An den Fingern des Räubers sah ich kurz eine Metallkette baumeln, bevor er die Hand fest darum schloss. Meine Kette. Mein Medaillon. Mein einziges Bild von meiner Mutter! Ich stürzte mich darauf, doch er hielt die Hand außer meiner Reichweite und lachte leise.
Dann sah ich, was er in der anderen Hand hielt. Eine Pistole.
»Und jetzt raus aus der Kutsche!«
Er sprach mit so sanfter Stimme, dass es mir eisig über den Rücken lief. Zwischen meinen Schulterblättern brach mir kalter Schweiß aus. Ich wich in die hinterste Ecke der Kutsche zurück. Wenn mich dieser Schurke außerhalb der Kutsche sehen wollte, dann musste er mich herauszerren.
Offenbar hatte er denselben Gedanken. Er umklammerte mich am Fußgelenk und drehte es so fest herum, dass ein Schmerz an meinem Bein emporschoss. Mit dem Gesicht nach unten fiel ich auf den Boden der Kutsche und wurde Richtung Tür gezogen. Ich tastete nach etwas, woran ich mich festhalten konnte, und schrie. Es war ein entsetzlicher, furchterregender Schrei, der kein Ende nehmen wollte. Schließlich begriff ich, dass nicht ich so laut schrie, sondern Betsy.
Meine Zofe hatte ich ganz vergessen, doch nun erfüllte ihr Schrei die Nachtluft mit einem markerschütternden Klang, der mein Herz zum Rasen brachte. Sie klang wie eine Irre. Blitzartig ging mir auf, dass sie nichts von der Pistole des Straßenräubers wusste. Gerade wollte ich sie warnen, als über meinem Kopf ein scharfes, ohrenbetäubendes Geräusch erscholl.
Der Schrei verwandelte sich in ein Keuchen, zu dem sich ein lautes Fluchen und das Wiehern panischer Pferde gesellten. Rauch erfüllte die Luft. Die Kutsche schwankte, und die Tür schlug gegen mein Fußgelenk. Angesichts des stechenden Schmerzes jaulte ich auf und kniete mich mühsam hin.
»Betsy! Bist du verletzt?!«
Mühsam rappelte ich mich hoch und packte sie an den Schultern. Betsy schüttelte den Kopf und hielt mir etwas entgegen. Das Mondlicht fiel auf eine silberne Pistole, die sie mit zitternder Hand umklammert hielt. Ich starrte meine Zofe mit großen Augen an, packte die Pistole und legte sie behutsam auf der Sitzbank ab.
Der Klang von Hufgetrappel ließ mich aufhorchen. Ich sah aus dem Fenster und stellte fest, dass jemand auf einem Pferd davongaloppierte. Unser Wegelagerer suchte offenbar das Weite.
Betsy brach auf der Bank zusammen, und ich sank neben sie. Ihr Schnaufen verwandelte sich in einen Schluckauf. »O nein! Ich habe gerade auf einen Mann geschossen! Was, wenn ich ihn u-u-umgebracht habe? W-was geschieht dann mit mir?«
Mir schwirrte der Kopf. Ich versuchte, tief Luft zu holen, musste wegen des Pulverdampfs jedoch husten. »Nein, keine Bange, du hast ihn nicht getötet. Ich habe ihn fortreiten sehen. Aber wie in aller Welt bist du an seine Pistole herangekommen?«
»D-das war gar nicht seine«, hickste sie. »Ich h-habe die benutzt, die in dem P-Polsterkissen versteckt war.«
Ich riss den Kopf hoch. »Da hat eine Pistole dringesteckt? Die ganze Zeit über? Woher wusstest du davon?«
»Ich h-habe sie entdeckt, als Sie sich mit Mr W-Whittles unterhalten haben.«
Vor Erleichterung hätte ich beinahe losgelacht. Betsy hatte uns gerettet! Ich umarmte sie, bis wir durch ihren Schluckauf mit den Köpfen zusammenstießen. Als ich mich von ihr löste, kam mir ein Gedanke.
»Moment mal, wo ist eigentlich James? Warum ist er uns nicht zu Hilfe geeilt?«
Plötzlich erinnerte ich mich an den ersten Pistolenschuss, der erklungen war, nachdem die Kutsche gehalten hatte. Der Schrei eines Mannes war zu hören gewesen. Mit beklommenem Herzen wandte ich mich um und sah durch das zerborstene Fenster eine Gestalt am Boden liegen. Es war unser Kutscher, James.
3. Kapitel
Ich sprang aus der Kutsche und rannte zu ihm. Bei ihm angekommen, rief ich seinen Namen und schüttelte ihn, doch er regte sich nicht. Ich riss mir die Haube vom Kopf und beugte mich zu ihm hinunter. Als ein schwacher Atemzug meine Wange streifte, fiel mir ein Stein vom Herzen. James lebte. Behutsam ließ ich meine Hände über seinen Körper wandern und suchte nach einer Wunde. Als ich an seiner Schulter eine klebrige Feuchtigkeit spürte, erstarrte ich. Er war angeschossen worden.
»Betsy! Ich brauche deine Hilfe! Schnell!«
Vage erinnerte ich mich, wie ein Hund meines Vaters auf der Jagd versehentlich angeschossen worden war. Mein Vater hatte seine Krawatte abgenommen und sie auf die blutende Wunde gepresst, um den Blutfluss zu stillen, wie er mir gesagt hatte. Wenn das bei einem Hund funktionierte, würde es das bei einem Menschen auch tun.
Ich streifte meine kurze Jacke ab und faltete sie zu einer Art großen Kompresse zusammen, denn etwas anderes hatte ich auf die Schnelle nicht zur Hand. In dieser misslichen Lage würde ich sicherlich nicht versuchen, mir meinen Unterrock auszuziehen. Ich tastete nach der feuchtesten Stelle an James’ Rock, legte die zusammengefaltete Jacke darauf und bat Betsy, fest darauf zu drücken.
Dann richtete ich mich auf und drehte mich zur Kutsche um. Im Tumult hatten die Pferde gescheut und sich etliche Meter von der Stelle entfernt, an der James zusammengebrochen war. Sollten wir ihn zur Kutsche tragen oder besser die Kutsche zu ihm bringen? Skeptisch nahm ich James in Augenschein. Bestimmt konnte ich nicht einmal jemanden heben, der halb so schwer war wie er, und Betsy war von fast ebenso zierlicher Statur wie ich. Folglich musste die Kutsche zu ihm kommen.
Die Pferde waren noch immer verschreckt und drohten sich aufzubäumen, als ich nach den Zügeln griff. Es war nicht leicht, sie zum Weitergehen zu überreden, und an einem bestimmten Punkt befürchtete ich schon, wir würden James und Betsy geradewegs überfahren. Wie es aussah, dauerte es viel zu lange, die Kutsche richtig zu positionieren.
Ich schwitzte, und meine Hände zitterten. In der Hast stolperte ich über etwas. Der Länge nach fiel ich in den Dreck, schürfte mir die Hände an den kleinen Steinen auf und knallte mit der Wange auf die Straße. Ich rappelte mich wieder auf, wobei mir die Röcke im Weg waren, und entdeckte zu meinen Füßen mein Retikül. Der Straßenräuber hatte mein Geld nicht gewollt? Ich stopfte das Täschchen in mein Gewand und machte mich wieder an die anstehende Aufgabe. Nun kam der schwierigste Teil – James zur Tür zu transportieren und ihn hineinzuheben.
Ich nahm ihn an den Schultern, während Betsy ihn an den Füßen packte, und dann schleppten wir ihn vorwärts, unsäglich langsam, Zentimeter für Zentimeter, mit vielen Pausen, während derer wir ihn kurz ablegten. Bei der Kutschentür angekommen, schätzte ich den Abstand zwischen Boden und Stufe und hätte beinahe losgeheult. Meine Arme zitterten vor Erschöpfung, doch wir mussten eine Möglichkeit finden, ihn hochzuwuchten.
Ich legte James mit den Schultern wieder auf dem Boden ab und sah Betsy mit finsterer Entschlossenheit an. Sie sackte gegen die Kutsche.
»Wir müssen es schaffen, Betsy. Keine Ahnung wie, aber etwas anderes bleibt uns nicht übrig!«
Sie nickte, und wir ergriffen jede einen Stiefel und schoben James’ Füße in die Kutsche. Wir zogen und zerrten an seinen Beinen, bis wir seine Hüfte durch die Tür bekommen hatten. Dann stieg ich wieder aus und sprang hinunter, in der Gewissheit, dass er, sollte er noch am Leben sein, durch all unser Schieben und Zerren inzwischen heftig bluten musste. Ich packte ihn unter den Schultern und schob ihn hinein, während Betsy an seinen Armen zog. Schließlich gelang es uns, auch seinen Oberkörper ins Innere zu wuchten, und ich schloss rasch die Tür, bevor er womöglich herausrutschte.
»Drück weiter auf seine Wunde!«, rief ich durch das zerbrochene Fenster.
»Wie denn, bitte? Der liegt doch zusammengeklappt auf dem Boden!«
»Versuch’s einfach!« Ich kletterte auf den Kutschbock, taumelte kurz, als mir klar wurde, in welcher Höhe ich mich befand, und ergriff die Zügel. Zum Glück hatte mir mein Vater beigebracht, wie man mit einer Kutsche umgeht. Unter meinen ungewohnten Berührungen bewegten sich die Pferde unruhig. »Glaubt mir, ich hätte es auch lieber, James würde uns kutschieren«, murmelte ich und schlug mit den Zügeln auf die Rücken der Tiere.
Wir schienen uns mitten im Nirgendwo zu befinden. Ich fuhr weiter und weiter, bis meine Arme und Schultern vor Erschöpfung brannten. Es war verflixt schwer, vier verängstigte Pferde im Zaum zu halten.
Als ich schließlich in der Ferne einen Lichtschein erblickte, kam es mir wie das lieblichste Licht vor, das ich je zu Gesicht bekommen hatte. Während wir uns weiter näherten, entdeckte ich zu meiner noch größeren Erleichterung die unmissverständlichen Anzeichen eines Gasthofs. »The Rose and Crown« stand auf einem Schild über der Tür. Ich bog in den Hof und kletterte mit zittrigen Beinen vom Kutschbock.
Eilig lief ich zur Tür, doch in der Hast schlug ich sie mit größerer Wucht auf, als nötig gewesen wäre. Laut knallte sie an die gegenüberliegende Wand. Ein hochgewachsener Gentleman, der am Schanktisch lehnte und den ich zweifelsohne durch meinen geräuschvollen Eintritt auf mich aufmerksam gemacht hatte, sah zu mir her.
So schnell mich meine schwachen Beine trugen, ging ich zu ihm.
»Ich brauche Hilfe draußen im Hof. Sofort!« Ich sagte es in so herrischem Ton, dass es an Unhöflichkeit grenzte, aber in meiner großen Sorge um James kümmerte mich das nicht.
Der Gentleman hob die Augenbraue. Sein Blick wanderte von meinem zerzausten Haar (wo war bloß meine Haube abgeblieben?) bis zu meinen schmutzverkrusteten Stiefeletten.
»Ich befürchte, Sie verwechseln mich«, sagte er kühl und kurz angebunden. »Den Wirt finden Sie in der Küche, glaube ich.«
Sein verächtlicher Blick ließ mich erröten, und dann gingen mit mir nach allem, was gerade passiert war, die Nerven durch. Wie konnte er es wagen, so mit mir zu reden? Zorn loderte in mir auf, und der Stolz erhob sein Haupt. In diesem Augenblick war ich nicht minder charakterstark als meine Großmutter.
Ich reckte das Kinn. »Pardon. Mich dünkte, ich hätte einen Gentleman vor mir. Nun sehe ich, dass da in der Tat eine Verwechslung vorliegt.«
Kurz registrierte ich seinen schockierten Gesichtsausdruck, bevor ich mich der offenen Tür hinter dem Schanktisch zuwandte. »Hallo! Herr Wirt?« Ein wohlbeleibter Mann mit schütterem Haar erschien und wischte sich die Hände an seinem Hemd ab. »Ich brauche Hilfe im Hof, und zwar sofort!«
»Ja, natürlich.« Er folgte mir nach draußen.
Sobald ich die Kutschentür geöffnet hatte, war keine weitere Erklärung vonnöten. Es bot sich ein grauenhaftes Bild: James in vorgebeugter Haltung auf dem Boden, Betsy neben ihm mit kreidebleichem Gesicht und beide voller Blut. Der Anblick entsetzte mich, selbst wenn ich darauf vorbereitet gewesen war.
Umso dankbarer war ich, dass dieser Wirt ein Mann der Tat und von kräftiger Statur war. Er beugte sich in die Kutsche, hob James in seine Arme und trug ihn in den Gasthof. Als ich sah, mit welcher Mühelosigkeit er das erledigte, was für Betsy und mich solch ein anstrengender Kraftakt gewesen war, fühlte ich mich den Tränen nahe.
Betsy stieg aus der Kutsche und taumelte ein wenig. Ich gab ihr Halt, indem ich den Arm um ihre Taille schlang, und dann folgten wir dem Gastwirt die Treppe hinauf. Aus dem Augenwinkel sah ich den arroganten Gentleman, würdigte ihn aber keines weiteren Blickes.
Die Treppe stellte für meinen müden und zitternden Körper eine große Herausforderung dar. Der Gastwirt erreichte den Treppenabsatz vor uns und wandte sich dem Raum linker Hand zu. Ich wollte einfach nur ein Bett für Betsy finden und dann nach James sehen. Doch sobald wir das obere Stockwerk erreicht hatten, pflanzte sich eine kräftige Frau vor uns auf.
»Was geht hier vor?« Sie stemmte die Hände in die fülligen Hüften. »Dies ist ein unbescholtener Gasthof, jawohl, und ich dulde keinerlei seltsames Treiben!«
Ich reckte mein Kinn. »Mein Kutscher wurde verletzt, und meine Zofe steht am Rande eines Zusammenbruchs. Bitte seien Sie so gut, und geben Sie uns ein Zimmer.«
Erschrocken klappte die Frau den Mund zu und machte einen Knicks. »Ich bitte um Verzeihung, Miss. Mir war nicht bewusst … Selbstverständlich.« Dann wies sie mir ein Zimmer auf der rechten Seite zu. Ihrer Reaktion nach hatte sie mich nicht für eine Dame gehalten, bis ich gesprochen hatte. Der Gedanke wurmte mich.
Erst nachdem ich Betsy geholfen hatte, sich aufs Bett zu setzen, fiel mir auf, wie angegriffen sie aussah. Kein Wunder: Sie hatte einen Schuss aus einer Pistole abgefeuert und einen blutenden Mann in den Armen gehalten, während ich vorn auf dem Kutschbock gesessen hatte. Sicherlich stand sie noch unter Schock.
»Leg dich hin!« Zu meiner Erleichterung schien Betsy kein Bedürfnis zu haben, über ihre Erlebnisse zu reden, sondern ließ sich einfach aufs Bett fallen und legte sich einen Arm übers Gesicht. Ich beobachtete sie mit Besorgnis, bis die Frau des Wirts (denn das war sie, nahm ich an) mit einer Waschschüssel, einem Stück Seife und einem Handtuch hereingeeilt kam.
»Für den Fall, dass Sie sich waschen wollen«, meinte sie und blickte vielsagend auf meine Hände. Tatsächlich boten sie einen fast so grauenvollen Anblick wie die von Betsy. An der Tür zögerte die Gastwirtin und sagte: »Sie sehen aus, als könnten Sie etwas Warmes im Magen vertragen. Kommen Sie doch in die Gaststube, und ich lasse etwas für Sie zubereiten. Solche Dinge lassen sich mit leerem Bauch nur schwer überstehen.«
Ich nickte und dankte ihr leise, erleichtert, dass sie nun doch Hilfsbereitschaft zeigte. Dann tauchte ich meine Hände in die Waschschüssel und spürte schmerzlich jeden roten Striemen und jede Schürfwunde. Als ich mir die Hände einseifte und mich dann bis zu meinen Ellbogen hocharbeitete, zog ich scharf die Luft ein. Das Wasser in der Schüssel färbte sich rot, und mir wurde bei dem Anblick flau im Magen. Ich schloss die Augen und atmete tief ein, um gegen die Übelkeit anzukämpfen, die in mir aufstieg.
Ich ließ Betsy zurück, die mit sperrangelweit geöffnetem Mund schnarchend auf dem Bett lag, und durchquerte den Gang zu dem Zimmer, in das sich der Gastwirt mit James zurückgezogen hatte.
Mittlerweile hatte er James auf ein Bett gelegt und ihm das Hemd aufgeschnitten. Unser Kutscher lag noch immer mit geschlossenen Augen da. Geschickt säuberte der Gastwirt ihm die Wunde. Seine Hände waren schwielig von der Arbeit, aber sauber. Seit ich wusste, dass sich James in den großen, fähigen Händen dieses Mannes befand, ging es mir gleich bedeutend besser.
»Der Arzt wird bald hier sein, Miss«, sagte er. »Ich habe schon schlimmere Wunden gesehen als diese hier. Es könnte sich um einen Streifschuss handeln, eine Kugel scheint jedenfalls nicht drinzustecken.«
Beim Klang seiner freundlichen, rauen Stimme fiel mir solch eine Last vom Herzen, dass meine Knie nachgaben. »Ich danke Ihnen.« Vor Rührung versagte mir die Stimme.
Der Wirt sah mich scharf an. »Sie setzen sich am besten hin, Miss. Sie sehen gar nicht gut aus.«
»Nein, nein, alles bestens«, erwiderte ich, stellte aber fest, dass der Boden unter mir zu schwanken schien.
»Setzen Sie sich doch unten an den Kamin und wärmen sich. Hier gibt es für Sie eh nichts zu tun.«
Ich nickte, denn mir kam es vor, als würde mein Kopf auf eine eigentümliche Art schweben. Ein Sessel am Kamin klang einfach himmlisch! Ich verließ das Zimmer und bewältigte die ersten Stufen nach unten noch problemlos. Doch irgendwo auf halbem Weg wollten meine Beine mich nicht mehr tragen, und meine Knie knickten ein. Ich ließ mich auf eine Stufe sinken und bemühte mich, nicht die Treppe hinunterzupurzeln. Die Wände begannen zu kippen, der Boden wölbte sich nach oben. Ich bedeckte meine Augen mit einer Hand, mit der anderen stützte ich mich an der Wand ab und versuchte mein Gleichgewicht nicht zu verlieren.
Plötzlich packte mich jemand mit starker Hand am Oberarm. Überrascht riss ich die Augen auf. Es war dieser abscheuliche, hochnäsige Mann von vorhin. Nun stand er ein paar Stufen unter mir und sah mich mit einem sonderbaren Gesichtsausdruck an, der fast wie … Besorgnis wirkte. Was wollte er denn? Ich versuchte, ihn danach zu fragen, doch wieder stürzten die Wände auf mich ein. Ich kniff fest die Augen zu.
»Ich glaube, Sie fallen gleich in Ohnmacht«, sagte eine leise Stimme.
Wessen Stimme war das? Sie war zu nett, um diesem Mann gehören zu können. Ich schüttelte den Kopf und erklärte mit schwacher Stimme: »Ich doch nicht!« Doch dann zog Dunkelheit herauf, und ich fiel. In der Mitte trafen wir uns, und sie verschluckte mich ganz. Zu meiner Erleichterung tat es nicht weh.
4. Kapitel
Nach und nach kam ich wieder zu mir. Zunächst registrierte ich nur etwas Warmes unter mir, dann leises Gemurmel ganz in der Nähe. Wo befand ich mich bloß? Zu Hause sicher nicht, denn es roch nicht wie daheim. Ich wusste, ich sollte die Augen öffnen, doch es wollte mir nicht gelingen. Also blieb ich still liegen und lauschte dem Raunen um mich her. Ein angenehmer Zustand eigentlich. Er erinnerte mich an etwas aus meiner Kindheit – wenn ich nachts in der Kutsche eingeschlafen war und doch mitbekommen hatte, wie meine Eltern sich leise unterhielten.
Die Kutsche!
Unvermittelt stürmten sämtliche Erinnerungen wieder auf mich ein, und zwar so lebhaft, dass ich aufstöhnte. Das Gemurmel verstummte, und ich merkte, dass sich jemand über mich beugte.
»Nun? Kommen Sie endlich zu sich?«