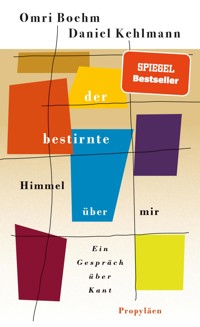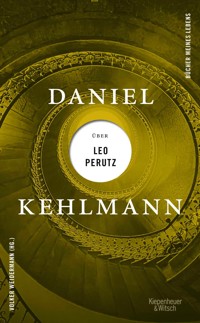21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ob Gabriel García Márquez, Heimito von Doderer, George Orwell, Salman Rushdie, Karl Kraus oder Jonathan Franzen: Daniel Kehlmann ist als Leser ein scharfsinnig Rühmender, ein kritisch Liebender, ein Lernender. Dasselbe gilt für ihn als Kinogänger, wenn er sich etwa von Michael Haneke oder Lars von Trier begeistern lässt. Auskunft über den Autor und Zeitgenossen Daniel Kehlmann gibt er in seinen großen Reden. Anlässlich der Entgegennahme des Anton-Wildgans-Preises stellt er sich die Frage, ob er ein österreichischer Autor ist. In der titelgebenden Marbacher Schillerrede denkt er über den historischen Roman nach. Und ein Konzert im KZ Mauthausen wird ihm zum Exempel dafür, dass Kunst keinen Ort abseits von der Welt beanspruchen darf.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 320
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Daniel Kehlmann
Sorgt, dass sie nicht zu zeitig mich erwecken
Essays und Reden
Über dieses Buch
Ob Gabriel García Márquez, Heimito von Doderer, George Orwell, Salman Rushdie, Karl Kraus oder Jonathan Franzen: Daniel Kehlmann ist als Leser ein scharfsinnig Rühmender, ein kritisch Liebender, ein Lernender. Dasselbe gilt für ihn als Kinogänger, wenn er sich etwa von Michael Haneke oder Lars von Trier begeistern lässt.
Auskunft über den Autor und Zeitgenossen Daniel Kehlmann gibt er in seinen großen Reden. Anlässlich der Entgegennahme des Anton-Wildgans-Preises stellt er sich die Frage, ob er ein österreichischer Autor ist. In der titelgebenden Marbacher Schillerrede denkt er über den historischen Roman nach. Und ein Konzert im KZ Mauthausen wird ihm zum Exempel dafür, dass Kunst keinen Ort abseits von der Welt beanspruchen darf.
Vita
Daniel Kehlmann, 1975 in München geboren, wurde für sein Werk unter anderem mit dem Candide-Preis, dem Per-Olov-Enquist-Preis, dem Kleist-Preis, dem Thomas-Mann-Preis und dem Friedrich-Hölderlin-Preis ausgezeichnet. Sein Roman Die Vermessung der Welt war eines der erfolgreichsten deutschen Bücher der Nachkriegszeit, und auch sein Roman Tyll stand monatelang auf den Bestsellerlisten und gelangte auf die Shortlist des International Booker Prize. Daniel Kehlmann lebt in Berlin.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Januar 2025
Copyright © 2025 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
Covergestaltung Anzinger und Rasp, München
ISBN 978-3-644-01130-4
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
In eigener Sache
Sorgt, dass sie nicht zu zeitig mich erwecken
Über Historie und Erfindung
Im Jahr 1978 beginnt der amerikanische Auslandsgeheimdienst CIA das Stargate Project. Es geht um den kontrollierten Einsatz paranormaler Fähigkeiten, vor allem um das sogenannte Remote Viewing. Das Strategic Research Institute in Menlo Park im Silicon Valley wird damit beauftragt, Hellseher auszubilden.
Man geht mit akribischem Ernst zu Werk. Im Dezember 1986 verfassen die Herren Scott Hubbard und Gary Langford ein Papier mit dem Auftrag A Suggested Remote Viewing Training Procedure. «A number of individuals», liest man da, «have demonstrated the ability to accurately perceive information inaccessible through the ‹conventional› ‹senses› and to convey their impressions in words and symbols. At times they can describe events, places, people, objects, and feelings with very high quality.»
Es brauche, schreiben Hubbard und Langford, 25 bis 30 Trainingssitzungen, am besten in stiller und kühler Umgebung, bis sich geeignete viewer – übersetzen wir ruhig mit «Seher» – vom Mittelmaß zu unterscheiden begännen und, zunächst in kurzen Erkenntnisblitzen, dann in ausführlicher und konsistenter Weise, Informationen über ihr target empfangen könnten. «The term ‹target› can include almost anything imaginable, e.g.: objects, events, people, places.»
Man mag schon verstehen, dass einem Nachrichtendienst derlei Fähigkeiten zupasskämen. Und so liest man mit beglückter Verblüffung jene inzwischen der Öffentlichkeit freigegebenen Forschungsdokumente, in welchen das SRI seine telepathischen Experimente schildert. Jede Menge Skizzen und Graphiken gibt es da, die meisten von eher dadaistischer Natur, andere wenigstens im Ansatz durchschaubar. Wichtig sei die Reduktion von noise, also allem Ablenkenden. Ablenkung könne naturgemäß von außen, aber auch von innen geschehen. An einem ruhigen, kühlen Ort also solle der remote viewer tätig werden und in großer Konzentration. Trance könne helfen, sei aber nicht unbedingt notwendig. Habe man solche Bedingungen hergestellt, könne dem viewer eine Aufgabe gegeben werden, etwa: «Describe the individual who committed a certain offense on a specified date.» Und dieser, so versichern die Herren Hubbard und Langford, zeichne dann ein «very accurate portrayal of the facial characteristics» der gesuchten Person.
Der Feldherr ist müde. Sein kühnes Unterfangen, der Griff nach dem Thron, ist gescheitert, er hat vom Leben nichts mehr zu erwarten, die Gefolgsleute verlassen ihn, und in einer Geste, die halb Resignation und halb Güte ist, entlässt er zuletzt noch seinen treuen Kammerdiener:
Der arme Mensch! Er hat im Kärntnerland
Ein kleines Gut und sorgt, sie nehmens ihm,
Weil er bei mir ist. Bin ich denn so arm,
Daß ich den Dienern nicht ersetzen kann?
Nun! Ich will niemand zwingen. Wenn du meinst,
Daß mich das Glück geflohen, so verlaß mich.
Heut magst du mich zum letztenmal entkleiden,
Und dann zu deinem Kaiser übergehn –
Gut Nacht, Gordon!
Ich denke einen langen Schlaf zu tun,
Denn dieser letzten Tage Qual war groß,
Sorgt, daß sie nicht zu zeitig mich erwecken.
«Er geht ab», sagt die Regieanweisung. «Kammerdiener leuchtet. Seni folgt. Gordon bleibt in der Dunkelheit stehen.»
Wallenstein wird den Morgen nicht erleben. Sein letzter Satz hat drei Bedeutungen, dicht ineinandergefaltet: Erstens, er ist ein gebrochener Mann, er ist sehr, sehr erschöpft. Zweitens, sein Schlaf wird länger währen, als er denkt, denn er geht nicht in eine erquickende Nachtruhe, sondern in den Tod. Und drittens ist die Anweisung, nicht zu früh geweckt zu werden, nicht nur an den Diener, sondern auch an die sich erinnernde Zukunft gerichtet: Schreibt nicht zu bald über mich, beschwört mich nicht zu früh auf die Bühne. Für einen Moment wird die Illusion durchscheinend, und neben Wallenstein taucht nebelhaft, doch in den Konturen erkennbar, der Schriftsteller Schiller auf, der rund hundertsechzig Jahre später – ja, Schiller steht Wallenstein zeitlich näher als wir ihm – ebendies tun, nämlich Albrecht von Wallenstein aus seinem Schlaf erwecken wird. Nicht zu zeitig solle dies geschehen – man muss das wohl so verstehen, dass Schiller Abstand für wichtig hielt, also: alles Nötige über die Figur zu wissen, aber vielleicht auch nicht zu viel. Haben die Zeugen das Feld verlassen, beginnt erst der erfindende Autor sein Werk.
Die Frage des richtigen Abstandes, nicht nur in zeitlicher Hinsicht, beschäftigt einen ständig, wenn man über Menschen schreibt, die tatsächlich gelebt haben. Das war immer schon eine Domäne der Literatur: Auch König Macbeth hat einst Schottland regiert, Henry V. hat nicht nur bei Shakespeare, sondern auch im realen Azincourt die Franzosen besiegt, Torquato Tasso und Lenz waren so real, dass sie uns Werke hinterlassen haben, die kaum weniger bedeutend sind als jene, in denen sie vorkommen, und Alexander Hamiltons Gesicht prangte schon auf der Zehndollarnote, bevor Lin-Manuel Miranda sein Meisterwerk über ihn schrieb.
Allerdings hat das Theater es hier erkenntnistheoretisch leichter als die Prosa. Wenn Wallenstein auf der Bühne steht, dann steht dort letztlich ein Mann, von dem jede Person im Publikum weiß, dass er nicht der Herzog von Friedland ist, sondern ein Darsteller im Kostüm. Auch wenn man sich dazu bringen kann, diesen Umstand in einer suspension of disbelief zu verdrängen, so handelt es sich dabei doch um eine hochkultivierte Selbsttäuschung, der man nur scheinbar verfällt. Selbst im Film, der realistischsten Fiktionsgattung, ist man über den ontologischen Status dessen, was man sieht, nie im Zweifel: Wir wissen in jeder Sekunde, dass keine Kamera bewegte Großaufnahmen der ersten Königin Elizabeth oder Adolf Hitlers im Bunker aufgenommen hat, ebenso wie wir wissen, dass Olivia Coleman nicht die zweite Königin Elizabeth ist; während wir aber, wenn wir auf einer aus einem Prosatext gerissenen Seite die Namen Wallenstein, Hamilton, Tasso oder Hitler lesen, noch nicht sicher sein können, mit welcher Art Sprechakt wir es zu tun haben.
Dieser Unterschied ist nicht trivial: Seinetwegen gibt es um historische Figuren in erzählender Prosa immer ein Flackern, eine Unsicherheit, eine Grundverwirrung, die wir im Theater oder im Film nicht erleben. Ein Dramentext ist, in den schönen Worten Tom Stoppards, für sich genommen noch kein Werk, sondern die Beschreibung eines künftigen Ereignisses – und dieses Ereignis wird per definitionem von sich verstellenden Leuten gestaltet. Bei einem Prosatext liegen die Dinge nicht so klar: «Sie zerrten aneinander, dachten auf ihre Weise sich Wallensteins zu entledigen. Er knirschte und krachte ihnen, wie sie noch saßen, sein Begehren über Nacken und Schultern. Er vermöge, ließ er sich schallend aus Prag vernehmen, keinen Unterschied zu sehen zwischen seinen Leistungen und denen des Kurfürsten Maximilian nach der Prager Schlacht.» Ob das von einem leicht exzentrischen Historiker verfasst ist oder von einem Romancier, in diesem Fall Alfred Döblin, wird nicht an jeder Stelle deutlich, eine Vagheit liegt über solchen Sätzen, die etwas im besten Sinn Unseriöses an sich haben. Denn vergessen wir nicht, das Unseriöse war immer schon der Ort, wo die Kunst sich entfalten konnte.
Der remote viewing process, schreiben Langford und Hubbard, sei dreistufig: Erstens «accessing the information concerning the target», zweitens «objectifying our feelings, perceptions and physical information in written and verbal form», drittens «qualifying the renderings, taking care to separate and label data related to the target from that which is extraneous to the task». Zunächst sei die Konzentration des viewers darauf gerichtet, aus dem Gewirr der Eindrücke und des noise das Relevante herauszufiltern. Dann aber, Schritt für Schritt, werde die trainierte Person fähig, ihre telepathisch erlangten Kenntnisse auch anderen mitzuteilen: «Gradually, the novice is exposed to techniques designed to convey their feelings to others in written and verbal communication. Only then can work be started on interpreting these feelings.» Denn sich anderen in geordneter Form mitteilen zu können, sei das Wesentliche, es sei aber auch die größte Schwierigkeit: «Expert level remote viewers spend nearly 100 % of their time on Step 3.» Eigentlich, fahren die Autoren fort, sei fast jeder zum remote viewing befähigt, aber der Lärm des Alltagslebens verhindere meist, dass man diese Möglichkeit kultivieren und dann auch lernen könne, das Erkannte adäquat mitzuteilen.
Bedauerlicherweise hatte das Stargate Project nie ein praktisches Ergebnis, nie konnte der Geheimdienst auf Agenten verzichten und einfach durch Magie spionieren. Dennoch lief es, wie so manche nutzlosen Projekte, erstaunlich lange weiter, und zwar bis zum September 1995. Der abschließende CIA-Report An Evaluation of Remote Viewing ist zwar buchstäblich vernichtend, aber zugleich nicht ohne Respekt: «The foregoing observations provide a compelling argument against continuation of the program within the intelligence community. Even though a statistically significant effect has been observed in the laboratory, it remains unclear whether the existence of a paranormal phenomenon […] has been demonstrated. […] Further, even if it could be demonstrated unequivocally that a paranormal phenomenon occurs under the conditions present in the laboratory paradigm, these conditions have limited applicability and utility for intelligence gathering operations.»
Der erste Impuls war ein Bild. Es kam wie aus dem Nichts, als ich in Südspanien am Meer stand: ein Mann auf einem Segelschiff, der, sich am Mast festhaltend, hinausschaut auf den Horizont, an dem sich, fern aber deutlich, ein Seeungeheuer aus den Wellen erhebt. Er blickte von mir weg, ich konnte sein Gesicht nicht sehen, und doch wusste ich, was in ihm vorging: einerseits tiefer Schrecken über das, was er sah, zugleich aber der feste Entschluss, dass er das Monster bald schon nicht mehr erblickt haben, dass er es aus seinem Gedächtnis löschen, dass er niemandem davon erzählen und es ganz und gar vergessen würde. Er war ein Reisender des späten achtzehnten Jahrhunderts, das konnte ich an seiner Kleidung sehen, aber ich wusste nicht, wer oder wohin des Wegs er war. Ich wusste nur, dass ich über ihn schreiben würde.
Nachdem ich ihn eine Weile umkreist hatte, nachdem unterschiedliche Skizzen und Versuche nirgendwohin geführt hatten, lernte ich in Mexiko die Werke Alexander von Humboldts kennen, war fasziniert von seinem schönen, deutschen, ganz von Humor befreiten Humanismus und seiner Vermessungswut, sah die Umrisse einer Komödie. Aber wirklich beginnen konnte ich erst, als mir klar wurde, dass der Reisende aus jenem Tagtraum niemand anderer gewesen war als er.
Und wirklich sieht Humboldt im zweiten Kapitel von Die Vermessung der Welt nun ein Seeungeheuer – und entschließt sich sofort, es nicht gesehen zu haben. Aufklärung heißt immer ignorieren, heißt immer auch verdrängen, nicht aus Blindheit, sondern aus bewusster Entscheidung. Ich behaupte nicht, dass der historische Humboldt je ein Seeungeheuer erblickt hat. Ich halte das sogar für unwahrscheinlich. Und doch nehme ich mir heraus zu hoffen, dass jenes Bild eine Wahrheit enthält, eher assoziativ traumhafter als symbolischer Natur, die in einer sachlicheren Gattung als der erzählenden nicht fassbar gewesen wäre.
Dass mich noch nie jemand nach dem Lesen auf dieses Monster angesprochen hat, welches doch der geheime Glutkern des Buches ist, stört mich nicht im Geringsten. Im Gegenteil, ich habe das Gefühl, das wichtigste Bild des Romans bleibt durch seine Unauffälligkeit beschützt, bleibt abgeschirmt von der Aufmerksamkeit der vielen Leute, die wie zerstreute Museumsbesucher am Sonntagnachmittag durch diesen Roman gezogen sind. Denn angesichts eines Werks, dem es bestimmt war, eine fast unsinnige Menge von Lesern zu finden, stellt man sich als Autor doch die Frage, die Saul Bellow nach dem Erfolg seines Romans Herzog formulierte: «I have examined my conscience. I’ve tried to find out whether I had unwittingly done wrong. But I haven’t discovered the sin.» Manchmal frage ich mich das auch, denn große Leserscharen sind mir kraft Überzeugung und Erziehung ebenso so suspekt, wie sie es dem Rezensenten Schiller waren, als er den armen Populärdichter Bürger in der vielleicht wirkungsreichsten Rezension der deutschen Literaturgeschichte ins Inferno verbannte. Aber dann denke ich an den Mann auf dem Schiff, der, von keinem bemerkt, ein Monster sieht und schon in dem Moment, da er es erblickt, weiß, dass er es nicht gesehen haben wird – und der doch weiß, dass zugleich wiederum er von diesem Ungeheuer, auf dessen Leugnung seine ganze Existenz beruht, betrachtet wird; ich denke also an den Moment, da die Blicke der beiden sich begegnen, und weiß, ganz gleich was andere sagen mögen, ich habe die Sünde nicht gefunden.
Stellen wir uns vor, wie die geübten remote viewer in ihren kühlen und stillen Zimmern sitzen und sich auf die targets konzentrieren, das Papier vor sich, den Stift in der Hand, in der Erwartung luzider Momente, welche, wie es ja in den Anweisungen ausdrücklich heißt, weitaus leichter zu erlangen als mitzuteilen sind. Einige zeichnen, andere schreiben. So starren sie durchs Papier hindurch in die Ferne.
Seltsam bekannt kommt mir diese Situation vor. Sie sieht meinem Alltag recht ähnlich. Auch mir hilft es, wenn der Raum still ist, auch ich mag es kühl, auch ich brauche Techniken, um den noise, das Stimmengewirr, das ständige Auf-mich-Einreden, in dem ich befangen und verfangen bin, zum Schweigen zu bringen. Haben die guten Probanden dort in Kalifornien tatsächlich Übersinnliches vollbracht? Ich weiß es nicht, ich bezweifle es. Ich glaube, statt der Telepathie hat die CIA beim Stargate Project – die Kunst entdeckt.
Konzentriere dich auf einen Menschen, den es irgendwo dort draußen gibt oder gab und über den du einiges weißt, aber bei weitem nicht alles. Vergegenwärtige dir seine Umstände, frage dich, was er denken mag, was er fühlt. Und dann schreib es auf. Stell ihn dir vor. Und schreib. Wir Autoren tun so etwas Tag für Tag, und definitiv gilt auch für uns, was die CIA an ihren Versuchspersonen festgestellt hat: Am schwersten sei es nicht, zu Bildern und Ideen zu finden, am schwersten sei es, diese Bilder und Ideen festzuhalten und auszudrücken. Auf den Ausdruck, schreiben Langford und Hubbard, verwenden die erfahrenen remote viewer so gut wie hundert Prozent ihrer Arbeitszeit. Das, kann ich da nur sagen, wird jedem Schriftsteller einleuchten.
Aber wen sehe ich, wenn ich als remote viewer tätig bin? Ich erfinde ja und stelle doch Behauptungen auf: Dies und das trägt Humboldt bei und an sich, dies und das denkt er, dies und das geschieht ihm. Hätte all das überhaupt keine Beziehung zu den bekannten Fakten, der Text hätte ebenso wenig Sinn, wie wenn ich in einem Roman nur Wahres und Belegtes verwenden wollte. Wie weit kann, darf, soll man also gehen beim Erfinden? Erlaubt das Wort «Roman», solange es nur gut sichtbar über dem Text prangt, alles?
Wie immer gibt es eine erste, einfache Antwort, und die lautet: Natürlich kann, soll, darf man alles erfinden, denn die Kunst muss alles dürfen. Und diese Antwort ist nicht falsch. Aber ist sie darum auch richtig?
Wer über die Lebenden schreibt, muss sich vorsehen, denn sie können sich wehren, notfalls mit Hilfe der Gerichte. Während der Fall bei den Verstorbenen umgekehrt liegt. Schreibst du über sie, musst du dich vorsehen, weil sie dir ausgeliefert sind. Das Einzige, was sie schützt, ist dein Sinn für Angemessenheit. Und die Frage danach ist seltsamerweise aufs Engste verknüpft mit der Frage der Macht.
Humboldt war ein einflussreicher Mann, ich kann ihm einiges andichten, aber nicht so viel wie zum Beispiel dem Warlord Gustav Adolf von Schweden, der in Tyll als unverhohlene Karikatur auftritt, als einer der «blutigen Hähne», wie Brecht die mörderischen Gewaltherrscher jener Zeit genannt hat. Auch gegenüber Athanasius Kircher, einem Vorläufer der modernen Wissenschaft zwar, aber auch einem Mann der Macht, der mit falschen Ergebnissen und unverdienter Autorität den wissenschaftlichen Fortschritt für hundert Jahre praktisch zum Stehen brachte, glaube ich, mich kaum zurückhalten zu müssen, deshalb ist er bei mir ein ständig beleidigter, hochgefährlicher Narzisst, während andererseits Immanuel Kant in Die Vermessung der Welt nur deshalb als dementer Greis auftritt, weil Kant am Ende seines Lebens wirklich ein dementer Greis war und weil der Umstand, dass meine Hauptfigur Gauß bei seinem – fiktiven – Besuch bei dem einzigen Menschen, der ihm geistig Widerpart hätte bieten können, eben keine profunde Debatte führen kann, sondern nur unsinniges Gebrabbel zu hören bekommt, letztlich mehr über die traurige Wahrheit des Menschenlebens erzählt als jedes herbeiphantasierte Zwiegespräch über die Grundlagen der Mathematik. Satire tritt in ihr Recht gegenüber den Mächtigen, gegenüber den Machtlosen wäre sie der ärmlichste, billigste Spott von oben. Nur über die privilegierteste Familie der Welt kann man zu Lebzeiten fast aller Beteiligten eine Serie wie The Crown drehen, bei wirklich jeder anderen wäre es primitive Rufschädigung. Dass Wilhelm von Humboldt, ein echter Sadist und nebenbei ministerialer Erfinder des preußischen Schulsystems, seinen Bruder schon als Kind umbringen wollte, habe ich frei erfunden, und dennoch erscheint es mir nicht ganz unwahr. Erlahmen allerdings fühlte ich meine Phantasie beim Schreiben über einen Hexenprozess im Roman Tyll: Die europäischen Hexenverfolgungen sind ein kollektives Verbrechen von kaum vorstellbaren Ausmaßen, mehr als hunderttausend unschuldige Menschen wurden qualvoll zu Tode gefoltert. Als Bewunderer des sogenannten magischen Realismus hätte ich nichts lieber getan, als den Angeklagten in meiner Geschichte zu einem echten Hexer zu machen, aber auf einmal stellte sich mir die Frage, ob man dann nicht auch einen fesselnden Roman über eine Verschwörung der Weisen von Zion schreiben könnte – es gab keine Hexen, es gab nur Opfer des Hexenwahns; und die wohlig gruselnde Folklorisierung in unseren Büchern, Vergnügungsparks und Horrorfilmen erschien mir plötzlich als Missbrauch des Unrechts, das einst echten Menschen in der wirklichen Welt zugefügt wurde.
Wer einen Roman schreibt, ist theoretisch frei, alles zu tun. Aber praktisch war ich hier nicht frei. Und dass ich es nicht war, lag nicht an irgendwelchen äußeren Zwängen. Kein Mensch hätte sich beschwert, wenn ich einen echten Hexer erfunden hätte, niemand hätte einen bösen Tweet verfasst, kein Leserbrief wäre gekommen. Dass ich nicht frei war, lag an der Sache selbst.
Die Figur Alexander von Humboldts war mir Eingang und ein Schlüssel in die erzählerische Welt Südamerikas. Der Begriff appropriation wurde damals noch nicht freizügig verwendet, aber ich war instinktiv davon überzeugt, dass ich nicht einfach so einen südamerikanischen Roman schreiben konnte, der unter Kolumbianern, Argentiniern oder Chilenen spielte. Ja, theoretisch darf man beim Schreiben alles, aber praktisch macht man sich doch meist einfach lächerlich, wenn man über Dinge zu schreiben unternimmt, die keinerlei Verbindung zur eigenen Kultur, zur eigenen Vergangenheit, dem selbst gelebten Leben und der eigenen Sprache haben. Einfach nur deshalb, weil alles andere mir albern vorgekommen wäre, schrieb ich meinen südamerikanischen Roman um eine deutsche Hauptfigur herum, einen abgesandten Weimars in Macondo, einen Mann, der aus meiner Kultur heraus, die ich kannte, ausgezogen war in eine Welt, die mir beim Schreiben so fremd rätselhaft und verheißungsvoll vorkam wie einst ihm.
Wir sind in der Literatur ja nie im Reiche des interesselosen Wohlgefallens, wo die Kunst frei wäre vom verunreinigenden Beiwerk des Denkens und der Ideen. Literatur spielt sich in Worten ab, in Sätzen, in Formulierungen und Aussagen, und wenn Kant von ebendiesem interesselosen Wohlgefallen spricht, meint er vor allem das Naturschöne, also Rosen und Hügel und grüne Wälder, und vielleicht auch noch das reine Ornament, maurische Fadenmuster und perfekte Seidentapeten. Lesen wir aber ein literarisches Werk, so tun wir das nie frei von Vorstellungen darüber, wer es verfasst hat und in welcher Lage und zu welchem Zweck. Wo wir das nicht wissen, füllen wir die Leerstellen mit Vermutungen und sind zuweilen arg brüskiert, wenn diese sich als falsch erweisen.
Wäre zum Beispiel Roman eines Schicksallosen ein ebenso bedeutendes Buch, wenn sich herausstellte, dass es von einem blutjungen Norweger verfasst wurde? Die einfachste Antwort ist wiederum ein schnell gerufenes: «Aber natürlich, nur das Werk zählt, das würde keinen Unterschied machen!» Und das ist nicht ganz falsch.
Aber ganz richtig ist es wohl auch nicht. Zieht man das moralische Gewicht der Zeugenschaft in Betracht, welche dieser Roman eben auch in sich fasst, so muss man wohl doch einräumen, dass Roman eines Schicksallosen in so einem Fall sicher ein ganz anderes und vielleicht auch kein ganz so bedeutendes Werk wäre. Davon eben handelt Borges’ Fabel von Pierre Menard, dem Autor des Quijote: Die gleichen Sätze, an unterschiedlichen Orten und zu unterschiedlichen Zeiten von unterschiedlichen Menschen zu Papier gebracht, wären etwas völlig anderes. Aus diesem Gedanken heraus aber erwächst ganz von selbst eine weitere, dritte Antwort, nämlich die, dass es eben kein reiner Zufall ist, dass Roman eines Schicksallosen eben nicht von einem fünfundzwanzigjährigen Norweger verfasst wurde, sondern von einem echten Insassen der Konzentrationslager Auschwitz und Buchenwald. Es liegt eine Wahrheit in dem Buch, eine Wahrhaftigkeit und Lakonie, zu der einer, der all dies nur nacherfinden würde, kaum imstande wäre – logisch denkbar wäre es schon, aber wahrscheinlich ist es nicht, und genau deshalb ist es auch nicht geschehen.
Oder nehmen wir an, jemand schriebe eine Fernsehserie über das Leben von Franz Kafka. Wer dürfte nun in diesem Gedankenspiel Kafka darstellen? Die einfachste Antwort: Jeder, der es kann und ihm einigermaßen ähnlich sieht, sei er nun Franzose, Irländer oder Texaner. Als Schauspieler stellt man nun mal andere dar, und wenn man das zum Problem erklärt, so fordert man doch letztlich, dass jeder überhaupt nur noch sich selbst spielen solle. Das Wesen der Kunst ist die Verwandlung!
Völlig richtig, möchte man rufen, aber dann fragt man sich plötzlich, ob das gleiche Argument nicht von einem elisabethanischen Theaterdirektor vorgebracht worden sein könnte, der begründen wollte, warum es nun wirklich keinen Grund gebe, Frauenrollen an Frauen zu vergeben: Das Wesen der Kunst sei Verwandlung, und wenn man so eine Forderung zu Ende denke, könne doch irgendwann jeder nur noch sich selbst spielen!
Treiben wir das Gedankenexperiment, das übrigens so abstrakt nicht ist, weil ich tatsächlich gerade eine Fernsehserie über Kafka geschrieben habe, nur eine Drehung weiter: Stellen wir uns eine nicht französische, nicht irische und auch nicht texanische, sondern eine rein deutsche Filmproduktion über die Familie und das Prag Franz Kafkas vor. Nicht nur seine drei Schwestern, auch die meisten anderen Verwandten, auch seine Freunde, auch die Frauen, die er liebte – ein Großteil von ihnen wurde in den Konzentrationslagern umgebracht. Stellen wir uns nun eine ansonsten vorzügliche Verfilmung vor, in der all die Ermordeten gespielt werden von Darstellern aus Westerland, Münster, Kassel und Garmisch-Partenkirchen, die, wie der Zufall so spielt, auch noch zu einem nicht geringen Teil Nachfahren von Wehrmachtssoldaten und SS-Leuten sind. Wäre daran etwas nicht in Ordnung? Abstrakt moralisch gesehen spricht nichts dagegen. Aber mit ungeteilter Freude würde man das Ergebnis nicht ansehen.
«Who lives, who dies, who tells your story», lautet die letzte Zeile von Mirandas Hamilton, die auf seltsame Weise ein Echo bildet zu Wallensteins Anweisung, nicht zu früh geweckt zu werden, denn auch sie macht für einen Moment den gestaltenden Dramatiker hinter seiner Figur sichtbar – und tatsächlich gelingt es nie, die Frage danach, wer gestorben und wer nun Erzähler ist, vollständig auszublenden. In der literarischen Kunst, ob nun prosaischer, dramatischer oder filmischer Art, ist nun mal alles durchwirkt von Geschichte und Vorgeschichte, von Ideen und Kontexten, von Zusammenhängen und Zugehörigkeiten, von Interesse und von Interessen. Sobald wir Sprache verwenden, malen wir Grau in Grau und suchen einen Weg durchs Gestrüpp der Paradoxien. Ja, man darf vieles, aber Sinn und Verstand sollte das Ganze schon haben, und dass in Deutschland tatsächlich noch heute Indianerfilme gedreht werden, in denen deutsche Darsteller mit Federn auf dem Kopf durchs Unterholz robben, ist an sich schon unglaublich. Wenn dann ein Kinderbuchverlag, wohlgemerkt: ein Verlag für pädagogische Bücher, entscheidet, ein paar auf diesem Unsinn basierende Produkte lieber doch nicht in den Verkauf zu bringen, so mag man das vielleicht kritisieren, aber den Untergang des Abendlandes braucht man deshalb nun wirklich so wenig auszurufen wie die Wiederkehr der Zensur.
Ein in ähnlichem Zusammenhang ganz anders gelagertes Problem fand ich vor, als ich von einem Wiener Theater gebeten wurde, ein Stück über die St. Louis zu schreiben, jenes Flüchtlingsschiff, auf dem 1939 fast tausend Juden versuchten, die Insel Kuba zu erreichen. Sowohl Kuba als auch die USA und Kanada weigerten sich, sie aufzunehmen, und die St. Louis musste zurück nach Europa. Gut die Hälfte der Passagiere überlebte nicht.
Als ich das Stück schrieb, wurde mir klar, das Wichtigste an dieser Geschichte ist der Umstand, dass sie passiert war. Als Erfindung wäre sie nicht interessant, und wer auf bestürzende Parallelen zwischen der Gegenwart und der Vergangenheit hinweisen will, verliert seine Berechtigung dazu, wenn er die Geschichte, die er erzählt, mit Erfindungen anreichert.
Es ist aber noch komplizierter. Eine Geschichte, die man erzählt und die wahr ist, ist erzählontologisch ein ganz anderes Ding als eine Geschichte, die man erzählt, weil sie wahr ist. Es genügt nicht, nichts zu erfinden; das Publikum muss auch wissen, dass nichts erfunden ist. Das wiederum kann ein Buch ohne Schwierigkeiten sicherstellen, aber wie macht es das Theater? Man könnte es ins Programmheft schreiben, aber erstens ist das eine kleinmütige Lösung und zweitens: Wer liest schon Programmhefte? Also musste es auf der Bühne passieren, die Figuren mussten immer wieder aus ihren Rollen treten, sich ans Publikum wenden, mussten erklären, dass all dies tatsächlich die Wahrheit sei – der Effekt war fast komödiantisch, er war aber vor allem notwendig; ich hätte nicht gewusst, wie man das, was ich zu tun hatte, anders hätte tun können. Postmoderne und Metafiktion dienen meist der Verfremdung, sie können aber auch der Klarstellung dienen. Immer kommt es auf den richtigen Abstand an, auf die schwere Frage, wann und unter welchen Umständen der Moment gekommen ist, eine historische Figur aus ihrem langen Schlaf zu wecken – nicht zu zeitig, nicht zu spät, und vor allem mit den richtigen Worten.
Im Geheimen, ohne es je laut zu sagen, ganz privat und für mich, stelle ich mir trotz allem den geschichtlichen Wallenstein als nahen Verwandten des Schiller’schen vor, der nur nicht in so perfekten Versen spricht. Ganz für mich glaube ich daran, dass der echte Simón Bolívar der Version von ihm, die García Márquez erfand, erstaunlich ähnlich war, dass der wahre Goethe ziemlich viel mit der Hauptfigur von Lotte in Weimar gemeinsam hat und dass wir in keiner Biographie so viel über Stalin lernen wie in dem Kapitel in Der erste Kreis der Hölle, in dem Solschenizyn sich in seinen Kopf versetzt. In manchen größenwahnsinnigen Augenblicken versteige ich mich sogar, nur vor mir selbst und ohne dass ich das je öffentlich wiederholen würde, zu der Überzeugung, dass der historische Humboldt meiner von Neurosen und Ängsten geplagten Figur ähnlicher gesehen haben könnte als dem marmorblassen Helden der vielen Festschriften. Das Erfinden verwischt nicht nur manche Wahrheit, es lässt auch Wahrheit hervortreten.
Aber die Wahrheit ist oft ein unzuverlässiger Bundesgenosse. Am Orinoko begegnet Alexander von Humboldt, der echte, nicht mein erfundener, einem bisher noch nicht beschriebenen Affen: «Es ist dieß der Ouavapavi mit grauem Pelz und bläulichem Gesicht», schreibt er in seinen Bericht Reise in die Aequinoctialgegenden des neuen Continents. «Augenränder und Stirne sind schneeweiß, und dadurch unterscheidet er sich auf den ersten Blick von der Simia capucina, der Simia apella, Simia trepida und den anderen Winselaffen, in deren Beschreibung bis jetzt so große Verwirrung herrscht. Das kleine Tier ist so sanftmüthig als hässlich. Jeden Tag sprang es im Hofe der Mission auf ein Schwein und blieb auf demselben von Morgen bis Abend sitzen, während es auf den Grasfluren umherlief. Wir sahen es auch auf dem Rücken einer großen Katze.» Und in einer Fußnote gibt der Entdecker und Erstbeschreiber sodann dem Tier den taxonomisch korrekten Namen «Simia albifrons Humboldt».
Dass einer einen Affen besonders hässlich nennt, dass er ihm zugleich ohne Zögern den eigenen Namen gibt und dass er dies auch noch schildert, ohne einen Moment innezuhalten und zu bemerken, dass dem Ganzen etwas Komisches innewohnt – das wiederum ist nur in der Wirklichkeit eine gute Geschichte. Es ist nur lustig, weil es geschehen ist, als Erfindung wäre es matt. Und weil in einem Roman selbst das ganz und gar Wahre nicht tauglich ist, wenn es nicht Erfindung, und zwar gute Erfindung, sein könnte, durfte ich dieses sprechende Detail aus Humboldts Reisebeschreibung nicht verwenden. Ich hätte gern, ich habe lang darüber nachgedacht, aber es ging nicht. Die Fiktion muss plausibel sein, darf nicht übertreiben, muss den Regeln der Dramaturgie folgen. Nur die Wirklichkeit muss nichts.
Die Wirklichkeit kann sich sogar eine weitere Pirouette gegenüber der Fiktion erlauben. Wer ihm nämlich nachforscht, dem ausnehmend hässlichen Affen mit grauem Pelz und bläulichem Gesicht sowie weißer Stirn und weißen Augenrändern, der gerne auf Schweinen und Katzen reitet, den erwartet eine Überraschung. Man lese zum Beispiel in der Abhandlung The True Identity and Characteristics of Simia Albifrons Humboldt von Thomas Defler und Jorge Hernández-Camacho nach, abgedruckt in Neotropical Primates 10(29), August 2002. Eine Affenart, auf die Humboldts Beschreibung zutrifft, hat laut Auskunft der Zoologen, die lange gesucht haben, nie existiert.
Marbacher Schillerrede, gehalten am 13. November 2022 im Deutschen Literaturarchiv, publiziert am 2. Dezember 2022 in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.
Mein Leben mit dem Monster
Zum Amtsantritt Donald Trumps
Dieser Tage kann man jedes harmlose Gespräch mit einem Wort in Düsternis stoßen. Es reicht aber auch, die Begriffe nuclear arms und checks and balances zu erwähnen. Gern versichert man sich ja jetzt des Umstandes, dass das Präsidentenamt in seiner Macht beschränkt sei: Die checks and balances, heißt es, hinderten den mächtigsten Mann der Welt daran zu tun, was er wolle, so regle es die amerikanische Verfassung. Und das stimmt auch, wenn es um Gesetzesvorlagen geht, es stimmt aber leider nicht hinsichtlich der Anordnung eines Atomschlags. Sollte also der unreife und rachsüchtige Mann, der jetzt ins Weiße Haus einzieht, einen Angriff mit Nuklearwaffen anordnen, so liegt der Menschheit einzige Hoffnung darin, dass die ausführenden Soldaten den Befehl verweigern. An diesem Punkt wird normalerweise das Thema gewechselt. Man redet ja nicht gern darüber, wie nahe wir der Katastrophe womöglich sind.
Tatsächlich hört man in Amerika jetzt oft die Sätze «Nachrichten lese ich nicht mehr» oder – etwa hinsichtlich Trumps bisher einziger Pressekonferenz nach der Wahl – «Das konnte ich mir nicht ansehen». Die Sorge ist zu groß, zu schwer wiegt das Gefühl der Hilflosigkeit gegenüber dem seit der Wahlnacht Gestalt annehmenden Schrecken.
In dieser Nacht des 8. November saßen wir in New York vor dem Fernseher wie der Rest des Landes; wir hatten vor, Hillary Clintons Siegesfeier zu besuchen, aber wir wollten lieber doch erst hingehen, wenn es die ersten guten Nachrichten geben würde. Um acht Uhr gab es noch keine. Eine befreundete Psychologin kam kurz zu Besuch und sagte leise: «Ich hätte nicht gedacht, dass es so etwas wirklich geben könnte. Eine Wahl zwischen Gut und Böse.» Auch um zehn gab es noch keine guten Neuigkeiten, ständig brachte CNN mit grell optimistischer Musik unterlegte key race alerts – die Dramaturgie der Berichterstattung war ganz und gar darauf ausgerichtet, Hillary beim Gewinnen zuzusehen, aber praktisch alle alerts waren Erfolgsmeldungen für Donald Trump. Kurz vor Mitternacht konnte man mit ansehen, wie der große Comedian Stephen Colbert, angetreten, um auf dem Sender Showtime launig Donald Trumps Niederlage zu kommentieren, mit bleichem Gesicht sagte: «I can’t put a happy face on that – and that’s my job.» Zufällig hatte Amazon in dieser Nacht Werbezeit gekauft, um die zweite Staffel der Serie The Man in the High Castle zu bewerben, was dazu führte, dass man zwischen den Interviews, die ein immer entsetzterer Colbert mit immer mehr schreckensstarren Gästen führte, aufwendig produzierte Kurzfilme von einer die Hand zum Hitlergruß hebenden Freiheitsstatue sah. In den frühen Morgenstunden gestand Hillary Clinton ihre Niederlage ein, und wir gingen betäubt vor Schreck schlafen. Vor unseren Augen war der Weg frei geworden für den Untergang der amerikanischen Demokratie.
Am nächsten Morgen, an dem passenderweise auch noch besonders nebliges, tristes Wetter herrschte, sah man Menschen auf der Straße im Gehen weinen – ein Schauspiel, wie ich es noch nie erlebt habe. Aber in Manhattan hatte Hillary ja auch 87 Prozent errungen, und viele hier klammerten sich nun am Auftritt Angela Merkels fest, die den neuen Präsidenten in einer knappen Presseerklärung daran erinnerte, dass eine Zusammenarbeit nur auf der Basis von Demokratie, Freiheit und Menschenwürde möglich sei. «She is the last one standing!», hörte man von da an ebenso oft wie die Frage: «Was glauben Sie, wird sie die Wahl gewinnen?»
Sollte die Demokratie dann doch nicht an Donald Trump zugrunde gehen, so wird es bestimmt nicht daran liegen, dass er sich als vernünftiger Mensch erweist. Nur jemand, der sich nicht mit diesem Mann beschäftigt hat oder der so fest zur Selbstberuhigung entschlossen ist, dass er keine Fakten zur Kenntnis nehmen will, könnte das für möglich halten. Natürlich hat Amerika schon inkompetente Präsidenten gehabt, auch korrupte Präsidenten, sogar pathologische Lügner. Aber etwas wie Trump gab es noch nie. Die humanistische Grundannahme, auf der unter anderem das Romanschreiben beruht, setzt voraus, dass Menschen an Menschlichkeit gewinnen, wenn man sich mit ihnen befasst: Je mehr man über eine Person weiß, desto besser versteht man sie, und alles zu verstehen würde schließlich bedeuten, alles verzeihen zu können.
Donald Trump aber hat die bemerkenswerte Eigenschaft, dass er unmenschlicher wird, je mehr man über ihn weiß. Sieht man ihn von weitem, scheint es da noch ein komplexes Wesen zu geben, das Pläne schmiedet, sich verstellt, Taktiken anwendet und ein verborgenes Seelenleben beherbergt. Nähert man sich ihm aber, indem man etwa Reportagen und Bücher über ihn liest (wie zum Beispiel die Erinnerungen seines Ghostwriters Tony Schwartz, der ihn monatelang auf Schritt und Tritt begleitet hat und es sich jetzt zur Lebensmission gemacht hat, vor ihm zu warnen, oder wie David Cay Johnstons umfangreiche investigative Recherche) und indem man Leute befragt, die ihm begegnet sind, so löst sich all das auf wie eine optische Täuschung, und es ist einem, als habe man es mit einer Person zu tun, die ebendas nicht ist: eine Person. Keine einzige Anekdote findet sich über einen Donald Trump, der sich weise oder freundlich verhalten hätte, man stößt auf keine Geschichte über eine Begebenheit, in der er Geist oder Mitleid oder Anzeichen einer Innerlichkeit jenseits der brutalen Regungen von Wut, Eigenlob oder Prahlerei gezeigt hätte. Würde man ein weltweites Casting für die flachste Bösewicht-Figur durchführen, so hätte Donald Trump schon vor seinem Wahlkampf die besten Chancen gehabt zu gewinnen.
Dass das Böse keine Tiefe braucht, fiel vor Hannah Arendt schon Voltaire auf, als er am Höhepunkt der europäischen Aufklärung zu der Erkenntnis fand, dass ein Mensch keine ernst zu nehmende Erscheinung sein müsse, um grausige Untaten begehen zu können: arlequins anthropophages nannte er die frömmlerischen Henker der Inquisition, «menschenfressende Harlekine» – moderner ausgedrückt: Horrorclowns.
Am Vormittag des 8. November war der menschenfressende Harlekin noch beim Besuch seines Wahllokals ausgebuht und ausgelacht worden. Man kann es sich auf YouTube ansehen – höhnisches Gelächter von allen Seiten und ein Mann, der mit scharfer Stimme ruft: «Gonna lose!» So sicher war man sich in New York, so sicher war auch mein Nachbar, ein Professor für Wirtschaftswissenschaft, der mich am selben Nachmittag im Lift gefragt hatte, wie es mir so gehe. Als ich sagte, dass ich doch sehr beunruhigt sei, wusste er nicht, was ich meinte. Na, wegen der Wahl, sagte ich. Da lachte er auf. Das sei ja absurd, da müsse man nun wirklich nicht nervös sein. Trump sei Vergangenheit!
Eine Woche später spielte mein siebenjähriger Sohn in einem Lokal in Montauk Tischfußball mit zwei sympathischen jungen Männern in Holzfällerhemden. Sie waren ungemein herzlich zu ihm, offen und freundlich, und danach kamen sie zu unserem Tisch herüber, um sich vorzustellen. Wir schüttelten einander die Hände, und als wir auf die Straße traten, sagte mein Sohn: «Die haben für Trump gestimmt.»
«Das haben sie erzählt?»
«Und ich habe gesagt: Aber der ist gemein zu Frauen, darauf haben sie gesagt: Hillarys Mann war viel schlimmer.»
Und sie waren wirklich sympathisch, die beiden, es waren keine bösartigen Menschen, sie wollten die Welt nicht ins Unglück stoßen und waren nur, wie Abermillionen andere, dem Wahn verfallen, Hillary Clinton für die korruptere Alternative zu halten. Man muss vielleicht bis zu den großen Wellen kollektiver Selbsttäuschung zurückblicken – der deutschen Begeisterung für die Nazis, der allgemeinen Zustimmung für den Krieg von 1914 oder den in der frühen Neuzeit immer wieder hochschwappenden Wellen der Hexenangst –, um ein vergleichbares Beispiel für millionenfache Verblendung zu finden: Fast die Hälfte der Amerikaner ist heute überzeugt, dass Hillary Clinton, die vor kurzem noch bessere Zustimmungsraten hatte als Barack Obama, mindestens so korrupt und gefährlich sei wie der mehrfach überführte Betrüger, Lügner und Hasardeur Donald Trump. Letztlich steht man hilflos vor diesem Phänomen, das allenfalls Tiefenpsychologen erklären könnten. Wenn etwa eine gutbürgerliche Frau, Mutter eines Mitschülers meines Sohnes, vier Tage nach der Wahl ausruft: «Yes, he is terrible, but better him than the bitch!», oder wenn ein Latino, Wachmann in der New York Public Library, wo ich zurzeit jeden Tag arbeite, mir im Brustton der Überzeugung sagt: «These two are just the same!»