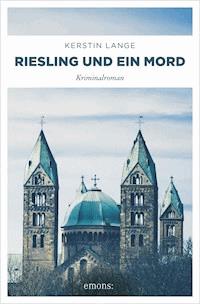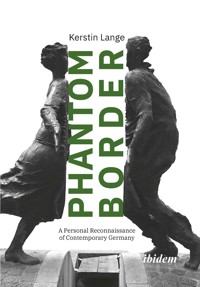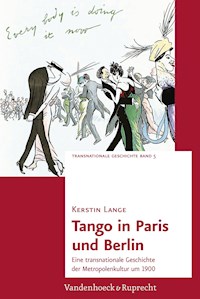8,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Die geschichtsträchtige Reithalle im Speyerer Quartier Normand soll abgerissen werden, doch einige Bürger wehren sich entschlossen dagegen. Als einer von ihnen Opfer eines Unfalls mit Fahrerfl ucht wird, übernimmt Kriminaloberrat a. D. Ferdinand Weber die Ermittlungen – und entdeckt einen Zusammenhang mit einem Suizid vor neunundzwanzig Jahren. Je tiefer Weber gräbt, desto näher kommt er selbst dem Tod...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 367
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Kerstin Lange, Jahrgang 1966, schreibt seit 2009 Kriminalromane mit meist regionalem Bezug und kann auf einige Auszeichnungen blicken. Die idyllische Domstadt Speyer liefert ihr den Rahmen für psychologische Krimis rund um den pensionierten Kriminaloberrat Ferdinand Weber.
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
© 2016 Emons Verlag GmbH Alle Rechte vorbehalten Umschlagmotiv: mauritius images/Colouria Media/Alamy Umschlaggestaltung: Tobias Doetsch Lektorat: Susann Säuberlich, Neubiberg eBook-Erstellung: CPI books GmbH, LeckISBN 978-3-96041-114-7 Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie regelmäßig über Neues von emons: Kostenlos bestellen unter www.emons-verlag.de
1
Der Wecker zeigte fünf Uhr zehn. Zu früh, um aufzustehen. Seit Stunden lag Ferdinand Weber wach, drehte sich von rechts nach links, auf den Bauch, auf den Rücken. Ohne Erfolg. Gefühlt hatte er nicht eine Minute geschlafen, seit er sich ins Bett gelegt hatte. Stattdessen erinnerte er sich an bessere Zeiten, träumte von seiner Louise und streckte seine Hand zur Seite, als könne er sie berühren.
Der Stich in seinem Herzen, den er spürte, wenn ihm die Leere bewusst wurde, nahm ihm den Atem. Das Wälzen, die Tagträume, ins Dunkle schauen, auf Geräusche achten– all das zermürbte ihn. Der Schlaf kam nicht. Nur die Gedanken an Louise.
Er begann sich vorzustellen, sie sei noch da. Träumte davon, was sie noch miteinander erleben wollten, bis ihm die Tränen über das Gesicht liefen. Diese Nächte machten ihm den Verlust seiner Frau so deutlich, wie es am Tag kaum möglich war. Sein Herz raste, sein Atem kam stoßweise, und er glaubte, kurz vor einem Infarkt zu stehen.
In diesen Momenten wusste er, dass er keine Angst vor dem Tod hatte. Nur vor dem Sterben. Selbst der Gedanke, dass er dann bei ihr war, nahm ihm nicht diese Angst. Bis jetzt war noch niemand zurückgekommen, um zu sagen, dass man im Tod bei seinen Lieben war.
Louise war immer bei ihm. Tagsüber sprach er mit ihr, integrierte sie in seine Abläufe, fragte sie um Rat. Er erzählte von Jeannette, seiner Bekannten aus der Buchhandlung, mit der er seine Leidenschaft für Bücher teilte. Dass das Café in der Buchhandlung »Osiander« geschlossen wurde und er sich einen neuen Ort für seine gemeinsamen Mittagessen mit Jeannette suchen musste. Dass sie Ärger mit ihrer Wohnung hatte, ständig Handwerker im Haus waren und sie eine Mieterhöhung nach der anderen bekam.
Die Gespräche halfen ihm, den Alltag zu bewältigen. Manchmal glaubte er sogar, dass Louise antwortete. Zwar hörte er nicht ihre Stimme, aber sein Inneres hatte eine Antwort für ihn parat, und er war der Überzeugung, ihr Geist oder was auch immer, stehe mit ihm in Kontakt.
Aber im Bett zu liegen, in diesem seltsamen Zustand zwischen Schlafen und Wachen, in dem er nicht wusste, was Realität oder Traum war, setzte ihm körperlich zu, raubte ihm Kraft, Zuversicht und Lebensmut.
Gegen sieben Uhr stand er endlich auf. Er fror und zog den Frotteemorgenmantel über, stellte die Kaffeemaschine an, nachdem er Pulver und Wasser eingefüllt hatte, und blieb einen Moment orientierungslos im Flur stehen.
Noch immer schlaftrunken, holte er die Tageszeitung aus dem Briefkasten. Dafür musste er zwei Treppen bis ins Erdgeschoss gehen. Er hoffte, dass ihn keiner seiner Nachbarn sah.
Im Flur war es eiskalt, er spürte den Luftzug, der unter der Haustür durchkam. Seit dem Bau des Wohnhauses war sie nicht ausgetauscht worden und im Laufe der Zeit undicht geworden. Mit einem Dichtungsband hatte er versucht, die Lücken zu schließen– mit mäßigem Erfolg.
Fröstelnd zog er den Mantel enger und beeilte sich, den Briefkasten aufzuschließen und die Zeitung herauszunehmen. Auf dem Weg zurück in die Wohnung überflog er die Schlagzeilen und schüttelte den Kopf. Krisen, wohin man sah. Anschläge, Kriege, Entführungen, Demonstrationen– die Welt kam nicht zur Ruhe. Das deprimierte ihn, dennoch spürte er mit Entsetzen, dass er mit jeder neuen schlimmen Nachricht abgestumpfter wurde. Verzweifelte Menschen auf der Flucht, tote Kinder, Vergewaltigungen, Hinrichtungen. Korrupte Politiker, die ihre Scherflein ins Trockene brachten– und das nicht nur in weit entfernten Ländern.
Weber erschrak über seine eigene Gelassenheit, die an Gleichgültigkeit grenzte. Das durfte nicht sein, nicht er, und doch war es der einzige Weg, um das Grauen zu ertragen. Die Augen zu verschließen war dennoch keine Lösung. Er versuchte, die Hintergründe von Hass und Gewalt zu begreifen, deren Ausmaß an Unmenschlichkeit kaum zu übertreffen war. Dabei spürte er mit jeder neuen Information die Unmöglichkeit seines Vorhabens.
In der Küche erwartete ihn der Duft von frischem Kaffee. Er setzte sich an seine Seite des Tischs und faltete die Zeitung auseinander. Dabei folgte er einem Ritual, das sich zu Louises Lebzeiten etabliert hatte. Seine Frau hatte darauf bestanden, den ersten Teil, Politik und Weltgeschehen, zu lesen, und ihm den Speyerer Lokalteil zu überlassen. Erst hatte es ihn geärgert, einige Male hatte er aufbegehrt, doch jeder Widerspruch war zwecklos gewesen. Auf ihre leise Art hatte Louise sich immer durchsetzen können.
Sie war nicht mehr da, nichts sprach dagegen, dass er nun die Zeitung Seite für Seite, von Anfang an, las. Doch wäre es ihm wie ein Verrat vorgekommen. Er legte den ersten Teil auf die gegenüberliegende Seite, als könnte Louise jederzeit die Küche betreten und sich zu ihm setzen.
Bereits die Schlagzeile des Speyerer Lokalteils sorgte dafür, dass sein Blutdruck nach oben schnellte.
»Abriss der ›Reithalle‹?«
Das Foto zeigte die Halle auf dem ehemaligen Exerzierplatz der Kaserne Normand. Ursprünglich als Sporthalle erbaut, nannte sie jeder Reithalle, obwohl mit Sicherheit niemals ein Pferd sie betreten hatte. Als die Planungen für das Gelände anstanden, hatte man beschlossen, sie zunächst als Sporthalle zu nutzen, weil es wie immer zu wenig öffentliche Räume gab. Bestandsschutz war nicht geboten, wie man damals glaubte. Aber seit einigen Jahren überlegte die Stadt, was sie damit machen sollte.
Man hatte geplant, sie weiter als Turnhalle oder für kulturelle Zwecke zu nutzen. Doch dafür musste man investieren, die Substanz war marode. In den 1930er Jahren gebaut, war nicht an Dämmung und andere Dinge gedacht worden, die heute für die Nutzung öffentlicher Räume nötig waren. Das kostete Geld. Sehr viel Geld. Zu viel für die Stadt. Also Verkauf. Es folgten Ausschreibungen und Planungen.
Webers letzter Stand war, dass eine Kindertagesstätte daraus entstehen sollte. Baubeginn im letzten Frühjahr. Warum das Projekt nicht umgesetzt wurde, wusste er nicht. Gerüchte gab es immer, und eines besagte, dass sich Anwohner gegen weiteren Kinderlärm ausgesprochen hatten. Anscheinend war das Projekt gekippt, wie er jetzt irritiert las. Die Stadtgärtnerei nutzte das Gebäude als Lagerraum, doch es sei einsturzgefährdet, wie ein neues Gutachten bestätigte.
Ferdinand Weber holte tief Luft. Das konnte doch nicht wahr sein! Neugierig las er weiter.
Die Unternehmerin Ingeborg Schindler setzte sich vehement für den Erhalt der Halle ein und hatte eine Bürgerinitiative ins Leben gerufen. Am morgigen Samstag sollte ein Demonstrationsmarsch vom Dom in Richtung Quartier Normand stattfinden, um ein Zeichen für den Erhalt zu setzen. Die Speyerer Bürger seien herzlich eingeladen, daran teilzunehmen.
Weber war sprachlos, spürte eine unendliche Traurigkeit in sich. Die Halle sollte verschwinden? Was für eine Katastrophe! Es wühlte ihn so auf, dass ihn die restlichen Artikel nicht mehr interessierten.
»Louise, weißt du noch, wie oft wir gemeinsam auf der Bank am Kinderspielplatz gesessen haben und uns über Zeiten unterhielten, als die Franzosen noch das Stadtbild prägten?«, sagte er und sah auf den leeren Stuhl ihm gegenüber. Wie gern hätte er jetzt mit ihr überlegt, was man noch tun könnte, um das Baudenkmal zu retten.
Auf dem ehemaligen Platz der Kaserne erinnerte nicht mehr viel an die Franzosen. Auf dem Exerzierplatz standen nun Mehrfamilienhäuser, Stadthäuser, umgeben von angelegten Rasenflächen, beleuchteten Wegen und Blumenrabatten. Mittendrin gab es diesen wunderbaren Kinderspielplatz, mit Bänken, Liegen, Klettergerüsten, Sandkasten und einem Outdoor-Fitnessparcours.
Wie oft hatte er dort auf einer Bank mit Louise gesessen und den Kindern beim Spielen zugeschaut. Ihr Lachen und Streiten genossen. Dort war Leben, Betriebsamkeit, es gab immer etwas zu gucken. Auf dem kleinen Gebiet trafen sich ältere Damen und Herren mit Rollatoren aus dem Altenheim, Bewohner der angrenzenden Lebenshilfe und natürlich viele Kinder, die die Spielgeräte nutzten, Ball oder Fangen spielten. Und die Sporthalle mit der Glasfront und dem auffälligen Uhrenturm passte wunderbar in die Umgebung, gab dem Ganzen einen Hauch von Nostalgie. Auch wenn die ehemaligen Soldatenunterkünfte an der Franz-Schöberl-Straße und Rulandstraße stehen geblieben waren und nur das Innenleben kernsaniert, ausgehöhlt und völlig neu gestaltet worden war, gab seiner Meinung nach die Halle dem Ganzen erst das besondere Flair.
Es war eine Frage der Ehre, dass er an der Demonstration teilnahm– und er war überzeugt, dass seine Freundin Jeannette Altmeyer ebenso dabei war.
Er nahm einen Schluck Kaffee, der mittlerweile kalt geworden war, und spürte, wie in ihm das Gefühl von Kampfgeist erwachte. Er setzte sich aufrecht auf den Stuhl, straffte den krummen, müden Rücken. Viel zu lange hatte er in den Tag hineingelebt. Die Müdigkeit und Schlappheit, die er nach dem Aufstehen in jeder Faser seines Körpers gespürt hatte, waren wie weggeblasen. Er hatte eine neue Aufgabe.
2
Clément Aust gab ungern zu, dass das Warten auf den Postboten zu den Highlights seines Tages gehörte. Vom Küchenfenster aus sah er, wann Lutz Gruber, der ihn seit Jahren mit Briefen versorgte, mit seinem gelben Fahrrad vor dem Einfamilienhaus im Vogelgesang-Viertel ankam.
Tagtäglich, sogar meist um die gleiche Uhrzeit, kam Lutz. Manchmal trat Aust vor die Tür, um ihn vor dem Haus abzufangen, einen kleinen Plausch zu halten oder ein wenig über die aktuelle Lokalpolitik zu diskutieren. In Frankreich geboren, war er in Speyer heimisch geworden. Hier fühlte er sich wohl. Das Viertel gefiel ihm, die Rheinauen waren fußläufig oder mit dem Fahrrad gut zu erreichen, und Nachbarschaft wurde großgeschrieben.
Er fror in seinem dünnen Hemd, während er auf Lutz wartete. Die Ladefläche des Postfahrrads war überfüllt, und es schwankte jedes Mal gefährlich, wenn Lutz in die Pedale trat.
Auch kein Spaß, dachte Aust. Er beobachtete, wie Lutz vor dem Nachbarhaus anhielt, einen Stapel Briefe sortierte und in den Briefkasten warf. Als er ihn sah, hob er seine Hand und winkte ihm zu.
Austs Frau Katharina hatte auf den Briefkasten außerhalb der Haustür bestanden. Ein amerikanischer, so einer aus Aluminium, bei dem der Postbote die rote Fahne nach oben stellt, wenn er etwas dagelassen hat. Clément hatte, wie so oft, der Begeisterung seiner Frau nachgegeben. Heute fragte er sich allerdings immer öfter, ob sie ihn nicht verlassen hätte, wenn er ihren Wünschen widersprochen hätte. Einfach mal einen kräftigen Streit vom Zaun brechen, statt immer zu allem Ja und Amen zu sagen. Inklusive seiner Namensänderung. Hervier fand sie zu schwierig. Pfälzisch ausgesprochen klang es tatsächlich nicht sonderlich harmonisch, auf Französisch jedoch wunderbar.
Aber er war verblendet gewesen, verliebt und nicht im Vollbesitz seiner geistigen Fähigkeiten. Keine Frau vor Katharina hatte das in ihm bewirkt, er hielt es für die große Liebe. Anders konnte er es sich heute nicht mehr erklären, dass er zu so vielen Kompromissen bereit gewesen war. Harmonie war wichtig für ihn, und solange es nicht um existenzielle Dinge ging, hatte er sie gewähren lassen. Wobei die Einteilung in wichtige und weniger wichtige Dinge im Auge des Betrachters lag. Irgendwann hatte Katharina ihre Sachen gepackt, ihm einen Brief auf den Küchentisch gelegt, in dem stand, dass sie ihn verlassen werde. Er sei zu lieb.
Anfangs hatte er es für einen Scherz gehalten, eine Laune oder eine Folge von Hormonschwankungen und geglaubt, dass sie bald zurückkommen würde. Selten hatte er sich so getäuscht. Eine Woche später rief sie an und erklärte ihm, dass ihr eine andere Art der Trennung nicht möglich gewesen wäre, weil er ihr sicherlich eine Auszeit vorgeschlagen, alle Zeit der Welt gegeben und größtes Verständnis gezeigt hätte.
Wie gut sie ihn kannte! Genau so hätte er reagiert, hätte ihren Wunsch, ihn zu verlassen, nicht ernst genommen.
»Nimm dir alle Zeit der Welt, die du brauchst«, hatte er am Telefon dann auch zu ihr gesagt.
Sie hatte laut aufgelacht, bevor sie ihm mit klarer, fester Stimme antwortete: »Mein Entschluss steht fest, ich brauche keine weitere Zeit.«
Vor ein paar Monaten war der Brief eines Anwalts gekommen, und erst allmählich begriff er, dass er verlassen worden war. Weil er zu lieb war. Es klang für ihn wie ein vorgeschobener Grund, den wahren wusste er bis heute nicht, vermutete aber, dass ein anderer Mann dahintersteckte.
Lutz fuhr auf ihn zu und reichte ihm einen Stapel Post. »Habe keine Zeit heute«, sagte er und setzte ohne eine weitere Erklärung seine Fahrt fort.
Aust blieb einen Moment stehen und blickte ihm irritiert hinterher, bevor er die Post durchsah. Ein Möbelgeschäft versprach dreißig Prozent Rabatt, eine Wohltätigkeitsorganisation für Kinder appellierte an sein Gewissen. Auch ein anderer Brief erregte seine Aufmerksamkeit. Ein einfacher weißer Umschlag, auf dem ein Aufkleber der Post mit seiner Adresse klebte. Vergeblich suchte er einen Absender. Eine Glückwunschkarte? Zu Ostern? Aber von wem? Seit Jahren bekam er keine persönliche Post mehr. Weder zum Geburtstag noch zum Weihnachtsfest, schon gar nicht zu Ostern.
Aust legte den obskuren Brief obenauf und ging ins Haus. Gerade als er die Tür aufgeschlossen hatte, öffnete sein Nachbar ein Fenster.
»Guten Morgen«, grüßte er, doch Aust beließ es bei einem kurzen Nicken.
Das interessierte seinen Nachbarn wenig, er sprach direkt weiter. »Heute findet die Demonstration gegen den Abriss der Halle im Quartier Normand statt. Sie nehmen doch auch teil, oder? Wir müssen etwas unternehmen. Es geht um den Erhalt wichtiger Kulturgüter!«
Der Schreck fuhr Aust in die Glieder. Die Kundgebung hätte er beinah vergessen. Natürlich stand sie heute auf seinem Programm.
»Selbstverständlich«, antwortete er, während er versuchte, mit seiner freien Hand die Tür aufzuschließen. Dann besann er sich und legte die Post auf den Boden. »Sagen Sie mal, finden Sie auch, dass die Werbebriefe überhandnehmen? Werden Sie auch so zugeschüttet? Schauen Sie mal«, sagte er und zeigte auf den Stapel. »Das ist doch nicht normal. Per E-Mail wird man kaum mehr belästigt, ob sich das für die Firmen überhaupt lohnt, jetzt, wo das Porto erhöht wurde?«
Sein Nachbar starrte in Austs Gesicht, dann auf den Stapel Briefe. Sein Gesichtsausdruck verriet, dass er eine andere Antwort erwartet hatte. Er presste die Lippen aufeinander. »Nein. Schönen Tag«, sagte er, bevor er das Fenster schloss.
Irritiert betrat Aust die Wohnküche und legte die Briefe auf den Küchentisch. Der weiße Umschlag rutschte herunter und blieb kurz vor der Kante des Tisches liegen. Neugierig nahm Aust ihn in die Hand und drehte ihn ein paarmal hin und her. Wer dachte an ihn und schickte Grüße? Ad hoc fiel ihm in seinem Bekanntenkreis niemand ein.
Seine Hände zitterten ein wenig beim Aufreißen des Umschlags. Es war kein kitschiges Blumenmotiv. Keine Osterwünsche, sondern eine Postkarte mit dem Konterfei des Papstes Johannes PaulII. vor dem Speyerer Dom. Auf der Rückseite stand mit akkurat gemalten Druckbuchstaben ein Zweizeiler:
»Nicht immer ist man gut, manchmal fehlt der Mut.«
Keine Unterschrift, kein Hinweis auf einen Absender. Ein grüner Aufdruck: »Papst Johannes PaulII. am 4.Mai 1987 in Speyer«.
Daneben ein grünes Wappen, das ihm völlig unbekannt war. Darunter las er: »Totus Tuus«.
Was sollte das? Irritiert ließ Aust die Postkarte sinken. Sie fühlte sich sehr dünn an, war vielleicht nur halb so dick wie eine der hochglänzenden Ansichtskarten, die man sonst von Speyer kaufen konnte.
Welche tiefere Bedeutung verbarg sich hinter diesen Zeilen? Wer schickte so etwas? War es eine verrückte Werbeaktion eines ortsansässigen Unternehmens? Mutmacherpost der Kirche? Wann kam die Auflösung?
Eine düstere Vorahnung überfiel Clément Aust, er hasste Rätsel und Dinge, die ihm unbekannt waren.
Immer noch über den Sinn der Karte nachdenkend, öffnete er die restliche Post. Wie erwartet, handelte es sich hauptsächlich um Werbung. Aber er war nicht bei der Sache. Sein Blick blieb auf den weißen Umschlag geheftet, und das mulmige Gefühl in seinem Bauch verstärkte sich. Wieso wollte ihn jemand an den Besuch des Papstes erinnern und die Vergangenheit auferstehen lassen?
Langsam erinnerte er sich. Bilder aus längst vergessenen Zeiten entstanden in seinem Kopf. Was hatte das zu bedeuten?
Nachdenklich nahm er die Karte wieder in die Hand. Er musste überprüfen, ob noch jemand eine bekommen hatte, und griff zum Telefon.
Ferdinand Weber musste sich beeilen. Er hatte sich mit Jeannette, seiner Bekannten aus der Buchhandlung »Osiander«, um Viertel vor drei am Dom verabredet, um fünfzehn Uhr sollte die Demonstration losgehen. Jeannette hatte noch Urlaub, und Weber freute sich, dass sie ihre freie Zeit so häufig mit ihm verbrachte. Was für ein Glücksfall, jemanden zu finden, mit dem man ein gemeinsames Ziel verfolgte. Jeannette erinnerte ihn stets ein wenig an die junge Louise. In ihrer Gegenwart fühlte er sich vitaler und nicht ganz so alt.
Die Demonstranten sammelten sich vor dem Dom neben dem Domnapf. Weber mochte den alten Steinhaufen, der wie ein riesiger Kelch geformt war. Im Mittelalter war er erbaut und im Laufe der Jahre ein paarmal umgesetzt worden. Zur Französischen Revolution musste er einem Freiheitsbaum weichen, später wurde er in den Domanlagen aufgestellt, wieder vor den Dom gesetzt und wieder zurück in die Anlagen gebracht. Erst zur Neunhundertjahrfeier der Grundsteinlegung des Doms wurde er wieder an der Beinah-Ursprungsstelle aufgebaut und durfte bleiben. Zu besonderen Jubiläen füllte man den Napf mit Wein. Das letzte Mal war Weber noch gut in Erinnerung geblieben: das neunhundertfünfzigjährige Domjubiläum 2011.
Als Jeannette und er am Domplatz ankamen, hatten sich bereits einige Befürworter der Reithalle eingefunden. Viele bekannte Gesichter waren unter ihnen, und Jeannette grüßte eifrig Kunden aus der Buchhandlung.
Zwei Streifenwagen und einige Uniformierte standen bereit, um den Gang durch die Stadt zu begleiten.
Ingeborg Schindler war natürlich schon da, umringt von einer Menschentraube. Wie immer sah sie sehr gut aus, wenn auch für Webers Geschmack etwas zu sehr gestylt. Die Haare waren in gleich große Wellen gelegt, beim Gehen wippte nicht eine Haarspitze. Die Haarfarbe glänzte haselnussbraun. Ihre Augen wirkten kühl. Weber wusste nicht, ob es an ihrem stechenden Blick oder an ihrer Art lag, jedem beim Sprechen sehr nahe zu kommen. Das störte ihn massiv, und unwillkürlich trat er einen halben Meter zurück, wenn er solchen Menschen begegnete.
Just in diesem Moment wurde ihm bewusst, dass das nicht der einzige Grund war, warum er die Frau nicht mochte. Sie war ihm zu künstlich. Alles an ihr wirkte in Szene gesetzt, jede Bewegung war auf ihre Außenwirkung getestet, nichts kam spontan oder gar von Herzen.
Ein junges Mädchen mit zerzausten blonden Haaren, die am Morgen wohl mit zwei geflochtenen Zöpfen in Fasson gebracht worden waren, sich aber jetzt mit aller Kraft aus dem Geflecht und dem Haargummi befreien wollten, erregte Webers Aufmerksamkeit. Ihr Anorak war mit braunen Flecken übersät, auf ihrer Nase prangte ein roter Kratzer. Ein Kind wie von Astrid Lindgren erschaffen. Glücklich, Kind sein zu dürfen.
Eine Frau, er schätzte sie auf Mitte dreißig, lief hinter dem Kind her, versuchte, es einzufangen. »Lieselotte, bleib stehen. Du kannst doch nicht…«
Lieselotte konnte. Mit leicht wackligem Gang lief sie auf Ingeborg Schindler zu und hielt ihr etwas hin. Weber bemerkte, wie zwei Männer in dunklen Anzügen aufmerksam wurden und sich vor sie stellten.
»Da!«, rief das Mädchen, lachte laut und dreckig, wie es nur Kinder können. Sie hielt einige Grashalme und blühendes Unkraut in der Hand, das sie Ingeborg Schindler schenken wollte. Die setzte ein Lächeln auf, das an Zahnpasta-Werbung erinnerte.
Hinter Weber flüsterte jemand. »Man kann sich diese Frau überhaupt nicht mit einem Kind vorstellen, oder? Es spricht für die Kleine, dass sie immer noch lacht. Ein Bild, das einem zu Herzen geht, finden Sie nicht auch?«
Weber blieb stumm, während Jeannette ihren Kommentar loswerden musste. »Die Frau wirkt kalt wie eine Hundeschnauze. Aber jetzt hat die Presse ein tolles Foto. Ich bin sicher, das wird ihr wieder einige Stimmen für ihr Vorhaben einbringen. Zumindest setzt sie sich für das Richtige ein, auch wenn ich nicht weiß, was ihre Beweggründe sind. Der Erhalt der Halle ist wichtig. Wir können doch nicht alles abreißen, was unsere Geschichte ausmacht, und Neubauten mit einer Gedenkplakette versehen. Damit hat Frau Schindler wirklich recht.«
Weber nickte vehement. Doch der Fremde war schneller als er. »Egal, was hinter ihren Motiven steckt, ich unterstütze sie in dieser Sache. Die Stadt sollte Geld für den Erhalt der Halle zur Verfügung stellen. Wenn die noch länger warten, fällt das Gebäude in sich zusammen.«
Weber lag eine Erwiderung auf der Zunge. Woher nehmen, wenn nicht stehlen? Die Stadtkasse war leer.
In diesem Moment begann Ingeborg Schindler mit dem Willkommensgruß. Die Männer in dunklen Anzügen standen unauffällig an ihrer Seite.
Wieso braucht die Frau Personenschützer? Ist das Teil der Show?, fragte sich Weber.
»Sie ahnen nicht, wie sehr ich mich über Ihre Unterstützung freue. Es ist mir eine Ehre…«
Weber hoffte von ganzem Herzen, dass ihre Ansprache nicht zu lange dauerte. Politische Selbstdarstellungen hatte er in seinem Leben zu oft gehört. Meist ging es immer nur für einen Bruchteil der Redezeit um die Sache, das Hauptaugenmerk bestand aus Eigenwerbung der redenden Person.
Er blickte sich nach bekannten Gesichtern um. Der Mann hinter ihm lächelte ihn an. »Ich kenne das Quartier Normand von früher, als noch die Kaserne stand«, sagte er. »Eine schöne Zeit damals, wie so vieles, wenn man zurückblickt. Wie heißt es so schön: Früher war alles besser.«
»Wie wahr«, bemerkte Weber, der genau wusste, was der Mann meinte.
Ingeborg Schindler gab kluge Worte von sich, eingepackt in nichtssagende Phrasen. Natürlich brauchte Speyer Wohnraum, das war seit Jahren ein Thema. Aber bezahlbaren Wohnraum. Ob der Abriss der Halle günstige Wohnungen oder gar bezahlbare Reihenhäuser bringen würde? Sie verteilte Flyer, erläuterte immer wieder ihre Motivation.
Weber war ehrlich, sympathischer war sie ihm nicht geworden, doch ihr Anliegen unterstützte er von ganzem Herzen. Und in Jeannette hatte er eine willensstarke Helferin gefunden.
Die Menschen setzten sich in Bewegung, sobald Ingeborg Schindler zum Ende kam. Gemeinsam gingen sie in Richtung Maximilianstraße, gleich einer Prozession. Vorn fuhr ein Streifenwagen, ein anderer bildete das Schlusslicht.
Wenn Weber gut zu Fuß war, schaffte er die Strecke vom Dom bis ins Quartier Normand in einer guten Viertelstunde. Im Pulk, neugierig von Touristen betrachtet, die immer wieder Fragen stellten, dauerte es wesentlich länger.
Sie gingen über die Maximilianstraße, marschierten durch das ehemalige Stadttor. Da die Demonstration angemeldet war, war der Verkehr an der Gilgenstraße umgeleitet worden. Der Weg führte an der Josephskirche vorbei, sie bogen auf den Bartholomäus-Weltz-Platz ab.
Das Gitter der Gedächtniskirche war geöffnet und gab den Blick auf die Luther-Statue frei. Weiter ging es die Schwerdstraße entlang, bevor sie in die Hilgardstraße abbogen. Kreuztorstraße, Friedensstraße, Diakonissenstraße. Am Feuerbachpark vorbei, zur Rulandstraße, Ecke Franz-Schöberl-Straße, Paul-Egell-Straße.
In den alten Gebäuden im Quartier Normand residierte früher das Bayerische Regiment, und nach dem Krieg fanden die französischen Pioniere hier Platz. Heute erinnerten noch die Fassaden eines Gebäuderiegels und einzelner Bauten daran. Und natürlich die Sporthalle, um die es ging.
Der Fremde suchte erneut das Gespräch. »Es ist schön geworden. Kein Vergleich zu früher.«
Ein typischer Speyerer, dachte Weber und lächelte. »Ich kann mich auch noch gut erinnern. Hier in der Nähe gab es doch früher eine Kneipe, nicht wahr? Da ging es oft hoch her. Musste mehr als einmal in meiner offiziellen Funktion als Polizist hierherkommen. War die Besitzerin nicht eine Frau? Warten Sie… Mir fällt der Name gleich ein.« Weber überlegte angestrengt. Vor seinem inneren Auge sah er die Bilder der Gaststätte, auch die Frau, der Rest blieb im Dunkeln.
Der Fremde half. »›Bei Krause‹ hieß die Kneipe. Die Wirtin, Mechthild Krause, war eine, die jeden unter den Tisch getrunken hat. Ich war auch ein paarmal da.« Er lachte verlegen, als fiele ihm gerade etwas ein, das er lieber wieder vergessen wollte.
Weber, der das bemerkte, ging nicht darauf ein. Mit Erinnerungen kannte er sich aus, auch mit Dingen, die man besser nicht erwähnte.
»Ich war schon lange nicht mehr hier«, sagte der Fremde und las die Inschrift auf der Granittafel vor. »Hier waren von 1945 bis 1997 das12., 1., 32. und 10. französische Pionierregiment stationiert.« Er drehte sich zu Weber und Jeannette um. »Da vorn war übrigens der Exerzierplatz. Dort, wo jetzt die Mehrfamilienhäuser stehen. Es sah wirklich ganz anders aus. Ich war hier stationiert und bin hängen geblieben. Aust ist übrigens mein Name, Clément Aust.«
Er hielt Weber und Jeannette die Hand hin.
»Sehen Sie dahinten das Haus?«, fuhr er fort. »Dort befand sich früher das Kasino. Während des Umbaus habe ich die Baustelle besucht und Interesse an einem Kauf bekundet. Einfach, um es mir anzuschauen. Das war wie eine Reise in die Vergangenheit. Viele Erinnerungen sind hochgekommen. Das ist nicht immer gut.«
Jeannette nickte mitfühlend, während Weber sich zurückzog. Was fand Jeannette bloß an alten, melancholischen Männern? Oder war sie einfach nur höflich?
Statt weiter über Jeannette nachzudenken, besann er sich auf die Gegenwart. Einige der Mitdemonstranten trugen Banner, auf denen stand: »Ja zur Halle!« und »Kein Abriss!«
Die meisten Befürworter beschränkten sich wie Weber und Jeannette auf das Mitgehen und waren erstaunlich ruhig. Weber hatte schon andere Menschenaufläufe erlebt, bei denen sich die Leute gegenseitig aufwiegelten und gewalttätig wurden. Er war zufrieden, dass es hier und heute anders war.
Mit langsamen Schritten gingen sie am Haus der Vereine vorbei. Der Stein des Anstoßes war bereits zu sehen. Weber drehte sich um, wollte dem ehemaligen Soldaten etwas sagen. Doch der unterhielt sich noch immer angeregt mit Jeannette.
Der Anblick der Halle versetzte Weber einen Stich. Sie sah schlimm aus. Rundherum stand das Unkraut hoch, Papierreste, Plastiktüten und anderer Müll befanden sich zwischen den Sträuchern und Bäumen. Weber hörte Vogelgezwitscher, das so laut klang, als würden auch die Vögel über den Zustand schimpfen. Selbst die ersten Triebe an den Bäumen verschönerten den Anblick nicht. Noch waren die städtischen Palmen und Oleanderbüsche im Innern des Gebäudes in ihrem Winterquartier. Wo sollten die hin, wenn die Halle abgerissen wurde?
Erst jetzt sah Weber den abbröckelnden Putz. Der imposante und charakteristische Uhrenturm verlor die Farbe. Mehrere der Sprossenfenster waren zerbrochen und notdürftig repariert worden.
Die Menge versammelte sich, als Ingeborg Schindler ihre Arme hob und um Ruhe bat.
»Noch ganz kurz: Herzlichen Dank, dass Sie den Erhalt der Halle unterstützen. Alle Befürworter treffen sich übrigens kommenden Mittwoch im ›Philipp Eins‹. Details finden Sie auf dem Flyer, der Ihnen gegeben wurde. Ich freue mich auf Ihren Besuch. Es ist von zentraler Bedeutung, dass wir zum Wohl der Stadt zeigen, was uns wichtig ist. Unterstützen Sie die Bürgerinitiative ›Ja zur Halle!‹. Ich denke, wir haben heute ein unübersehbares Zeichen gesetzt.«
Sie machte eine theatralische Pause, hob erneut die Hände, als wolle sie wie Queen Elizabeth winken. Im letzten Moment nahm sie sie wieder herunter. »Zum Abschluss gibt es noch eine besondere Überraschung. Der Chor der deutsch-französischen Freundschaft wird uns mit einem Lied erfreuen. Begrüßen Sie unsere Freunde mit einem herzlichen Applaus.«
Die Sänger gaben gut gelaunt ein französisches und ein deutsches Volkslied zum Besten, danach löste sich die Versammlung auf. Nur Ingeborg Schindler stand noch da, schüttelte Hände, grüßte und lachte. Sie gab das Bild einer engagierten Speyererin, die sich um ihre Stadt sorgte und stets ein offenes Ohr für sämtliche Belange der Bewohner hatte.
Irgendwie unehrlich, dachte Weber und fragte sich, was der wahre Grund für ihr Engagement war. Engagierte sie sich nur deshalb, weil sie in die Lokalpolitik wollte, wie diverse Gerüchte sagten? Reichte es ihr nicht mehr, Mitglied einer einflussreichen Unternehmerfamilie zu sein?
»Was machen wir noch mit dem angebrochenen Nachmittag?«, fragte er Jeannette und den Ex-Soldaten. »Trinken wir noch einen Kaffee? Da vorn beim Bäcker kann man draußen sitzen. Kommen Sie mit, Herr Aust, dann können wir noch etwas in Erinnerungen schwelgen.«
Aust schüttelte den Kopf. »Danke, nein, das ist sehr nett, dass Sie fragen, aber ich habe noch einiges zu tun. Hat mich aber sehr gefreut, Sie kennenzulernen.« Er reichte Weber und Jeannette die Hand zum Abschied und wandte sich zum Gehen.
Weit kam er nicht. Er schien das Gleichgewicht zu verlieren und stolperte. Ein roter Kleinwagen kam ihm gefährlich nahe.
Weber reagierte umgehend. Mit einem riesigen Schritt war er bei Aust, packte ihn am Arm und zog ihn zurück auf den Bürgersteig.
Die Bremsen des roten Autos quietschten. Der Oberkörper der Fahrerin flog nach vorn. Sie schrie, fuchtelte mit den Armen in der Luft, bevor sie nach einigen Sekunden die Beifahrerscheibe öffnete und mit zittriger Stimme fragte, ob alles in Ordnung sei.
Jeannette verständigte sich mit Weber durch Blickkontakt, bevor sie zu der Dame ging, um sie zu beruhigen. »Es ist nichts passiert. Sie haben zum Glück sehr gut reagiert. Da kann Ihnen der Mann auf ewig dankbar sein.«
»Aus dem Nichts fiel er fast vor mein Auto. Warum hat er denn nicht aufgepasst? Das ist mir noch nie passiert. Kann ich denn weiterfahren? Oder soll ich einen Krankenwagen rufen und warten, bis die Polizei kommt?«
Weber versicherte ihr, dass sie weiterfahren könne. Als das Auto aus seinem Blickfeld verschwunden war, krallte sich seine Hand noch immer in Austs Arm. Es gab so viele Fragen.
»Sind Sie verrückt? Haben Sie öfter Gleichgewichtsprobleme? Ist Ihnen schwindelig? Brauchen Sie einen Arzt?«
Das Gesicht des Mannes war blass, sein Atem kam stoßweise. »Ich
3
Ingeborg Schindler stand auf dem Balkon ihres Schlafzimmers und blickte in den Garten. Die Magnolie, ihr Lieblingsbaum, zeigte die ersten Knospen. Ein sicheres Zeichen, dass der Frühling kam und es bald wieder wärmer wurde. Sie sehnte sich nach Sonne, der Winter war nicht ihre Jahreszeit.
Hinter ihrem Rücken hörte sie Geräusche, doch sie drehte sich nicht um.
»Hier, meine Liebe, dein Kaffee«, sagte Walter und hielt ihr die Tasse hin. Cappuccino stilecht in einer italienischen Tasse, gekauft in der Toskana im letzten Urlaub. Volterra, San Gimignano und Siena. Zehn Tage Rundreise, die sie einander wieder näherbringen sollten. Walters Idee, ein misslungener Versuch.
Die Luft war raus aus ihrer Ehe. Trotz der vielen gemeinsamen Jahre, vieler Höhen und Tiefen, der Sorgen um Julius, des Ärgers im Betrieb hatten sie sich auseinandergelebt. Doch sie mussten zusammenbleiben. Eine Scheidung würde sie beide ruinieren.
Dabei hatte sie damals wirklich geglaubt, Walter zu lieben. Er hatte etwas Geheimnisvolles an sich gehabt, etwas, was sie ergründen wollte. Seine Schüchternheit, seine Unsicherheit, seine Liebe zu Literatur und Musik: All das war ihr fremd und faszinierte sie. Anfangs hielt sie es für Liebe, heute war sie schlauer. Eine Art Muttergefühl, bei Männern nannte man es wohl Beschützerinstinkt. Er brauchte sie, das gefiel ihr. Für ihn hatte sie in all den Jahren die Kastanien aus dem Feuer geholt, für ihn wieder und wieder Lösungen und Auswege gesucht und gefunden. Ohne sie hätte er alles verloren, würde er nicht existieren. Und er hatte sie machen lassen, ohne Vorschriften oder Bedenken. Alles, was sie tat, war gut.
Sie war schon immer eine starke Frau gewesen. Zu ihrem analytischen Verstand kamen schnelles Denken, Durchsetzungsvermögen und eine gute Menschenkenntnis hinzu. Nur bei Walter hatte sie sich getäuscht. Dabei hätte sie es besser wissen müssen. Bei dem Vater war es kein Wunder, dass Walter so geworden war. Schindler senior war ein Unternehmer alter Schule gewesen, der sich in der Rolle des Förderers und Wohltäters seiner Angestellten gefallen und sie wie Kinder behandelt hatte. Taten sie, was er wollte, und standen sie loyal zu ihm, war alles gut. Kehrten sie ihm den Rücken zu, reagierte er mit verletztem Stolz. Ein Patriarch wie aus dem Bilderbuch. Walter hatte immer Angst vor ihm gehabt und war schon als Kind in Bücher geflüchtet. Ingeborg fühlte sich nicht nur von Walter angezogen, sondern wollte in das Unternehmen einheiraten, was ihr kurz nach dem Kennenlernen gelang.
Mit ihrem Schwiegervater hatte sie von Anfang an eine Hassliebe verbunden. Vielleicht waren sie sich im Wesen zu ähnlich. Er hatte nur nicht verstanden, dass man eine Firma in der heutigen Zeit so nicht mehr führen konnte. Jede Diskussion mit ihm endete in Streit. Es war ein Segen, dass er so bald gestorben war und die Veränderungen nicht miterleben musste.
Was war nur los mit ihr? Diese Selbstzweifel kannte sie nicht von sich, noch nie hatte sie eine einmal getroffene Entscheidung in Frage gestellt.
»Alles wird gut, oder?«, fragte Walter in ihre Gedanken hinein.
»Rhetorische Frage, oder?«
Er kam näher, sie spürte seinen Atem in ihrem Nacken.
»Danke. Ich weiß, dass ich mich auf dich verlassen kann. Wie immer.«
Er war ein Weichei. Niemand, der Entscheidungen treffen konnte, schon gar nicht unpopuläre. Hatten in der Vergangenheit im Betrieb Entlassungen angestanden, war sie diejenige gewesen, die die Gespräche geführt hatte. Sie saß mit den Gekündigten an einem Tisch, immun gegen Tränen, Beschimpfungen, Bitten und Bestechungsversuche. Ihre Entscheidung beruhte auf korrekten Recherchen und Analysen, auf welche Mitarbeiter sie verzichten konnten. Sie zahlten gute Gehälter, über Tarif, ein Erbe von Walters Vater. Die Angestellten konnten doch nicht ernsthaft davon ausgehen, dass ein Arbeitgeber sich immer um sie kümmerte. Die Zeiten waren definitiv vorbei, die Arbeitsmarktlage hatte sich verändert und die Arbeitsbedingungen auch.
In der Regel erklärte sie die Situation dem Personal so lange, bis sie es verstanden hatten. Persönliche Schicksale durften nicht die Entscheidungsgrundlage bilden. Walter versteckte sich in diesen besonderen Situationen stets, las Gedichte oder verbrachte einen Tag im Bett, weil ihm Entscheidungen wie diese körperliche Schmerzen verursachten.
Das Ergebnis war, dass man sie hasste und ihn liebte. Aber damit konnte sie leben, es war ihr egal, was die Menschen über sie dachten.
»Kommst du frühstücken?« Walter stand noch immer hinter ihr. Seine Nähe nahm ihr den Atem, erdrückte sie.
»Gleich. Gib mir noch einen Moment.«
»Zwischen Gartenhäuschen und Terrasse würde sich gut ein Pool machen«, sagte Walter. »Was meinst du?«
»Würden wir den nutzen? Wer macht die Arbeit? Hans ist jetzt schon überfordert.«
»Hans schimpft immer über zu viel Arbeit. Und wird sie trotzdem machen. Du weißt doch, was passiert, wenn man über seinen Kopf hinweg Entscheidungen trifft.«
»Er vergöttert dich. Er würde dich nie im Stich lassen. Wenn du einen Pool möchtest, wird er ihn auch gut finden.«
»Manchmal denke ich, so eine Veränderung würde die Erinnerung vollkommen auslöschen, weißt du? Aber so ist es auch gut.«
Ingeborg war alarmiert. »Ist es wieder so weit? Wegen der Halle?«
Er schüttelte den Kopf.
Besorgt sah sie in sein Gesicht. Wenn seine Angstzustände jetzt wiederkamen, war das ganze Projekt gefährdet. Damals hatte er das Haus auf einmal nicht mehr verlassen, den Garten nicht mehr betreten können. Schlaflosigkeit und Depressionen quälten ihn.
»Denkst du oft daran?«, fragte Walter und klang traurig. Er legte seine Hand auf ihren Rücken.
Augenblicklich verspannte sie sich. »Wieso sollte ich? Nein.« Sie holte tief Luft und drehte sich um. »Jetzt treibt mich etwas anderes um. Die Halle muss erhalten bleiben. Ich muss die Speyerer motivieren, mich zu unterstützen.«
»Du bist doch auf einem guten Weg. Die Presse feiert dich, die Demonstration war gut besucht. So viele Teilnehmer hatte ich gar nicht erwartet. Das war eine richtig gute Idee, den Weg vom Dom bis zum Quartier Normand zu wählen. Respekt. Aber eigentlich wundert mich das nicht.« Er hielt inne.
»Wie meinst du das?«, fragte sie.
»Du findest immer einen Weg. Während ich tatenlos herumstehe, mich Panik befällt, befindest du dich im Lösungsmodus und handelst. Was würde ich ohne dich nur tun?«
Er beugte sich herab, und einen Moment fürchtete sie, dass er sie küssen wollte. Stocksteif erwartete sie die nasse Berührung.
Doch er spürte, dass es falsch wäre, und trat einen Schritt zurück. »Du sorgst dafür, dass es weitergeht. Ohne dich bin ich ein Nichts.«
Noch immer blieb sie starr stehen, vergaß zu trinken. Der kalte Kaffeeduft stieg ihr in die Nase.
Ohne mich wärst du nicht hier, dachte sie. Ohne mich gäbe es die Firma nicht. Ohne mich hätten wir Julius nicht. Ohne mich wäre dein Leben vorbei. Sie trat einen Schritt zurück. »Ich muss die Versammlung vorbereiten.«
»Auch dieses Mal wird alles gut, oder?«, fragte er.
»Natürlich, Walter. Wird es doch immer, oder? Ich tue alles, was in meiner Macht steht.«
4
Clément Aust machte sich auf den Weg zur Polizeiinspektion Speyer in der Maximilianstraße. Es wurde Zeit für die Anzeige. Je mehr er über den Vorfall während der Demo im Quartier Normand nachdachte, desto sicherer wurde er, dass ihn jemand vor das Auto gestoßen hatte.
Wieder und wieder überlegte er, was genau passiert war, wer in seiner unmittelbaren Nähe gewesen war. Natürlich hatte er schon öfter in einer Menschenmenge gestanden. Der »Weihnachtsmarkt« und »Altpörtel in Flammen« fielen ihm spontan ein. Da drängelte man um den besten Platz oder ließ sich im Strom der Menschen mitschieben. Unwillkürlich trat man jemandem auf den Fuß oder stieß den Vordermann an. Dann entschuldigte man sich, lächelte dazu– oder auch nicht–, je nachdem, wie genervt man bereits war.
Aber um ihn, einen Fünfundneunzig-Kilo-Mann, aus dem Gleichgewicht zu bringen, da gehörte mehr dazu als ein Anrempler. Dahinter steckte Absicht, eine gezielte Aktion. Nur wer? Er hatte keine Feinde. Katharina war er los, sie hatte keinen Grund, ihm den Tod zu wünschen. Allein der Ausdruck »den Tod wünschen« erschreckte ihn. Wem wünschte man den Tod? Jemandem, der einen um die Ersparnisse gebracht oder einem auf andere Art und Weise übel mitgespielt hatte.
Aust fühlte sich unschuldig, hatte ein reines Gewissen. Niemals in seinem Leben hatte er wissentlich jemandem Böses zugefügt. Wenn ihn Weber nicht im letzten Moment zurückgezogen hätte, wäre er tatsächlich vor das Auto geraten. Und selbst mit einem Kleinwagen hatte er im Zweikampf schlechte Karten. Der Fahrerin konnte man keinen Vorwurf machen.
Es blieb ein ungutes Gefühl wegen der Postkarte und des Gedankens, ob es zwischen den Vorfällen einen Zusammenhang gab.
Am Tag, als der Papst Speyer besucht hatte, war er gar nicht in der Stadt gewesen. Er hatte seinen Urlaub in der Provence mit Katharina verbracht.
Bloß nicht daran denken. Wäre er nicht so verblendet gewesen, hätte er bereits damals erkennen müssen, dass sie nicht gut für ihn gewesen war. Aber er war ihrem Charme, ihrem Aussehen und ihren Verführungskünsten erlegen. So einfach war das.
Er schob die Erinnerungen zur Seite, das hatte nichts mit dem Geschehen bei der Kundgebung zu tun.
Auf jeden Fall wollte er Anzeige gegen unbekannt stellen, egal, wie die Beamten reagierten. Ihm war nämlich noch ein anderer Gedanke gekommen. Was, wenn der heimtückische Stoß gar nicht ihm persönlich gegolten hatte? Wenn der Grund einfach in seiner Teilnahme an der Demo zu suchen war? Immerhin war es möglich, dass sich ein Gegner der Halle zwischen die Befürworter geschlichen hatte. Vielleicht auch mehrere, die ihn als zufälliges Opfer auserkoren hatten, weil er gerade dastand und die Gelegenheit günstig war. Als Abschreckung. Wie funktionierten schon so Fanatiker? Und natürlich blieb immer noch die Möglichkeit eines Versehens, an die er aber nicht glaubte.
Schon das Betreten der Polizeistation war eine kleine Zeitreise. Das Gebäude war alt, er wusste nicht, aus welchem Jahr. Am Empfang brachte er sein Anliegen vor. Der Beamte hinter der Glasscheibe nahm seinen Wunsch auf und bat ihn, einzutreten, als er die Tür per Knopfdruck öffnete. Ein Summer ertönte. Jemand würde ihn gleich abholen, wurde ihm mitgeteilt.
Auch wenn Aust nichts Unrechtes getan hatte, spürte er ein ungutes Gefühl in sich aufsteigen. Eine Art Schuld, dass er sich doch nicht immer korrekt verhalten hatte. Aber wer tat das schon?
Er musste nicht lange warten. Ein Beamter begrüßte ihn freundlich.
»Christian Hamacher«, stellte er sich vor. »Worum geht es? Kommen Sie doch mit in mein Büro. Was kann ich für Sie tun?«
In dem Zimmer mit Linoleumfußboden nahm Aust auf einem marode aussehenden Holzstuhl Platz, der unter seinem Gewicht knarrte. Aus Angst, der Stuhl könnte zusammenbrechen, verlagerte er seine fünfundneunzig Kilo so gut es ging nach vorn.
Auf dem Weg zur Polizeistation hatte er lange überlegt, wie er den Verdacht formulieren sollte. Mit »eventuell« und »höchstwahrscheinlich«, »ich denke« und »ich glaube« die Beschuldigung nicht aufbauschen, sondern sachlich vortragen.
»Jemand will mich umbringen«, sagte er rundheraus und erschrak selbst vor der deutlichen Aussage.
Hamacher lehnte sich zurück und sah ihn skeptisch an. Eine Augenbraue wanderte nach oben, seine Lippen spitzten sich zu. »Bitte?«
Aust räusperte sich. »Ja. Anders ist das nicht zu erklären. Erst die Postkarte, mittlerweile bin ich mir sicher, dass es eine Drohung ist. Und dann dieser Beinah-Unfall. Irgendwie hängt das zusammen, wenn ich auch noch nicht herausgefunden habe, wie.«
»Würden Sie bitte von Anfang an erzählen? Der Reihe nach, im Moment verstehe ich überhaupt nicht, wovon Sie reden.«
»Ja, natürlich. Entschuldigung. Aber ich bin aufgebracht. Je länger ich darüber nachdenke, desto sicherer bin ich, dass es jemand auf mich abgesehen hat.«
»Und wer hat es auf Sie abgesehen? Wen sollen wir verhaften?« Hamachers gleichmütiger Tonfall verriet keine Gefühle, was Aust irritierte. Er hatte mehr Anteilnahme oder Entsetzen erwartet.
»Das weiß ich natürlich nicht, deshalb bin ich ja hier. Sie müssen mich schützen. Dafür sind Sie doch zuständig.«
»Sagen Sie mir erst mal, wer Sie sind.«
Aust legte ihm wortlos seinen Personalausweis hin.
»Sie sind Franzose?«
»Ja.« Was für eine dumme Frage, dachte Aust, behielt den Gedanken aber für sich.
»Seit wann wohnen Sie hier? Die Adresse stimmt noch? Geborener Hervier? Wieso… Das verstehe… Sie sind verheiratet?«, fragte Hamacher schließlich, nachdem ihm der Grund einfiel, warum der Mann ihm gegenüber einen anderen Geburtsnamen hatte.
Aust nickte, schüttelte aber sofort den Kopf, um sich zu erklären.
Hamacher unterbrach ihn. »Natürlich. Auch Männer können den Namen der Frau annehmen, allerdings kenne ich niemanden persönlich. Aber das stimmt jetzt nicht mehr.« Ein missglücktes Lächeln.
Für Aust lief das Gespräch nicht, wie er es sich wünschte. »Ich lebe in Scheidung.«
Wieder ein Blick, den er nicht deuten konnte. »Was meinen Sie mit der Drohung? Ihnen wurde eine Postkarte mit einer Morddrohung zugeschickt?«, hakte Hamacher nach, ohne auf die Scheidung einzugehen.
»Ja. Handgeschrieben. Die Schrift kenne ich nicht, es gab auch keine Unterschrift. ›Nicht immer ist man gut, manchmal fehlt der Mut‹, stand darauf.«
»Und davon fühlen Sie sich bedroht?«
»Na ja, es ist ungewöhnlich. Vielleicht keine direkte Bedrohung, aber im Zusammenhang mit dem Sturz…« Aust brach ab. Es war eine Schnapsidee gewesen, hierherzukommen. Der Polizist glaubte ihm kein Wort. Seine nächste Geste bewies es.
Hamacher legte die Hände auf den Schreibtisch, als weigerte er sich, weiterzuschreiben. »Sie müssen doch zugeben, dass es ungewöhnlich klingt. Ich verstehe Sie richtig? Sie wollen gegen den Absender einer Postkarte, den Sie nicht kennen, Anzeige erstatten?«
»Nein, natürlich nicht. Das hätte ich vielleicht zum Schluss… Also, eigentlich war ich auf der Demo. Wegen der Halle, die abgerissen werden soll. Stand in der Zeitung. Sie wissen schon. Und auf dem Weg nach Hause, da hat mich jemand gestoßen. Und ich wäre beinah vor ein Auto gefallen. Das war Absicht, das war ein Mordversuch.«
»Sie meinen die Kundgebung am Samstag? Es waren gut zweihundert Menschen da. Es bleibt nicht aus, dass man jemanden berührt, wenn sich eine solche Menge auflöst. Die Zusammenkunft ist sehr friedlich verlaufen. Den Kollegen vor Ort ist nichts Verdächtiges aufgefallen. Und Sie glauben, jemand wollte Sie umbringen?«
Aust musste zugeben, dass es so zusammengefasst irgendwie seltsam klang. Unglaubwürdig. Die Verschwörungstheorie eines abgedrehten Spinners und nicht die berechtigte Sorge eines Bürgers.
»Wenn mich dieser Weber nicht gerettet hätte– wer weiß, wo ich jetzt wäre. Sicherlich könnte ich nicht hier sitzen. Sie sind doch dafür da, die Bürger dieser Stadt zu schützen. Mehr verlange ich doch gar nicht. Ich will nur…« Wieder brach er den Satz ab. Täuschte er sich, oder hatte sein Gegenüber bei dem Namen Weber eine Reaktion gezeigt?
»Weber?«, hakte Hamacher nach. »Kennen Sie Ihren Retter näher? Wie sieht er aus?«
»Ein älterer Herr, vollschlank. Ferdinand Weber, so hat er sich vorgestellt. Er war mit einer ganz reizenden jungen Dame da, mit der habe ich mich sehr gut unterhalten. Es war sowieso ein toller Nachmittag. Das Wetter spielte mit und…«
Wieder unterbrach Hamacher ihn. »Ja, das muss mein ehemaliger Kollege sein.«
»Er erwähnte, er sei Polizist gewesen.«
»›Polizist‹ ist etwas untertrieben, er war ein fähiger Kriminalist. Er hat Sie gerettet? Im letzten Moment zurückgehalten, bevor Sie vor das Auto fallen konnten?«
Aust nickte.
»Können Sie den Wagen beschreiben? Haben Sie ein Kennzeichen für uns?«