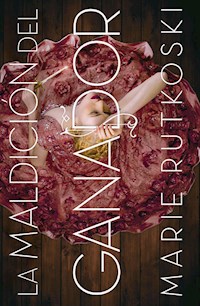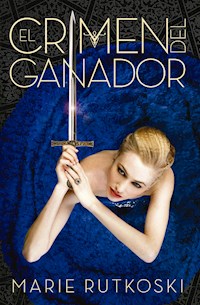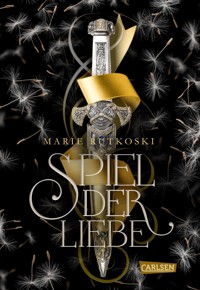9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Carlsen
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Als Tochter des ranghöchsten Generals von Valoria hat die siebzehnjährige Kestrel nur zwei Möglichkeiten: der Armee beizutreten oder jung zu heiraten. Aber Kestrel hat fürs Kämpfen wenig übrig; für sie ist die Musik das kostbarste Gut. Einem plötzlichen Impuls folgend ersteigert sie den Sklaven Arin, der sie auf unerklärliche Weise fasziniert. Schon bald muss sie sich eingestehen, dass sie mehr für ihn empfindet, als sie sollte. Doch er hat ein Geheimnis – und der Preis, den sie schließlich für ihn zahlt, wird ihr Herz sein … Romantisch, mitreißend und brillant erzählt – »Spiel der Macht« ist der erste Band der Fantasy-Serie »Die Schatten von Valoria«. Alle Bände der international erfolgreichen Serie: Spiel der Macht (Band 1) Spiel der Ehre (Band 2) Spiel der Liebe (Band 3)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Sammlungen
Ähnliche
Marie RutkoskiSpiel der Macht
Kopf oder Herz
Als Tochter des ranghöchsten Generals von Valoria hat die siebzehnjährige Kestrel nur zwei Möglichkeiten: der Armee beizutreten oder jung zu heiraten. Aber Kestrel hat fürs Kämpfen wenig übrig; für sie ist die Musik das kostbarste Gut. Einem plötzlichen Impuls folgend ersteigert sie den Sklaven Arin, der sie auf unerklärliche Weise fasziniert. Schon bald muss sie sich eingestehen, dass sie mehr für ihn empfindet, als sie sollte. Doch er hat ein Geheimnis – und der Preis, den sie schließlich für ihn zahlt, wird ihr Herz sein …
Romantisch, mitreißend und brillant erzählt – »Spiel der Macht« ist der erste Band der Fantasy-Serie »Die Schatten von Valoria«.
Die Schatten von Valoria
Spiel der Macht (Band 1)
In Vorbereitung:
Spiel der Ehre (Band 2)
Spiel der Liebe (Band 3)
Wohin soll es gehen?
Landkarte
Buch lesen
Anmerkung der Autorin
Viten
Das könnte dir auch gefallen
Leseprobe
WIEDER FÜR THOMAS
1
Hätte sie sich doch nur nicht in Versuchung führen lassen.
Das dachte Kestrel, als sie das Silber der Seeleute auf dem behelfsmäßigen Spieltisch einstrich, der in einer Ecke des Markts aufgestellt worden war.
»Geht nicht«, bat einer der Seeleute.
»Bleibt doch noch«, bekräftigte ein anderer, aber Kestrel zog die Samtbörse zu, die sie am Handgelenk trug. Die Sonne stand bereits tief und tauchte alles in ein karamellfarbenes Licht – was bedeutete, dass sie lange genug Karten gespielt hatte, um von jemandem bemerkt zu werden, der von Bedeutung war.
Jemandem, der es ihrem Vater berichten würde.
Dabei waren Karten gar nicht ihr Lieblingsspiel. Das Silber würde sie nicht einmal ansatzweise für ihr Seidenkleid entschädigen, das sie sich an der roh gezimmerten Kiste aufgerissen hatte, welche ihr als Hocker diente. Aber Seeleute waren viel bessere Gegenspieler als der durchschnittliche Aristokrat. Sie spielten mit wüsten Tricks, fluchten, wenn sie verloren, fluchten, wenn sie gewannen, und pressten selbst einem Freund noch den letzten Silberling ab. Und sie schummelten. Kestrel mochte es ganz besonders, wenn sie schummelten. Das machte es nicht ganz so leicht, sie zu schlagen.
Sie lächelte und ging. Dann schwand ihr Lächeln. Diese Stunde des prickelnden Abenteuers würde sie teuer zu stehen kommen. Es war nicht das Kartenspiel, das ihren Vater in Rage bringen würde, und auch nicht die Gesellschaft, in die sie sich begeben hatte. Nein, General Trajan würde wissen wollen, warum seine Tochter sich allein auf dem Markt herumtrieb.
Andere Leute fragten sich das ebenfalls. Sie sah es an ihren Augen, während sie sich durch die Verkaufsstände schlängelte. Dort wurden Gewürze in geöffneten Säcken feilgeboten, und ihr Duft vermischte sich mit der salzigen Brise, die vom nahen Hafen heranwehte. Kestrel konnte sich die Worte denken, die die Leute nicht einmal zu flüstern wagten, als sie vorbeiging. Denn natürlich sagten sie nichts. Sie wussten, wer sie war.
Wo war die Begleitung von Lady Kestrel?
Und wenn sich offenbar schon niemand von ihren Freunden oder ihrer Familie gefunden hatte, um sie auf den Markt zu begleiten – wo war ihre Sklavin?
Was die Sklavin anging, so hatte sie sie in ihrer Villa zurückgelassen. Kestrel brauchte sie nicht.
Was den Verbleib ihrer Begleitung anging, so stellte sie sich dieselbe Frage.
Jess war davongeschlendert, um all die angebotenen Waren zu begutachten. Wie eine von Nektar trunkene Biene war sie von Stand zu Stand geflattert – das war das Letzte, was Kestrel von ihr gesehen hatte. In der Sommersonne hatte ihr hellblondes Haar fast weiß gewirkt. Theoretisch konnte Jess sich genauso viel Ärger einhandeln wie Kestrel. Einem jungen valorianischen Mädchen, das nicht dem Militär angehörte, war es nicht erlaubt, sich allein in der Öffentlichkeit zu bewegen. Aber Jess’ Eltern liebten sie abgöttisch und hielten es nicht annähernd so genau mit Zucht und Ordnung wie der ranghöchste General der valorianischen Armee.
Kestrel suchte die Stände nach ihrer Freundin ab, und endlich erhaschte sie einen Blick auf ein Paar blonde Zöpfe, die nach der neuesten Mode geflochten waren. Jess sprach gerade mit einer Schmuckverkäuferin, von deren Hand ein Paar Ohrringe herabbaumelte. In den durchsichtigen goldenen Hängern fing sich das Licht.
Kestrel ging auf sie zu.
»Topas«, sagte die betagte Frau gerade zu Jess. »Er wird Eure schönen braunen Augen erstrahlen lassen. Nur zehn Silberlinge.«
Um den Mund der Schmuckverkäuferin lag ein harter Zug. Kestrel begegnete dem grauäugigen Blick der Frau und sah, dass ihre faltige Haut von der jahrelangen Arbeit im Freien gebräunt war. Sie war eine Herrani, aber ein Brandmal an ihrem Handgelenk bekundete, dass sie keine Sklavin mehr war. Kestrel grübelte, wie sie sich die Freiheit wohl verdient haben mochte. Sklaven, die von ihren Herren freigelassen wurden, waren selten.
Jess blickte auf. »Oh, Kestrel«, flüsterte sie. »Sind diese Ohrringe nicht zauberhaft?«
Vielleicht hätte Kestrel nicht widersprochen, wenn das Gewicht der Silberlinge in der Samtbörse nicht an ihrem Handgelenk gezerrt hätte. Vielleicht hätte Kestrel vor ihrer Antwort nachgedacht, wenn sie dieses Zerren nicht auch furchtsam in ihrem Herzen gespürt hätte. Stattdessen platzte sie heraus mit dem, was ganz offensichtlich die Wahrheit war: »Das ist kein Topas. Das ist Glas.«
Plötzlich trat Stille ein wie eine riesige Luftblase. Sie breitete sich aus, wurde dünn und durchsichtig. Die Leute um sie her lauschten mit einem Mal. Die Ohrringe zitterten in der Luft.
Weil die knochigen Finger der Schmuckverkäuferin zitterten.
Weil Kestrel sie soeben beschuldigt hatte, eine Valorianerin betrügen zu wollen.
Was würde jetzt geschehen? Was würde mit jeder beliebigen Herrani geschehen, die in der Situation dieser Frau war? Was würde die Menge zu sehen bekommen?
Ein Offizier der Stadtwache, der hinzugerufen wurde. Unschuldsbeteuerungen, denen niemand Gehör schenkte. Alte Hände, die man an die Geißelsäule fesselte. Peitschenhiebe, bis Blut den Staub des Markts dunkel färbte.
»Lass mich mal sehen«, sagte Kestrel mit herrischer Stimme, da sie zufällig sehr gut darin war, herrisch zu sein. Sie griff nach den Ohrringen und tat so, als würde sie sie eingehend prüfen. »Ach, da habe ich mich offenbar geirrt. Das ist ja wirklich Topas.«
»Nehmt sie als Geschenk«, flüsterte die Schmuckverkäuferin.
»Wir sind nicht arm. Wir haben Geschenke von jemandem wie dir nicht nötig.« Kestrel legte ein paar Münzen auf den Verkaufstisch. Die stille Blase zerplatzte, und die Marktbesucher kehrten zu ihren Verhandlungen um die Waren zurück, auf die ihr begehrlicher Blick gefallen war.
Kestrel reichte die Ohrringe an Jess weiter und ging mit ihr davon.
Im Gehen untersuchte Jess einen der Ohrringe und ließ ihn wie eine winzige Glocke hin und her schwingen. »Sie sind also wirklich echt?«
»Nein.«
»Woher weißt du das?«
»Sie haben keinerlei Eintrübung«, antwortete Kestrel. »Keinerlei Makel. Zehn Silberlinge wären zu billig für Topase dieser Qualität.«
Jess hätte nun einwenden können, dass zehn Silberlinge zu teuer für Glas seien. Aber sie erwiderte nur: »Die Herrani würden sagen, dass der Gott der Lügen dich lieben muss, weil du die Dinge so klar siehst.«
Kestrel fielen die gequälten grauen Augen der Frau ein. »Die Herrani erzählen zu viele Geschichten.« Sie waren Träumer. Ihr Vater sagte immer, dass sie deshalb so leicht zu unterwerfen gewesen waren.
»Jeder liebt Geschichten«, sagte Jess.
Kestrel blieb stehen, um ihrer Freundin die Ohrringe aus der Hand zu nehmen und sie ihr anzulegen. »Dann trag sie zur nächsten Abendgesellschaft. Erzähl allen, du hättest eine unverschämte Summe dafür gezahlt, und sie werden glauben, dass sie echt sind. Ist es nicht das, worum es bei Geschichten geht – die Wahrheit wie Lüge aussehen zu lassen und Lüge wie die Wahrheit?«
Jess lächelte und drehte den Kopf hin und her, sodass die Ohrringe leise klingelten. »Und? Bin ich nicht hübsch?«
»Dummerchen. Das weißt du doch.«
Jess übernahm die Führung und schlüpfte an einem Verkaufstisch mit Messingschalen voller Färbepulver vorbei. »Jetzt bin ich an der Reihe, dir etwas zu kaufen«, sagte sie.
»Ich habe doch alles, was ich brauche.«
»Du klingst schon wie eine alte Frau! Man könnte meinen, du wärst siebzig und nicht siebzehn.«
Die Menge wurde nun dichter. Überall sah man die Goldtöne der Valorianer, deren Haar und Haut und Augen honigfarben bis hellbraun leuchteten. Die vereinzelten dunklen Schöpfe gehörten gut gekleideten Haussklaven, die mit ihren Herren gekommen waren und sich dicht bei ihnen hielten.
»Schau doch nicht so betroffen«, sagte Jess. »Komm, ich finde etwas, das dich wieder aufheitert. Ein Armband vielleicht?«
Aber das erinnerte Kestrel nur an die Schmuckverkäuferin. »Wir sollten heimgehen.«
»Musiknoten?«
Kestrel zögerte.
»Aha«, sagte Jess und ergriff Kestrels Hand. »Nicht loslassen.«
Es war ein altes Spiel. Kestrel schloss die Augen und ließ sich blind von Jess ziehen. Ihre Freundin lachte, und dann lachte auch Kestrel, wie sie es schon vor Jahren getan hatte, als sie sich kennengelernt hatten.
Der General war allmählich ungeduldig geworden, weil Kestrel so lange trauerte. »Deine Mutter ist jetzt seit einem halben Jahr tot«, hatte er gesagt. »Das ist lange genug.« Schließlich hatte er einen Senator aus einer benachbarten Villa gebeten, seine ebenfalls achtjährige Tochter zu Besuch mitzubringen. Die Männer gingen ins Haus, den Mädchen sagten sie, sie sollten draußen bleiben. »Spielt etwas«, hatte der General befohlen.
Jess hatte Kestrel, die gar nicht auf sie achtete, die Ohren vollgeschnattert. Endlich hatte Jess aufgehört. »Mach die Augen zu«, hatte sie gesagt.
Neugierig hatte Kestrel es getan.
Jess hatte ihre Hand gepackt. »Nicht loslassen!« Sie liefen rutschend, stolpernd und lachend kreuz und quer über den Rasen des Generals.
So war es jetzt wieder, nur dass sie sich mitten im Getümmel befanden.
Jess wurde langsamer. Dann blieb sie stehen und machte »Oh«.
Kestrel öffnete die Augen.
Die Mädchen standen vor einer hüfthohen hölzernen Absperrung, von der aus man in eine Grube hinabblickte. »Hierher hast du mich gebracht?«
»Das wollte ich nicht«, erwiderte Jess. »Ich habe mich vom Hut einer Frau ablenken lassen – wusstest du, dass Hüte jetzt wieder in Mode sind? – und bin ihr nachgegangen, um ihn besser sehen zu können, und dann …«
»… hast du uns zum Sklavenmarkt geführt.« Die Menge war hinter ihnen stehen geblieben; sie war laut und aufgekratzt und voller Erwartung. Die Versteigerung würde bald beginnen.
Kestrel wich zurück. Sie hörte einen erstickten Fluch, als sie jemandem mit dem Absatz auf die Zehen trat.
»Jetzt kommen wir hier sowieso nicht mehr weg«, sagte Jess. »Wir können genauso gut bleiben, bis die Auktion zu Ende ist.«
Hunderte Valorianer hatten sich vor der Absperrung versammelt, die einen weiten Halbkreis absteckte. Jeder in der Menge trug Seide und einen Dolch an der Hüfte, auch wenn einige – wie Jess – diesen mehr als schmückendes Beiwerk denn als Waffe betrachteten.
Die Grube unter ihnen war bis auf einen großen Holzblock leer.
»Wenigstens haben wir einen guten Ausblick.« Jess zuckte die Achseln.
Kestrel wusste, dass Jess verstand, warum sie öffentlich bekundet hatte, die gläsernen Ohrringe seien aus Topas. Jess verstand, warum sie sie gekauft hatte. Doch ihr Achselzucken erinnerte Kestrel daran, dass es gewisse Dinge gab, über die sie nicht miteinander sprechen konnten.
»Ah«, machte die Frau mit dem spitzen Kinn neben Kestrel. »Endlich.« Sie kniff die Augen zusammen und blickte in die Grube hinab, zu dem stämmigen Mann, der nun dort unten in die Mitte ging. Er war ein Herrani. Er hatte das charakteristische dunkle Haar, obschon seine Haut blass war, weil er kein allzu schweres Leben hatte – zweifellos dank derselben Günstlingswirtschaft, die ihm auch diese Arbeit eingebracht hatte. Er hatte gelernt, wie man die valorianischen Eroberer bei Laune hielt.
Der Auktionator blieb vor dem Holzblock stehen.
»Zeig uns zuerst ein Mädchen«, rief die Frau neben Kestrel. Ihre Stimme war laut und träge.
Viele Stimmen erhoben sich nun, und jede rief, was sie sehen wollte. Kestrel fiel das Atmen auf einmal schwer.
»Ein Mädchen!«, schrie die Frau mit dem spitzen Kinn wieder, diesmal noch lauter.
Der Auktionator, der bisher mit den Händen gewedelt hatte, als wollte er die Rufe und die Aufregung zusammenraffen, hielt inne, als die Forderung der Frau trotz des Lärms zu ihm herandrang. Er sah zu ihr, dann zu Kestrel. Etwas wie Überraschung schien sich auf seinem Gesicht abzuzeichnen. Kestrel nahm an, sie hätte es sich nur eingebildet, weil sein Blick zu Jess weiterwanderte und dann das ganze Halbrund aus Valorianern hinter der Absperrung über ihm abtastete.
Er hob die Hand. Stille trat ein. »Ich habe da etwas ganz Besonderes für Euch.«
Die Grube war so gebaut, dass selbst ein Flüstern weit trug, und der Auktionator verstand sein Handwerk. Seine leise Stimme sorgte dafür, dass alle aufhorchten und sich vorbeugten.
Er winkte zu einem niedrigen, überdachten Unterstand hinüber, der nach allen Seiten hin offen war und sich am hinteren Ende der Grube befand. Dann schnippte er einmal, zweimal mit den Fingern, und etwas regte sich in dem Pferch drüben.
Ein junger Mann trat heraus.
Ein Murmeln lief durch die Menge. Die Verwirrung wuchs, als der Sklave sich langsam über den gelben Sand näherte. Er stieg auf den Holzblock.
Das war ganz und gar nichts Besonderes.
»Neunzehn Jahre alt und in bester Verfassung.« Der Auktionator klopfte dem Sklaven auf den Rücken. »Der hier«, sagte er, »würde sich perfekt im Haus machen.«
Gelächter wurde laut. Die Valorianer stießen einander an und lobten den Auktionator. Er wusste, wie er sie unterhalten musste.
Der Sklave war schlechte Ware. Kestrel fand, dass er wie ein Grobian aussah. Ein dunkler Bluterguss an der Wange wies auf einen Kampf hin und darauf, dass er schwer zu bändigen sein würde. Seine nackten Arme waren muskulös, was der Menge nur bestätigte, dass er am besten für jemanden arbeiten sollte, der immer eine Peitsche zur Hand hatte. Vielleicht hätte man ihn in einem anderen Leben für die Arbeit im Haus heranziehen können. Sein Haar war braun und hell genug, um einigen Valorianern zu gefallen, und während Kestrel sein Gesicht aus der Ferne nicht gut erkennen konnte, lag Stolz in seiner Haltung. Doch seine Haut war gebräunt von harter Arbeit im Freien, und sicher würde er auch zu dieser Art Arbeit zurückkehren. Vielleicht kaufte ihn jemand, der einen Hafenarbeiter oder einen Maurer brauchte.
Trotzdem trieb der Auktionator seinen Spaß weiter. »Er könnte bei Tisch bedienen.«
Wieder Gelächter.
»Oder Euer Leibdiener werden.«
Die Valorianer hielten sich die Seite und machten dem Auktionator Zeichen, er möge doch bitte, bitte aufhören, es war zu lustig.
»Ich will gehen«, sagte Kestrel zu Jess, die so tat, als hätte sie nichts gehört.
»Na gut, na gut.« Der Auktionator grinste. »Der Bursche hat wirklich seine Qualitäten. Bei meiner Ehre«, fügte er hinzu und legte die Hand aufs Herz, und die Menge prustete schon wieder los, denn es war allseits bekannt, dass es so etwas wie Herrani-Ehre nicht gab. »Dieser Sklave wurde zum Schmied ausgebildet. Er wäre für einen Soldaten geeignet, besonders für einen Offizier mit eigener Leibgarde und Waffen, die gepflegt werden müssen.«
Interessiertes Gemurmel kam auf. Herrani-Schmiede waren selten. Wenn Kestrels Vater hier gewesen wäre, hätte er wahrscheinlich mitgeboten. Seine Leibgarde beschwerte sich schon seit Langem über die Arbeit des städtischen Schmieds.
»Sollen wir mit der Versteigerung beginnen?«, fragte der Auktionator. »Fünf Piaster. Höre ich fünf Bronzepiaster für den Jungen? Meine Damen und Herren, für so kleines Geld könntet Ihr einen Schmied nicht einmal mieten.«
»Fünf«, rief jemand.
»Sechs.«
Und das Bieten begann ernsthaft.
Die Leiber in Kestrels Rücken hätten ebenso gut aus Stein sein können. Sie konnte sich nicht bewegen. Sie konnte die Gesichter der Leute nicht sehen. Sie konnte Jess’ Aufmerksamkeit nicht auf sich ziehen und auch nicht in den strahlenden Himmel schauen. All das waren Gründe, beschloss sie, warum es unmöglich war, den Sklaven nicht anzuschauen.
»Ach, kommt schon«, sagte der Auktionator. »Er ist mindestens zehn wert!«
Die Schultern des Sklaven spannten sich an. Das Bieten ging weiter.
Kestrel schloss die Augen. Als das aktuelle Gebot bei fünfundzwanzig Piastern stand, fragte Jess: »Kestrel, bist du krank?«
»Ja.«
»Wir gehen, sobald es vorbei ist. Es dauert nicht mehr lange.«
Die Versteigerung geriet ins Stocken, und es sah ganz danach aus, als würde der Sklave für fünfundzwanzig Piaster verkauft werden – ein erbärmlicher Preis und gerade so viel, wie jemand für einen Menschen zu zahlen bereit war, der so schwer schuften würde, dass er bald nicht mehr zu gebrauchen war.
»Meine lieben Valorianer«, sagte der Auktionator. »Etwas habe ich noch vergessen. Seid Ihr sicher, dass er keinen prächtigen Haussklaven abgeben würde? Dieser Kerl hier kann nämlich singen.«
Kestrel öffnete die Augen.
»Stellt euch nur vor: Musik zum Abendessen. Wie entzückt wären Eure Gäste!« Der Auktionator blickte zu dem Sklaven empor, der erhobenen Hauptes auf dem Holzblock stand. »Los. Sing für sie!«
Erst jetzt rührte sich der Sklave. Fast unmerklich, und er erstarrte sofort wieder, aber Jess hielt hörbar den Atem an, als rechnete sie – wie Kestrel – damit, dass dort unten gleich ein Kampf ausbrechen würde.
Der Auktionator zischte dem Sklaven etwas in schnell gesprochenem Herrani zu. Zu leise, als dass Kestrel es hätte verstehen können.
Der Sklave antwortete in seiner Sprache. Seine Stimme war tief: »Nein.«
Vielleicht wusste er nichts von der Akustik in der Grube. Vielleicht war es ihm auch gleichgültig oder es beunruhigte ihn nicht, dass unter den Valorianern jemand genug Herrani sprechen könnte, um ihn zu verstehen. Egal. Die Versteigerung war vorüber. Niemand sonst würde ihn jetzt noch wollen. Wahrscheinlich bedauerte die Person, die fünfundzwanzig Piaster hatte geben wollen, bereits, auf jemanden geboten zu haben, der so störrisch war, dass er nicht einmal seinesgleichen gehorchte.
Doch seine Weigerung berührte Kestrel. Die versteinerte Haltung seiner Schultern erinnerte sie daran, wie sie selbst sich fühlte, wenn ihr Vater etwas von ihr verlangte, das sie ihm nicht geben konnte.
Der Auktionator war außer sich. Er hätte den Verkauf abschließen oder zumindest zum Schein noch nach einem höheren Gebot fragen sollen. Aber er stand einfach nur da, die Fäuste geballt an den Seiten, und überlegte wahrscheinlich, wie er den jungen Mann bestrafen konnte – bevor er ihn seinem Elend überlassen würde, künftig in einem Steinbruch oder in der Hitze einer Schmiede zu schuften.
Kestrels Hand hatte sich von ganz allein bewegt. »Ein Silberling«, rief sie.
Der Auktionator drehte sich um. Er suchte die Menge ab. Als er Kestrel entdeckte, zauberte ein Lächeln eine verschlagene Freude auf sein Gesicht. »Ah«, machte er. »Da ist ja doch jemand, der etwas von Wert versteht.«
»Kestrel.« Jess zupfte an ihrem Ärmel. »Was tust du?«
Die Stimme des Auktionators ertönte: »Zum Ersten, zum Zweiten –«
»Zwölf Silberlinge!«, rief ein Mann, der auf der anderen Seite des Halbkreises, Kestrel gegenüber, an der Absperrung lehnte.
Dem Auktionator fiel die Kinnlade herunter. »Zwölf?«
»Dreizehn!«, ertönte das nächste Gebot.
Kestrel zuckte innerlich zusammen. Wenn sie schon hatte bieten müssen – warum überhaupt? –, dann doch nicht so hoch. Alle, die sich um die Grube drängten, blickten auf sie: die Tochter des Generals, ein Vögelchen aus gutem Hause, das von einem ehrenwerten Anwesen zum nächsten flatterte. Sie dachten wohl –
»Vierzehn!«
Sie dachten wohl, dass der Sklave den Preis wert sein musste, wenn sie ihn wollte. Es musste einen Grund geben, ihn ebenfalls zu wollen.
»Fünfzehn!«
Und das äußerst delikate Geheimnis um das Warum ließ ein Gebot auf das nächste folgen.
Der Sklave starrte sie nun an, was kein Wunder war, denn sie war es gewesen, die diesen Wahnsinn entfesselt hatte. Kestrel spürte innerlich ein Pendel zwischen Schicksalsergebenheit und Entscheidungsfreiheit hin- und herschwingen.
Sie hob die Hand. »Ich biete zwanzig Silberlinge.«
»Gütiger Himmel, Mädchen«, sagte die Frau mit dem spitzen Kinn zu ihrer Linken. »Lasst es gut sein. Warum bietet Ihr auf ihn? Weil er singt? Höchstens schmutzige Herrani-Trinklieder.«
Kestrel würdigte sie ebenso wenig eines Blickes wie Jess, obwohl sie spürte, dass ihre Freundin die Hände rang. Kestrels Blick hielt dem des Sklaven stand.
»Fünfundzwanzig!«, rief eine Frau von hinten.
Dieser Preis überstieg den Inhalt von Kestrels Samtbörse. Der Auktionator sah aus, als könnte er es kaum fassen. Die Gebote schraubten sich höher und höher, und jeder Rufer stachelte den nächsten an, bis es so wirkte, als würde ein Pfeil mit einem Seil daran in die Menge geschossen, um sie alle aneinanderzufesseln und in der Aufregung immer fester zusammenzuziehen.
Kestrels Stimme klang ausdruckslos, als sie sagte: »Fünfzig Silberlinge.«
Die plötzlich eintretende, fassungslose Stille tat ihren Ohren weh. Jess schnappte nach Luft.
»Verkauft!«, schrie der Auktionator. Sein Gesicht war verzerrt vor Freude. »An Lady Kestrel, für fünfzig Silberlinge!« Er zerrte den Sklaven vom Block, und da erst musste dieser den Blick von Kestrel wenden. Er sah so eindringlich in den Sand, als stünde dort seine Zukunft zu lesen, bis der Auktionator ihn in Richtung Pferch stieß.
Kestrel holte bebend Luft. Ihre Knochen fühlten sich watteweich an. Was hatte sie getan?
Jess schob ihr stützend eine Hand unter den Ellbogen. »Du bist wirklich krank.«
»Und jetzt ziemlich mittellos, würde ich sagen.« Die Frau mit dem spitzen Kinn kicherte. »Sieht so aus, als würde hier jemand unter dem Fluch des Gewinners leiden.«
Kestrel wandte sich ihr zu. »Was meint Ihr damit?«
»Ihr geht nicht oft auf Auktionen, oder? Der Fluch des Gewinners bedeutet, dass man sich bei einer Versteigerung zwar durchsetzt, aber zu einem horrenden Preis.«
Die Menge verlief sich. Schon brachte der Auktionator jemand anderen heraus, doch die Aufregung, die die Valorianer an die Grube gefesselt hatte, hatte sich gelöst. Der Weg war nun frei, Kestrel konnte gehen – sie konnte sich nur nicht bewegen.
»Ich verstehe das nicht«, sagte Jess.
Kestrel ging es nicht anders. Was hatte sie sich nur dabei gedacht? Was hatte sie beweisen wollen?
Nichts, sagte sie sich. Mit dem Rücken zur Grube zwang sie ihren Fuß dazu, den ersten Schritt zu machen, weg von dem, was sie getan hatte.
Überhaupt nichts.
2
Der Wartebereich hinter dem Pferch lag unter freiem Himmel und ging auf die Straße hinaus. Es stank nach ungewaschenen Leibern. Jess blieb in der Nähe und ließ keinen Blick von der Eisentür, die in die gegenüberliegende Mauer eingelassen war. Kestrel versuchte, es ihr nicht gleichzutun. Sie war zum ersten Mal hier. Haussklaven kaufte normalerweise ihr Vater oder der Haushofmeister ihrer Familie, dem die Sklaven unterstanden.
Der Auktionator wartete neben einigen bequemen Stühlen, die für die valorianischen Kunden aufgestellt worden waren. »Ah.« Er strahlte, als er Kestrel sah. »Die Gewinnerin! Ich hoffte, hier zu sein, bevor Ihr eintreffen würdet. Ich habe die Grube verlassen, so schnell ich konnte.«
»Begrüßt du deine Kunden immer persönlich?« Sie war überrascht von seiner Beflissenheit.
»Ja, die guten schon.«
Kestrel fragte sich, wie viel man wohl durch das winzige vergitterte Fenster der Eisentür hören konnte.
»Sonst überlasse ich die Abwicklung meiner Assistentin«, fuhr der Mann fort. »Sie ist gerade in der Grube und versucht, Zwillinge an den Mann zu bringen.« Er verdrehte die Augen angesichts der Schwierigkeit, Geschwister gemeinsam zu verkaufen. »Na ja« – er zuckte die Achseln – »vielleicht will ja jemand ein Pärchen haben.«
Zwei Valorianer betraten den Wartebereich, ein Ehepaar. Der Auktionator lächelte, bat sie, Platz zu nehmen, und erklärte, er werde gleich für sie da sein. Jess flüsterte Kestrel ins Ohr, dass der Mann und die Frau, die sich nun auf zwei niedrigen Stühlen in einer Ecke niederließen, Freunde ihrer Eltern seien. Ob es Kestrel etwas ausmache, wenn sie sie begrüßen ging?
»Nein«, sagte Kestrel. »Es macht mir nichts aus.« Sie konnte es Jess nicht verübeln, dass ihr die unangenehmen Einzelheiten eines Menschenkaufs nicht behagten, selbst wenn jede Stunde ihres Tages von diesem Geschäft geprägt war – von dem Moment an, da eine Sklavin ihr das Morgenbad einließ, bis ihr eine andere vor dem Zubettgehen das Haar löste.
Nachdem Jess sich zu dem Paar gesellt hatte, sah Kestrel den Auktionator vielsagend an. Er nickte. Dann zog er einen großen Schlüssel aus seiner Tasche, ging hinüber zur Tür, um sie aufzuschließen, und trat ein. »Du«, hörte Kestrel ihn auf Herrani blaffen. »Es ist Zeit.«
Es raschelte, und der Auktionator kehrte zurück. Der Sklave folgte ihm.
Er hob den Blick und begegnete dem von Kestrel. Seine Augen waren von einem klaren, kühlen Grau.
Sie schrak zusammen. Diese Farbe war bei einem Herrani durchaus zu erwarten gewesen, und so dachte Kestrel, dass es der dunkelviolette Bluterguss auf seiner Wange sein musste, der seinen Augen einen so unheimlichen Ausdruck verlieh. Ihr war nicht wohl unter seinem Blick. Dann schlug er die Augen nieder. Er sah zu Boden, sodass sein Gesicht von seinem langen Haar verdeckt wurde. Es war noch immer zur Hälfte geschwollen von dem Kampf. Oder der Züchtigung.
Er schien alles um ihn her mit absoluter Gleichgültigkeit aufzunehmen. Kestrel existierte gar nicht, ebenso wenig wie der Auktionator oder er selbst.
Der Auktionator schloss die Eisentür wieder ab. »Und nun …« Er klatschte einmal in die Hände. »Die Kleinigkeit der Bezahlung.«
Sie überreichte ihm ihre Geldbörse. »Ich habe vierundzwanzig Silberlinge.«
Der Auktionator zögerte; er wirkte verunsichert. »Vierundzwanzig ist nicht fünfzig, Herrin.«
»Ich werde meinen Haushofmeister später mit dem Rest zu dir schicken.«
»Oh, aber was, wenn er sich verläuft?«
»Ich bin General Trajans Tochter.«
Er lächelte. »Ich weiß.«
»Die volle Summe bereitet uns keine Schwierigkeiten«, fuhr Kestrel fort. »Ich habe einfach nur beschlossen, heute keine fünfzig Silberlinge mit mir herumzutragen. Mein Wort ist gut genug.«
»Sicher.« Er sagte nicht, dass Kestrel ja später zurückkehren könne, um ihren Einkauf abzuholen und die Summe zu bezahlen. Und Kestrel erwähnte weder die Wut, die ihm anzusehen gewesen war, als der Sklave sich ihm widersetzt hatte, noch ihren Verdacht, dass er sich dafür würde rächen wollen. Die Wahrscheinlichkeit, dass er es tun würde, wuchs mit jedem Augenblick, den der Sklave noch hier verbrachte.
Kestrel sah dem Auktionator beim Denken zu. Er konnte darauf bestehen, dass sie später wiederkam, damit allerdings riskieren, dass er sie beleidigte, und die gesamte Summe verlieren. Oder er konnte nicht einmal die Hälfte der fünfzig Silberlinge einstreichen und den Rest vielleicht niemals erhalten.
Aber er war gerissen. »Darf ich Euch mit Eurem Einkauf nach Hause begleiten? Ich würde gern sehen, dass Schmied sicher ankommt. Euer Haushofmeister kann sich dann um die Bezahlung kümmern.«
Sie warf einen Blick auf den Sklaven. Er hatte bei seinem Namen geblinzelt, den Kopf jedoch nicht gehoben. »Gut«, sagte sie zu dem Auktionator.
Sie ging hinüber zu Jess und fragte den Mann und die Frau, ob sie ihre Freundin nach Hause begleiten würden.
»Natürlich«, antwortete der Mann – Senator Nicon, fiel Kestrel ein. »Aber was ist mit Euch?«
Sie wies mit dem Kopf über die Schulter auf die beiden Männer hinter ihr. »Sie werden mit mir kommen.«
Jess wusste, dass ein Herrani-Auktionator und ein Sklave keine salonfähige Begleitung waren. Auch Kestrel wusste das, und da packte sie wie aus heiterem Himmel Ärger über ihre Situation – eine Situation, die sie selbst heraufbeschworen hatte. Die Regeln, die ihre Welt beherrschten, machten sie krank.
Jess fragte: »Bist du sicher?«
»Ja.«
Das Ehepaar zog die Augenbrauen hoch, beschloss aber offensichtlich, dass es mit der Situation nichts zu schaffen hatte – den Klatsch, den es später darüber verbreiten würde, einmal ausgenommen.
Kestrel verließ den Sklavenmarkt mit dem Auktionator und Schmied im Schlepptau.
Sie schritt rasch durch die angrenzenden Viertel, die diesen schmuddeligen Teil der Stadt vom vornehmen Parkviertel trennten. Das Raster der Straßen war geordnet, rechtwinklig, von valorianischer Hand angelegt. Sie kannte den Weg und doch hatte sie das sonderbare Gefühl, in die Irre zu gehen. Heute erschien ihr alles fremd. Als sie durch das Soldatenquartier kamen, zwischen dessen dicht gedrängten Unterkünften sie als Kind immer herumgelaufen war, sah sie vor ihrem geistigen Auge Soldaten, die sich ihr in den Weg stellten.
Doch natürlich würden all diese bewaffneten Männer und Frauen sterben, um sie zu beschützen, und sie erwarteten von ihr, eine der Ihren zu werden. Kestrel musste nur den Wünschen ihres Vaters entsprechen und der Armee beitreten.
Als die Straßen sich zu verändern begannen, in Richtungen liefen, die unlogisch wirkten, und sich wie Wasserläufe dahinschlängelten, war Kestrel erleichtert. Bäume breiteten ihr grünes Blätterdach über ihr aus. Sie konnte Brunnen hinter steinernen Mauern plätschern hören.
Sie gelangte an eine massive Eisentür. Eine der Wachen ihres Vaters spähte durch das Sichtfenster und riss die Tür auf.
Kestrel richtete weder an den Mann noch an die anderen Wachposten ein Wort, und auch sie sagten nichts zu ihr. Sie übernahm die Führung über das weitläufige Anwesen. Der Auktionator und der Sklave folgten ihr.
Sie war zu Hause. Aber die Schritte hinter ihr auf den Steinplatten des Wegs erinnerten Kestrel daran, dass es nicht immer ihr Zuhause gewesen war. Dieses Anwesen war ebenso wie das gesamte Parkviertel von den Herrani errichtet worden, die es nur anders genannt hatten, als es noch ihnen gehörte.
Sie trat auf den Rasen. Die beiden Männer folgten ihr, und das Geräusch ihrer Schritte wurde nun durch das Gras gedämpft.
Ein gelber Vogel flog zwitschernd zwischen den Bäumen hindurch. Kestrel lauschte, bis das Lied verklang. Sie ging weiter auf die Villa zu.
Das Geräusch, das ihre Sandalen auf dem Marmorboden des Wegs verursachten, hallte sachte von den Wänden wider, die mit herumtollenden Fabelwesen, Blumen und ihr unbekannten Göttern bemalt waren. Ihre Schritte vermischten sich mit dem Plätschern von Wasser, das einem flachen, in den Boden eingelassenen Becken entsprang.
»Ein schönes Haus«, sagte der Auktionator.
Sie warf ihm einen aufmerksamen Blick zu, obwohl sie keine Bitterkeit in seiner Stimme hörte. Sie forschte nach einem Anzeichen, dass er dieses Haus kannte, dass er es vor dem Herranischen Krieg schon einmal aufgesucht hatte – als geehrter Gast, Freund oder gar als Familienmitglied. Doch es war eine törichte Vermutung. Die Villen im Parkviertel hatten adeligen Herrani gehört, und wenn der Auktionator zu ihnen gezählt hätte, wäre er nicht bei dieser Art von Arbeit gelandet. Er wäre Haussklave geworden, vielleicht sogar der Hauslehrer valorianischer Kinder. Falls der Auktionator dieses Haus tatsächlich kannte, dann weil er schon einmal Sklaven für ihren Vater hierhergebracht hatte.
Sie zögerte, Schmied anzuschauen. Als sie es dennoch tat, wollte er ihren Blick nicht erwidern.
Die Haushälterin kam durch den langen Gang, der auf der anderen Seite des Brunnens begann, auf sie zu. Kestrel schickte sie mit dem Auftrag wieder weg, den Haushofmeister zu bitten, mit sechsundzwanzig Silberlingen herzukommen. Als er eintraf, waren seine blonden Augenbrauen zusammengezogen und seine Hände umschlossen mit festem Griff eine kleine Kassette. Harmans Griff wurde noch fester, als er den Auktionator und den Sklaven sah.
Kestrel öffnete die Kassette und zählte dem Auktionator Geld in die ausgestreckte Hand. Er steckte das Silber ein, dann leerte er ihre Börse aus, die er mitgebracht hatte. Mit einer leichten Verbeugung reichte er ihr den schlaffen Beutel zurück. »Es war mir ein großes Vergnügen, mit Euch Geschäfte zu machen.« Er wandte sich zum Gehen.
Sie sagte: »Es wäre besser gewesen, wenn er keine frischen Verletzungen aufweisen würde.«
Der Blick des Auktionators huschte zu dem Sklaven und über seine Lumpenkleider, seine schmutzigen, von Narben übersäten Arme. »Ihr dürft ihn gern untersuchen, Herrin«, sagte er gedehnt.
Kestrel runzelte die Stirn. Ihr behagte die Vorstellung nicht, jemanden zu untersuchen, schon gar nicht ihn. Aber bevor sie eine Antwort herausbrachte, war der Auktionator schon gegangen.
»Wie viel?«, wollte Harman wissen. »Wie viel hat er gekostet – alles in allem?«
Sie sagte es ihm.
Er holte tief Luft. »Euer Vater –«
»Ich werde es meinem Vater selbst erzählen.«
»So, und was soll ich mit ihm anstellen?«
Kestrel sah auf den Sklaven. Er hatte sich nicht gerührt und stand noch immer auf derselben schwarzen Fliese, als wäre es der Holzblock. Er hatte dem gesamten Gespräch keinerlei Beachtung geschenkt und das Valorianisch ausgeblendet, das er wahrscheinlich gar nicht wirklich verstand. Sein Blick ruhte auf einer gemalten Nachtigall, die die gegenüberliegende Wand zierte. »Das ist Schmied«, sagte Kestrel zu dem Haushofmeister.
Harmans Anspannung ließ ein wenig nach. »Ein Hufschmied?« Sklaven wurden manchmal von ihren Herren nach ihrer Arbeit benannt. »Den könnten wir gebrauchen. Ich werde ihn in die Schmiede schicken.«
»Warte. Ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn dort haben will.« Sie wandte sich auf Herrani an Schmied: »Singst du?«
Da sah er sie an, und Kestrel erkannte denselben Ausdruck in seinen Augen wie zuvor im Wartebereich. Seine grauen Augen waren eisig. »Nein.«
Schmied hatte in ihrer Sprache geantwortet. Sein Akzent war nur schwach.
Er wandte sich ab. Das dunkle Haar fiel ihm ins Gesicht und verschleierte sein Profil.
Kestrel bohrte die Nägel in die Handflächen. »Sorge dafür, dass er ein Bad nimmt«, befahl sie Harman mit einer Stimme, von der sie hoffte, dass sie eher bestimmt denn frustriert klang. »Und gib ihm angemessene Kleidung.«
Sie entfernte sich durch den Gang, blieb aber noch einmal stehen. Ein paar weitere Worte entschlüpften ihr: »Und schneidet ihm das Haar.«
Kestrel spürte die Kälte von Schmieds Blick in ihrem Rücken, während sie sich zurückzog. Jetzt war es leicht, diesem Ausdruck in seinen Augen einen Namen zu geben.
Verachtung.
3
Kestrel wusste nicht, was sie sagen sollte.
Ihr Vater hatte einen heißen Tag hinter sich, an dem er Soldaten gedrillt hatte, und deshalb ein erfrischendes Bad genommen. Nun goss er Wasser in seinen Wein. Der dritte Gang wurde serviert: mit Rosinen und zerstoßenen Mandeln gefülltes Hühnchen. Es schmeckte irgendwie trocken
»Hast du geübt?«, fragte er.
»Nein.«
Seine großen Hände hielten mitten in der Bewegung inne.
»Ich hole es nach«, sagte sie. »Später.« Sie trank aus ihrem Pokal und fuhr dann mit dem Daumen darüber. Das Glas war rauchig grün und fein geblasen. Sie hatten es zusammen mit dem Haus übernommen. »Wie sind die neuen Soldaten?«
»Noch grün hinter den Ohren, aber gar nicht so übel.« Er zuckte die Achseln. »Und wir brauchen sie.«
Kestrel nickte. Die Valorianer hatten schon immer gegen Barbaren zu kämpfen gehabt, die in die Grenzgebiete einfielen, und da das Imperium in den vergangenen fünf Jahren gewachsen war, waren derlei Übergriffe häufiger geworden. Die herranische Halbinsel bedrohten sie nicht, aber General Trajan musste oft Bataillone ausbilden, um sie anschließend an die äußersten Grenzen des Imperiums zu entsenden.
Er spießte eine glasierte Karotte auf seine Gabel. Kestrel blickte auf das silberne Essbesteck, dessen Zinken im Kerzenlicht schimmerten. Es war eine Herrani-Erfindung, die schon vor langer Zeit von ihrer eigenen Kultur übernommen worden war. Darüber konnte man als Valorianer leicht vergessen, dass man jemals mit den Fingern gegessen hatte.
»Ich dachte, du warst heute Nachmittag mit Jess auf dem Markt«, sagte er. »Warum isst sie nicht mit uns zu Abend?«
»Sie hat mich nicht nach Hause begleitet.«
Er setzte die Gabel ab. »Wer hat es dann getan?«
»Vater, ich habe heute fünfzig Silberlinge ausgegeben.«
Er machte eine wegwerfende Handbewegung, um ihr zu bedeuten, dass diese Summe keine Rolle spielte. Seine Stimme war ganz ruhig: »Wenn du schon wieder allein durch die Stadt gegangen bist –«
»Bin ich nicht.« Sie erzählte ihm, wer bei ihr gewesen war und warum.
Der General rieb sich die Stirn und kniff die Augen zusammen. »Das war deine Begleitung?«
»Ich brauche keine Begleitung.«
»Du würdest keine brauchen, wenn du beim Militär wärest.«
Und da waren sie wieder beim Thema und rührten an den wunden Punkt eines alten Streits. »Ich werde niemals Soldatin«, sagte sie.
»Das hast du bereits deutlich gemacht.«
»Wenn eine Frau für das Imperium kämpfen und sterben kann, warum kann sie dann nicht allein irgendwohin gehen?«
»Darum geht es ja nicht. Eine Soldatin hat ihre Stärke schon bewiesen und braucht keinen Schutz mehr.«
»Genauso wenig wie ich.«
Der General legte die Hände flach auf den Tisch. Als ein Mädchen erschien, um die Teller abzuräumen, fuhr er sie an, sie solle verschwinden.
»Du glaubst doch nicht im Ernst, dass Jess mich beschützen könnte«, fuhr Kestrel fort.
»Frauen, die keine Soldatinnen sind, haben nicht allein unterwegs zu sein. Das ist so Brauch.«
»Unsere Bräuche sind absurd. Wir Valorianer sind stolz darauf, mit wenig Essen überleben zu können, wenn wir müssen, aber ein Abendessen mit weniger als sieben Gängen ist eine Beleidigung. Ich kämpfe ganz gut, doch wenn ich keine Soldatin bin, ist es so, als hätte es all die Jahre voller Kampfübungen gar nicht gegeben.«
Ihr Vater sah sie fest an. »Deine militärische Stärke lag noch nie im Kampf.«
Was nur eine andere Formulierung dafür war, dass sie eine miserable Kämpferin war.
Sanfter fuhr er fort: »Du bist Strategin.«
Kestrel zuckte die Achseln.
Ihr Vater fragte: »Wer hat denn vorgeschlagen, dass ich die barbarischen Dacrer in die Berge locken soll, als sie die Imperiumsgrenze im Osten angegriffen haben?«
Alles, was sie damals getan hatte, war, das Offensichtliche auszusprechen. Es war klar gewesen, dass die Barbaren blind auf ihre Reiterei bauten. Ebenso klar war gewesen, dass in den trockenen Bergen im Osten Pferde nicht genug Wasser finden würden. Wenn jemand Stratege war, dann ihr Vater. Genau jetzt setzte er aus strategischen Gründen Schmeichelei ein, um zu bekommen, was er wollte.
»Stell dir vor, von welch großem Nutzen es für das Imperium wäre, wenn du wirklich mit mir zusammenarbeiten würdest«, sagte er. »Und wenn du dein Talent dazu gebrauchen würdest, das Imperium zu sichern, anstatt die Logik von Bräuchen, die unsere Gesellschaft ordnen, infrage zu stellen.«
»Unsere Bräuche sind Lügen.« Kestrels Finger umklammerten den zarten Stiel ihres Pokals.
Der Blick ihres Vaters fiel auf ihre weißen Knöchel. Er griff nach ihrer Hand. Ruhig, fest meinte er: »Es sind nicht meine Regeln. Es sind die des Imperiums. Kämpfe für es, und du bekommst deine Unabhängigkeit. Tu es nicht und nimm Einschränkungen hin. Wie auch immer, lebe nach unseren Gesetzen.« Er hob den Zeigefinger. »Und beschwere dich nicht.«
Dann würde sie gar nichts mehr sagen, beschloss Kestrel. Sie entriss ihm ihre Hand und stand auf. Ihr fiel ein, wie der Sklave Schweigen als Waffe eingesetzt hatte. Man hatte um ihn gefeilscht, ihn herumgeschubst, an ihm gezerrt, ihn beäugt. Er würde gebadet, geschoren, angekleidet werden. Und doch hatte er sich geweigert, alles aufzugeben.
Kestrel erkannte Stärke, wenn sie sie sah.
Das galt auch für ihren Vater. Er sah sie an und kniff seine hellbraunen Augen zusammen.
Sie verließ den Speiseraum und stahl sich durch den Nordflügel der Villa, bis sie eine Doppeltür erreichte. Sie öffnete sie und ertastete sich den Weg durch den dunklen Innenraum bis zu einem silbernen Kästchen und einer Öllampe. Ihre Finger waren vertraut mit diesem Ritual. Es war kein Problem, die Lampe blind anzuzünden. Sie konnte auch blind spielen, aber sie wollte es nicht riskieren, einen falschen Ton zu spielen. Nicht heute Abend, nicht wenn sie schon tagsüber den falschen Ton und die falschen Entscheidungen getroffen hatte.
Sie ging um das Klavier in der Mitte des Raums herum, wobei sie mit der Handfläche über seine ebene, polierte Oberfläche fuhr. Das Instrument war eines der wenigen Dinge, die ihre Familie aus der Hauptstadt mitgebracht hatte. Es hatte ihrer Mutter gehört.
Kestrel öffnete mehrere Glastüren, die auf den Garten hinausgingen. Sie atmete die Nacht ein und sammelte die Luft in ihren Lungen.
Sie roch Jasmin. Vor ihrem geistigen Auge sah sie die winzige Blume im Dunkeln blühen, jedes Blütenblatt steif und spitz zulaufend und vollkommen. Wieder dachte sie an den Sklaven und wusste nicht, warum.
Sie blickte auf ihre verräterische Hand, die, die sich in die Luft gestreckt hatte, um den Blick des Auktionators auf sich zu ziehen.
Kestrel schüttelte den Kopf. Sie wollte nicht mehr an den Sklaven denken.
Sie setzte sich vor die Reihe von schwarzen und weißen Tasten des Instruments; es waren fast hundert.
Dies war nicht die Art von Übung, die ihr Vater im Sinn gehabt hatte. Er hatte ihre täglichen Einheiten mit dem Hauptmann seiner Wache gemeint. Nun, sie wollte sich nicht im Kampf mit Nadeln üben und ebenso wenig mit allem anderen, was ihr Vater für sinnvoll erachtete.
Ihre Finger ruhten auf den Tasten. Sie drückte leicht, noch nicht fest genug, damit die Hämmer im Innern die Metallsaiten anschlagen konnten.
Sie holte tief Luft und begann dann zu spielen.
4
Sie hatte ihn vergessen.
Drei Tage waren vergangen, und die Herrin des Hauses schien gar nicht mehr zu wissen, dass sie zu den 48 Dienstboten des Generals einen weiteren Sklaven gekauft hatte.
Der Sklave war sich nicht sicher, ob er darüber erleichtert sein sollte.
Die ersten beiden Tage waren ein Segen gewesen. Er konnte sich nicht daran erinnern, wann man ihm zum letzten Mal erlaubt hatte, auf der faulen Haut zu liegen. Das Bad war wunderbar heiß gewesen, und die Seife hatte ihn erstaunt in den Dampf stieren lassen. Sie schäumte mehr als jede andere, die er in den vergangenen Jahren benutzt hatte.
Danach fühlte sich seine Haut wie neu an, und obwohl er den Kopf starr gehalten hatte, während ihm ein anderer Herrani-Sklave das Haar schnitt, und sich immer noch Locken, die nun nicht mehr da waren, aus dem Gesicht strich, fand er schon am zweiten Tag, dass es ihm kaum noch etwas ausmachte. Er sah nun klar auf seine Welt.
Am dritten Tag kam der Haushofmeister ihn holen.
Der Sklave war auf dem Anwesen umhergelaufen, da er keine Befehle bekam. Der Zutritt zum Haus war verboten, aber er war zufrieden damit, es von außen zu betrachten. Er zählte die Unmengen von Fenstern und Türen. Er legte sich ins warme Gras, das seine Füße kitzelte, und freute sich, dass seine Hände nicht zu schwielig geworden waren, um den Widerstand der grünen Halme zu spüren. Das Ocker der Mauern glänzte im Licht und verblasste dann. Er prägte sich ein, in welchen Räumen es im Haus zu welcher Tageszeit dunkel wurde. Er sah in die Orangenbäume hinauf. Manchmal schlief er.
Die anderen Sklaven bemühten sich nach Kräften, ihn nicht zu beachten. Zuerst warfen sie ihm Blicke zu, die von Groll über Verwirrung bis hin zu Neid reichten. Er konnte sich nicht dazu durchringen, sich etwas daraus zu machen. Sobald er in die Sklavenunterkünfte geführt worden war – sie lagen in einem Gebäude, das fast genauso wie die Stallungen aussah –, hatte er die Hackordnung der Herrani begriffen, die sich in den Diensten des Generals befanden. Er stand ganz unten.
Er aß sein Brot wie die anderen auch und zuckte die Achseln, wenn er gefragt wurde, warum ihm keine Arbeit aufgetragen worden war. Er antwortete auf direkte Fragen. Meistens jedoch hörte er nur zu.
Am dritten Tag legte er im Geiste eine Karte von den Außengebäuden an: den Sklavenunterkünften, den Stallungen, den Kasernen der Leibgarde des Generals, der Schmiede, den kleinen Lagerschuppen, einem Häuschen in der Nähe des Gartens. Das Anwesen war sehr weitläufig, besonders wenn man bedachte, dass es noch immer in der Stadt lag. Der Sklave hatte sich glücklich geschätzt, dass ihm so viele freie Stunden zur Verfügung standen, um es zu erkunden.
Nun saß er in einiger Höhe auf einem sanften Hügel am Obstgarten, sodass er den Haushofmeister von der Villa aus auf ihn zukommen sah, lange bevor dieser ihn erreichte. Das gefiel dem Sklaven. Es bestätigte den Verdacht, den er hegte: dass das Gut von General Trajan nicht leicht zu verteidigen sein würde, wenn man es nur richtig angriff. Das Anwesen war wahrscheinlich deshalb dem General übertragen worden, weil es das größte und schönste in der ganzen Stadt war und außerdem ideal für das Unterhalten von Leibwächtern und Pferden. Doch die baumbestandenen Hänge, die das Haus umgaben, würden Feinden Vorteile bieten. Der Sklave fragte sich, ob der General dies wirklich nicht erkannte. Andererseits wussten die Valorianer ja gar nicht, wie es war, in ihrem eigenen Heim überfallen zu werden.
Der Sklave verbot sich weitere Gedanken. Sie drohten seine Vergangenheit aufzuwühlen. Er zwang seinen Geist, wie gefrorene Erde zu werden: hart und öde.
Er beobachtete den Haushofmeister, der den Hügel heraufschnaufte. Dieser war einer der wenigen valorianischen Diener – wie die Haushälterin –, deren Stellung zu wichtig war, um sie einem Herrani zu übertragen. Der Sklave vermutete, dass der Haushofmeister gut bezahlt wurde. Gut gekleidet war er jedenfalls, und zwar in die golddurchwirkten Stoffe, die die Valorianer bevorzugten. Das lichte Haar des Mannes flatterte in der Brise. Im Näherkommen hörte der Sklave, wie er auf Valorianisch etwas murmelte, und wusste, dass er der Grund für den Groll des Haushofmeisters war.
»Du«, sagte der in schwerfälligem Herrani. »Da du sein, du fauler Nichtsnutz.«
Der Sklave erinnerte sich an den Namen des Mannes – Harman –, benutzte ihn aber nicht. Er sagte gar nichts, ließ es nur geschehen, dass Harman seinem Ärger Luft machte. Es erheiterte ihn zu hören, wie der Mann seine Muttersprache verunstaltete. Der Akzent des Haushofmeisters war aber auch zu komisch, seine Grammatik noch schlimmer. Unschlagbar war nur sein Vokabular an Beleidigungen.
»Du kommen.« Harman wedelte mit der Hand, um ihm zu bedeuten, dass er ihm folgen sollte.
Der Sklave begriff rasch, dass er zur Schmiede geführt wurde.
Eine Herrani wartete davor. Er erkannte sie, obwohl er sie nur zu den Mahlzeiten und abends sah. Sie hieß Lirah und arbeitete im Haus. Sie war hübsch. Jünger als er, wahrscheinlich zu jung, um sich noch an den Krieg zu erinnern.
Harman begann, Valorianisch mit ihr zu sprechen. Der Sklave versuchte, geduldig zu bleiben, während Lirah für ihn übersetzte.
»Lady Kestrel soll nicht damit behelligt werden, dir eine Aufgabe zuzuteilen, und so habe ich –« Sie wurde rot. »Ich meine, er« – sie wies mit dem Kopf auf Harman – »hat beschlossen, dir Arbeit zu geben. Normalerweise kümmert sich die Leibgarde des Generals selbst um die Reparatur ihrer Waffen, und man bezahlt einen valorianischen Schmied aus der Stadt dafür, dass er neue Waffen schmiedet.«
Der Sklave nickte. Es gab gute Gründe, warum die Valorianer nur wenige Herrani-Schmiede ausbildeten. Man musste sich nur einmal in der Schmiede umsehen, um das zu verstehen. Wer die schweren Werkzeuge sah, erriet, welche Kraft für ihre Handhabung nötig war.
»Das wirst ab jetzt du tun«, fuhr Lirah fort. »Solange du dich als nützlich erweist.«
Harman nahm das Schweigen, das eintrat, als Einladung, erneut das Wort zu ergreifen. Lira übersetzte. »Heute wirst du Hufeisen schmieden.«
»Hufeisen?« Das war zu leicht.
Lirah lächelte ihm mitfühlend zu. Sie sprach mit ihren eigenen Worten, ohne Harmans gestelzte Worte zu wiederholen. »Sie stellen dich auf die Probe. Du sollst bis Sonnenuntergang so viele Hufeisen schmieden, wie du kannst. Kannst du auch ein Pferd beschlagen?«
»Ja.«
Lirah schien diese Antwort um seinetwillen zu bedauern. Sie gab sie an den Haushofmeister weiter, der daraufhin sagte: »Dann wird er das morgen tun. Jedes Pferd im Stall braucht neue Hufeisen.« Er schnaubte. »Wir werden ja sehen, wie diese Kreatur mit den anderen auskommt.«
Vor dem Krieg hatten die Valorianer die Herrani bewundert, sogar beneidet – ja, beneidet. Danach schien es, als wäre der Bann gebrochen oder als hätte man sie mit einem neuen belegt. Der Sklave hatte es nie ganz glauben können. Irgendwie war »Kreatur« möglich geworden. Irgendwie beschrieb das Wort ihn. Diese Entdeckung war zehn Jahre alt, und doch musste er sie jeden Tag erneut machen. Sie hätte sich durch die Wiederholung abnutzen sollen. Stattdessen war er wund von ihrem Stachel, der ihn noch immer überraschend traf. Ihm kam vor heruntergeschlucktem Zorn die Galle hoch.
Der freundliche, geübte Ausdruck auf Lirahs Gesicht war noch immer da. Sie deutete auf den Kohleverschlag, die Kienspäne und die Haufen von Roh- und Alteisen. Der Haushofmeister stellte eine Schachtel mit Schwefelhölzern auf den Amboss. Dann gingen beide davon.
Der Sklave sah sich in der Schmiede um und überlegte, ob er die Probe bestehen oder durchfallen sollte.
Er seufzte und entfachte das Feuer.
Es war vorbei mit der Muße. An seinem ersten Tag in der Schmiede fertigte der Sklave über fünfzig Hufeisen an – genug, um fleißig und geschickt zu wirken, aber nicht genug, um aufzufallen. Am folgenden Tag beschlug er alle Pferde, selbst die, die bereits neue Hufeisen trugen. Der Stallbursche warnte ihn, dass einige Pferde gefährlich werden könnten, vor allem die Hengste des Generals. Aber der Sklave hatte keinerlei Schwierigkeiten mit ihnen. Er sorgte allerdings dafür, dass er den ganzen Tag mit seinem Auftrag beschäftigt war. Er mochte es, dem leisen Wiehern der Pferde zu lauschen und ihren sanften, warmen Atem zu spüren. Außerdem waren die Stallungen ein geeigneter Ort, um Neuigkeiten aufzuschnappen – zumindest wären sie das gewesen, wenn ein Soldat gekommen wäre, um ein Pferd zu reiten.
Oder wenn das Mädchen gekommen wäre.
Der Sklave galt bald als guter Einkauf. Lady Kestrel habe ein gutes Auge, sagte Harman widerwillig, und der Sklave bekam mehrere Waffen zur Reparatur, ebenso wie Aufträge für das Schmieden neuer Waffen.
In der Abenddämmerung, wenn der Sklave von der Schmiede über das Anwesen zu seiner Unterkunft lief, erstrahlte die Villa von Licht. Es herrschte Ausgangssperre und Schlafenszeit für die Sklaven, aber die rastlosen Valorianer würden noch lange nicht zu Bett gehen. Sie übten, mit wenig Schlaf auszukommen, vielleicht mit sechs Stunden pro Nacht – oder weniger, wenn nötig. Unter anderem war es das gewesen, was ihnen geholfen hatte, den Krieg zu gewinnen.
Der Sklave war der Erste, der sich auf der Pritsche ausstreckte. Jeden Abend versuchte er, die Ereignisse des Tages noch einmal durchzugehen und nützliche Informationen daraus zu ziehen. Aber alles, was er erlebt hatte, war harte Arbeit.
Erschöpft schloss er die Augen. Er fragte sich, ob die beiden Tage des Müßiggangs sich nicht doch noch als Unglück herausstellen würden. In dieser Zeit hatte er ganz vergessen, wer er war. Sie spielte seinem Kopf Streiche.
Und manchmal, wenn er schon hinüberdämmerte, meinte er, Musik zu hören.
5
Normalerweise empfand Kestrel ihr Zuhause als einen Ort, in dem es vor Leere hallte, weil der Großteil der Räume, obwohl sie schön waren, nicht bewohnt war. Auch auf dem Außengelände war es meist ruhig, es gab nur leise Geräusche: das Kratzen einer Hacke im Garten, das ferne Trappeln von Pferdehufen von der Koppel weit hinter dem Haus, das Seufzen der Bäume. Normalerweise genoss es Kestrel, wie dieser Ort und diese Ruhe ihre Sinne schärften.
Seit Kurzem jedoch fand sie zu Hause keinen Frieden. Sie sonderte sich mit ihrer Musik ab, aber dann spielte sie nur schwierige Stücke mit Noten, die sich dicht aneinanderdrängten, und ihre Finger jagten über die Tasten. Das Üben laugte sie aus. Die Steifheit war nebensächlich und saß nur an bestimmten Stellen – in ihren Handgelenken, im unteren Rücken –, aber wenn sie nicht spielte, konnte sie das Stechen und Zwicken nicht ignorieren. Jeden Morgen schwor sie sich wieder, dass sie das Klavierspiel langsam angehen lassen würde. Aber in der Abenddämmerung, nachdem sie stundenlang das Gefühl gehabt hatte, als würde sie ersticken – nein, eher, als würde sie sich in ihrem eigenen Haus vergraben –, rang sie der Musik doch wieder ein anspruchsvolles Stück ab.
Eines Nachmittags, vielleicht acht Tage nach der Auktion, kam eine Nachricht von Jess. Kestrel öffnete sie schnell, froh über die Abwechslung. In ihrer typischen Schnörkelschrift und kurzen, ungeduldigen Sätzen fragte Jess, warum Kestrel sich vor ihr versteckte. Werde sie Jess heute bitte besuchen kommen? Kestrels Rat, was zum Picknick von Lady Faris anzuziehen wäre, sei vonnöten. Jess fügte ein Postskriptum hinzu: einen Satz in kleinerer Schrift, mit eng stehenden, eilig hingeworfenen Buchstaben, was anzeigte, dass sie sich einen Wink mit dem Zaunpfahl nicht verkneifen konnte, auch wenn sie gleichzeitig Sorge hatte, Kestrel damit zu verärgern: Übrigens hat mein Bruder nach dir gefragt.
Kestrel griff nach ihren Reitstiefeln.
Während sie ihre Gemächer durchmaß, erhaschte sie durch ein Fenster einen Blick auf das strohgedeckte Häuschen in der Nähe des Gartens.
Kestrel blieb stehen, sodass die Lederstiefel in ihren Händen gegen ihren Oberschenkel stießen. Das Häuschen war nicht sehr weit entfernt von den Sklavenunterkünften, die sich am Rande des Gesichtsfeldes im Fenster andeuteten. Sie spürte ein unangenehmes Ziehen.
Natürlich. Kestrel wandte den Blick von den Sklavenunterkünften ab und fasste Enais Häuschen ins Auge. Sie hatte ihre alte Kinderfrau schon einige Tage nicht mehr gesehen. Kein Wunder, dass der Ausblick sie bekümmerte, zeigte er doch das hübsche Häuschen, das auf Kestrels Wunsch hin für die Frau, die sie aufgezogen hatte, errichtet worden war. Nun, sie würde Enai auf dem Weg zu den Stallungen einen Besuch abstatten.
Aber als sie endlich ihre Stiefel zugeschnürt hatte und auf dem Weg nach unten war, hatte der Haushofmeister bereits dank der eifrigen Gerüchteküche im Haus erfahren, dass Kestrel ausgehen wollte. Harman lauerte ihr an der Tür zum Salon auf.
»Ihr reitet aus, Herrin?«
Sie streifte einen Handschuh über. »Wie du siehst.«
»Ihr braucht Euch nicht um eine Begleitung zu kümmern.« Fingerschnippend gab er einem älteren Herrani, der den Boden schrubbte, Zeichen. »Der hier wird genügen.«
Kestrel atmete langsam aus. »Ich reite zu Jess.«
»Ich bin sicher, dass er reiten kann«, erwiderte Harman, obwohl sie beide sehr gut wussten, dass das nicht besonders wahrscheinlich war. Reiten wurde den Sklaven nicht beigebracht. Entweder hatten sie es vor dem Krieg gelernt, oder sie würden es nie lernen. »Wenn nicht«, sagte Harman, »dann könnt Ihr zusammen die Kutsche nehmen. Der General wird gern zwei Kutschpferde entbehren, damit Ihr angemessene Begleitung habt.«
Kestrel nickte kaum wahrnehmbar. Sie wandte sich zum Gehen.
»Herrin, noch eines …«
Kestrel wusste, was dieses eine sein würde, konnte ihm aber nicht den Mund verbieten, denn sonst hätte sie zugegeben, dass sie es wusste, und wünschte, sie wüsste es nicht.
»Eine Woche ist vergangen, seitdem Ihr diesen jungen Sklaven gekauft habt«, sagte der Haushofmeister. »Ihr habt noch keine Anweisung erteilt, wie er einzusetzen ist.«
»Ich habe es vergessen«, log Kestrel.
»Natürlich. Ihr habt Wichtigeres zu tun. Dennoch war ich mir sicher, es könne nicht Eure Absicht sein, dass er auf der faulen Haut liegt und nichts tut. Deshalb habe ich ihn als Hufschmied für die Pferde eingesetzt. Er macht seine Sache gut. Meinen Glückwunsch, Lady Kestrel. Ihr habt einen hervorragenden Blick für gute Herrani-Sklaven.«
Sie sah ihn an.
Wie um sich zu verteidigen, sagte er: »Ich habe ihn nur in der Schmiede eingesetzt, weil er dafür geeignet war.«