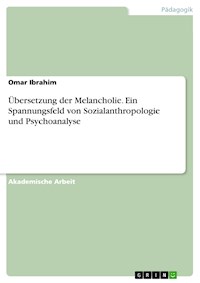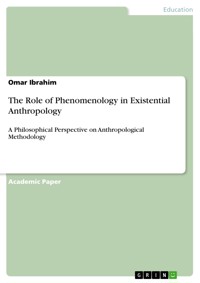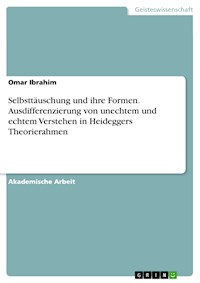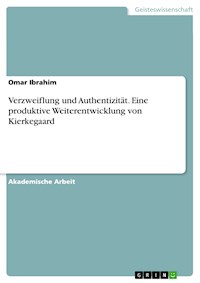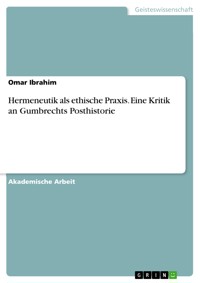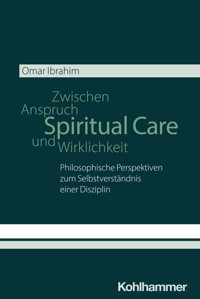
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer Verlag
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
"Spiritual Care" ist ein unklarer und damit auch umstrittener Begriff. Folglich fehlt bislang auch ein klares Verständnis davon, was genau diese Disziplin auszeichnet, welche Ziele sie verfolgen und Wege sie beschreiten soll. Aus einer philosophischen Perspektive beleuchtet dieser Band theoretische, praktische und professionalisierungsbezogene Problemfelder von Spiritual Care und strukturiert sie zugleich. Hierbei deckt er sowohl theoretische Leerstellen als auch praktische Holzwege auf. Die philosophische Untersuchung beabsichtigt letztlich, ein grundlagentheoretisches Selbstverständnis dieser noch jungen Disziplin zu ermöglichen und Klarheit zu verschaffen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 374
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Omar Ibrahim
Spiritual Care – Zwischen Anspruch und Wirklichkeit
Philosophische Perspektiven zum Selbstverständnis einer Disziplin
Verlag W. Kohlhammer
1. Auflage 2025
Alle Rechte vorbehalten
© W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Gesamtherstellung: W. Kohlhammer GmbH, Heßbrühlstr. 69, 70565 Stuttgart
Print:
ISBN 978-3-17-046003-4
E-Book-Formate:
PDF: ISBN 978-3-17-046004-1
epub: ISBN 978-3-17-046005-8
Für den Inhalt abgedruckter oder verlinkter Websites ist ausschließlich der jeweilige Betreiber verantwortlich. Die W. Kohlhammer GmbH hat keinen Einfluss auf die verknüpften Seiten und übernimmt hierfür keinerlei Haftung.
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Inhalt
Cover
Geleitwort
1 »Spiritual Care«: Eine umstrittene Variable
2 Philosophie: Mehr als nur eine Bezugsdisziplin
2.1 Einsichtsfähigkeit: Inferentielle Hermeneutik
2.2 Urteilsfähigkeit: Transzendentalkritische Analyse
2.3 Reflexionsfähigkeit: Normative Skepsis
3 Theoriedefizite in Spiritual Care
3.1 Wissenschaftsphilosophie: Theoriebildung für das Disziplinverständnis
3.2 Ontologie: Spiritualitätsbegriff als Herausforderung
4 Praxisdefizite in Spiritual Care
4.1 Handlungsphilosophie: Probleme der Assessmentlogik
4.2 Sprachphilosophie: Komplexität des Carebegriffs
5 Professionalisierungsdefizite in Spiritual Care
5.1 Epistemologie: Wie gelingt eine Qualitätssicherung?
5.2 Differenztheorie: Die Frage nach der Expertise
6 Anspruchsbezogene Defizite in Spiritual Care
6.1 Ethik: Gegen eine Systemimmanenz
6.2 Sozialphilosophie: Gesellschaftliche Anforderungen
7 Vermittelbarkeit: Theorie und Praxis
7.1 Philosophische Anthropologie: Bildsamkeit
7.2 Diskurstheorie: Kommunikatives Handeln in Praxis und Lehre
8 Grenzen der Philosophie
Danksagung
Literatur
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Geleitwort
Die vorliegende Untersuchung ist im Kontext der Dissertation von Omar Ibrahim mit dem Titel »Philosophical Care. Entwurf einer praxistheoretischen Grundlegung« entstanden, die an der Abteilung Seelsorge, Religionspsychologie und Religionspädagogik am Institut für Praktische Theologie der Theologischen Fakultät der Universität Bern verfasst wurde. Es handelt sich um eine Art Nebenprodukt einer exzellenten Promotion, das nun noch vor derselben erscheint. Schon diese Informationen zeigen, dass wir es mit einem äußerst vielseitigen und hochbegabten Forscher zu tun haben, der sich beeindruckende interdisziplinäre Kompetenzen erworben hat und von dem wir auch in Zukunft in wissenschaftlicher Hinsicht noch einiges erwarten dürfen. Bei all dem muss festgehalten werden, dass es eine bestimmte Disziplin ist, die seine Sicht und seine Orientierung fundiert, nämlich die Philosophie. Ihr fühlt Omar Ibrahim sich im Innersten verpflichtet, und sie ist es, die es ihm ermöglicht, einen Zugang zu anderen Fachgebieten, Untersuchungsgegenständen und Themen zu finden, die diese in gänzlich neuem Licht erscheinen lassen. So verhilft er im vorliegenden Werk der Spiritual Care zu mehr Klarheit über ihre eigenen Grundlagen, Praktiken und Zielsetzungen. Messerscharfe und methodisch strenge philosophische Analysen kennzeichnen sein Vorgehen. Sie dienen dem Ziel, die gegenwärtig noch allzu große Lücke, die zwischen Anspruch und Wirklichkeit von Spiritual Care klafft, schließen zu helfen – eine Lücke, die weder die Theologie noch die Medizin zu schließen vermocht hätte, weshalb diese um so dankbarer zur Kenntnis nehmen dürfen, dass dies nun von philosophischer Seite geschehen konnte.
Bern, im Oktober 2024 Isabelle Noth
1»Spiritual Care«: Eine umstrittene Variable
Anspruch und Wirklichkeit
Zwischen Anspruch und Wirklichkeit klafft eine Lücke. Dies ist an sich nicht problematisch. Denn der Anspruch wirft sich über die Wirklichkeit hinaus auf etwas, das es zu erreichen gilt. Er zeigt auf einen Zustand des Sollens, während die Wirklichkeit das momentane Sein beschreibt. Zwischen jenem Sein und Sollen findet sich die Lücke, die es zu überbrücken gilt. Entsprechend kann es im besten Fall auch möglich sein, dass Sein und Sollen zusammenfallen. Wie dies geschieht – ob es nun an der Struktur, dem Prozess oder am Ergebnis liegt – hängt jeweils von Situation und Vorhaben ab.
Wie und ob Spiritual Care es schafft, Wirklichkeit und Anspruch zusammenzuführen, die Lücke zwischen ihnen zu schließen, scheint fraglich zu sein. Dies zeigt sich schon anhand der wachsenden Publikationen zur Thematik. Man bemüht sich offenbar darum, herauszufinden, was genau Spiritual Care ist und wie sie bestmöglich gelingen kann. Problematisch wird dieses Vorhaben, wenn weder klar ist, was Spiritual Care genau sein soll (Wirklichkeit), noch wenn man weiß, wie sie tatsächlich als gelungen bezeichnet werden kann (Anspruch). Man arbeitet entsprechend mit zwei unbekannten Variablen, die man miteinander durch wissenschaftliche Bemühung, Erkenntnis und die erfolgreiche Implementierung in der Praxis gleichsetzen will. Potenziert wird die Problemstellung dadurch, dass auch das nötige Rüstzeug fehlt, um sich über Struktur, Prozess und Ergebnisse jener Bemühungen zu vergewissern. Wie und mit welchen Mitteln kann überprüft werden, was Spiritual Care ist und wie sie gelingt? Wie soll sich dies begründen und überprüfen lassen? Man stößt hier schnell auf grundlagentheoretische Fragestellungen und Herausforderungen.
In der vorliegenden Arbeit soll es darum gehen, das nötige Rüstzeug dazu zu liefern, dass sich Spiritual Care als Disziplin selbst verstehen kann und genügend Instrumente zur Hand hat, um ihre grundlagentheoretische Bemühung von Anspruchsbestrebung und Wirklichkeitsreflexion erfassen und überprüfen zu können. Es wird sich zeigen, dass die Philosophie eine zentrale Stellung für dieses Vorhaben einnehmen kann. Die Philosophie bietet Perspektiven, anhand welcher sich die Disziplin Spiritual Care selbst vergewissern und überprüfen kann.[1]
Wichtig für die Beleuchtung von Spiritual Care ist zuallererst die Unterscheidung zwischen Spiritual Care (in ihrer Theorie- und Praxisentwicklung) an sich (Wirklichkeit) und der Art und Weise wie sie sich im Diskurs darstellen will (Anspruch). Dass dabei unterschiedliche Deutungsvarianten, religiöse sowie politische und wissenschaftsakademische Interessen einflussreich und ausschlaggebend sind, führt dazu, dass die Positionsdarstellungen nicht immer sachgemäß oder unverzerrt präsentiert werden oder dass mit der Positionierung ganz bestimmte Interessen verfolgt werden. Dies muss für die vorliegende Darstellung unweigerlich berücksichtigt werden.
Um ein solches Vorhaben zum Selbstverständnis von Spiritual Care überhaupt in Gang setzen zu können, muss daher expliziert werden, was unter dem Term Spiritual Care gemeinhin verstanden wird. Indem man das Vorverständnis offenlegt, wird die Untersuchung in ihrer eigenen Positionierung aufgezeigt und kritisch reflektiert. Das bedeutet, dass die vorliegende Untersuchung die eigene Perspektivität der Zugangsweise auf die Thematik und die Dynamik des Untersuchungsgegenstandes in die Analyse miteinbezieht.
Ein erster Ansatz für ein Vorverständnis von Spiritual Care findet sich demgemäß bei Traugott Roser. Er definiert Spiritual Care wie folgt: »Spiritual Care ist die Organisation gemeinsamer Sorge um die individuelle Teilnahme und Teilhabe an einem als sinnvoll erfahrenen Leben im umfassenden Verständnis« (Roser, 2017: 15). Dieses Verständnis ist dahingehend unbefriedigend, weil die Definition einerseits zu weit und andererseits zu eng ist. Zu weit ist sie deshalb, weil die gemeinsame Sorge um individuelle Teilnahme und Teilhabe an einem als sinnvoll erfahrenen Leben auch sozialstaatliche und pädagogische Praktiken mit umschließt. Die Bildung von Menschen sowie die materielle Deckung von Grundbedürfnissen, das demokratische Partizipationsrecht etc. sind alles auch Formen der gemeinsamen Sorge um eine solche Teilhabe und Teilnahme. Dies ist jedoch nicht spezifisch als Spiritual Care zu verstehen. Zugleich ist das Verständnis zu eng, weil die Teilnahme und Teilhabe an einem als sinnvoll erfahrenen Leben nicht mehr für alle Menschen möglich ist. Dies ist beispielsweise für Sterbende, schwer Kranke etc. der Fall, wo eine oberflächliche Hoffnung und ein klischeehaftes Heilsversprechen den Situationen nicht genügen kann. Vieles kann nicht ganz sein, muss losgelassen werden, ist sinnlos und bleibt Fragment (Rüegger, 2023: 130).
Aufschlussreicher scheint hingegen die Definition von Doris Nauer zu sein. Sie beschreibt Spiritual Care in folgenden Worten: »Spiritual Care – ein interdisziplinär angelegtes theoretisches Konzept individuumszentrierter spiritueller Begleitung, dem ein ganzheitliches Menschenbild mit ausdrücklicher Fokussierung auf die spirituelle Dimension menschlicher Existenz zugrunde liegt« (Nauer, 2015: 47, H.i.O.). Interessant und auffällig ist hier, dass Nauer von einem interdisziplinären Ansatz ausgeht. Ist Spiritual Care also selbst keine Disziplin, sondern ein Amalgam verschiedenster anderer Bereiche? Oder lässt sich Spiritual Care in andere Disziplinen einordnen? »Wer zum Beispiel Spiritual Care der Medizin zuordnet oder Spiritual Care mit Krankenhausseelsorge in eins setzt oder Spiritual Care zur Medizin und Krankenhausseelsorge in ein Kontrastverhältnis bringt, dem steht jeweils ein konkreter Ansatz vor Augen« (Knoll, 2020: 345, H.i.O.). Welches Verständnis also tragend und maßgebend ist, übt auch einen Einfluss darauf aus, wie Spiritual Care praktiziert wird. Wirklichkeit und Anspruch sind daher auf die je besondere Situation des grundlagentheoretischen Ausgangspunktes angewiesen.
Es ist hier nicht möglich, alle Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen den verschiedenen Ansätzen und Beschreibungsweisen von Spiritual Care systematisch herauszuarbeiten. Und es handelt sich auch nicht nur um eine Begriffsfrage von Synonymen (Wild, 2023: 16). Für die vorliegende Arbeit lohnt es sich jedoch, zumindest auf einen Aspekt von vielen einzugehen, der auch mit dafür verantwortlich ist, weshalb sich Spiritual Care als Form der sorgenden Tätigkeit überhaupt erst entwickelt hat. »Auch wenn die Palliative Care weder die erste noch einzige Quelle darstellte, so trug sie doch wesentlich dazu bei, in den darauffolgenden Jahrzehnten eine interprofessionelle Spiritual Care im Gesundheitswesen vieler Länder zu etablieren« (Peng-Keller, 2021: 35). Seelsorge, Medizin und Psychologie können ebenfalls als Quellen betrachtet werden. Ihnen allen liegt die Idee zugrunde, Menschen irgendwie zu helfen, sich um sie zu sorgen (Care-Tätigkeit). Wie sich Spiritual Care zu diesen einzelnen Disziplinen verhält, scheint vorerst noch unklar. Entsprechend wird in der vorliegenden Untersuchung auf eine Auswahl von Darstellungen von Spiritual Care eingegangen und Spiritual Care nach dem eigenen Verständnis gegenüber der Seelsorge und anderen Disziplinen durch eine philosophische Perspektive positioniert. Dies bedarf jedoch vorerst weiterer grundlegender Erklärungen.
Disziplin, Multidisziplinarität und Handlungswissenschaft
Roser spricht bei Spiritual Care von Organisation und Nauer von einem theoretischen Konzept. Auch dies sind wiederum Festlegungen, die kritisiert werden können. Weder scheint es ersichtlich zu sein, wofür, auf welchen Ebenen und was für eine Organisation Spiritual Care genau sein soll. Noch scheint ein theoretisches Konzept unbefriedigend zu sein, weist doch der Begriff Care auf weitaus mehr hin als nur auf theoretische Konzepte, auch wenn diese letztlich in die Praxis individuumszentrierter spiritueller Begleitung münden.
Für die vorliegende Untersuchung wird daher bei Spiritual Care von einer Disziplin ausgegangen. Als Disziplin sollen hier untereinander zusammenhängende Einzel- beziehungsweise Grundlagenwissenschaften verstanden werden, deren Vertreter und Vertreterinnen sich auf einen gemeinsamen Gegenstand oder einen spezifischen Forschungsbereich geeinigt und einen besonders strukturierten wissenschaftlichen Zugang dazu institutionalisiert haben (Staub-Bernasconi, 2018: 137). Der gemeinsame Forschungsgegenstand besteht daher in der Care und zwar nicht in irgendeiner Care, sondern in Spiritual Care. Zusammenhängend sind sie (Gegenstand und Forschungsbereich) nicht nur deshalb, weil sie aufeinander Bezug nehmen, sondern als Disziplin ein mehr oder minder konsistentes und kohärentes Gebilde von Ansätzen, Methoden, Untersuchungen etc. bilden.
Spiritual Care ist daher nicht nur irgendeine Organisation, sondern weist eine strukturierte wissenschaftliche Prägung auf. »Prägung im Sinne von Gegenstandskonstitution meint, dass durch die verwendeten Begriffe und die Sprachformen die Wirklichkeit in dem, was sie ist und entsprechend auch als was sie erfahrbar wird, geprägt wird« (Böhme, 1994: 42f; H.i.O.).
Daraus folgt, dass Wirklichkeit und Anspruch nicht einfach unabhängige Größen sind, die man schlicht in der Welt vorfindet. Sie sind immer schon anhand der jeweiligen Disziplin auf eine bestimmte Art und Weise aufgefasst und verstanden. Die Organisation findet daher nicht im luftleeren oder konzeptionslosen Raum statt, sondern ist von verschiedenen Aspekten und Dimensionen geprägt. Auch Spiritual Care »sollte berücksichtigen, dass die Ergebnisse, die erzielt werden, Ergebnisse sind, die nur durch die Problemstellung hindurch und nur mithilfe des theoretischen Instrumentariums in den Blick kommen, die der Ergebnissuche zugrunde liegen« (Anhalt, 2012: 51, H.i.O.). Ob nun Seelsorge, humanmedizinische oder gesundheitspsychologische Überlegungen maßgebend sind, wirkt sich grundlegend auf das Verständnis von Spiritual Care aus. Was Spiritual Care in Wirklichkeit ist und welchem Anspruch sie zu genügen hat, ist damit eine Frage der Positionierung und der eingenommenen Perspektive. Dass alle drei Disziplinen (Seelsorge, Medizin, Gesundheitspsychologie) einen Einfluss haben, scheint offensichtlich zu sein. Die Frage ist nur, wie dies genau geschieht und ob jene Einflüsse begründet und inwieweit auch begrüßenswert sind. Ob sich Spiritual Care zugleich von einer dieser drei Disziplinen vereinnahmen lässt, ist ebenfalls eine Frage, die sich im Kontext dieser Überlegungen aufdrängt. Dies philosophisch freizulegen und zu analysieren, ist das Ziel der vorliegenden Arbeit. Insofern sich Spiritual Care jedoch als eigenständige Disziplin verstehen will, müsste solch eine Positionierung in einem ersten Schritt zumindest verworfen werden.
Was nun festgestellt werden kann, ist, dass Spiritual Care nicht einfach ein theoretisches Konzept ist. Care bezieht sich auf Handeln. Das menschliche Handeln lässt sich nicht auf ein theoretisches Konzept reduzieren oder von diesem vollständig erfassen. Und Handeln ist ein alltägliches Phänomen. »Das für Handlungen charakteristische Merkmal ist ihre Absichtlichkeit« (Quante, 2020: 52). Handeln geschieht also nicht zufällig, wie anderes menschliches Verhalten, sondern ist durch Planung, Umsetzung und Ergebniskontrolle definiert. Dasselbe gilt für Care-Tätigkeiten. Nun ist Care aber eine ganz spezifische Form der Handlung. »So gibt die jeweilige Handlungssituation entscheidende Parameter vor, an denen wir uns bei der Ausführung unserer Handlungen orientieren« (Weidtmann, 2016: 43). Das bedeutet, dass die Parameter angeben, wie und was unter Care zu verzeichnen ist und zugleich, wie und weshalb eine Care-Tätigkeit als erfolgreich bezeichnet werden kann. Care ist daher sowohl eine Praxis als auch eine normative Orientierung von diesen Handlungen (Held, 2006: 9).
Wird nun Spiritual Care als Disziplin verstanden, so muss diese Form von Handlung den Bereich darstellen, auf den sich die gemeinsame strukturierte, wissenschaftlich institutionalisierte Gegenstandsbetrachtung festlegt, um genau dies zu erfragen und zu überprüfen.
Daher scheint es angebracht, bei Spiritual Care von einer Handlungswissenschaft auszugehen. In ihr wird das Handeln (die Care-Tätigkeit) untersucht, beobachtet und gegebenenfalls bewertet. Zum Handeln selbst kommt zusätzlich das Handlungsfeld hinzu. Beide zusammen bilden die Grundform aller menschlichen Praxis. Damit ist gemeint, dass Handlungen je schon in kulturellen, teils mehr oder weniger institutionalisierten Situationen stattfinden und gewissen Normen und Regeln folgen. Nun ist es aber nicht so, dass die jeweils gegebenen Handlungsfelder einseitig die Handlungen bestimmen. Die Beziehung zwischen den Handlungen und dem situativen Handlungsfeld ist eine wechselseitige, da Handlungen das Handlungsfeld auch wieder zu verändern vermögen (Weidtmann, 2016: 44).
Dies erklärt nun auch, weshalb es eine Wissenschaft von spezifischen Handlungen braucht, um Spiritual Care genauer verstehen zu können. Handlungen sind komplexe Phänomene menschlichen Verhaltens. Sie lassen sich nicht vollständig definieren, was auch für die Handlungsfelder gilt. Charles Pépin fasst dies treffend zusammen: »Handeln lässt sich nicht auf die Konsequenz einer vorangegangenen Überlegung reduzieren, es ist auch und vor allem ein Augenblick, eine Öffnung, ein Sprung ins Unbekannte« (Pépin, 2022: 141). Anders als beispielsweise naturwissenschaftliche Forschungsgegenstände kann Handeln immer unterschiedlich gedeutet werden, kann sich verändern und stets wieder neu problematisiert werden. Die disziplinäre Wissenschaft versucht daher, strukturiert und im reflektiv-kritischen Austausch jene Handlungen zu beschreiben und zu bewerten. So ist Spiritual Care am besten als eine Handlungswissenschaft aufzufassen. Das impliziert folglich, dass in solchen Beschreibungen von Handlungen kausale und begründende Aspekte zusammenkommen und ineinandergreifen müssen, insofern eine Handlungserklärung anhand wissenschaftlicher Vorgaben gelingen soll.
Handlungen sind also selbst Phänomene, die beschrieben (Wirklichkeit) und bewertet (Anspruch) werden können. Da Handlungen immer auch Ereignisse in situativen Handlungsfeldern sind, die in Kausalrelationen von verschiedenen Handelnden stehen, zugleich aber auch in der ethischen Praxis bewertender Einstellungen sind, können sie auf beide Dimensionen hin untersucht und geprüft werden. Es geht also nicht nur darum zu erklären, was die Handlung ausmacht, sondern auch zu erklären oder zu begründen, weshalb sie durchgeführt wurde. Durch ein grundlegendes Verständnis davon, was Handlungen sind und wie sie erfolgreich gelingen können, kann schließlich darüber Klarheit erzeugt werden, was Spiritual Care ist und wie sie gelingen kann. Weiter schreibt Michael Quante: »Insgesamt ergibt sich damit eine komplexe Konstellation, die zwischen den beiden Dimensionen der Kausalität und der Normativität des Handelns aufgespannt ist« (Quante, 2020: 108).
Positivität und Lebensweltlichkeit von Care
Wie hängen nun die oben erwähnte Gegenstandkonstitution und die Handlungswissenschaft miteinander zusammen? Martin Heidegger erklärt dies in seiner eigenen Wortwahl: »Wissenschaft ist die begründete Enthüllung eines je in sich geschlossenen Gebiets des Seienden, bzw. des Seins, um der Enthülltheit selbst willen. Jedes Gegenstandsgebiet hat gemäß dem Sachcharakter und der Seinsart seiner Gegenstände eine eigene Art der möglichen Enthüllung« (Heidegger, 2013: 48). Das bedeutet, die Gegenstandskonstitution ist weder vollständig konstruktivistisch zu betrachten, als was die Forschung den Gegenstand schlicht und einfach erfindet, noch ist sie einem Realismus verpflichtet, in welchem der Gegenstand in der Welt an sich bestehend nur vorgefunden wird. In der Konstitution wird Vorgefundenes anhand der Perspektivität der Zugangsweise und der Dynamik und situativen Handlungsfelder interpretiert und gedeutet (vgl. Rucker & Anhalt, 2017). Das bedeutet: Die positive Handlungswissenschaft macht ein schon in der Alltagswelt vorliegendes Phänomen zum Thema, das immer schon in einer gewissen Weise vor der wissenschaftlichen Enthüllung in der alltäglichen Lebenswelt auf eine Art und Weise enthüllt ist (Heidegger, 2013: 48). Die Wissenschaft versucht damit, das alltägliche Phänomen zu explizieren, wobei es in diesem Verdeutlichungsprozess nochmals verändert wird.
Spiritual Care ist also irgendwie in der alltäglichen Lebenswelt – und besonders in Kliniken, Spitälern und Heimen – vorfindbar, auch ohne wissenschaftlichen Zugriff. Spiritual Care findet mitten in der Praxis und im Leben statt. »Die Wahrnehmung von spirituellen Bedürfnissen wird in der heutigen Gesellschaft zunehmend wichtiger« (Wierzbicki, 2022: 19). Ob die Spiritual Care Tätigen dabei wissen, was sie tun und ob es ihnen gelingt, muss bei ihnen nicht bewusst thematisiert werden. Vieles läuft auch automatisch oder routinemäßig ab. Spiritual Care kann ebenso unbewusst, jedoch nie unabsichtlich, geschehen. Daher gibt es theorieunabhängige und damit vorwissenschaftliche Tatsachen und Wahrheiten zu Spiritual Care, welche jedoch durch die Linse der Handlungswissenschaft expliziert und überprüft werden können (Hampe, 2014: 187). »Wer forscht, befindet sich insofern in einer Situation, die ihn in eine Beziehung zu einem ihm vorgegebenen Etwas stellt« (Anhalt, 2012: 55).
Es ist daher nicht möglich, Spiritual Care unabhängig der wissenschaftlichen Perspektive und der damit einhergehenden Gegenstandskonstitution zu beschreiben. Care und ganz besonders Spiritual Care sind daher im wissenschaftlichen Diskurs durch die Beschreibungsfolie des disziplinären Zugriffs immer schon in einer gewissen Weise gedeutet. So definiert beispielsweise Doris Wierzbicki Spiritual Care: »Das sind Begegnungen, die im Inneren berühren und den Heilungsprozess, wie auch immer dieser aussehen mag, unterstützen« (Wierzbicki, 2022: 19). Und schließlich können die Handlungen von Spiritual Care auch normativ bewertet werden: »Alle – auch die sozialen und geistigen Bedürfnisse müssen im Minimum in Bezug auf eine Notschwelle befriedigt sein, um ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen« (Staub-Bernasconi, 2018: 31).
Dies sind alles offensichtlich theoretisch aufgeladene Aussagen und es muss sich zeigen sowie begründen lassen, wie diese Annahmen für den Zuschnitt auf Spiritual Care gelingen und welche Ansprüche daraus abgeleitet werden können. Das Charakteristikum einer solchen Handlungswissenschaft liegt demzufolge darin, dass die Richtung der Gegenstandskonstitution dessen, was sie als alltägliches, lebensweltliches Phänomen zum Thema macht, geradezu auf dasjenige zugeht als eine explizierende, analysierende und bewertende Fortführung der schon existierenden vorwissenschaftlichen Einstellung zu diesem Phänomen (Heidegger, 2013: 48).
Unterbestimmung
Aus den bisherigen Erörterungen konnte gezeigt werden, dass Spiritual Care im herrschenden Diskurs eine Variable darstellt. Es ist nicht genau klar, was Spiritual Care ist (Wirklichkeit) und was sie sein sollte (Anspruch). Um dies zu klären, bedarf es daher eines grundlagentheoretischen Bemühens. Weiter konnte durch das Vorverständnis aufgedeckt werden, dass man bei Spiritual Care von einer Disziplin sprechen kann, welche unterschiedliche Bezüge zu anderen Disziplinen aufweist, sich jedoch im wissenschaftlich strukturierten Zugang auf einen spezifischen Forschungsgegenstand bezieht. Dabei wurde Spiritual Care als Handlungswissenschaft ausgezeichnet. Es geht ihr also um die wissenschaftliche Untersuchung und Kontrolle von Care als Handlung und zwar die Handlungen von Spiritual Care. Diese lässt sich in der alltäglichen Lebenswelt schon beobachten und wird durch die theoretische Betrachtung weiter konstituiert, strukturiert und differenziert.
Mit diesen ersten Überlegungen scheint jedoch weiterhin unklar zu sein, warum, wie und wofür diese Handlungen stehen und wie sie gedeutet sowie kontrolliert werden können. Aufgrund der Bezüge zu unterschiedlichen anderen Disziplinen (besonders Theologie, Humanmedizin und Gesundheitspsychologie) scheint diese Variable aufgrund dieser Unterbestimmung umstritten zu sein. Warum, Wie und Wofür in der Care-Tätigkeit sind daher aufgrund jener anderen Disziplinen umkämpft, weshalb verschiedene Ansätze behaupten, diese drei Dimensionen des Handelns auf die eigene Disziplin rückführen und erklären zu können. Indem eine der Positionen davon ausgeht, die grundlagentheoretischen Überlegungen und die Gegenstandskonstitution von Spiritual Care zu begründen, wird die Bedeutung der anderen Disziplinen und Positionen in und deren Bemühen um jene Klärung bis zu einem gewissen Grad in Abrede gestellt. Indem also versucht wird, Spiritual Care zu definieren, werden andere Ansätze notwendigerweise und unabdinglich ausgeschlossen oder zurückgedrängt.
Cicely Saunders war diejenige, welche Spiritual Care zu einem eigenständigen Konzept erarbeitet hat, das sich diskursiv festigte und zugleich weiterentwickelte. Dabei waren ihre Absichten in der Hospizarbeit fernab von missionarischen Absichten, es ging ihr um die Zuwendung und Begleitung von Sterbenden (Heller & Heller, 2018: 21). Ihre Überzeugungen zu Palliative Care wurden später mehr oder weniger auf Spiritual Care ausgeweitet und verfeinert. Eine systematische Auseinandersetzung findet sich beispielsweise im Werk Spiritual Care statt Seelsorge? bei Nauer. Seelsorge und Spiritual Care stehen nach Nauer in einem engen Verhältnis. »Viele Theorieelemente und Praxisformen von Spiritual Care entstammen dem Theorie- und Praxisdesign moderner christlicher Seelsorge« (Nauer, 2015: 208).
Dieses Verhältnis ist nach Nauer und anderen Positionen so eng, dass man Spiritual Care nicht notwendigerweise von der Seelsorge abspalten müsse. Mögliche Verhältnisse lassen sich unter anderem so zusammenfassen: Spiritual Care als Seelsorge (Unterbegriff), Seelsorge als Spiritual Care (Oberbegriff), Spiritual Care anstatt Seelsorge (Substitutionsbegriff) sowie Spiritual Care und Seelsorge (Komplementärbegriff). So verbirgt sich hier hinter einem solchen disziplinären und interdisziplinären Disput um eine richtige oder falsche Positionierung von Spiritual Care in Wirklichkeit eine begriffliche und definitorische Unklarheit (Hampe, 2014: 154). Der Disput ist aber nicht einfach nur eine Auseinandersetzung um ein Wortverständnis, sondern es spielt eine wesentliche Rolle für das Selbstverständnis der Disziplin, ob sie sich als Unter-, Ober-, Substitutions- oder Komplementärbegriff zur christlichen Seelsorge versteht.
Wenn nun dafür argumentiert wird, dass Spiritual Care sich direkt zur Seelsorge verhält (Unter- oder Oberbegriff), wird damit die Disziplin der Theologie überantwortet.
Simon Peng-Keller weist entsprechend darauf hin: »Spiritual Care monolinear aus der Hospizbewegung herzuleiten, bedeutet insbesondere zu übersehen, dass auch die Seelsorgebewegung des 20. Jahrhunderts und das kirchliche Engagement im Gesundheitswesen wesentlich zu dieser Genealogie gehören« (Peng-Keller, 2021: 157). Seelsorge und Spiritual Care sind aber auch keine Synonyme, wie Thomas Wild schon betont hat. Es ist klar festzustellen, dass es sich bei Spiritual Care um einen Begriff handelt, der hauptsächlich im Kontext des Gesundheitswesens und deren Institutionen angesiedelt ist und daher nicht synonym mit christlich religiöser Seelsorge ausgetauscht werden kann (Nauer, 2015: 14).
Aber nicht nur die Genealogie, sondern auch strukturelle Merkmale sind je nach Darstellung und Auffassung für die Positionierung von Spiritual Care verantwortlich. Wird Spiritual Care der Theologie überantwortet, wird ganz besonders auf das Theoriedesign der beiden Handlungswissenschaften verwiesen. Seelsorge und Spiritual Care verstehen sich beide als ein Beziehungs- und Begegnungsgeschehen unterschiedlicher Menschen in mehr oder minder deckungsgleichen Institutionen, welches entsprechende Kompetenzen einfordert (Nauer, 2015. 142). Wie sich diese Kompetenzen ausweisen und kultivieren lassen, ist ein weiterer Diskussionspunkt.
Aber auch gegenläufige Argumentationen werden propagiert. Es geht nicht einfach darum, eine Handlungswissenschaft a priori zu entwickeln. Sowohl die Seelsorgelehre als auch Spiritual Care werden nicht konzeptionell entworfen, sondern stehen im ständigen Austausch mit der Praxis: »Die Praxis ist darum für die Entwicklung theoretischen Denkens nicht nur unverzichtbar, sondern wirkt sich bereits durch die Vorannahme praktischer Konsequenzen auf Theoriebildung aus« (Roser, 2017: 26). Daraus lassen sich sowohl für die Praxis als auch für die Theorie von Spiritual Care und Seelsorge unterschiedliche Konsequenzen und Verantwortungen ableiten. Und weiter konzediert Nauer: »Auch im Blick darauf, dass die (spirituelle) Begleitung eines Menschen sowohl verbal als auch nonverbal ablaufen kann, stimmt der Ansatz von Seelsorge und Spiritual Care überein« (Nauer, 2015: 142, H.i.O.).
Inwiefern dies dem Anspruch von Spiritual Care gerecht wird und wie dies in der Wirklichkeit tatsächlich aussieht, muss folglich so entschieden werden, dass die jeweilige Überantwortung, wer dies begründet kontrollieren soll, eine entsprechende Antwort provoziert. Roser ergänzt hierzu: »Die Bemühungen um eine Definition erfolgen in einem gesundheitspolitischen Interesse, dessen Ziele letzten Endes ein inklusives Verständnis von Gesundheit und eine entsprechend umfassende Versorgung sind« (Roser, 2017: 453).
Und doch hält Wild gegen eine Gleichsetzung von Seelsorge und Spiritual Care: »Es handelt sich um unterschiedliche Paradigmen, die in ihren geschichtlichen, soziologischen und theologischen Dimensionen verstanden werden wollen« (Wild, 2023: 16). Obwohl Wild also eine theologische Dimension in der Praxis und Theorie von Spiritual Care vermutet, lässt Spiritual Care sich nach ihm dennoch nicht der Theologie überantworten. Die unterschiedlichen Paradigmen im Sinne von Thomas Kuhn (vgl. Kuhn, 2020) sind je schon gefärbte, strukturierte Zugänge in Bezug auf einen ganz bestimmten Forschungsgegenstand (Zima, 2017: 104). Mit einem solchen Zugang wird der Untersuchungsgegenstand dahingehend konstituiert, dass einige Erfahrungen und Beobachtungen sowie einige Ansätze oder gar Kritikpunkte als nicht zugehörig deklariert werden, während andere als die ausschlaggebenden und grundlagentheoretischen Überlegungen markiert werden.
Das Verhältnis zwischen Seelsorge und Spiritual Care war und ist daher weiterhin unbestimmt und die Geister scheiden sich hierzu. Die Variable Spiritual Care kann nicht ohne Weiteres der Theologie überantwortet werden. »Die Diskussion ist nicht abgeschlossen, sondern mutiert zu einer von unterschiedlichen Interessen geleiteten Grundsatzdebatte um die Zukunft seelsorglicher Versorgung in einer (post-)säkularen Gesellschaft« (Wild, 2023: 15).
Was zeichnet Spiritual Care also aus? Hierfür soll nochmals Nauers Definition in etwas anderen Worten vorgebracht werden: »Zusammenfassend lässt sich Spiritual Care beschreiben als ein theoretisches Konzept individuumszentrierter spiritueller Begleitung, dem ein ganzheitliches Menschenbild mit ausdrücklicher Fokussierung auf die spirituelle Dimension menschlicher Existenz zugrunde liegt« (Nauer, 2014: 341, H.i.O.). Individuumszentrierte Begleitung, ganzheitliches Menschenbild und Spiritualität sind also jene drei Aspekte, die für die Selbstvergewisserung nach Nauer betrachtet werden sollen.
Es wird nicht behauptet, dass sich diese Ansätze von Nauers Definition beispielsweise bei der zeitgenössischen Seelsorge und einigen ihrer Strömungen nicht finden lassen. Sie werden jedoch bei Spiritual Care als spezifische Form der Care Tätigkeit auf bestimmte Punkte hin beleuchtet, die zu den unterschiedlichen Paradigmen nach Wild führen. Wenn nun Spiritual Care für das grundlagentheoretische Selbstverständnis aber trotzdem der Theologie überantwortet werden soll, erwachsen daraus ganz spezifische Konsequenzen für die Theoriebildung und die Praxis.
Theologische Vereinnahmungsversuche
Wie sieht also eine mögliche Überantwortung von Spiritual Care an die Theologie aus? Insofern Spiritual Care als eine spezifische Form von Seelsorge (Unterbegriff) oder als eine Form der Sorge, zu welcher die christliche Seelsorge unter anderen Ansätzen dazugehört (Oberbegriff), angesehen wird, wird Spiritual Care in ihren grundlagentheoretischen Überlegungen und der Gegenstandskonstitution durch eine theologische Linse geprägt und betrachtet. Damit gehen auch spezifische Begründungsstrukturen einher.
Peng-Keller liefert hierfür beispielsweise eine Begründungsmöglichkeit. Er sieht Spiritual Care als eine Form spezialisierter Krankenhaus- und Heimseelsorge: »Entgegen der Tendenz, Heilung biomedizinisch auf die kurative Dimension engzuführen, ist das Verständnis von Heilung und Gesundheit aus medizinischer und theologischer Perspektive zu differenzieren« (Peng-Keller, 2021: 210). Heilung und Gesundheit sind daher weder nur humanmedizinische noch gesundheitspsychologische Begriffe, sondern weisen nach ihm auf eine spezifische theologische Dimension hin. Daraus lässt sich ableiten, dass es bei Spiritual Care nach Peng-Keller um eine Handlungswissenschaft geht, die sich anhand dieser theologischen Dimension entfalten und beschreiben lässt (warum, wie und wofür). Entsprechend ist Spiritual Care nach diesem Verständnis eine spezialisierte Form der christlichen Seelsorge, die in gesundheits- und heilungsspezifischen Institutionen gewirkt und ausgeübt wird. Dabei geht es nicht nur um religiös-spirituelles Sorgen, sondern auch um eine Spiritualität der Sorge, welche sowohl Motivationshintergründe als auch Zweckbestimmungen definiert (Wierzbicki, 2022: 38).
Damit wird zugleich auch ein Verständnis von Seelsorge propagiert. Es gibt entsprechend dieser Auffassung unterschiedliche Formen und Einsatzorte von Seelsorge. »Seelsorge hat ihren Ort gewiss nicht nur an den Grenzen des Lebens und in Krisensituationen« (Faber in Noth & Faber, 2023: 140). An jenen Orten, wo Grenzsituationen und Krisen erfahren werden, kann jedoch Spiritual Care als mögliche Form der Sorge praktiziert werden. Spiritual Care ist daher nur eine mögliche Form der Seelsorge, welche spezifische Kompetenzen verlangt.
Weiter will Peng-Keller also für Spiritual Care als spezifische Seelsorgeform festgehalten wissen: »Sie ist ein Heilberuf, weil sie teilhat am christlichen Heilungsauftrag, der wesentlich zur kirchlichen Sendung gehört« (Peng-Keller, 2021: 7). Aus einer solchen Perspektive bedeutet Spiritual Care eine spezifische Form der Seelsorge um ein Leben, das nicht nur theologisch erfasst und begründet wird, sondern deren Heilungskraft und Beitrag zur Gesundheit auch durch das Wirken des christlichen Gottes versteht (Roser, 2017: 461). Aufgrund dieser theologischen Überantwortung lässt sich auch das Warum und das Wofür von Spiritual Care festlegen. »Wer den christlichen Heilungsauftrag auf den kirchlichen Raum begrenzt, verkennt den grenzüberschreitenden Charakter der Heilungspraxis Jesu und einer zweitausendjährigen Tradition« (Peng-Keller, 2021: 88). Gehandelt wird aus christlichen Gründen und um christliche Ziele zu erreichen.
Anscheinend ist nach dieser Begründungsvariante Spiritual Care theologisch begründet sowie kontrolliert und durch den persönlichen christlichen Glauben motiviert und in der Wirkkraft der christlichen Heilungs- und Gesundheitsbetrachtung eingebunden.
Ist damit Spiritual Care aber dem Glauben oder der Theologie überantwortet? Nun lassen sich Glaube und Theologie nicht einfach voneinander unterscheiden. Denn offenbar kann die Theologie nicht nur eine neutrale Wissenschaft vom Christentum als einem kontingenten weltgeschichtlichen Phänomen sein, sondern sie ist eine ganz spezifische Wissenschaft, die nämlich selbst zur Geschichte des Christentums gehört, von ihr getragen wird und sie selbst wiederum beeinflusst (Heidegger, 2013: 51). Theologie kann daher vereinfacht gesagt als Reflexion des eigenen Glaubens innerhalb einer bestimmten Geschichte und christlichen Gemeinschaft verstanden werden. Für die Theologie ist daher nur die emische Perspektive (Eriksen, 2015: 47) möglich. Nur im Glauben selbst kann die Offenbarung des Glaubens ihren Ausdruck erhalten. Hierzu nochmals Heidegger: »Die Theologie zielt als begriffliche Selbstinterpretation der gläubigen Existenz, d. h. als historische Erkenntnis, einzig auf die in der Gläubigkeit offenbare und durch die Gläubigkeit selbst in ihren Grenzen umrissene Durchsichtigkeit des christlichen Geschehens« (Heidegger, 2013: 56).
Die unmittelbare Konsequenz, die daraus erwächst, besteht in der vollständigen Überantwortung von Spiritual Care an die Theologie. Spiritual Care ist – trotz multidisziplinärer Bezüge – nur im Offenbarungsgeschehen des christlichen Glaubens und der Theologie überhaupt versteh- und begründbar. Die Beiträge der anderen Disziplinen können daher nur noch als Bezugswissenschaften betrachtet werden. Damit geht auch die Folge einher, dass der Glaube für die Praxis von Spiritual Care in irgendeiner Form als notwendige Voraussetzung angesehen wird. Ohne Glauben und ohne die Wirkkraft des christlichen Gottes wäre folglich Spiritual Care nicht erfolgreich durchführbar.
Ein anderer Ansatz besteht darin, Spiritual Care als Oberbegriff aufzufassen und christliche Seelsorge als eine spezifische Form von Spiritual Care zu betrachten. Theologische Reflexionen und Überlegungen im Rahmen von Spiritual Care haben folglich die Aufgabe der Übersetzung christlicher Denkmuster und Traditionen in andere religiöse oder nicht-religiöse Diskurse (Roser in Frick & Maidl, 2019: 296). Spiritual Care bildet demzufolge den Schirmbegriff, unter den neben der christlichen Seelsorge auch andere Formen der Sorge fallen.
Die Überantwortung von Spiritual Care an die Theologie ist daher nicht vollständig, sondern instrumentell. Die Theologie bietet das theoretische und praxistheoretische Rüstzeug, sich über die Dimensionen von Spiritual Care (warum, wie und wozu) zu vergewissern. Dass dabei immer nur eine (die christliche) Seite beleuchtet wird, wird mitberücksichtigt. Praktisch wird die christliche Theologie daher, weil sie systematisch, reflexiv und begründend die Gegenstandskonstitution zu verstehen hilft (Heidegger, 2013: 59).
Das Einander-Helfen und das Sorgen um seine Mit- und Umwelt kann unter dieser Voraussetzung theologisch begründet werden, auch wenn es eine universale menschliche Fähigkeit und Fertigkeit darstellt (vgl. Rüegger & Sigrist, 2011). Die theologische Begründung in diesem Sinne ist daher nicht grundlagentheoretisch zu verstehen, sondern als eine mögliche Ausdrucksform unter anderen. Das zwischenmenschliche Helfen und das Kümmern können auch anders beschrieben, begründet und kontrolliert werden. In der theologischen Begründung wird jedoch hervorgehoben, wie der christliche Beitrag zu diesem Verständnis aufgefasst werden kann.
So beschreibt es beispielweise Ronald Mundhenk: »Im Nehmen und Geben, im Bewusstsein grundlegenden Auf-einander-angewiesen-Sein, im Brauchen und Gebrauchtwerden wird die gemeinsame Gotteskindschaft konkret« (Mundhenk, 2010: 107). Und ähnlich formuliert es auch Hans-Urs von Balthasar: »Nie ist der Andere Mittel zum Zweck, sondern immer der in Verantwortung zu Verehrende; Dienst schließlich, der das alltägliche Einanderdienen-Müssen des Menschen in einem beliebigen sozialen Beruf in seine religiöse Erfüllung führt«, kann als christliche Form der Sorge verstanden werden (Von Balthasar, 2022: 98).
Unabhängig davon, ob nun Spiritual Care als Unter- oder als Oberbegriff von Seelsorge aufgefasst wird, werden klare Entscheidungen für grundlagentheoretische Überlegungen und die Gegenstandskonstitution getroffen. Wird Spiritual Care der Theologie überantwortet, fällt Spiritual Care notwendigerweise in den Zuständigkeitsbereich der christlichen Glaubensgemeinschaft und der Theologie als Reflexionskraft. Hierzu noch einmal Peng-Keller: »Es gehört zur kirchlichen Leitungsaufgabe, die vielfältigen Formen, den christlichen Heilungsauftrag wahrzunehmen, zu fördern, zu koordinieren und den gegenseitigen Austausch anzuregen« (Peng-Keller, 2021: 112).
Humanistische Vereinnahmungsversuche
Es ist aber auch möglich, in der Theologie nur eine Bezugsdisziplin unter anderen zu sehen und die Seelsorge als Substitutions- oder Komplementärbegriff zu sehen. Ein solches Vorhaben soll hier als humanistische Überantwortung bezeichnet werden. Spiritual Care ersetzt oder ergänzt folglich die christlich religiöse Seelsorge, da sie sich wesentlich von ihr unterscheidet und sich nicht von ihr vereinnahmen lässt.[2] Vielmehr werden andere Disziplinen wie die Humanmedizin, die Pflegewissenschaft und die Gesundheitspsychologie für die grundlagentheoretischen Überlegungen und die Gegenstandskonstitution von Spiritual Care maßgebend.[3] »An die Stelle der religiös geprägten Sprache von der Liebe Gottes und der Heiligkeit des Lebens treten die Begriffe Würde und Lebensqualität« (Heller & Heller, 2018: 21).
Zuerst bedarf es kurz der Klärung, was in der vorliegenden Arbeit überhaupt unter Humanismus verstanden werden kann. Die erste historische Form des Humanismus findet sich im alten Rom und der stoischen und epikureischen Philosophie (Heidegger, 2013: 320). Der Begriff Humanismus wird jedoch erst in der europäischen Renaissance zur vollen Bedeutung entwickelt. Der Humanismus formuliert im Gegensatz zu transzendentalen Begründungen dem menschlichen Diesseits zugewandte Entsprechungen zur orientierungsstiftenden Hoffnung auf ein besseres Leben und eine bessere Welt. Damit wird der Mensch zum Maß der Dinge. Das Ziel des Humanismus ist daher Erziehung und Bildung des Menschen im weitesten Sinn, um dieses Ziel zu erreichen (Roeck, 2023: 352).
In humanistischen Ansätzen geht es also nicht um theologische Begründungsansätze und Motivationshintergründe. Vielmehr ist der Mensch und der Mensch allein ausschlaggebend für die Begründungsstruktur von Spiritual Care. In diesem Sinne wird auch Spiritualität säkularisiert (vgl. Metzinger, 2014). So bleibt die Menschlichkeit das Anliegen eines solchen Denkens. Dahingehend lässt sich auch der Humanismus als Position definieren: sich besinnen und dafür sorgen, dass der Mensch mit seinen Mitmenschen menschlich bleibt und nicht unmenschlich wird. Zu diesem Schluss gelangt auch Julian Nida-Rümelin: »Humanistisches Denken und humanistische Praxis kreisen in unterschiedlichen Formen um das Menschliche« (Nida-Rümelin, 2018: 353, H.i.O.). Das Paradigma löst sich also aus dem Glauben und der Theologie heraus. Dies hat auch Auswirkungen auf die Care-Tätigkeit. So fasst Jutta Mader die Bedeutung von Spiritual Care als Praxis zusammen: »Die Entwicklung spiritueller Begleitung im Krankenhaus ist auf internationaler Ebene von einer De-Konfessionalisierung geprägt« (Mader, 2017: 268).
Nun steht der Humanismus nicht notwendigerweise im Gegensatz zur Religion oder zur Theologie.[4] Wenn der Mensch das Maß der Dinge wird, so wird damit der Geltung oder Wirkmächtigkeit der Religion oder Gottes keineswegs ein Riegel vorgeschoben. Ein Humanismus in solch einem weiten Sinne ist daher auch das Christentum, insofern es nach christlicher Lehre beim menschlichen Leben auf das Seelenheil (salus aeterna) ankommt und die gesamte Geschichte der Menschheit im Rahmen der evangelischen Heilsgeschichte erscheint (Heidegger, 2013: 321). Daher sind verschiedene Begründungsformen des Humanismus möglich. Hierzu ergänzt Nida-Rümelin: »Zum unaufgebbaren Kern des Humanismus gehört die Überzeugung, dass jedem menschlichen Individuum eine eigene Würde zukommt, wie immer das näher begründet wird« (Nida-Rümelin, 2018: 353).
Die humanistische Position, in welcher der Mensch das Maß der Dinge ist, überlässt den Einzelnen die Möglichkeit, sich Begründungsstrukturen für die eigene Lebensführung und für die helfende sowie sorgende Praxis zu finden und zu vertreten. Dies kann nun auch auf theoriebildender Ebene angewendet werden. Anders als theologische Vereinnahmungsversuche scheint es auf den ersten Blick so zu sein, als würde die humanistische Überantwortung daher weniger Vorentscheidungen für die grundlagentheoretischen Überlegungen und Gegenstandskonstitutionen in den Diskurs miteinbringen. Dies trügt jedoch.
Auch der Humanismus ist nicht vor Vorentscheidungen gefeit, sondern ist eine ebenso klare und voraussetzungsreiche Position wie die theologische. »Jeder Humanismus gründet entweder in einer Metaphysik oder er macht sich selbst zum Grund einer solchen« (Heidegger, 2013: 321). So wird beispielsweise das Wesen des Menschen als animal rationale oder als mit Würde behaftetes Leben bezeichnet. »Das Menschliche geht für Humanisten nicht auf in der Biologie, in den biologischen Eigenschaften einer Spezies, nämlich des Homo sapiens, sondern ist ethisch verfasst« (Nida-Rümelin, 2018: 353). Der Mensch lässt sich daher nicht nur als organisches Tier auffassen oder als biologischer Körper, wie er primär in der Humanmedizin erfasst wird, sondern es gehen in den Voraussetzungen des Humanismus immer auch andere weiterführende und ganz besonders normative Aussagen über den Menschen mit ein.
In der Moderne wird beispielsweise die zunehmende Psychologisierung vom Menschenverständnis und der sorgenden Praxis tragend (Noth, 2010: 16). Aber weder die Humanmedizin noch die Psychologie sind frei von Menschenbildern und Auffassungen, warum, wie und wofür Care-Tätigkeit ausgeübt wird oder werden sollte. Die Psychologie nimmt auf diese Weise zunehmend die Form von Anleitung zum Miteinanderumgehen an, die darin besteht, sich mit den Menschen der eigenen Mit- und Umwelt und schließlich auch mit sich selbst auszusöhnen (Fellmann, 2009: 121). Ausschlaggebend für die Theoriebildung, die Gegenstandskonstitution und die dazugehörigen Arbeitsprinzipien ist dann nicht mehr primär der Mensch als Vernunftwesen oder als würdebehaftetes Leben, sondern beispielsweise auch die Ergebnisse von Umfragen oder Erhebungsbögen. Empirische Untersuchungen werden dabei für Spiritual Care zu einer zentralen Quelle für das eigene Selbstverständnis. Indem Befragungen und Umfragen auf die Meinungen der Menschen eingehen, wird versucht zu begründen, dass die daraus abgeleiteten Erkenntnisse den menschlichen Interessen und Selbstbildern entsprechen. Die empirische Forschung versucht daher humanistische Menschenbilder zu umgehen, muss sich aber in der eigenen Theoriebildung problematischerweise selbst wieder darauf beziehen, indem sie die Umfragen und Erhebungen sortiert und auswertet.
Ob nun Spiritual Care in humanistischer Verständnisart die christliche Seelsorge ergänzen oder eher ersetzen soll, hängt nicht von wissenschaftlichen Entscheidungen ab, sondern viel eher davon, welchen Platz man der christlich religiösen Seelsorge in spezifischen Institutionen gewähren will.
In Institutionen mit säkularer Trägerschaft scheint es fraglich zu sein, wie und wo religiöse Menschen ihre Praxis ausleben dürfen. Ebenfalls ist in der zunehmend pluralisierten Gesellschaft nicht immer eine religiöse Begleitung erwünscht oder notwendig. »In der Begegnung geht es auch nicht gleich und auch nicht automatisch um Fragen des Glaubens« (Roser in Frick & Maidl, 2019: 299). Hierzu ergänzt Franziskus Knoll: »Oft meint Spiritual Care einfach eine spirituelle Unterstützung von Menschen in deren Auseinandersetzung mit existenziellen (Grenz-)Erfahrungen« (Knoll, 2020: 345). Dabei wird die Religion nicht immer relevant.
Für solche Situationen und solche Begegnungen ist keine theologische Überantwort in der Theorie oder in der Praxis vonnöten. »Der Humanismus beruht letztlich auf der Einsicht in die Verantwortlichkeit und Freiheit des Menschen« (Nida-Rümelin, 2018: 382, H.i.O.). Der Mensch kann sich selbst helfen. Wenn man lernt, mit sich selbst und mit anderen zurechtzukommen, sich selbst Orientierung und Halt bieten kann, Heilung und Trost findet, kann dies auch ohne religiöse Begleitung oder Begründung geschehen. Im Zentrum des humanistischen Ethos steht daher die Selbsttätigkeit des Menschen. Diese kann entweder zur Religion und zur Theologie ergänzend erfolgen, oder man kann gänzlich darauf verzichten und höchstens einzelne erkenntnisreiche Inputs für das Selbstverständnis von Spiritual Care verwenden. Solange dies nicht geklärt ist, scheint es auch nicht ersichtlich zu sein, wie Spiritual Care nun zu deuten ist. Daher kommt auch die Begriffsverwirrung und damit lässt sie sich, wie Wild behauptet, auch nicht nur als einen Streit um Synonyme betrachten.
Ausblick
In der vorliegenden Arbeit wird weder der theologischen Überantwortung, noch der humanistischen Überantwortung Gültigkeit abgesprochen. Beide sind jedoch nicht unproblematisch und stehen sowohl bei der Theoriebildung als auch in der Umsetzung handlungsleitender Arbeitsprinzipien und Methoden vor Herausforderungen. Dies zeigt sich sowohl in theoretischen (Kapitel 3), praktischen (Kapitel 4), professionalisierungsbezogenen (Kapitel 5) und anspruchsbezogenen Defiziten (Kapitel 6), die sich bei Spiritual Care feststellen lassen. Zusätzlich wird damit auch die Frage nach der Vermittelbarkeit von Spiritualität und Spiritual Care aufgeworfen (Kapitel 7). Solange diese Defizite nicht klar ersichtlich aufgezeigt und anschließend aufgearbeitet respektive überwunden werden können, kann auch eine Zusammenführung von Anspruch und Wirklichkeit nicht gelingen.
In einem ersten Schritt sollte daher gezeigt werden, dass Spiritual Care eine Variable darstellt, die von verschiedenen Lagern und Positionen gedeutet und damit auch gleich in Anspruch genommen wird. Offenbar ist man also gefangen in einem schwer durchschaubaren Netz von Ähnlichkeiten und Differenzen, wie Psychotherapie, Seelsorge, Spiritual Care, Humanmedizin etc. miteinander zusammen in Verbindung stehen. Schließlich – und dies ist der wohl wichtigste Punkt, welcher in den weiteren Ausführungen noch ersichtlicher dargestellt wird – kann sich Spiritual Care in dieser umstrittenen Position nicht selbst begründen und ist durch besagte grundlagentheoretische Leerstelle zugleich auch der Gefahr ausgeliefert, im Dienst von Therapie, Begleitung und Behandlung instrumentalisiert zu werden und eigene praxeologische Hinterfragungen nicht oder nur ungenügend berücksichtigen zu können.
Für diese Herausforderung kann die Philosophie Abhilfe leisten. Eine für die vorliegenden Überlegungen erste wichtige Bezugsgröße stellt also das Verhältnis von philosophischer Erhellung und Systematisierung des Vorverständnisses von Spiritual Care dar (Kapitel 2). Dabei ist dieses Vorverständnis selbst kein homogenes Phänomen, sondern wird durch die philosophische Perspektive gedeutet und begründet. Warum dieses philosophische Vorhaben in Anspruch genommen wird und weshalb dies für das Selbstverständnis von Spiritual Care als Disziplin einer Handlungswissenschaft vielleicht sogar notwendig ist, wird sich durch die Bearbeitung der verschiedenen Defizite von Spiritual Care aufzeigen lassen. Dabei werden die Einsichten einer eher abstrakten Ebene der Theoriebildung auf konkretere Aspekte innerhalb der Praxis entfaltet. Die Defizite werden anhand innerphilosophischer Disziplinen betrachtet und geprüft. So wird sich zeigen, dass Spiritual Care eine Überbrückung zwischen Wirklichkeit und Anspruch gelingt, sofern sie sich den grundlagentheoretischen Überlegungen und der Gegenstandskonstitution durch eine philosophische Perspektive überantworten lässt, ohne darin vollständig aufzugehen.
2Philosophie: Mehr als nur eine Bezugsdisziplin
Auffallend ist bei der Debatte um das Selbstverständnis von Spiritual Care, dass die Philosophie – wenn überhaupt – nur als Randnotiz vorkommt. Der Multidisziplinarität von Spiritual Care und deren mögliche Überantwortung für grundlagentheoretische Überlegungen und die Gegenstandskonstitution werden entweder theologischen oder humanistischen Ansätzen zugesprochen. Der Wettbewerb der verschiedenen Disziplinen bestimmt sich demnach durch die unterschiedliche Definitionsmacht der Handlungswissenschaft von Spiritual Care für theoretische und praktische Problemlösungen für das Selbstverständnis besagter Disziplin (Mieg, 2018: 111).
Wie lässt sich Spiritual Care überhaupt verstehen und begründen? Wie können Anspruch und Wirklichkeit zusammengeführt werden? Aus den bisherigen Ansätzen kann keine zufriedenstellende Lösung angeboten werden.
Ein möglicher Ausweg kann darin bestehen, dass die Philosophie für ein solches Unterfangen beigezogen wird. Die Philosophie, so hier die These, vermag es nicht nur, die bisherigen Defizite von Spiritual Care in Praxis und Theorie zu beleuchten und zu strukturieren, sie kann auch mögliche Werkzeuge liefern, mit jenen Herausforderungen produktiv umgehen zu können. Dies liegt daran, dass die philosophischen Perspektiven sowohl auf der Theorie- als auch auf der Praxisebene von Spiritual Care ihre Anwendung finden können.
Wird damit aber Spiritual Care der Philosophie überantwortet? Und wird dadurch ein Selbstverständnis von Spiritual Care abgesprochen, insofern die philosophische Perspektive hinzugezogen wird? Die Philosophie verhält sich gegenüber der theologischen und der humanistischen Überantwortung anders zu Spiritual Care. Denn Philosophie ist sowohl in den theologischen als auch in den humanistischen Ansätzen vorhanden. Sie ist die Möglichkeit der jeweiligen grundlegenden Bedingungen, welche eine Überantwortung – falls nötig – erschaffen, begründen und kontrollieren kann. Sie kann aber genau in derselben Weise zum Selbstverständnis von Spiritual Care und deren Eigenbegründung beitragen, indem sie die theoretischen und praktischen, professionalisierungs- und anspruchsbezogenen Herausforderungen zu thematisieren und reflektieren hilft. Die innerphilosophischen Disziplinen bieten dafür Orientierungs- und zugleich Strukturierungshilfen. Dies wird durch Einsichts-, Urteils- und Reflexionsfähigkeit gewährleistet. Alle drei sind genuin philosophische Fähigkeiten, die sich zwar auch in anderen Disziplinen finden lassen, sich in der Philosophie jedoch als zentrale Schaltstellen oder Kompetenzen ausweisen lassen.
Damit ist die Philosophie für Spiritual Care nicht einfach eine Bezugsdisziplin unter anderen, sondern diejenige Disziplin, welche grundlagentheoretische Überlegungen und die Gegenstandskonstitution für Spiritual Care wissenschaftlich strukturiert ermöglichen, begründen und kontrollieren kann. Ob Spiritual Care anschließend an andere Disziplinen überantwortet wird oder selbstbegründend sein kann, oder sollte, scheint eine Frage zu sein, welche erst im Anschluss gestellt werden kann.
Was ist Philosophie?
Wenn Philosophie einen solchen Anspruch zur grundlagentheoretischen und gegenstandskonstitutiven Klärung von Spiritual Care erhebt, dann muss zuerst bestimmt werden, was unter Philosophie verstanden werden kann. Die Frage, was Philosophie sei, ist eines derjenigen Themen, welches sich wohl durch die gesamte Geschichte der Philosophie gehalten hat und auch heute nicht abgeschlossen ist. Es ist daher keineswegs klar, was genau unter dem Philosophiebegriff verstanden werden kann. »Stattdessen steht die Bedeutung von Philosophie im Prozess des Philosophierens immer selbst mit zur Debatte und unterliegt dementsprechend geschichtlichem Wandel« (Weidtmann, 2016: 8).