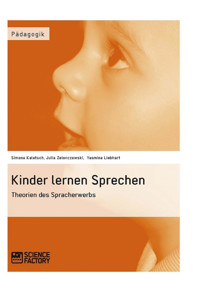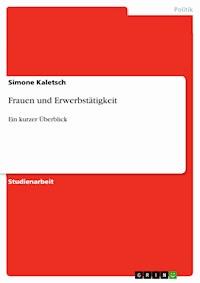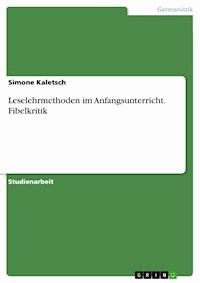15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Studienarbeit aus dem Jahr 2001 im Fachbereich Didaktik für das Fach Deutsch - Pädagogik, Sprachwissenschaft, Note: 1-, Justus-Liebig-Universität Gießen (Institut für Sprachwissenschaft), Veranstaltung: Spracherwerb, Sprache: Deutsch, Abstract: Wenn man sich mit dem Spracherwerb beim Kleinkind auseinandersetzt, so stellt man fest, dass es sich dabei um einen sehr komplexen Themenbereich handelt. Die Arbeit befasst sich mit relevanten Punkten des Spracherwerbs beim Kleinkind. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf den verschiedenen Spracherwerbsstilen. Nach einem einem theoretischen Teil, wird am Beispiel eines kleinen Jungen versucht, die Theorie in der Praxis zu überprüfen. Zu Beginn ist es wichtig, erst einmal zu klären, was Sprache überhaupt ist. Danach wird sich mit dem Verlauf und den Theorien des Spracherwerbs befasst. Nach einer Einführung, die nur kurz den Zeitpunkt des Spracherwerbs darstellt, kommen die verschiedenen Theorien der Spracherwerbsforschung zur Sprache. An die Erläuterung der verschiedenen Ansätze schließt sich dann ein Kapitel über die Phasen des Spracherwerbs an. In diesem Teil tauchen dann noch einmal etwas ausführlicher die relevanten zeitlichen Abläufe auf. Während sich die Theorien und die Phasen des Spracherwerbs mit Aspekten befassen, die bei allen Kindern gleich sind, liegt bei der Erforschung von Spracherwerbsstilen der Schwerpunkt auf den Unterschieden zwischen individuellen Kindern. Dieses Thema wird als Abschluss für das zweite Kapitel gewählt. Die Existenz einer an das Kind gerichtete Sprache kommt im letzten Kapitel zur Darstellung. Im zweiten Teil der Arbeit sind noch einmal die Spracherwerbsstile thematisiert. Es wird ein kleiner Junge beobachtet, um herauszufinden, ob er auf solche verschiedenen Strategien zurückgreift. Anschließend finden sich einige Anmerkungen sowie das Literaturverzeichnis.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2006
Ähnliche
Page 1
Page 3
0. Einleitung
Wenn man sich mit dem Spracherwerb beim Kleinkind auseinandersetzt, so stellt man fest, dass es sich dabei um einen komplexen Themenbereich handelt. Aus diesem Grunde konnten wir uns natürlich nicht mit allen interessanten Punkten dieses Bereiches auseinandersetzen. Letztendlich einigten wir uns darauf, einen theoretischen Teil und einen eher praktisch orientierten Teil zu verfassen. Im ersten Teil der Arbeit haben wir uns der Theorie zugewandt. Wir befanden es als wichtig, erst einmal zu klären, was Sprache überhaupt ist. Danach haben wir uns mit dem Verlauf und den Theorien des Spracherwerbs befasst. Nach einer Einführung, die nur kurz den Zeitpunkt des Spracherwerbs darstellt, haben wir uns den verschiedenen Theorien der Spracherwerbsforschung gewidmet. An die Erläuterung der verschiedenen Ansätze schließt sich dann ein Kapitel über die Phasen des Spracherwerbs an. In diesem Teil tauchen dann noch einmal etwas ausführlicher die relevanten zeitlichen Abläufe auf. Während sich die Theorien und die Phasen des Spracherwerbs mit Aspekten befassen, die bei allen Kindern gleich sind, liegt bei der Erforschung von Spracherwerbsstilen der Schwerpunkt auf den Unterschieden zwischen individuellen Kindern. Wir haben dieses Thema als Abschluss für unser zweites Kapitel gewählt. Die Existenz einer an das Kind gerichtete Sprache kommt im letzten Kapitel zur Darstellung. Im zweiten Teil unserer Arbeit kommen wir noch einmal auf die Spracherwerbsstile zurück. Wir haben einen kleinen Jungen beobachtet und versucht herauszufinden, ob er auf solche verschiedenen Strategien zurückgreift. Anschließend finden sich einige Anmerkungen sowie das Literaturverzeichnis.
Page 4