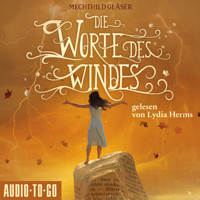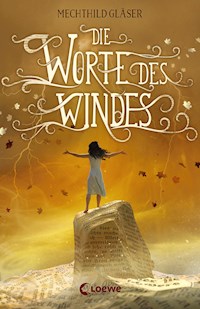Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Loewe
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Eisenheim-Dilogie
- Sprache: Deutsch
Für ihr Debüt wurde Die Buchspringer-Autorin Mechthild Gläser mit dem SERAPH-Phantastikpreis ausgezeichnet. Die hinreißende Liebesgeschichte entführt in eine originelle Fantasy-Welt und lädt Leser zum Träumen ein. Flora fällt aus allen Wolken, als sie erfährt, dass ihre Seele seit jeher ein nächtliches Doppelleben in der geheimnisvollen Stadt Eisenheim führt. Von nun an wird sie nie wieder schlafen, ohne dass ihr Bewusstsein in die farblose Welt der Schatten wandert. Als wäre das nicht unerfreulich genug, hat ihre Seele offenbar den Weißen Löwen gestohlen, einen mächtigen alchemistischen Stein, nach dem sich nicht nur die Herrscher der Schattenwelt verzehren.Bald ist Flora selbst in der realen Welt vor den Gefahren Eisenheims nicht mehr sicher und eines ist klar: Sie kann niemandem trauen, nicht einmal Marian, der plötzlich in beiden Welten auftaucht und dessen Küsse vertrauter schmecken, als ihr lieb ist. Auszeichnung:SERAPH für "Bestes Debüt 2012" "Stadt aus Trug und Schatten" ist der erste von zwei Bänden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 508
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
INHALT
Prolog
1 Traumschatten
2 Ein ungebetener Gast
3 Eisenheim
4 Finstere Jäger
5 Schlafwanderung
6 Ein fremdes Leben
7 Dämmerungstraining
8 Die Dame
9 Der Angriff
10 Der Eiserne Kanzler
11 Maskenball
12 Der Schattenfürst
13 Schattenflug
14 Festmahl
15 Unter Bestien
16 Fluvius Grindeaut
17 Himmelszeichen
18 Erinnerungen
19 Marian
20 Materiensturm
21 Der Weiße Löwe
22 Wahrheiten
23 Palastschatten
PROLOG
feifend strich der Wind durch die Straßen der Stadt und kratzte an den Fassaden der Häuser. Er trug den Geruch von Rauch und Flussschlamm mit sich, der einem in der Nase kleben blieb, bis man an nichts anderes mehr dachte als an die milchig trüben Fluten. Es war kalt, eisig, als habe niemals ein Sonnenstrahl das Dickicht der Häuserschluchten durchdrungen. Und in der Tat: Seit Anbeginn der Zeiten lag Eisenheim in ewiger Nacht. Eisenheim, die Stadt, die weder das Tageslicht noch die Sonne kannte. Für immer lastete die Finsternis auf ihren Dächern, die sich in alle Richtungen bis zum Horizont erstreckten. Nur dann und wann glomm das Licht einer Gaslaterne in der Dunkelheit auf. Überall am Himmel sammelte sich der Qualm, der aus den unzähligen Schornsteinen des Stadtteils Schlotbaron emporstieg, zu einer brodelnden Gewitterwolke.
Undurchdringlich erfüllte die Schwärze auch die schmale Gasse im Herzen von Krummsen, dem westlichsten Viertel Eisenheims. Wie Geisterfinger krochen hier die Nebelfetzen vom Fluss herauf und über das Kopfsteinpflaster hinweg, um nach den Kellerfenstern zu greifen, genauso wie nach den Füßen des alten Mannes. Es waren die Füße eines Mannes, an dem man vorbeiging, ohne ihn in Erinnerung zu behalten.
Er trug einen grauen Mantel, schlicht und weit, etwas altmodisch vielleicht. Und zerknittert, als wäre er darin gerannt. Die Kapuze hatte er sich so tief ins Gesicht gezogen, dass es im Schatten lag. Nur sein Bart, der bis auf seine Brust hinabreichte, quoll darunter hervor. Blutspritzer klebten in den silbrigen Haaren, das gleiche Blut, das auch in Rinnsalen über seine Hände lief.
»Amadé«, flüsterte er. »Was haben sie dir angetan?«
Das Mädchen in seinen Armen schlug langsam die Augen auf und sah ihn an. Die Verletzungen waren schwer, das hatte er gleich erkannt. Der Mann konnte es kaum ertragen, in das von Wunden und Blutergüssen bedeckte Gesicht zu sehen. Doch nun, da er ihrem Blick begegnete, traten ihm die Tränen in die Augen. »Mein armes Kind. Das habe ich nicht gewollt. Ich hätte es niemals so weit kommen lassen dürfen, niemals hätte –«
»Er«, begann das Mädchen. Es war kaum mehr als ein Hauchen. Ihre Hand krallte sich in den Stoff des Mantels.
Der alte Mann schluckte. »Ist ja gut«, sagte er und strich ihr über das Haar, das bis auf das Kopfsteinpflaster hinabreichte, verklebt von Dreck und Blut. »Jetzt ist es vorbei. Ich bringe dich nach Hause, da bist du in Sicherheit.«
Er wusste nicht, ob sie ihn verstanden hatte, denn seine Worte schienen sie nicht zu beruhigen. Noch immer sah sie ihn an und noch immer versuchten ihre rissigen Lippen, Silben zu formen.
»Er«, wisperte sie wieder und es klang, als käme ihre Stimme von weit her, ein Zischen in der Dunkelheit. »Er … weiß … es!«
Der Mann erstarrte, biss sich auf die Zunge. »Was?«, entfuhr es ihm eine Spur zu scharf. »Was hast du ihm erzählt?«
Das Mädchen antwortete nicht, sondern drohte erneut das Bewusstsein zu verlieren. Der Griff seiner Hand lockerte sich, während die Finsternis der Gasse sich weiter zu verdichten schien, sodass nun auch die geschulten Augen des Mannes kaum noch etwas erkennen konnten. Er schüttelte den schmächtigen Körper in seinen Armen. »Amadé! Was hast du ihm erzählt? Sag es mir. Du musst es mir sagen, hörst du?«
Ein Stöhnen, Augenlider, die sich zitternd schlossen.
»Bitte, Amadé!« Der Mann packte das Mädchen fester, so fest, dass es vor Schmerz aufschrie, sich aufbäumte und versuchte, mit letzter Kraft nach ihm zu schlagen. »Sag es«, rief er. Er musste es wissen. Sofort.
Da endlich reagierte das Mädchen und begann zu schluchzen. »Flora«, murmelte es. »Ich … habe sie verraten.«
1 TRAUMSCHATTEN
lora? Also wirklich! Schläfst du etwa?«
Ich schreckte auf. »Was? Äh, nein, gar nicht.« Mein Kopf fühlte sich seltsam leicht an, als wäre er mit Helium gefüllt wie ein Ballon. Doch noch begriff ich nicht, was gerade mit mir geschehen war. Ein wenig verspätet bemerkte ich, wo ich mich befand, musste dann aber noch ein paarmal blinzeln, bis mir auffiel, dass die ganze Klasse mich anstarrte.
»Das sah aber anders aus«, sagte unser Deutschlehrer Herr Bachmann, der sich direkt vor meinem Pult in der dritten Reihe aufgebaut hatte und mich über seinen Schnurrbart hinweg anfunkelte. Es war die siebte Stunde und Herr Bachmann hatte das Licht ausgeschaltet und die Vorhänge zugezogen, um uns zum dritten Mal in dieser Woche mit einer uralten, scheinbar in Echtzeit gedrehten Verfilmung der Buddenbrooks zu quälen. Alle paar Minuten stoppte er den Film, um uns Fragen zu stellen.
So wie es aussah, hatte ich einen dieser Stopps verschlafen, was mich verwirrte, denn ich achtete stets darauf, was um mich herum geschah. Einfach im Unterricht einzuschlafen, sah mir nicht ähnlich. Allerdings hatte ich auch die halbe Nacht geholfen, ein entlaufenes Rudel Süßwasserkrabben zu jagen, das aus einem der Aquarien meines Vaters entkommen und in unserem Wohnzimmer unterwegs gewesen war. Bereits beim Weckerklingeln heute Morgen hatte ich mich furchtbar müde gefühlt. Nein, was mich wirklich verwirrte, war eigentlich nicht so sehr, dass ich eingeschlafen war, sondern die Tatsache, dabei auch noch geträumt zu haben.
Ich träumte nämlich niemals.
Und schon gar nicht so etwas.
»Ich werte das als mangelndes Interesse am Unterrichtsstoff. Einzuschlafen! Eine Frechheit ist das«, erklärte Herr Bachmann und zückte die Fernbedienung, um den Film weiterlaufen zu lassen.
»Aber ich schlafe nie ein«, sagte ich, weil es das war, was mir gerade durch den Kopf ging.
Herr Bachmann schien das für einen Versuch zu halten, mich herauszureden, und steckte die Fernbedienung zurück in die Tasche seines senffarbenen Sakkos. (Seine Anzüge waren immer senffarben und er trug stets dazu passende Socken und Schuhe.) »Ach nein?«, sagte er. »Was ist denn zuletzt passiert?«
»Tony ist für einige Wochen an die See gefahren.« Das war die letzte Szene, an die ich mich erinnerte.
»Und dann?«
»Dort hat sie sich in den Studenten Morten Schwarzkopf verliebt. Aber der ist arm und kann sie noch nicht heiraten. Als Tony nach Lübeck zurückkehrt, erkennt sie, wie wichtig es ist, zur Familie zu halten, und willigt in die Hochzeit mit Grünlich ein«, ratterte ich herunter.
Herr Bachmann bedachte mich mit einem triumphierenden Blick. »Ha! So weit waren wir noch gar nicht. Du hast geschlafen.«
Ich zuckte mit den Achseln. »Zum Glück kenne ich ja das Buch.« In der Klasse war vereinzeltes Kichern zu hören, während mich von rechts ein Tritt von meiner besten Freundin Wiebke in die Wade traf.
Auf Herrn Bachmanns Hals und Wangen bildeten sich rote Flecken. »Wie bitte?«
»Ich meine, wir haben in diesem Halbjahr noch über nichts anderes als die Buddenbrooks gesprochen. Jeder hier kennt die Geschichte zur Genüge«, sagte ich. »Und der Film ist ziemlich, ach, er ist sogar stinklangweilig.« Wie eine Sendung im Teleshoppingkanal, wobei man sich über die wenigstens noch lustig machen konnte.
»Langweilig?« Die roten Flecken bedeckten nun beinahe sein ganzes Gesicht. Herr Bachmann hatte die Wangen aufgebläht wie eine fette Kröte und sah aus, als würde er gleich platzen. »Du findest meinen Unterricht langweilig?«
»Na ja –«
»Nein, Herr Bachmann. Flora findet nur diesen speziellen Film ein klein wenig langweilig. Ihr Unterricht hingegen hat dafür gesorgt, dass wir alle uns bestens mit den Buddenbrooks auskennen. Er scheint also sogar sehr gut zu sein«, schaltete Wiebke sich ein, nicht ohne Herrn Bachmann ein strahlendes Lächeln zu schenken. Wiebke konnte einfach umwerfend lächeln, ich kannte niemanden, der so viel Charme hatte wie sie.
Dem konnte sich wohl auch Herr Bachmann nicht entziehen, denn er wirkte von einem Moment zum nächsten besänftigt. »Nun, wenn das so ist.« Er strich sich über den Schnurrbart und dachte nach. »Ich glaube, ich habe euch tatsächlich schon sehr viel über dieses literarische Meisterwerk vermitteln können. Also gut, wir sehen uns den Film nur noch in dieser Stunde an«, sagte er schließlich und drückte wieder auf Play.
»Diplomatie«, wisperte Wiebke und warf mir über den Rand ihrer Brille einen strengen Blick zu, während Tony auf dem Bildschirm in die Hochzeit mit Grünlich einwilligte. Diplomatie, das Wort, das Wiebke, seit wir uns vor über acht Jahren in der dritten Klasse kennengelernt hatten, gebetsmühlenartig wiederholte, wann immer ich es schaffte, mich um Kopf und Kragen zu reden. Sie hatte häufig Gelegenheit, es zu sagen, und jedes Mal nahm ich mir vor, in Zukunft erst zu denken und dann zu sprechen.
»Bei dir sind irgendwelche Synapsen falsch verbunden«, erklärte Wiebke mir oft. »Vielleicht hast du Glück und es wächst sich noch aus.« Das hoffte ich auch, denn, nun ja, ich konnte ziemlich gut austeilen, besonders wenn ich es gar nicht wollte.
Der Rest der Stunde verging ohne weitere Nickerchen meinerseits. Herr Bachmann unterbrach den Film nicht noch einmal und so nutzte ich die Zeit, um mich weiter über meinen Traum zu wundern. Jedenfalls glaubte ich, dass es einer gewesen war. Wie gesagt, ich hatte noch nie etwas geträumt und das bisher eigentlich auch ganz in Ordnung gefunden.
»Zu träumen lenkt einen bloß vom richtigen Leben ab und meistens ist es sowieso kompletter Blödsinn«, pflegte unsere Haushälterin Christabel zu sagen, die sich seit der Trennung meiner Eltern vor zehn Jahren um meinen Vater und mich kümmerte beziehungsweise es versuchte. »Wenn es dir aus Versehen doch mal passiert, sag mir Bescheid, Engelchen, dann gebe ich dir eine von meinen Tabletten, damit schläfst du wieder wie ein Stein.«
Ihr Angebot war mir schon immer seltsam vorgekommen, aber jetzt … Der Traum war wirklich unheimlich gewesen, wie eine Szene aus einem Horrorfilm. Meine Erinnerung begann glücklicherweise bereits zu verschwimmen, doch ein Bild stand mir noch immer deutlich vor Augen: Ich befand mich in einem dunklen Raum, in dem es wie beim Zahnarzt roch, und lag auf dem Rücken. Nein, eigentlich schwamm ich auf dem Rücken in einem Behälter, der mit einer nebligen Substanz gefüllt war, und hatte das dumme Gefühl, dass jeden Augenblick Dr.Frankenstein auftauchen und mir eine Elektrode ins Gehirn pflanzen würde. An der Decke über mir hingen altmodische Zirkel und verkorkte Glaskolben mit schimmernden Flüssigkeiten, die diesen Eindruck verstärkten.
Außerdem wirkte alles blass und grau, farblos wie in einem alten Schwarz-Weiß-Film.
»Ich glaube, sie kommt zu sich, Meister«, sagte ein Mann irgendwo außerhalb meines Blickfeldes. Er klang aufgeregt.
»So bald?«, entgegnete jemand deutlich Älteres, dessen Stimme an das Rascheln von Papier erinnerte.
Ein faltiges Gesicht beugte sich über mich. Ich erkannte eisgraue Augen, die in Nestern aus Runzeln saßen, und einen bauschigen Bart, in dem etwas klebte. Feine, schwarz glänzende Spritzer, die sich in den silbrigen Haaren verfangen zu haben schienen …
Das Klingeln unterbrach meine Gedanken.
»Na endlich«, meinte Wiebke und sprang auf. »Ich dachte schon, die Stunde geht nie vorbei.«
»Ja, ich auch«, stimmte ich halbherzig zu. Geistesabwesend stopfte ich meine Sachen in meinen Rucksack. Dann schlüpfte ich in meine neonfarbene Jacke, die in Wiebkes Augen einfach furchtbar war, weil ihre quadratische Form mich anscheinend noch kleiner wirken ließ, als ich ohnehin schon war. Man sah mir darin tatsächlich nicht unbedingt an, dass ich siebzehn und nicht dreizehn Jahre alt war, aber ich liebte sie, denn sie reichte mir bis fast zu den Knien und ich konnte die Hände problemlos in den überlangen Ärmeln verschwinden lassen. Zwei unschätzbare Vorteile, wenn man schnell fror.
»Los, komm schon. Linus wartet am Schultor auf uns«, sagte Wiebke, drehte sich die schwarze Mähne zu einem Knoten und zog mich an einem der besagten Ärmel Richtung Ausgang, vorbei am Lehrerpult, wo Herr Bachmann gerade etwas im Klassenbuch notierte, was verdächtig nach dem Namen Flora Gerstmann aussah. Meine mündliche Note war heute wohl ins Bodenlose gestürzt.
Ich nagte an meiner Unterlippe und versuchte, mit Wiebke Schritt zu halten, die erst langsamer wurde, als wir den ebenfalls dunkelhaarigen Jungen mit der Lederjacke erreichten, der am Rande des Schulhofs auf uns wartete. Lässig lehnte Linus sich gegen den Zaun und grinste uns über die Köpfe einer Horde von Mittelstufenschülerinnen hinweg an, die auffällig unauffällig in seiner Nähe herumlungerten.
»Buongiorno, die Damen«, rief er und hielt uns einen Pizzakarton unter die Nase. »Einmal mit allem und extra Käse.« Hungrig griffen wir zu, um uns kauend auf den Weg in Richtung U-Bahn zu machen, denn wir wohnten alle drei fast am anderen Ende von Essen. Linus war Wiebkes Zwillingsbruder und ging in die Parallelklasse, weil die Eltern der beiden wollten, dass sie »eigenständige Persönlichkeiten entwickelten«.
Tatsächlich waren die beiden einander so ähnlich, wie zwei Menschen unterschiedlichen Geschlechts es nur sein konnten. Nicht nur, dass sie das gleiche fein geschnittene Gesicht und die dazu passenden seidigen Wimpern besaßen. Sie lachten auch über die gleichen Witze, mochten die gleichen Dinge und waren schlicht unzertrennlich. Manchmal beschlich mich sogar das unheimliche Gefühl, dass sie gegenseitig ihre Gedanken lesen konnten, so wie jetzt, als Linus plötzlich auf mein Gesicht deutete: »Krass, was hast du denn da?«
Ich betastete meine Wange und fühlte Linien und Falten, die dort definitiv nicht hingehörten, aber irgendwie an den Reißverschluss meines Stiftetuis erinnerten. Ich musste es bei meinem Nickerchen als Kopfkissen benutzt haben.
»Wir haben in Deutsch schon wieder die Buddenbrooks gesehen«, erklärte ich. »Das war zum Gähnen langweilig.«
Linus tauschte einen Blick mit Wiebke und war sofort im Bilde. »Du bist eingeschlafen und Herr Bachmann hat dich erwischt?« Er schürzte anerkennend die gepiercte Unterlippe. »Reife Leistung!« Linus legte den Arm um mich, um mir auf die Schulter zu klopfen, und ließ ihn anschließend dort liegen.
Eine Geste, die augenblicklich Lavinia auf den Plan rief, die wie jeden Tag in Minirock und High Heels hinter uns herstöckelte und versuchte, Linus’ Aufmerksamkeit zu erregen. »Habe ich eigentlich schon erzählt, dass ich meinen Geburtstag nächste Woche im Knightclub feiern will?«, keuchte sie. Anscheinend war sie gerannt, um uns einzuholen.
»Echt?« Linus ließ sich zu ihr zurückfallen und Wiebke und ich verdrehten gleichzeitig die Augen. Lavinia war eines von diesen Mädchen, die zu viel Make-up auflegten und sich trotz Hüftspeck unerklärlicherweise immer wieder für Klamotten in Größe XS entschieden. Seit ein paar Monaten verfolgte sie Linus auf Schritt und Tritt. Genauer gesagt, seit ich mit ihm Schluss gemacht hatte und es ihr zu Ohren gekommen war. (Ich mochte Linus, aber mit ihm zusammen zu sein, das hatte sich angefühlt, als würde ich mit Wiebke gehen.)
Fast die gesamte U-Bahn-Fahrt über drehte sich das Gespräch um Discos in Essen und Umgebung, ein Thema, zu dem ich als erklärter Partymuffel nur wenig beizusteuern hatte. Also lehnte ich mich in meinem Sitz zurück, während die rot-weiße U-Bahn wie ein Wurm über ihr Gleis zwischen den verstopften Spuren der Autobahn A40 kroch, und döste vor mich hin. Die Sonne schien durch die staubigen Scheiben und malte helle Flecken auf die Sitzpolsterung, die früher einmal bunt gemustert gewesen, aber jetzt nur noch ausgeblichen und schmutzig war. Mit den Jahren hatten die Bezüge die Farbe alter Kaugummis angenommen und irgendwie rochen sie auch so. U-Bahn-Geruch. Seufzend legte ich den Kopf in den Nacken.
Ich war wirklich verdammt müde.
Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass es dunkler wurde, als die U-Bahn wenig später in den Tunnel kurz vor der Haltestelle Bismarckplatz einfuhr, aber das war der Moment, in dem ich es zum ersten Mal bemerkte. Der Moment, in dem mir bewusst wurde, dass sich etwas verändert hatte.
Denn ich sah einen Schatten.
Eigentlich war es mehr eine Bewegung, gleich neben mir, draußen vor dem Fenster. Ein Flackern in der Dunkelheit, das ich aus dem Augenwinkel zu erkennen meinte. Eine schwarze Masse, halb durchsichtig. Erst hielt ich es für eine optische Täuschung und schaute genauer hin. Aber nein, es gab keinen Zweifel. Auch wenn ich es nicht erklären konnte, instinktiv wusste ich es: Dort war etwas, etwas Großes, Unförmiges.
Und es rannte neben der U-Bahn her.
Ich spürte, wie sich die Härchen an meinen Unterarmen aufrichteten. »Hey, Leute, seht ihr das?«, unterbrach ich Lavinia, die gerade über Schaumpartys referierte, und deutete hinaus.
»Was denn? Die Tunnelwand?«, fragte sie genervt und hob eine nachgezogene Augenbraue. »Unglaublich aufregend. Also, was ich eigentlich sagen wollte –«
»Nein, da ist irgendwas … Lebendiges. Seht ihr das nicht?« Was mochte es nur sein? Ein Tier vielleicht?
»Keine Angst, Flora, das ist nur dein Spiegelbild«, meinte Linus und grinste mich an.
Ich durchbohrte ihn mit meinem Blick. »Haha.«
Wiebke runzelte die Stirn, rückte ans Fenster und schüttelte dann den Kopf. »Ich kann nichts erkennen, tut mir leid.«
In diesem Augenblick fuhr die U-Bahn in die nächste Haltestelle ein und mit dem plötzlichen Licht verschwand auch der Schatten. Ich blinzelte. »Jetzt ist er weg.«
»Er?« Lavinia wirkte amüsiert.
»Oder es. Wahrscheinlich habe ich mich getäuscht. Ich bin einfach so fertig heute«, sagte ich und hoffte, dass, was immer ich gesehen hatte, sich in Luft aufgelöst hatte. Aber natürlich erfüllte sich mein Wunsch nicht.
Das nächste Mal sah ich den Schatten, als Wiebke und ich am Hauptbahnhof ausstiegen und uns durch das lindgrün geflieste Gebäude auf den Weg zur Ballettschule machten. Seelenruhig stand er inmitten der kreuz und quer vorbeieilenden Reisenden, unmittelbar vor dem Drogeriemarkt. Jedenfalls glaubte ich, dass er stand, er hatte schließlich keine richtige Form, sondern war eher so etwas wie ein blinder Fleck. Ein schwarzes Loch von der Größe eines Basketballspielers, das aus dem gekachelten Fußboden wuchs und scheinbar von niemandem außer mir bemerkt wurde. Mir wurde flau in der Magengegend. Beobachtete ich das alles wirklich? Gerade lief ein Mann mit Anzug und Aktenkoffer schnurstracks durch den Schatten hindurch.
»Da! Hast du das gesehen?« Ich hielt Wiebke, die sich vor mir durch eine japanische Reisegruppe schlängelte, an ihrem Rucksack fest, damit sie stehen blieb. »Da vorne ist er wieder.«
Wiebke folgte meinem Blick. Sie sah den Schattenfleck jetzt direkt an und es kam mir so vor, als starrte dieser zurück. Plötzlich hatte er etwas Lauerndes an sich, wie ein Wolf, der eine Fährte aufnahm.
Wiebke jedoch schüttelte wieder den Kopf. »Ich weiß echt nicht, was du da siehst«, sagte sie. »Vielleicht ist irgendwas mit deinen Augen nicht in Ordnung. Wir haben doch letztens diesen Film gesehen, in dem sich bei einem Jungen die Netzhaut ablöst und er dann die ganze Zeit Blitze sieht, wo keine sind.«
»Ich sehe aber keine Blitze, sondern einen Schatten. Also so ziemlich das Gegenteil«, sagte ich gereizt und setzte mich wieder in Bewegung. »Los, komm. Gehen wir zum Training.«
Dreimal pro Woche fuhren Wiebke und ich nach der Schule zum Ballettunterricht in der Innenstadt. Nicht dass ich viel für Tüllkleidchen und Kitsch übriggehabt hätte, aber ich liebte das Gefühl, meinen Körper bis in den kleinsten Muskel hinein zu kontrollieren. Und man war danach so herrlich müde, ein Umstand, auf den ich heute allerdings gerne verzichtet hätte. Viel müder konnte ich kaum noch werden. Keine gute Ausgangslage für ein Spitzentanztraining.
Tatsächlich war meine Leistung heute ein einziges Desaster. Schon bei den Übungen an der Stange war ich unkonzentriert, hielt dauernd Ausschau nach dem Schatten, als erwartete ich, er würde plötzlich durch eine der Spiegelwände des Tanzsaales hereinschweben. Beim Zählen der Pliés kam ich immer wieder durcheinander, verpatzte anschließend mehrere Sprungkombinationen und zog damit langsam, aber sicher den Zorn unserer Ballettlehrerin Isabelle auf mich. Andauernd musste sie meine Armhaltung korrigieren.
»Das sieht aus wie die Flügel eines toten Vogels, Flora. Achte auf deine Ellenbogen.«
»Mach ich doch.«
»Machst du nicht. Und denk an deine Handgelenke.«
»Jaa.«
»Die Ellenbogen!«
Nach der Hälfte der Stunde war ich zu frustriert, um weiterzumachen, entschuldigte mich mit einem genuschelten »Mir ist schlecht!« und rannte in die Umkleide. Natürlich war ich es gewohnt, Fehler zu machen. Und mit meiner gedrungenen Statur (»Ein Zwerg mit Stupsnase«, wie Lavinia es gern ausdrückte) würde ich vermutlich niemals für Schwanensee engagiert werden. Aber was zu viel war, war zu viel.
Mittlerweile konnte ich vor Müdigkeit kaum noch die Augen offen halten. Hastig zog ich mich um, machte mir nicht einmal die Mühe, die Klammern zu entfernen, mit denen ich mir beim Training mein braunes Haar aus dem Gesicht hielt, und lief auf die Straße hinaus.
Ohne auf irgendwelche dubiosen Schatten zu achten und ohne noch einen einzigen Gedanken an meinen Traum zu verschwenden, bahnte ich mir meinen Weg in Richtung Bushaltestelle. Wahrscheinlich war ich gerade dabei, verrückt zu werden. Nicht dass ich Erfahrung damit gehabt hätte. Aber so was hörte man schließlich nicht gerade selten: Leute, die plötzlich Wahnvorstellungen entwickelten und Dinge sahen, die gar nicht da waren. Vielleicht war Wiebkes Theorie von meinen falsch verbundenen Synapsen gar nicht so unwahrscheinlich. Schatten zu sehen! Du meine Güte, vermutlich war ich schwer hirnkrank!
»Flora! Was ist mit dir?«, rief Wiebke, die mich auf Höhe der Stadtbibliothek einholte. Auch sie hatte sich nur halb umgezogen, der roséfarbene Träger ihres Trikots lugte aus ihrer Jacke hervor. Außer Atem berichtete ich ihr von meiner Selbstdiagnose, welche sie mit einem energischen »So ein Blödsinn!« abtat. »Na und? Dann siehst du halt mal schwarze Flecken. Das kann auch vom Kreislauf kommen. Was du brauchst, ist jedenfalls keine Gummizelle, sondern ein Kaffee«, erklärte sie und schleppte mich schon in Richtung Starbucks.
»Nein«, protestierte ich. »Du verstehst das nicht. Es sind nicht einfach nur Flecken. Es sind … Wesen, klar? Sie leben.« Ich hatte nicht den blassesten Schimmer, woher ich das wusste. Aber ich war mir sicher, dass es so war.
»Ich bin deine beste Freundin und das bedeutet, ich verstehe alles«, sagte Wiebke in einem Ton, der keine Widerrede zuließ.
Fünf Minuten später saßen wir jede in einem Plüschsessel und nippten an großen Tassen voller Cappuccino mit Milchschaum.
»Vielleicht sind es die Geister von Verstorbenen, die noch unerledigte Dinge haben und nun deine Hilfe brauchen«, sagte Wiebke und grinste mich an. Sie kicherte. »Das wäre echt cool, oder?«
Leider konnte ich über ihren Witz nicht lachen. Wiebke, die meinen Gesichtsausdruck bemerkte, wurde wieder ernst. »Hey, tut mir leid. Ich wollte mich nicht über dich lustig machen. Aber ich glaube immer noch nicht, dass du verrückt wirst. Und auch nicht, dass da wirklich Schatten sind.«
Sie klaubte eine Haarspange aus meinem von Natur aus immer ein wenig zu welligen Pony. Ich war mal wieder dabei, mir die Haare lang wachsen zu lassen. Seit Jahren hatte ich das schon vor, doch über die Schulterlänge kam ich nie hinaus. Irgendwann verlor ich stets die Nerven und erlag der mysteriösen Vorstellung, ein Bob würde zu meinem Gesicht passen. Dieses Mal hatte ich mir allerdings geschworen durchzuhalten. Und bis zu den Schlüsselbeinen reichte meine Mähne immerhin schon.
»Vielleicht geht es dir heute einfach nicht so gut«, mutmaßte Wiebke und nahm einen zu großen Schluck von ihrem Cappuccino, an dem sie sich die Zunge verbrannte. »Bekommst du deine Tage?«, nuschelte sie.
Ich schüttelte den Kopf. »Nein. Und so fühlt es sich auch nicht an. Ich bin total müde. Und ich habe diese Dinger gesehen, ganz sicher.«
»Seltsam.« Wiebke stützte den Kopf in ihre Hand, ihre pinkfarbenen Strassohrringe klimperten gegen den Bügel ihrer Brille.
»Finde ich auch«, sagte ich und zuckte im selben Augenblick zusammen, als hätte ich gerade einen Autounfall beobachtet.
Denn da war schon wieder ein Schatten.
Ein ziemlich großer sogar.
Wiebke folgte meinem Blick nach draußen auf die Straße, wo der Schatten vor der Fensterscheibe des Starbucks hing wie eine tieffliegende Gewitterwolke. »Da«, flüsterte ich. »Da ist schon wieder einer.«
»Wo?«
Der Schatten schwebte direkt vor uns und nahm die gesamte obere Hälfte der Scheibe ein, wie ein dunkles Loch, das in die Welt gerissen worden war. Eine schwarze Masse, ein flackernder Leib, augenlos. Und doch wusste ich, dass er mich anstarrte. Ich begann zu zittern. »Na da.«
»Meinst du den von dem Baum dort?« Wiebke zeigte auf eine Linde auf der gegenüberliegenden Straßenseite.
»Nein«, krächzte ich, unfähig, mich zu rühren. Der Schatten fixierte mich. Es kam mir vor, als blickte er durch meine Augen hinab in meine Seele. Als fragte er sich, ob ich diejenige war, die er suchte. Was dachte ich da für einen Quatsch? Ich blinzelte und im nächsten Moment ließ das … Ding von mir ab. Es zog sich unmerklich zusammen, als ducke es sich zum Sprung. Dann flog es davon.
Erst jetzt merkte ich, dass ich Wiebkes Hand umklammerte. Rasch ließ ich los. Meine Finger hatten weiße Flecken auf ihrer Haut hinterlassen. »Tut mir leid«, murmelte ich.
»Schon gut.« Inzwischen lag echte Sorge in Wiebkes Blick. »Mann, bist du blass geworden. Ist dir schwindelig? Könnte gut sein, dass dein Kreislauf absackt, dann wird einem doch auch schwarz vor Augen, nicht? Los, trink noch einen Schluck Kaffee. Oder willst du lieber ein Glas Wasser?«
»Cappuccino reicht«, sagte ich schnell. Ich wollte mittlerweile nur nach Hause, mich in meinem Zimmer verkriechen, mir die Decke über den Kopf ziehen und in Ruhe geistesgestört sein. »Hör zu, ich sollte mich wohl besser ein wenig hinlegen.«
»Gute Idee.« Wiebke stand auf. »Da vorne ist gerade eine von den Couchen frei geworden.«
»Eigentlich hatte ich an mein Bett gedacht«, erklärte ich und leerte meine Tasse, indem ich den Kopf in den Nacken legte und darauf wartete, dass der Rest Milchschaum in meinen Mund lief. Der war schließlich am leckersten.
»Soll ich meine Mutter fragen, ob sie uns abholt und dich nach Hause bringt?« Wiebke hatte bereits ihr Handy gezückt, um ihre Eltern anzurufen.
Doch ich schüttelte den Kopf. Wiebkes Mutter sah genauso aus wie Wiebke, nur ein bisschen älter, und war Hausfrau und Mutter aus Leidenschaft. Wann immer ich bei Wiebke und Linus zu Besuch war, buk sie Kuchen oder Kekse, machte Eiscreme oder legte einem einen Schokoriegel aufs Kopfkissen. In ihrer Gegenwart fühlte ich mich stets wie eine bemitleidenswerte Waise. Etwas, wonach mir gerade so gar nicht der Sinn stand. »Das ist lieb, aber überhaupt nicht nötig. Die Bushaltestelle ist ja gleich um die Ecke«, wehrte ich deshalb schnell ab.
»Na gut, aber bis dorthin bringe ich dich auf jeden Fall.«
»In Ordnung«, sagte ich, froh darüber, mich nun bald hinlegen zu können. Zu Hause würde die Sache sicher schon anders aussehen.
Wie hätte ich auch ahnen können, dass mich dort schon die nächste Katastrophe erwartete?
2 EIN UNGEBETENER GAST
ch wohnte im Stadtteil Steele in einer kleinen Seitenstraße in der Nähe der Ruhr. Die Häuser hier waren groß und alt, hatten Stuckfassaden und feuchte Keller und ragten unter dem graublauen Nachmittagshimmel auf wie schlafende Ungeheuer. Unsere Wohnung lag im dritten Stock von Hausnummer 34, einem sandsteinfarbenen Bau mit Fenstersimsen im Jugendstil, und auf unserem Klingelschild stand in schnörkeliger Schrift »Fam. Gerstmann«.
Auch das Treppenhaus wirkte mit seinen schwarz-weißen Fliesen und dem geschwungenen Geländer antik. Ein blasser Abglanz früherer Tage, der sich allerdings spätestens an unserer Wohnungstür in Luft auflöste, wo Alarmanlagen und Sicherheitsschlösser ihn zusammen mit jedem Einbrecher in die Flucht schlugen.
»Wegen der Fische«, hatte mein Vater mir erklärt, als ich noch klein gewesen war. In unserer Wohnung standen nämlich über zwanzig Aquarien, die teils mit Salz-, teils mit Süßwasser gefüllt waren und allerlei wertvolles Meeresgetier beherbergten. (Mein Vater besaß ein Aquaristikfachgeschäft und war, damit zogen wir ihn gelegentlich auf, selbst sein bester Kunde.) Ich konnte mir zwar immer noch nicht vorstellen, welcher Einbrecher es ausgerechnet auf unsere Clownfische und Seeanemonen abgesehen haben sollte, aber mein Vater und Christabel schienen von dem Gedanken, ausgeraubt zu werden, regelrecht besessen zu sein. Andauernd modifizierten sie das Alarmsystem. Vor Kurzem hatten sie sogar unsere Fenster elektronisch gesichert und im Arbeitszimmer meines Vaters gab es eine Lichtschranke. Langsam nahm es krankhafte Züge an.
Für die Wohnungstür allein benötigte man mittlerweile sage und schreibe fünf Schlüssel, sodass es eine Weile dauerte, bis ich sie aufbekam. Vor allem weil ich auf meinem Knie einen Korb voller Bügelwäsche balancierte, die ich aus der Waschküche mit heraufgenommen hatte.
Schon in der Diele hörte ich ihre Stimmen.
Erst dachte ich, Christabel würde sich wieder einen Actionfilm aus ihrer umfangreichen Sammlung ansehen. Doch dann erkannte ich, dass es nicht Jackie Chan, sondern mein Vater war, der dort im Wohnzimmer gerade von »Schutzbestimmungen« und »fragwürdigen Einschränkungen aufgrund von Gerüchten« sprach. Er klang ernst.
War etwas mit dem Laden? Ich spürte, wie mein Mund trocken wurde. Um diese Uhrzeit war mein Vater nie zu Hause. Plötzlich war ich wieder hellwach, ließ sowohl den Wäschekorb als auch meinen Rucksack einfach auf den Boden fallen und stürzte ins Wohnzimmer. »Ist alles in Ordnung?«
Drei Köpfe wandten sich erschrocken in meine Richtung.
»Oh, Engelchen, wir hatten noch gar nicht mit dir gerechnet«, sagte Christabel und war mit zwei schnellen Schritten bei mir. Sie trug wie immer einen geblümten Kittel und rosafarbene Plüschpantoffeln, aber heute saß ihre rot gefärbte Dauerwelle nicht annähernd so makellos wie sonst. Eine Locke hing ihr so verwegen ins Gesicht, dass ich mich einmal mehr fragte, wie alt sie eigentlich war. Mindestens sechzig bestimmt. Auf jeden Fall zu alt für quietschpinken Lippenstift.
Neben Christabel wirkte mein Vater mit seinem mausbraunen Haar und der schlichten Kleidung nahezu farblos. Er war groß und schlaksig, maß beinahe zwei Meter, doch hätte er in seinem Ohrensessel nicht eine so natürliche Autorität ausgestrahlt, man hätte ihn neben seiner Haushälterin sicherlich kaum wahrgenommen.
Allerdings waren es weder Christabels Frisur noch die aufeinandergepressten Lippen meines Vaters, die mich aus dem Konzept brachten, sondern der Junge, der es sich auf unserem Sofa bequem gemacht hatte. Aus grünen Augen sah er zu mir herüber, nein, eigentlich starrte er mich an, musterte mich, als wäre ich ein Geist. Er musste ungefähr so alt wie ich sein, war flachsblond, blass und sommersprossig, gut aussehend, auf eine seltsam kühle Art und Weise. Aber nicht mein Typ, entschied ich und fragte mich gleichzeitig, warum mir ausgerechnet das jetzt durch den Kopf ging.
»Wer –«, stammelte ich.
»Setzt dich erst mal hin, Engelchen«, sagte Christabel und legte mir eine Hand auf den Arm, die ich jedoch sofort abschüttelte.
»Wer ist das?«
»Das ist Marian Immonen, ein Austauschschüler aus Finnland. Er wird die nächsten Monate bei uns wohnen«, erklärte mein Vater und sah dabei recht unglücklich aus.
Ich hingegen hatte das dumpfe Gefühl, mich verhört zu haben. Fremde durften unsere Wohnung niemals betreten. Das war eine goldene Regel und für meinen Vater und Christabel beinahe genauso wichtig wie das Alarmsystem. In all den Jahren unserer Freundschaft hatten sie es nicht einmal Wiebke erlaubt, uns zu besuchen. Krankhaft, wie gesagt. Aber ich hatte es akzeptiert. Seit meine Mutter nicht mehr bei uns lebte, waren wir ohnehin keine richtige Familie mehr, sondern nur noch eine chaotische Wohngemeinschaft. Ich hatte kaum je das Bedürfnis verspürt, dies jemandem auf die Nase zu binden.
Doch jetzt beherbergten wir einen Austauschschüler?
Ich verschränkte die Arme vor der Brust. »Und wo soll er schlafen?«
»Ich bekomme ein Klappbett im Arbeitszimmer«, sagte Marian mit deutlichem Akzent und für meinen Geschmack ein wenig zu selbstsicher. Seine Stimme kam mir von irgendwoher bekannt vor.
»Mit dir rede ich gar nicht«, beschied ich ihn und funkelte stattdessen meinen Vater und Christabel an. »Ich will sofort wissen, was passiert ist. Wieso ist er hier?«
»Es ist ja nur vorübergehend«, sagte mein Vater.
Ich schwieg zornig und wartete auf eine Erklärung, doch anscheinend konnte sich niemand dazu durchringen. Einen Moment lang hing die Stille zwischen uns wie Qualm, der einem die Luft zum Atmen nimmt. Selbst die Fische in den Aquarien an der Längsseite des Raumes schienen erwartungsvoll zu den Scheiben zu schwimmen.
Christabel und mein Vater tauschten einen langen Blick, während Marian auf seine Hände starrte, als hätte er sich am liebsten in Luft aufgelöst. Auch ich wünschte mir sehnlichst, er wäre in diesem Augenblick irgendwo anders gewesen, im finnischen Wald oder so, aber nicht hier bei uns in Essen, wo meine Familie gerade am Rad drehte.
In den bernsteinfarbenen Augen meines Vaters lag ein gequälter Ausdruck, als er schließlich den Kopf in die Hände stützte und seufzte. »Weißt du, das Problem ist, dass der Laden im Moment nicht besonders gut läuft. Als Gastfamilie bekommen wir etwas Geld und –«
»Das glaube ich dir nicht«, unterbrach ich ihn und erschrak selbst darüber, wie harsch es klang. »Ich meine, das kann doch nicht dein Ernst sein. Seit Jahren lassen wir hier nicht einmal einen Handwerker rein und jetzt nehmen wir plötzlich einen vollkommen Fremden auf? Wenn wir wirklich Geld brauchen, warum verkaufst du nicht einfach ein paar von deinen eigenen Fischen, wenn die doch so wertvoll sind? Warum entlassen wir nicht Christabel?«
»Flora!« Mein Vater war mit einem Mal sehr wütend. »Christabel gehört zur Familie.«
»Ja, ich weiß. Tut mir leid«, sagte ich ein wenig kleinlaut, denn ich war mal wieder über das Ziel hinausgeschossen. Natürlich würden wir Christabel nicht entlassen. Sie war die schlechteste Haushälterin der Welt, aber ich liebte sie. Sie hatte mich praktisch großgezogen. (Na ja, eigentlich hatte ich mich selbst großgezogen, aber sie war immerhin dabei gewesen.)
»Schon gut«, sagte Christabel und legte mir erneut ihre Hand auf den Arm. Dieses Mal ließ ich sie gewähren und tatsächlich tröstete mich die Berührung etwas. Allerdings nur bis zum nächsten halbherzigen Erklärungsversuch.
»Versteh doch, Engelchen, es muss sein«, begann Christabel. »Und so schlimm ist es doch auch gar nicht. Ihr werdet bestimmt Freunde.«
»Pah«, machte ich. Irgendetwas stimmte hier nicht, was wollten sie mir verheimlichen? »Ich bin kein Kind mehr, also sagt mir gefälligst, was los ist.«
»Das haben wir gerade getan.«
»Unsinn.« Ich spürte, wie mir Tränen in die Augen stiegen. Das hatte mir gerade noch gefehlt. Was war nur los mit mir? Heute Morgen noch war alles wie immer gewesen. Dann hatte ich diesen komischen Traum gehabt, auf den ich mir auch jetzt noch keinen Reim machen konnte. Ich hatte Schatten gesehen, wo keine hätten sein dürfen, und nun kam ich nach Hause, um festzustellen, dass meine Familie plötzlich einen ihrer wichtigsten Grundsätze über den Haufen warf, ohne mir den wahren Grund dafür zu sagen.
Meine Unterlippe begann bereits gefährlich zu zittern und so tat ich das einzig Richtige: Ich entschied mich zum Rückzug. »Ich will ihn hier nicht haben«, murmelte ich noch in Marians Richtung, dann stürzte ich hinaus in die Diele.
Meine Zimmertür ließ ich mit einem Knall ins Schloss fallen.
Anschließend warf ich mich auf mein Bett, vergrub das Gesicht in den Kissen und begann zu schluchzen. Es dauerte eine ganze Weile, bis ich mich ausgeweint hatte, besonders weil ich es damit gar nicht eilig hatte. Heiß rollten die Tränen über meine Wangen und bildeten feuchte Flecken auf meinem Kopfkissen. Ich ließ sie gewähren, zu viele Gedanken wirbelten hinter meinen geschlossenen Lidern umher. Ich war wütend. Und ich war verwirrt. Vor allem aber fragte ich mich, ob mein Leben heute tatsächlich auf mysteriöse Weise aus den Fugen geraten war oder ob ich schlicht einen psychischen Aussetzer durchlebte. Hatte ich mir vielleicht meinen Traum, die Schatten und den Jungen in unserem Wohnzimmer vor lauter Müdigkeit zusammenfantasiert? So recht glauben mochte ich das nicht.
Andererseits: Hier in meinem Zimmer war alles wie immer. Mein Blick glitt über meinen stets penibel aufgeräumten Schreibtisch am Fenster, die tiefrot gestrichene Wand mit dem Bücherregal und meinen für ein Mädchen fast schon lächerlich kleinen Kleiderschrank (ich besaß eben nur das Nötigste). An der Decke über meinem Bett hing der einzige Raumschmuck, mit dem ich mich hatte anfreunden können: ein Mobile aus bunten Holzvögeln.
Meine Mutter hatte es mir zusammen mit einem Entschuldigungsbrief vor Jahren aus Brasilien geschickt, wo sie jetzt mit ihrer neuen Familie lebte. Das hatte ich mir jedenfalls erfolgreich eingeredet, nachdem ich das Ding vor sechs Jahren auf einem Flohmarkt gekauft hatte. In Wahrheit hatte ich seit dem Tag, an dem meine Mutter uns verlassen hatte, nie wieder etwas von ihr gehört. Und die Vögel hatten kitschige Glupschaugen. Trotzdem konnte ich mich einfach nicht davon trennen. Es war absurd, aber ich betrachtete es als mein letztes Andenken an Mama.
Jemand klopfte sacht an der Tür. »Engelchen?«, fragte Christabel. »Darf ich reinkommen?«
Ich gab keine Antwort, zog mir stattdessen die Bettdecke über den Kopf und schloss die brennenden Augen. Etwa eine Viertelstunde lang bemühte ich mich einzuschlafen. Immerhin fühlte ich mich auch jetzt noch todmüde, meine Glieder waren so schwer, als steckten Hände und Füße in Betonkübeln. Bestimmt würde ich klarer sehen, wenn ich ein wenig ausgeruhter wäre.
Doch der Schlaf wollte einfach nicht kommen.
Ich hörte ein kratzendes Geräusch an der Wand hinter dem Kopfende meines Bettes, dort, wo sich das Arbeitszimmer meines Vaters befand. Anscheinend stellten sie tatsächlich das Klappbett auf. Sie machten also Ernst.
Noch immer wollte ich es nicht glauben.
Langsam bekam ich Kopfschmerzen. Seufzend warf ich die Decke zurück, unter der es viel zu stickig geworden war, atmete tief durch und stand auf. Zuerst setzte ich mich an den Schreibtisch und kramte das kleine Heft heraus, in dem ich meine Hausaufgaben notierte. Für morgen standen allerdings nur ein paar Matheaufgaben an. Die hatte ich gestern schon gemacht.
Da fiel mir der Korb mit der Bügelwäsche ins Auge und ich begann, die Socken herauszusuchen und zu kleinen Bällen zusammenzufalten. Natürlich wäre das eigentlich Christabels Aufgabe gewesen, genauso wie das Kochen und Putzen. Obwohl Christabel in ihrer britischen Heimat angeblich eine der besten Schulen für Hauspersonal besucht hatte, schien sie sich zu keiner dieser Tätigkeiten in der Lage zu fühlen. Stattdessen begleitete sie meinen Vater beinahe überallhin und interessierte sich auffallend für Kampfsportarten. Mein Vater, der das anscheinend in Ordnung fand, hatte so viel mit dem Laden zu tun, dass ich bereits seit meiner Kindheit den größten Teil der Hausarbeit übernahm.
Umso erstaunter war ich deshalb, als es eine Dreiviertelstunde später (ich legte gerade Handtücher zusammen) erneut an meiner Tür klopfte. »Das Abendessen ist fertig«, sagte mein Vater. »Kommst du bitte?«
»Ich habe keinen Hunger.«
»Doch, den hast du bestimmt.«
Hatte ich auch. Einen Bärenhunger sogar, wie mir jetzt auffiel. Aber ich hatte heute auch erst einen Apfel und ein einsames Stück Pizza gegessen. Widerwillig schlurfte ich zur Tür und folgte meinem Vater in die Küche, bemüht, möglichst beleidigt auszusehen.
Marian und Christabel saßen bereits am Esstisch, Christabel mit deutlich schlechtem Gewissen, Marian mit einem undurchdringlichen Ausdruck in den Augen. Er wirkte jetzt doch ein wenig älter, als ich zunächst angenommen hatte, sein breiter Kiefer verlieh seinem Gesicht etwas Kantiges, das mir zuvor nicht aufgefallen war.
Auf dem Tisch standen Schüsseln mit Nudeln, Tomatensoße und geriebenem Parmesan. Ich ließ mich auf meinen Platz fallen. »Wer hat gekocht?«, fragte ich teilnahmslos.
»Das war ich«, sagte mein Vater, der mittlerweile ein T-Shirt mit dem Aufdruck »Ein Herz für Guppys« trug, und setzte sich neben mich. Sichtlich stolz reichte er mir die erste Schüssel und tatsächlich schmeckte es gar nicht so schlecht.
Trotzdem wurde das Abendessen zu einer eher schweigsamen Angelegenheit, hauptsächlich deshalb, weil ich die meiste Zeit auf meinen Teller starrte. Christabel versuchte ein paarmal, mich in ein Gespräch zu verwickeln, aber sowohl ihre Nachfragen zu meinem Schultag als auch ihre vorsichtigen Vermittlungsversuche (»Marian kommt aus Südfinnland, wir haben vorletztes Jahr quasi bei ihm nebenan Urlaub gemacht.«) speiste ich mit einsilbigen Antworten ab.
Die meiste Zeit über war nur das Klackern von Christabels Fingernägeln zu hören, die so lang waren, dass es einiges an Geschicklichkeit erforderte, damit eine Gabel zu halten, und spitz genug, um jemanden damit aufzuschlitzen. Es waren natürlich keine echten Nägel, sondern diese Gelversionen aus dem Nagelstudio, also viel härter als normale Fingernägel. Und damit eindeutig auch gefährlicher.
Überhaupt war Christabel schon immer diejenige in unserer Familie gewesen, die die Beschützerrolle einnahm. Ich erinnerte mich noch genau an unseren Urlaub auf Mallorca vor fünf Jahren, in dem ein Taschendieb mit dem Portemonnaie meines Vaters abgehauen war. Christabel hatte sich den Typen nicht nur geschnappt und unser Eigentum zurückgeholt, sie hatte ihn auch ganz schön … vermöbelt. Unser gesamtes Geld war in dem Portemonnaie gewesen, plus der Ausweise von meinem Vater und mir. Ich war ziemlich geschockt gewesen, als ich sah, wie sie sich auf den jungen Mann stürzte, der nicht mit den Kampfkünsten unserer ältlichen Haushälterin gerechnet hatte. Im Handumdrehen hatte sie ihm die Schulter ausgekugelt und ihn außer Gefecht gesetzt. Der arme Kerl hatte vor Schmerz laut aufgeschrien. Obwohl ich kein Freund von körperlicher Gewalt war, konnten wir nur froh sein, dass Christabel dabei gewesen war. Mein Vater wäre mit der Sache vollkommen überfordert gewesen. Der brachte es noch nicht einmal über sich, eine Mücke zu erschlagen.
Jetzt machte Christabel allerdings eher einen nervösen als einen aggressiven Eindruck. Immer wieder wanderte ihr Blick zwischen Marian und mir hin und her. Auch wenn ich sie kaum ansah, spürte ich, wie sie mich beobachtete. Gerade so, als warte sie nur darauf, dass ich mich mit diesem dämlichen Austauschschüler, den sie angeschleppt hatte, anfreundete. Aber den Gefallen würde ich ihr nicht tun.
Hastig schlang ich die Nudeln in mich hinein. Dann hatte ich es endlich geschafft, meine Portion zu bewältigen. Ich war zwar noch nicht ganz satt, aber einen Nachschlag zu nehmen und noch länger hier sitzen zu bleiben, kam nicht infrage. Dafür war ich eindeutig noch viel zu wütend. Ohne darauf zu warten, dass die anderen aufgegessen hatten, stand ich auf.
»Ich gehe schlafen«, verkündete ich und war schon fast aus der Tür, als ich plötzlich stockte. Nein! Das durfte doch nicht wahr sein! Hatte ich jetzt endgültig den Verstand verloren? Ich wirbelte herum und starrte zur Spüle herüber.
Aus dem Augenwinkel hatte ich eine Bewegung wahrgenommen. Eine Bewegung, wo keine hätte sein dürfen.
Einen Schatten.
Verfolgten mich diese Dinger jetzt etwa schon bis nach Hause? Ich blinzelte, doch der Platz vor der Arbeitsfläche war leer.
Meine Güte! Sollte ich meinen Vater bitten, mich in eine psychiatrische Klinik zu bringen? Ich war mir sicher, dass da gerade etwas gewesen war, etwas oder jemand. Direkt neben der Spüle. Und es hatte einen Schritt in meine Richtung gemacht. Ich spürte, wie sich eine steile Falte auf meiner Stirn bildete, und fuhr mir mit der Hand über die Augen. Zumindest einen Sehtest sollte ich wohl mal wieder machen. Den würde ich für den Führerschein ja ohnehin in ein paar Monaten brauchen. Bei dem Gedanken, demnächst blind oder geistesgestört in der Fahrprüfung zu sitzen, musste ich grinsen und erschrak im selben Augenblick, weil dieses Grinsen ja wohl eindeutig auf Letzteres hindeutete. Mein Vater, der mit dem Rücken zu mir saß, bemerkte von alldem nichts. Christabel und Marian musterten mich allerdings mit einem höchst merkwürdigen Blick.
»Ist alles in Ordnung, Engelchen?«, fragte Christabel.
Ich blinzelte. »Ja, klar«, stammelte ich. »Gute Nacht.«
Verunsichert stolperte ich ins Bad und stellte mich unter die Dusche. Länger als nötig ließ ich mir das heiße Wasser auf Kopf und Rücken plätschern. Es tat gut. Als würde alle Verwirrung von mir gewaschen. Ich fühlte, wie sich meine Muskeln entspannten und das Gedankenkarussell in meinem Kopf langsamer wurde. So langsam, dass ich, als ich kurz darauf satt und schläfrig in meinem Bett lag, beschloss, mich vorhin in der Küche getäuscht zu haben. Es war ein langer seltsamer Tag gewesen. Kein Grund, hinter jeder Ecke einen Schatten zu sehen, dachte ich, schob mir Franz, mein schafförmiges Kuschelkissen, in den Nacken und griff nach dem Buch auf meinem Nachttisch, um noch ein wenig zu lesen. Schon nach ein paar Seiten jedoch fielen mir die Augen zu. Ich war müde, unheimlich müde. Müde wie nie in meinem Leben.
Der Schlaf überkam mich wie ein unbändiger Sog, schien mich zu verschlingen. Es kam mir vor, als würde er mich in die Tiefe reißen. Als fiele ich mitten hinein in ein dunkles Nichts. Als sänke ich hinab zum Grund eines schwarzen Vulkansees. Es fühlte sich gut an, beruhigend. Aber ganz anders als sonst. Normalerweise dämmerte ich langsam hinüber, hatte einen leichten Schlaf.
Jetzt aber ließ ich mich erschöpft fallen, weiter und immer weiter hinab in die Finsternis, ein Meer aus samtigem Schwarz, das über meine Haut strich wie eine Liebkosung. Bis die wohlige Schwärze plötzlich von einem gleißenden Licht durchbrochen wurde, das mich blendete und zurückzucken ließ. Ich konnte die Quelle nicht ausmachen, doch einen kurzen Augenblick lang fühlte ich mich ganz und gar durchleuchtet. Mein Innerstes war erfüllt von dem Licht, heiß glühend und klar. Friedlich. Fast hatte ich den Eindruck, ich selbst wäre es, die leuchtete wie eine Sternschnuppe und am nächtlichen Himmel ihre Bahn zog. Ich genoss die Hitze auf meiner Haut, die mich zu streicheln schien, sah nichts als Helligkeit und fühlte mich geborgen. Am liebsten wäre ich für immer im Licht geblieben.
Doch wenig später erlosch es genauso plötzlich, wie es erstrahlt war. Die Dunkelheit, die mir vorher so angenehm gewesen war, umschloss mich erneut, dieses Mal jedoch mit eisigem Griff, und riss mich weiter hinab in ihren Schlund. Ich fror, schlang im Fallen die Arme um meinen Körper und bemerkte im gleichen Augenblick, dass ich nicht länger allein war.
Überall um mich herum waren jetzt schemenhafte Gestalten. Und auch sie fielen. Wie menschliche Regentropfen rasten wir gemeinsam hinab. Frierend stürzten wir einem Erdboden entgegen, der von einer Sekunde zur nächsten unter uns erschienen war. Ich erkannte ein Meer von Dächern und Schornsteinen, das sich von Horizont zu Horizont erstreckte. Eine Stadt. Grau leuchtete sie mir entgegen. Doch ich verspürte keine Furcht, war seltsam teilnahmslos, wie man es nur im Traum sein konnte.
Träumte ich tatsächlich wieder?
Ich wusste es nicht, fiel einfach immer weiter. Die finstere Stadt unter mir kam unablässig näher. Straßen und Plätze schälten sich aus dem Dickicht der Häuser. Menschen waren auf ihnen unterwegs, wurden rasend schnell größer, während ich geradewegs auf das Dach eines rechteckigen Gebäudes zustürzte, schneller und schneller. Fast schon hatte ich es erreicht.
Den Aufprall erwartend, blinzelte ich, nur den Bruchteil einer Sekunde schlossen sich meine Lider. Doch im gleichen Augenblick spürte ich, wie mein Fallen abrupt endete.
Ungläubig schlug ich die Augen auf.
3 EISENHEIM
ieder befand ich mich in diesem Raum. Ich erkannte ihn am Geruch und den Gerätschaften unter der Decke. Allerdings schwamm ich dieses Mal nicht in einer Wanne voller Nebel, sondern lag auf einer Art Trage. Und ich fühlte mich auch nicht so erstarrt wie in meinem Traum am Mittag.
Schwungvoll setzte ich mich auf und bemerkte, dass ich mit meiner Vermutung anscheinend gar nicht so falschgelegen hatte: Ich war in einer Art Labor gelandet, und zwar in einem sehr staubigen. Der Raum war klein, kaum größer als mein Zimmer. Vielleicht wirkte er aber auch nur so, vollgestopft, wie er war. Mit Ausnahme der Aussparung, die man für eine niedrige Holztür gelassen hatte, war jeder Zentimeter Wand von Regalen bedeckt, in denen sich Bücher, Tiegel, Dosen und Reagenzgläser in einem heillosen Durcheinander türmten. Dazwischen lugten Werkzeuge und seltsam geformte Metallgegenstände hervor, von denen manche verdächtig nach Skalpellen aussahen. Etwas Schleimiges schwamm in einem Einmachglas auf einem der oberen Bretter.
Ich schluckte. War das hier womöglich der Operationssaal eines Wahnsinnigen? Meine Trage jedenfalls stand ziemlich mittig im Raum und erinnerte mich an die ledergepolsterte Liege meiner Hausärztin. Auch der Geruch sprach dafür, wobei der Staub und die Spinnweben zwischen den Regalen nicht gerade von Sterilität kündeten. Und das gedämpfte Licht, das von einer Petroleumlampe unter der Decke ausging, schien nicht unbedingt das einer Arbeitsleuchte zu sein.
Ein Schaudern durchlief meinen Körper, vor allem weil mir plötzlich auffiel, wie schal und farblos alles um mich herum wirkte. Ausgewaschen und verblichen. Was war das nur für ein seltsamer Traum? Ich sah an mir herunter und bemerkte, dass auch ich jede Farbe verloren hatte. Einen Moment lang starrte ich auf meine grauweißen Hände.
Ein lang gezogenes Quietschen ließ mich zusammenfahren, als plötzlich die schwere Tür des Labors geöffnet wurde und der alte Mann eintrat, den ich bereits in meinem letzten Traum gesehen hatte.
»Ah«, sagte er, als er mich sah. »Du bist aufgewacht.« Mit zwei raschen Schritten, die ich ihm in seinem Alter gar nicht zugetraut hätte, war er bei mir. Obwohl er mit seiner bodenlangen Robe und den buschigen Brauen nicht gerade aussah, als habe er in nächster Zeit vor, mein Gehirn zu transplantieren, wich ich zurück bis ans andere Ende der Liege.
»Wer sind Sie?«, fragte ich mit belegter Stimme.
»Du hast bestimmt Angst, Flora, das ist ganz normal. Und natürlich verstehst du nicht, was heute mit dir geschehen ist«, sagte der Mann und kam erneut näher. »Ich bin Fluvius Grindeaut und es gibt überhaupt keinen Grund, sich zu fürchten, in Ordnung?«
Ich rutschte trotzdem weiter zurück. Zu weit. Unsanft landete ich auf dem gefliesten Boden.
»Hoppla«, sagte der Mann mit dem Bart, während ich mir die schmerzende Hüfte rieb. Dass sich ein Traum so echt anfühlen konnte …
»Was … ist das hier? Wo …?«, stotterte ich.
»Bitte, Flora, du musst wirklich –«
In diesem Moment, gerade als ich mich wieder aufgerappelt und dabei festgestellt hatte, dass ich statt meines Schlafanzugs eine weite dunkle Hose mit passendem Hemd und weiche Lederstiefel trug, erschien aus dem Nichts heraus eine weitere Gestalt. Von einer Sekunde zur nächsten stand sie da, kaum zwei Meter von mir entfernt. Ich erschrak, denn auch diese Person kannte ich bereits.
Es war Marian. Groß und bleich und genauso farblos wie ich sah er mich an, die Kiefer fest aufeinandergepresst. Er war ähnlich gekleidet wie ich. Betont lässig verschränkte er die Arme vor der Brust. Mit einem langen kritischen Blick musterte er mich. »Flora?«, murmelte er misstrauisch.
Ich kniff die Augen zusammen, machte noch einen Schritt nach hinten und spürte, wie meine Schultern gegen eines der Regale stießen. Hinter meinem Rücken begann ich nach etwas zu tasten, das sich als Waffe gebrauchen ließe.
»Bitte beruhige dich, Flora. Wir werden dir alles erklären«, redete der alte Mann noch einmal in beschwörendem Tonfall auf mich ein, bevor er sich zu Marian umwandte und ihn zornig anfunkelte. »Ich hatte dir doch gesagt, du sollst nicht hier auftauchen. Nicht, bis ich mit ihr geredet habe.«
»Ich bitte um Verzeihung, Meister«, sagte Marian, während meine Hand etwas Weiches, Felliges ertastete, das mich angeekelt zurückzucken ließ. »Ich hätte nicht so lange bei ihr wachen dürfen.«
»In der Tat«, sagte der Mann und wandte sich wieder mir zu. »Komm, Flora. Wir haben viel zu besprechen und wir sollten es an einem etwas angenehmeren Ort tun.« Er öffnete die Tür und bedeutete Marian und mir, ihm zu folgen.
Zuerst zögerte ich. Ich misstraute diesen Leuten, aber ich fürchtete mich auch vor diesem finsteren Labor. Und außerdem wäre ich jetzt wirklich gerne aufgewacht. Im Vergleich zu meinem Traum am Mittag dauerte dieser hier entschieden zu lang. Ich versuchte es mit diesem alten Trick, indem ich mich selbst in den Arm kniff, aber außer dass der Schmerz sich überraschend echt anfühlte, passierte nichts.
Erwartungsvoll stand Marian in der Tür und sah mich an. »Komm schon«, sagte er. Es klang beinahe freundlich.
Mit einem Seufzen folgte ich den beiden Männern hinaus und durch einen von gräulich leuchtenden Fackeln erhellten Gang aus grob behauenem Stein, der an einem schmiedeeisernen Tor endete. Unversehens fand ich mich im Freien wieder.
Es war Nacht und wir betraten einen kleinen Platz, der von riesenhaften Wohnhäusern gesäumt wurde. Auf der gegenüberliegenden Seite erhob sich die Silhouette einer Kirche, links und rechts zweigten mehrere Gassen ab, die ich in der Dunkelheit nur erahnen konnte. Eisige Kälte schlug mir ins Gesicht, doch meine Kleidung erwies sich als erstaunlich wärmend.
»Es ist nicht weit«, sagte der alte Mann und hielt auf die Kirche zu. »Und du brauchst wirklich keine Angst zu haben.«
»In Ordnung«, sagte ich und ließ mich unauffällig ein paar Schritte zurückfallen.
»Ich werde Mafalda bitten, uns einen Tee zu kochen«, fuhr er fort und sah sich über die Schulter zu mir um, ein Lächeln auf den Lippen. Es gefror jedoch zu einer Maske, denn in diesem Moment rannte ich los.
Ich machte einfach auf dem Absatz kehrt und nahm die Beine in die Hand. Ohne zu überlegen, stürzte ich in die am nächsten gelegene Gasse.
»Warte!«, rief der Mann heiser. »Bleib hier!«
Doch ich achtete gar nicht auf ihn, rannte einfach immer weiter, ganz egal, wohin, bloß weg von diesen Leuten. Dunkel wuchsen die Häuser rechts und links neben mir empor. Nur hier und da drang ein Lichtschein aus den Fenstern und tauchte die Gasse in ein mattes Schimmern. Meine Schritte waren auf dem Kopfsteinpflaster beinahe lautlos. Ich hörte lediglich meinen eigenen fliehenden Atem und das Klopfen meines Herzens. Trotzdem spürte ich, dass ich verfolgt wurde.
Irgendwo hinter mir war Marian.
Und er holte rasch auf. Er war einfach so viel schneller als ich, schon erahnte ich einen Luftzug hinter mir.
Meine einzige Chance war die Dunkelheit. Ich konnte nur hoffen, dass es mir in der Finsternis gelang, ihn im Gewirr der Gassen abzuhängen. Schnell schlug ich einen Haken, lief wahllos um Kurven, zwängte mich zwischen zwei Häuserwänden hindurch in eine Querstraße und dachte schon, ich hätte es geschafft. Da bemerkte ich, dass ich in einer Sackgasse gelandet war.
Mit einem Satz war Marian bei mir und umfasste meine Schultern mit eisernem Griff. Ich wehrte mich, versuchte, mich ihm zu entwinden und nach ihm zu treten, doch es war zwecklos. Dennoch gab ich nicht auf, zappelte herum, so viel ich konnte, und schrie aus Leibeskräften um Hilfe, während mir der Geruch von Holz und Harz und Erde in die Nase stieg. Wald, schoss es mir durch den Kopf.
»Hiiiiiiilfeeeeeee!«, kreischte ich.
»Beruhige dich, Flora. Niemand hat vor, dir etwas zu tun!«, rief Marian und packte mich noch ein wenig fester. »Beruhige dich!«
»Ich will mich aber nicht beruhigen«, keuchte ich. »Hilfe! Hört mich denn keiner?«
Nirgendwo rührte sich etwas.
»Bitte«, versuchte Marian es etwas freundlicher. »Wir helfen dir. Komm mit mir, ja?«, sagte er und zwang mich, ihm ins Gesicht zu sehen. »Ja?«
Ich schluckte, verwirrt, weil er so anders aussah als heute Nachmittag. Das blonde Haar hing ihm zerzaust und fast weiß in die Stirn und seine vorher grünen Augen wirkten in dieser seltsamen Stadt wie graue Murmeln. Wie glänzendes Glas. Etwas in seinem harten Blick traf mich tief in meinem Innersten, ohne dass ich es hätte fassen oder gar erklären können. Es war ein seltsam vertrautes und doch fremdes Gefühl. Der Ausdruck, der auf seinem ebenmäßigen Gesicht lag, erschütterte mich und beinahe meinte ich, so etwas wie einen Funken Zuneigung darin zu erkennen.
Aber zugleich spürte ich auch, wie ich furchtbar zornig wurde. »Was fällt dir eigentlich ein, dich zuerst in meine Familie und dann auch noch in meinen Traum einzuschleichen?«, fauchte ich und der Funke erlosch. »Ich kenne dich nicht. Ich mag dich nicht. Und ich brauche keine Hilfe, verstanden?«
Einen Augenblick lang taxierten wir uns. Dann kniff ich die Lippen zusammen, starrte betont an ihm vorbei, wartete. Ein paar Sekunden lang hielt Marian mich noch fest, dann lockerte sich sein Griff.
»Verstanden«, sagte er schließlich und ließ mich endgültig los. Abrupt wandte er sich um und ging. Ohne sich noch einmal umzusehen.
Verdattert und außer Atem sah ich ihm nach, bis er kurz darauf um die nächste Kurve verschwand. Ich war allein. Erschöpft hockte ich mich in einen Hauseingang und legte den Kopf in den Nacken. Meine Oberarme schmerzten dort, wo Marians Hände sie umfasst hatten, bestimmt bekam ich blaue Flecken. Ich seufzte. Blutergüsse von einem Traum, das war doch abstrus. Was geschah nur mit mir? Nach allem, was ich über Träume wusste, hatte ich jedenfalls nicht das Gefühl, dass dieser hier normal war. Nein, das Gegenteil war der Fall. Ich war in eine verwirrende Traumwelt geraten, die mir beinahe real erschien, obwohl ich längst zu alt war, um an Orte wie diesen zu glauben. Ich wollte auf die Uhr sehen und tastete in meiner Hosentasche nach meinem Handy. Vergeblich natürlich, denn dies war ein Traum. Ein mieser, handyloser Traum.
Eine Zeit lang blieb ich unschlüssig auf der steinernen Türschwelle sitzen. Vielleicht ist es am klügsten, einfach abzuwarten, bis ich aufwache, überlegte ich, als plötzlich etwas aus der Dunkelheit auf mich zuschoss und mich mit einem Knurren zu Boden riss.
Spitze Zähne blitzten vor meinem Gesicht auf, fauliger Atem schlug mir ins Gesicht. Es war ein Tier, da bestand kein Zweifel. Und es schnappte nach mir. Panisch wand ich mich unter dem Gewicht des Biestes, das in etwa so groß wie ein Schäferhund war, entkam den vorschnellenden Kiefern und rammte meine Faust in die Flanke des Monsters. Meine Fingerknöchel schabten über den von Hornplatten überzogenen Körper, die echsenhaften Augen des Wesens verengten sich zu Schlitzen. Erneut schnappte es nach mir. Diesmal streiften die nadelspitzen Zähne meine Schulter. Ich schrie auf, obwohl die Wunde nicht tief sein konnte. Warmes Blut sickerte in einem Rinnsal meinen Arm hinab, während das Ding auf meiner Brust sich bereit machte, meine Halsschlagader zu zerfetzen.
»Filibert! Aus! Komm her!«, ertönte eine Kinderstimme. Tatsächlich ließ das Ungeheuer augenblicklich von mir ab und trabte zu dem Mädchen hinüber, das in einen altmodischen Mantel und eine Fellmütze gehüllt am Ende der Gasse erschienen war. Ächzend rappelte ich mich auf. Als wäre es so zahm wie ein Regenwurm, strich das Monster um die Beine der Kleinen. Sie mochte vielleicht neun Jahre alt sein. Auf ihrer Stirn bildete sich eine Falte, als sie mich sah.
»Tut … tut mir leid«, stammelte sie, sah dabei aber nicht sonderlich zerknirscht aus. »Ich habe Filibert erst seit ein paar Wochen. Aber er ist selbst für einen Drago ziemlich wild.« Sie griff in ihre Manteltasche und streckte dem Biest zu ihren Füßen die Hand hin. Der Drago, wie sie ihn genannt hatte, schien kurz zu überlegen, ob er sie abbeißen sollte, entschied sich dann aber doch, sich nur das Leckerchen zu schnappen.
»Dein Vieh da hätte mich fast umgebracht, Kleine«, stieß ich hervor und deutete auf meine Schulter. Ein dunkler Fleck von der Größe eines Handtellers hatte sich rechts über dem Schlüsselbein gebildet.
Das Mädchen tätschelte dem Ungeheuer den Kopf. »Tut mir wirklich leid. Irgendwie macht er so was andauernd«, sagte es und warf mir einen verschwörerischen Blick zu. »Meine Mutter hat gesagt, draußen vor der Stadt, wo das ewige Nichts beginnt, leben Dämonen und warten auf jeden, der sich bis dorthin wagt. Ich habe schon überlegt, ob Filibert vielleicht von so einem besessen sein könnte.« Die Kleine flüsterte jetzt. »Das wäre ganz schön cool, oder? Finden Sie nicht?« Sie grinste ein Zahnlückengrinsen.
»Geht so«, sagte ich langsam und wich zurück, als das Biest in meine Richtung sah.
»Einen besessenen Drago hat jedenfalls keiner«, meinte das Mädchen beleidigt und wandte sich um. »Filibert und ich müssen jetzt gehen. Und Ihre Schulter heilt schon wieder. Ist doch nur ein Kratzer.«
Noch immer vollkommen perplex presste ich den Finger auf die Wunde, um die Blutung zu stillen, und sah den beiden nach, auch dann noch, als sie schon längst wieder im Gewirr der Gassen verschwunden waren. Ein Monster hatte mich angefallen und gebissen! War ich eigentlich noch gegen Tetanus geimpft? Im Geiste versuchte ich mir die Stempel in meinem Impfpass vorzustellen. Dann schüttelte ich entschieden den Kopf. Verdammt, das hier war ein Traum, mehr nicht. Einer von der beschisseneren Sorte, zugegeben. Und wie es aussah, einer, in dem ich festsaß.
Ich strich mir das Haar hinter die Ohren und hauchte in meine eisigen Hände. Ein heißer Kaffee wäre jetzt gut, dachte ich und bemerkte kaum, wie ich den Hauseingang verließ und mich aufmachte, diese Stadt zu erkunden, die mir von Moment zu Moment merkwürdiger vorkam. Ich lief los, ohne zu wissen, wohin meine Schritte mich lenken würden, und es dauerte nicht lange, bis die Stille von einem Rauschen übertönt wurde, das langsam lauter wurde. Und deutlicher. Ich näherte mich den Geräuschen, erkannte bald Stimmen, hörte Motoren und Menschen. Neugierig bog ich um die nächste Ecke und befand mich plötzlich auf einer breiten Straße, die von Gaslaternen erleuchtet wurde.
Ein bisschen kam es mir so vor, als wäre ich in einen alten Schwarz-Weiß-Film gestolpert: Zwischen Geschäften und Cafés mit Speisekarten in schnörkeliger Schrift flanierten Menschen jeden Alters. Sie alle trugen altmodische Kleidung, die Frauen schmale Kleider mit tief sitzenden Taillen und passenden Hüten, die Männer Einstecktücher und Spazierstöcke. Glänzende Oldtimer bahnten sich ihren Weg vorbei an spielenden Kindern und Litfaßsäulen, die für Varieté- und Theatervorführungen warben. »Rue Monsieur le Coq« stand auf einem eleganten Schild an einer der Hauswände.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: