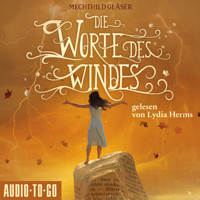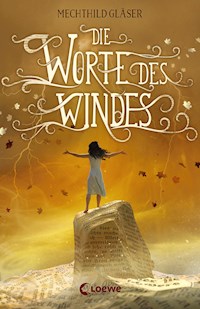9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Loewe
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Eisenheim-Dilogie
- Sprache: Deutsch
Tagsüber geht Flora zur Schule, nachts wacht ihre Seele in Eisenheim auf. Noch immer bedroht der Eiserne Kanzler Eisenheim. Zwar ist es Flora gelungen, den Weißen Löwen vor ihm zu verbergen, aber dafür musste sie Marian anlügen, den Jungen, den sie liebt. Doch nun lauert eine neue Gefahr: Immer mehr Stadtbezirke von Eisenheim werden von einer unheimlichen Macht vernichtet und alles deutet darauf hin, dass Flora und der verschwundene Weiße Löwe der Grund für die Zerstörung sind. Nacht aus Trug und Schatten ist der zweite Teil von Mechthild Gläsers traumhaft schöner Fantasy-Dilogie. Für den ersten Band der Eisenheim-Dilogie wurde Die Buchspringer-Autorin Mechthild Gläser mit dem SERAPH-Phantastikpreis ausgezeichnet. Nun erscheint auch der zweite Teil ihres Debüts. Die hinreißende Liebesgeschichte für Kinder ab 13 Jahren entführt in eine originelle Fantasy-Welt und lädt Leser*innen zum Träumen ein.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 484
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
INHALT
Prolog
1 Asche
2 Marmorkuchen
3 Materienbeben
4 Eine blöde Idee
5 Philistergasse
6 Ruhestörung
7 Der König des Backands
8 Das Ende
9 Nachforschungen
10 Ylva
11 Rache
12 Regen
13 Eishockey
14 Aufbruch ins Ungewisse
15 Fieberwahn
16 Löcher im Nichts
17 Geister
18 Verloren
19 Verschwundene Seelen
20 Hinter der Maske
21 Die Prophezeiung
22 Gegen das Nichts
23 Im Reich der Gespenster
24 Ein Stern und ein Mädchen
Epilog
PROLOG
Schwarz hing der Himmel über den Gassen von Eisenheim. Seelen regneten als menschliche Tropfen von ihm herab, farblose Gestalten, die kurz darauf frierend in ihren Häusern landeten, über die Straßen flanierten oder durch die Fabriktore des Schlotbarons strömten, während andere bereits wieder verschwanden, weil ihre Körper in der realen Welt aufgewacht waren. Wer zurückblieb, hastete bibbernd durch die Straßen und machte, dass er ins Warme kam. Jedenfalls wenn er konnte.
Die Dame rieb die behandschuhten Finger aneinander und zog sich ihr Pelzcape fester um die Schultern. Trotz der Decke, die sie auf der Rückbank des Oldtimers über ihre Beine gebreitet hatte, fühlten ihre Füße sich taub in den geknöpften Stiefelchen an. War es in Eisenheim schon immer so kalt gewesen? Die Dame versuchte, sich zu erinnern, kam jedoch zu keinem zufriedenstellenden Ergebnis. Dafür verließ sie die schützenden Mauern von Notre-Dame viel zu selten. Möglicherweise war es schlicht der Schock, nach Monaten wieder einmal draußen zu sein.
Ihr war keine Wahl geblieben. Ein Hinweis auf die Prophezeiung hatte sie in die Nacht hinausgetrieben. Auch wenn er ins Leere geführt hatte, sie war froh, ihm nachgegangen zu sein. Jedes Fitzelchen Information über Flora und den Weißen Löwen konnte von Bedeutung sein.
Der Wagen holperte über das Kopfsteinpflaster von Graldingen und die Dame hoffte, bald da zu sein. Nun, da sie mit leeren Händen zurückkehrte, hatte sie keine Freude mehr an der frischen Luft oder dem Anblick der Stadt, die ihr sonst so gefielen. Genau wie alle anderen wollte sie nur noch vor ein prasselndes Kaminfeuer. Eine Tasse Tee trinken. Frisch aufgebrüht und mit einem Schuss Likör …
Doch statt aufs Gas zu treten, verlangsamte der Chauffeur das Auto. Die Fahrt geriet ins Stocken, weil ein mit der glänzenden Hülle eines Luftschiffs beladener Transporter ihren Weg kreuzte. Mehrere Wagen mühten sich damit ab, das Ungetüm von einem Zeppelin durch die Gasse zu quetschen. Da war kein Durchkommen.
Der Chauffeur fluchte und schob sich ein nach Anis duftendes Bonbon in den Mund. »Das wird dauern«, brummte er, das Bonbon klackerte gegen seine Zähne.
Das Luftschiff füllte jetzt die gesamte Windschutzscheibe aus, silberne Stoffbahnen zwischen bröckelnden Stuckfassaden.
Unter ihrer Maske presste die Dame die Lippen aufeinander und schloss die Augen. Vermutlich würde sie zu spät zu ihrer Verabredung kommen. Zu spät und tiefgekühlt wie ein Fischstäbchen. Warum hatte sie bloß ein Automobil ohne Flugantrieb ausgesucht? Weil sie es hasste, den Boden unter den Füßen zu verlieren, nun gut. Dennoch war es wenig vorausschauend gewesen, zur Hauptverkehrszeit die inneren Stadtbezirke durchqueren zu wollen. Die Dame ärgerte sich über sich selbst.
Die Minuten verstrichen, während das Luftschiff in Zeitlupe vor ihnen über die Straße kroch und das Klackern des Anisbonbons immer lauter und ungeduldiger wurde. Das Trommeln von Fingern auf dem Lenkrad gesellte sich dazu. »Nun, wir können uns nicht an jede Verkehrsregel halten. Ich setze zurück«, entschied der Chauffeur schließlich und legte den Gang ein.
»Gute Idee«, pflichtete die Dame ihm bei.
Hinter ihnen hupte jemand, als sie sich in Bewegung setzten.
»Platz da!«, rief ihr Chauffeur und kurbelte das Fenster herunter, sodass ein Windhauch sie frösteln ließ. »Das ist ein Notfall, wir –«
Die Dame erfuhr nicht mehr, welche Ausrede er den hinter ihnen Wartenden hatte auftischen wollen, denn in diesem Augenblick knallte etwas auf das Dach ihres Wagens und hinterließ eine gewaltige Delle im Blech gleich über dem Kopf der Dame. Sie stieß einen spitzen Schrei aus und warf sich zur Seite. Direkt neben ihrem Gesicht schabte der Flügel eines Schattenpferdes über die Fensterscheibe. Was ging hier vor?
Die Dame wollte sich gerade aufrappeln, ihren Hut zurechtrücken und den Schaden inspizieren, da traf etwas den Kofferraum. Es schepperte ohrenbetäubend. Dann passierten mehrere Dinge gleichzeitig. Ein Wiehern zerriss die Nacht, ein Huf bohrte sich in die Motorhaube, ein anderer zertrümmerte die Windschutzscheibe und die Nase ihres Chauffeurs mit einem einzigen Tritt.
Glas splitterte.
Blut spritzte.
Der Chauffeur heulte vor Schmerz.
Qualm stieg vom Motorblock auf, dessen Tuckern sich zum Röcheln eines sterbenden Tieres verzerrte.
»Nein!«, rief die Dame und: »Hilfe!« Verzweifelt klammerte sie sich an den Türgriff und machte sich so klein wie möglich, kauerte sich im Fußraum zusammen wie ein verschrecktes Kind. Ein weiterer Schlag ließ den Oldtimer erzittern. Die Dame hörte sich selbst kreischen. Es klang unheimlich und schien die Angreifer für einen Augenblick zu irritieren, denn plötzlich verschwanden die Flügel an der Scheibe.
Langsam hob die Dame den Kopf, bis sie über die untere Kante des Fensters spähen konnte. War es vorbei? Würde sie noch einmal davonkommen? Der Hoffnungsschimmer verblasste so rasch, wie er aufgeglommen war. In der Dunkelheit erkannte die Dame die glühenden Augen mehrerer Schattenpferde, die schnaubend die Köpfe senkten.
Sie nahmen bloß Anlauf.
1
ASCHE
Warum nicht?«, fragte Linus und lächelte mich unschuldig an. Sein Lippenpiercing glänzte im Licht der Laterne, unter der wir saßen.
Mit dem Kinn deutete ich auf das mit Hello Kitty dekorierte Fenster in der ersten Etage des Reihenhauses auf der anderen Straßenseite. »Äh, weil Wiebke die Windpocken hat.«
»Sie ist nicht mehr ansteckend.«
»Aber sie schläft.« Ich verdrehte die Augen. »Es ist drei Uhr morgens, Linus, und ich komme nicht mit rein.«
»Verstehe.« Er verschränkte die Arme vor der Brust, zog eine Schnute und sah unter seinen langen dunklen Wimpern hervor. Zur Jeans trug er lediglich ein Muskelshirt. Kein Wunder, dass er es kaum noch hier draußen aushielt, es war immerhin Mitte November. »Hoffentlich hole ich mir nicht den Tod.«
»Wenn, wärst du jedenfalls selbst schuld.« Ich zog den Reißverschluss meiner Daunenjacke ein Stück nach oben. »Niemand zwingt dich, hier mit mir Wache zu halten.«
»Und niemand zwingt dich, hier draußen auf einer Parkbank herumzusitzen, um uns zu beschützen. Wir könnten es uns drinnen gemütlich machen. Mit Tee und einer Decke, bei mir im Zimmer, auf meinem Bett …«
Er zwinkerte mir zu und ich musste mich anstrengen, nicht aus Versehen zu grinsen. Denn das würde er hundertprozentig falsch verstehen. Obwohl er wusste, dass ich seit Monaten einen anderen liebte, versuchte er immer noch, bei mir zu landen. Dabei hatte er so viel Auswahl, die Mädchen auf unserer Schule standen quasi Schlange. Trotzdem flirtete Linus mich bei jeder Gelegenheit an, als wäre ich das einzige weibliche Wesen auf diesem Planeten. Und Gelegenheiten gab es viele, wenn man bedachte, dass nicht nur seine Zwillingsschwester und ich beste Freundinnen waren, sondern seit dem Vorfall mit dem Schattenreiter vor einigen Wochen auch immer ein Seelenwanderer in der Nähe der beiden blieb.
Unter anderem ich.
Gemeinsam mit Marian und sieben anderen Kämpfern des Grauen Bundes teilte ich mir die Tage und Nächte, um meine Freunde vor dem zu beschützen, was ich in Gang gesetzt hatte. Es war verrückt, wie sich mein Leben verändert hatte, seit ich herausgefunden hatte, dass es die Schattenstadt Eisenheim gab, in der die Seelen aller Menschen sich versammelten, sobald diese einschliefen. Ich war zu einer Wandernden geworden: Im Gegensatz zu Wiebke und Linus erlebte ich diese Reise nun bewusst mit. Doch damit nicht genug, ich hatte meinem Vater, dem Schattenfürsten, auch noch einen magischen Stein gestohlen, ihn verborgen, wiedergefunden und erneut versteckt, bevor ich anschließend alle belog, indem ich so tat, als hätte ich meine Erinnerungen daran verloren. Das hatte einige Leute ziemlich wütend gemacht, zum Beispiel meinen Freund Marian, den ich dadurch verloren hatte, und den Eisernen Kanzler, der nun Jagd auf meine Freunde machte. Dennoch behielt ich mein Geheimnis für mich, denn der Weiße Löwe war gefährlich.
»Geh doch einfach schlafen«, sagte ich.
Linus kniff die Augen zusammen. »Damit du hier allein herumsitzt? Mitten in der Nacht?« Er sprach in der beruhigenden Stimmlage, mit der man Wahnsinnige bedachte, um sie nicht zu verschrecken. »Niemals. Wer weiß, wer sich hier um diese Zeit herumtreibt. Vergewaltiger, Axtmörder …« Er versuchte es zu verbergen, doch er zitterte am ganzen Körper.
Ich betrachtete die gepflegten Vorgärten und die akkurat gesäumten Kieswege des Parks, in dem wir saßen. »Klar, in eurem Viertel ist die Kriminalitätsrate bestimmt erschreckend.« Jetzt lächelte ich doch ein bisschen.
»Alles wäre einfacher, wenn ich auch so ein Wandernder werden könnte. Ich verstehe sowieso nicht, warum nur ein paar Tausend Menschen auf der ganzen Welt dieses komische Bewusstsein für Eisenheim haben dürfen«, schnaubte Linus.
Weil der Rest der Menschheit in den Minen arbeiten und Dunkle Materie für uns abbauen muss, dachte ich. Es war besser, wenn sich die Schlafenden nicht daran erinnerten, und auch Linus würde es nur beunruhigen, wenn er davon erfuhr. »Du brauchst dir wirklich keine Gedanken um mich zu machen. Ich werde sowieso gleich abgelöst.«
»Ja?«, fragte Linus mit einem Stirnrunzeln, als wäre er sich nicht sicher, ob er sich freuen sollte, weil er dann bald ins Warme konnte, oder sich ärgern, weil er bereits ahnte, wer in Kürze hier auftauchen würde. Er blickte auf die Uhrzeitanzeige im Display seines Smartphones. »Wann denn?«
Ich zögerte.
»Flora? Wann kommt die Ablösung?«
»Äh, gleich.«
»Gleich?«
»Mhm.« Ich nickte. »Also noch nicht sofort.«
»Sondern?«
Ich zog die Knie an und steckte sie mit unter meine Jacke, sodass ich in einem Kokon aus Daunen auf der Bank hockte. »In … nicht allzu ferner Zukunft?«, stammelte ich.
Linus runzelte die Stirn. Er saugte an seinem Lippenpiercing. »Häh?«, sagte er schließlich und brachte mich mit seinem verwirrten Gesichtsausdruck endgültig zur Kapitulation.
»Vor anderthalb Stunden«, gab ich zu und stützte den Kopf in meine in den Jackenärmeln steckenden Hände, um mich für Linus’ Ausbruch zu wappnen, der unweigerlich folgte, wann immer er etwas an Marian fand, das er kritisieren konnte. In der Regel genügten Kleinigkeiten wie die bloße Anwesenheit meines Exfreundes. Eine Verspätung von über einer Stunde war für Linus vermutlich Grund genug, Marian aus dem Land zu jagen.
Tatsächlich schäumte er bereits einen Atemzug später vor Wut. »Alter! Ich wusste, er ist ein Arsch. Aber dass er dich echt versetzt! Noch dazu mitten in der Nacht! Bei minus achtzig Grad und –«
»Der Arsch hatte mit einem Notfall zu tun«, sagte eine Stimme hinter uns, ehe Linus sich weiter in Rage reden konnte.
Eine bleiche Hand schob sich auf meine Schulter. »Tut mir leid«, murmelte Marian.
Einen Wimpernschlag lang hüllte mich der Duft von Holz und Erde ein. Finnischer Wald. Dann ließ Marian mich so plötzlich los, als habe er sich an mir verbrannt, und kam um die Bank herum. Breitschultrig baute er sich zwischen Linus und mir und dem Haus, das wir bewachten, auf. Das weißblonde Haar hing ihm ungekämmt in die Stirn, seine Kiefer presste er aufeinander, die Muskeln unter seinem Kapuzensweatshirt waren angespannt. Wieder einmal erinnerte er mich so sehr an einen Wikinger, dass ich vor meinem inneren Auge förmlich sah, wie seine Vorfahren in Drachenbooten die Weltmeere erobert hatten.
»Spät dran, was?«, feixte Linus, den Marians Gestalt nicht im Geringsten zu beeindrucken schien. Er hatte die Beine vor sich ausgestreckt und seinen rechten Arm wie zufällig hinter mir auf die Lehne der Bank gelegt. »Wir hatten trotzdem einen netten Abend. Oder sollte ich lieber sagen: gerade deswegen?«
Der herausfordernde Unterton prallte von Marian ab wie von einer Wand, er bemerkte ihn nicht einmal. Stattdessen starrte er mich an. In seinem Blick erkannte ich, dass etwas nicht in Ordnung war. Ganz und gar nicht in Ordnung. Mit einem Schlag war ich hellwach.
»Es war sehr unterhaltsam.« Linus grinste vielsagend.
»Wurdet ihr etwa angegriffen?«, fragte Marian alarmiert. Seine Hände ballten sich zu Fäusten.
»Nein, hier war alles ruhig. Keine Schattenreiter weit und breit, Linus redet bloß mal wieder Blödsinn«, beeilte ich mich zu sagen. »Was ist denn passiert?«
»Eisenheim«, stieß Marian hervor. Erst jetzt bemerkte ich, wie schnell er atmete. Du meine Güte!
»Was? Was ist mit Eisenheim?« Meine Handflächen wurden feucht.
Für einen Sekundenbruchteil huschten Marians Pupillen in Linus’ Richtung und wieder zurück.
»Marian?« Die nächtliche Stille wurde mit einem Mal unangenehm drückend. »Marian? Rede mit mir.«
»Nichts«, sagte er mit zusammengebissenen Zähnen.
Endlich schien auch Linus den Ernst der Lage zu erkennen. »Okay, Leute, hab’s kapiert. Das ist mein Stichwort.« Er erhob sich. »Also dann: Bis morgen. Gute Nacht, Flora! Tschüss, Hulk! Wird hier ja sowieso langsam ungemütlich.«
»Nacht«, murmelte ich abwesend, während Linus schon zum Haus auf der anderen Straßenseite stapfte und mit zitternden Fingern einen Schlüsselbund aus seiner Hosentasche angelte. Kurz darauf fiel die Haustür hinter ihm mit so viel Schwung ins Schloss, dass vermutlich seine ganze Familie erschrocken aus dem Schlaf fuhr.
Allerdings war das im Augenblick so ziemlich das Letzte, worum ich mir Sorgen machte. »Was ist passiert?«, fragte ich, jede Silbe einzeln betonend. Ich unterdrückte den Impuls, Marian bei den Schultern zu packen und zu schütteln. »Wurde jemand verletzt? Geht es meinem Vater gut? Hat der Kanzler –«
»Es hat geregnet«, flüsterte Marian. »Ascheflocken! Und das Nichts … es bewegt sich wieder!«
Die Furcht schwappte durch meine Glieder wie Eiswasser. Fassungslos starrte ich Marian an und er starrte zurück. Das sonst so leuchtende Grün seiner Augen wirkte dunkel, als läge ein Schleier darüber.
»Es bewegt sich wieder?«, wiederholte ich seine Worte, die sich so ganz falsch auf meiner Zunge anfühlten. Schließlich durfte das nicht sein. Das Nichts, das die Schattenstadt umgab und alle paar Jahrzehnte einen Teil von ihr fraß, war noch lange nicht wieder so weit. Jedenfalls war dies die einhellige Meinung der Wissenschaftler Eisenheims gewesen. Erst vor wenigen Tagen hatten sie meinem Vater noch versichert, wie zuversichtlich sie wären, bald hinter das Geheimnis der vollkommenen Abwesenheit von Materie zu kommen und ein Mittel, mit dem man das Nichts würde kontrollieren können, zu entwickeln. Das Nichts, das in gleichem Maße faszinierend wie tödlich war. »Das kann nicht sein.«
Doch Marian nickte kaum merklich. »Es leckt an den Mauern Notre-Dames.«
Mit dem Nachtexpress fuhr ich zu unserer Wohnung in Essen-Steele, die ich stockfinster und grabesstill vorfand. Sicherheitshalber überprüfte ich alle Zimmer, inklusive des Geheimbüros meines Vaters hinter der Wand seines Arbeitszimmers, in dem wir Marian beherbergt hatten, als er sich noch als Austauschschüler ausgegeben hatte. Erleichtert stellte ich fest, dass sowohl mein Vater als auch unsere ältliche Haushälterin Christabel schlummernd in ihren Betten lagen, Ersterer in einem mit Goldfischen bedruckten Pyjama voller Chipskrümel, Letztere mit pinkfarbenen Lockenwicklern im Haar und einer gehäkelten Schlafbrille mit Troddeln über den Augen. Doch bis auf die Geschmacksverirrung wirkten beide gesund und vor allem lebendig. Ich atmete auf. Das Nichts hatte bisher keinen von ihnen verschlungen.
Vermutlich riefen die beiden in Eisenheim gerade den Notstand aus. Immerhin war mein Vater der Herrscher der Schattenstadt und Christabel sein treuer Bodyguard.
Auf leisen Sohlen schlich ich ins Bad und putzte mir die Zähne, dann legte ich mich mit Klamotten ins Bett. Mittlerweile war es fast vier Uhr, nur noch zweieinhalb Stunden blieben mir bis zum Weckerklingeln und die würde ich nutzen. Um meinen Körper auszuruhen. Und um die Lage in Eisenheim auszukundschaften. Ich hatte Glück, dass es bereits so spät und ich zum Umfallen müde war. Der Schlaf stellte sich ein, kaum dass ich meine Augen geschlossen hatte.
Wie immer, seit ich zu einer Wandernden geworden war, war das Einschlafen kein sanftes Hinüberdämmern, kein Durcheinanderwirbeln von Gedankenfetzen, die sich zu Traumbildern formten, sondern ein dunkler Sog, dem ich mich nicht widersetzen konnte. Von einem Herzschlag zum nächsten war in mir nichts als Schwärze, Finsternis, die jede Faser meines Körpers aushöhlte und mich verschlang. Schon fiel ich. Wind zerzauste mein Haar und ließ es hinter mir flattern.
Ich schrie nicht, während ich ins Bodenlose stürzte. Warum auch? Es gab keinen Grund, Angst zu haben. Zuerst kam die Schwärze, dann das Licht und dann die Stadt. Nacht für Nacht, wann immer ich einschlief. Auch heute umfingen mich Wärme und Helligkeit jäh und wohltuend. Das Gleißen, dessen Quelle ich nicht ausmachen konnte, lockte und liebkoste mich, sodass ich am liebsten dort geblieben wäre. Aber natürlich ging das nicht, denn ich fiel immer weiter. Zärtlich strichen die letzten Lichtstrahlen über meine Wangen. Dann griff eisige Kälte nach mir und biss mir ins Gesicht. Ich sauste durch Nacht und Dunkelheit und erkannte um mich herum andere Seelen, die ebenfalls fielen.
Unter uns lag Eisenheim, ein farbloses Meer aus Häusern und Straßen, schattenhafte Pendants berühmter Bauwerke aus allen Epochen und Kulturen. Noch hatte die Stadt, die sich von Horizont zu Horizont erstreckte, die Größe einer Briefmarke. Aber das änderte sich mit jedem Atemzug, den ich tat. Immer schneller raste ich in die Tiefe. Bald schon konnte ich das Nichts ausmachen, das die Schattenstadt wie eine Faust umschlossen hielt, jederzeit bereit zuzudrücken. Auch heute beugte es sich über Eisenheim, bereit zum Sprung, doch kam es mir vor, als wären da schlierenhafte Bewegungen, wabernde Nebelfetzen, die auf die Ränder der Stadt zukrochen. Oder bildete ich mir das nur ein?
Ich versuchte, mich zu orientieren, erkannte den Palast meines Vaters auf dem Hügel, der Grind genannt wurde, das glitzernde Band des Hades, der die Stadt durchfloss, und die Siedlung der Arbeiter im Krawoster Grund. Endlich schälten sich die vertrauten Türme Notre-Dames aus dem Dickicht. Das Nichts war so nah herangekommen! Es musste innerhalb der letzten Stunden eine Strecke von sicher einhundert Metern zurückgelegt haben. Nur noch der kleine Platz, an dem die Kathedrale errichtet worden war, lag nun zwischen ihr und dem Nichts, das sich in ein viktorianisch anmutendes Stadthaus hineingegraben hatte, sodass nur noch dessen Fassade am Rande des Platzes in den Himmel ragte.
Überall standen Menschen in altmodischer Kleidung und betrachteten die Ungeheuerlichkeit. Eine Frau bückte sich, klaubte ein helles Pulver vom Kopfsteinpflaster und betrachtete es im Licht des Heliometers, der über ihrem Kopf schwebte. Ich riss die Augen auf, während ich immer näher kam. War das die Asche, von der Marian gesprochen hatte? Ascheregen? Die weißliche Substanz bedeckte auch das Dach der Kathedrale. Ich streckte meine Hand nach den Schindeln aus, um das Zeug zu berühren. Meine Finger waren nur noch wenige Zentimeter von ihm entfernt.
Doch die Begutachtung des Wetterphänomens musste ich auf später verschieben, denn in diesem Moment blinzelte ich. Mein Sturz endete so abrupt, wie er begonnen hatte. Statt vom Himmel zu fallen, lag ich wieder in einem Bett in einem Zimmer. In einem schwarz-weißen allerdings, das vollgestopft war mit Dingen wie Surfbrettern und Bungee-Seilen und Kampfstöcken. Nichts, womit ich groß etwas hätte anfangen können. Doch meine Seele, mein Unterbewusstsein, das hier in der Schattenwelt gelebt hatte, bevor ich eine Wandernde geworden war, hatte so manches anders gesehen als ich. Einen Teil davon verstand ich mittlerweile nur allzu gut. Etwa, dass die Schatten-Flora den Weißen Löwen verborgen hatte. Oder ihre Vorliebe für einen gewissen Finnen. Andere hingegen waren mir noch immer ein Rätsel. Das Chaos, das ich in diesem Zimmer vorgefunden hatte, zum Beispiel.
Ich schwang die Beine über die Bettkante und faltete die Patchworkdecke, unter der ich gelegen hatte, zu einem ordentlichen Rechteck. Dann schlüpfte ich in meine weichen Lederstiefel und den Kampfanzug aus dunklem Tuch, den alle Kämpfer des Grauen Bundes trugen, und schnappte mir einen der Langstäbe, die hinter der Tür lehnten. So ausgerüstet trat ich auf den Gang hinaus und machte mich durch farblose Flure voller Teppiche und aus den Wänden ragender Fackeln auf den Weg zum Dämmerungstraining. Denn wenn es einen Termin gab, zu dem ich nach Meinung des Großmeisters musste, dann war es dieser. Immerhin hatte ich Freunde, die es gegen mächtige Schattenpferde zu verteidigen galt, daran änderte auch ein sich bewegendes Ungeheuer von Nichts nicht das Geringste.
Ein bisschen war es, als würde ich durch die Kulissen eines alten Horrorfilms aus den Zwanzigerjahren streifen. Es hätte mich nicht gewundert, wenn ein Mitglied der Addams Family um die nächste Ecke gebogen wäre, so bizarr wirkten das gräuliche Flackern der Flammen und die Schatten des altmodischen Mobiliars, mit dem Generationen von Mitgliedern des Grauen Bundes die Kathedrale bis in die hintersten Ecken vollgestopft hatten.
Die verwinkelten Flure waren um diese Zeit menschenleer. Vielleicht weil alle draußen waren, um das Nichts zu betrachten. Oder, und das war eindeutig wahrscheinlicher, ich war extrem spät dran. Unfassbar viel zu spät dran. Und das ohne vorherige Abmeldung! Ich ahnte bereits, dass Madame Mafalda den augenscheinlichen Weltuntergang, der sich vor den Toren Notre-Dames vollzog, nicht als Entschuldigung durchgehen lassen würde. Rasch klemmte ich mir den Langstab fester unter den Arm und legte einen Zahn zu.
Das Geräusch, mit dem ich mir dreißig Sekunden später den Fuß an einem Biedermeiersekretär stieß, war in der Stille so lächerlich laut, dass ich mich gezwungen sah, es mit heftigem Fluchen zu übertönen. Verdammter Mist!
Ich rieb mir den pochenden Zeh, als sich direkt vor meiner Nase die Flügeltüren des Tiberischen Saales öffneten. Wie immer thronte Madame Mafalda, Schwester des Großmeisters und legendäre Kämpferin, auf ihrem storchenbeinigen Stuhl in der Mitte des Raumes. Ein zeltartiges Kleid umspielte ihre fleischigen Knöchel, ihr Haar hatte sie zu einem Dutt geknotet, der im Vergleich zu ihrer Körperfülle und dem teigigen Gesicht geradezu winzig wirkte. Eine Erbse, die an ihrem Hinterkopf klebte und sich als Frisur ausgab. Über verschränkte Arme hinweg funkelte die alte Dame mich an.
Langsam betrat ich den Übungssaal, dessen Boden von schmalen Wasserkanälen durchzogen wurde.
»So, so«, murmelte sie. »Beim Barte des Desiderius, die Prinzessin bequemt sich also doch noch zu uns.«
Natürlich war mir klar, dass ich bei Madame Mafalda nicht mit einer Sonderbehandlung rechnen konnte, nur weil ich zufällig die Tochter des Schattenfürsten war. »Ich –«, setzte ich dennoch zu einer Entschuldigung an.
»Habe mir nur das Nichts angesehen?«, sagte Madame Mafalda und es klang wie: Der Hund hat meine Hausaufgaben gefressen.
»Nein«, protestierte ich. »Es ist wegen …« Ich zögerte. Madame Mafalda wusste selbstverständlich darüber Bescheid, dass wir Wiebke und Linus bewachten und vor den Schattenreitern des Kanzlers beschützten. Ebenso wie der Großmeister und etwa ein Dutzend Kämpfer des Bundes. Doch das galt längst nicht für alle, die in Notre-Dame lebten und gerade mit Kampfstöcken um uns herumwirbelten. Die Angelegenheit war schließlich einigermaßen … delikat, wenn man bedachte, dass mein Vater dem Kanzler noch immer mehr vertraute als sonst einem Menschen, was wahnwitzig war, nur weil der Kanzler unsterblich war und seit Generationen meiner Familie diente. Dabei hatte er erst vor Kurzem versucht, den Weißen Löwen an sich zu bringen und ein Portal zwischen den Welten zu schaffen, um auch in der realen Welt Angst und Schrecken verbreiten zu können. Ich atmete tief durch. »Es ist wegen meiner Freunde«, erklärte ich.
Madame Mafalda spitzte die wulstigen Lippen. »Gab es irgendwelche Vorkommnisse?«
»Nein, das nicht. Aber –«
Die Schwester des Großmeisters schnaubte. »Dann, Herzchen, bist du zu spät. So etwas dulde ich nicht. Sollte das noch einmal vorkommen, wirst du vom Training ausgeschlossen. Und zwar auf unbestimmte Zeit. Habe ich mich deutlich ausgedrückt?«
»Aber es war nicht meine Schuld!«, rief ich. »Ich wurde nicht rechtzeitig abgelöst, okay? Ich habe nicht getrödelt oder so.« Madame Mafalda sah aus, als habe sie in eine Zitrone gebissen. »Und außerdem bin ich sonst noch nie zu spät gekommen. Es war ein Versehen! Kein Grund, so auszurasten«, ereiferte ich mich weiter. Madame Mafalda schwieg und erst da bemerkte ich die Empörung im Blick der alten Dame und die dunklen Flecken, die der Zorn auf ihre Doppelkinne malte. »Also, äh, es tut mir natürlich trotzdem sehr leid«, nuschelte ich.
Sie seufzte. »Und mir erst. Es ist ja nicht so, als hättest du kein Training nötig, nicht wahr? Na los, warm machen.«
Gehorsam trottete ich in eine Ecke und begann damit, mich zu dehnen. Neben mir fochten derweil der grobschlächtige Arkon und die schmale Amadé. Obwohl Amadé Arkon kaum bis zur Brust reichte, behielt sie die Oberhand und drängte ihren Gegner immer weiter in Richtung Wand. Ihre Bewegungen waren ein einziges Fließen, sie hielt den Langstab so mühelos, als sei er ein Zahnstocher.
Madame Mafalda hatte recht, so gut wie Amadé war ich noch lange nicht und vermutlich würde ich es niemals werden. Dennoch hatte ich in den letzten Wochen beachtliche Fortschritte gemacht. Mittlerweile beherrschte ich zumindest die einfachen Techniken der Verteidigung und auch den einen oder anderen Angriff. Nicht viele Kombinationen, aber dafür effektive. Genug jedenfalls, um jeden Schattenreiter in die Flucht zu schlagen, der sich erdreistete, in der Nähe der Zwillinge aufzutauchen.
Obwohl meine Gedanken immer noch um das Nichts und die weißliche Asche kreisten, die ich bei meinem Sturz gesehen hatte, beeilte ich mich mit den Aufwärmübungen. Anschließend begab ich mich auf die Suche nach einem Gegner, doch das Dämmerungstraining fand ein jähes Ende, noch bevor ich jemanden gefunden hatte.
Denn der Schattenfürst höchstpersönlich rauschte in den Saal. Augenblicklich wurden die Kämpfe eingestellt. Alle Köpfe wandten sich zur Tür.
Mein Vater trug einen Pelzmantel, der bis zum Boden reichte, und seine Kette aus Silberplatten, deren Gewicht ihn leicht vornübergebeugt stehen ließ. Fahrig wischte er sich über die Augen, unter denen dunkle Schatten lagen, die wie Tintenflecken auf seiner aschgrauen Haut klebten. War er in normalen Nächten schon müde, so wirkte er heute zu Tode erschöpft. Durchscheinend. Es sah aus, als habe er Mühe, sich auf den Beinen zu halten. Als wäre er kurz davor, sich auf Christabel oder einen der anderen beiden Kämpfer zu stützen, die seine Eskorte bildeten.
»Hoheit.« Madame Mafalda verneigte sich ächzend und die übrigen Anwesenden taten es ihr gleich. Nur ich hielt mich aufrecht, legte meinen Langstab zur Seite und trat einen Schritt auf meinen Vater zu. »Hallo, Papa. Geht es dir nicht gut?«
Der Schattenfürst sah mich aus wässrigen Augen an. »Doch, natürlich. Wir haben alles unter Kontrolle. Es gibt keinen Grund zur Besorgnis«, sagte er viel zu laut und in keine bestimmte Richtung. »Trotzdem wäre es besser, wenn du jetzt mit mir kommst, Flora.«
Unsicher sah ich zu Madame Mafalda hinüber. Die Schwester des Großmeisters nickte mit verkniffenem Gesicht. »Wenn der Fürst es wünscht«, sagte sie.
Ich konnte nicht verhindern, dass ein feines Lächeln über meine Züge huschte. Erhobenen Hauptes durchquerte ich den Saal und erschrak, als ich meinen Vater erreichte. Von Nahem sah er noch viel ungesünder aus. Er drückte mich kurz an sich.
»Bist du in Ordnung?«, flüsterte ich.
»Nur gestresst«, murmelte er und schob mich zur Tür hinaus.
Schweigend führten seine Leibwächter uns zu der schmiedeeisernen Treppe am Giebel des Ostflügels. An ihrem Ende erwartete uns ein eleganter Zeppelin mit lackschwarzer Außenhaut. Kaum hatten wir die knarrende Treppe überwunden und die Passagiergondel erreicht, schnappte sich Christabel auch schon das Steuerrad und startete die Motoren. Sie gab so plötzlich Gas, dass ich beinahe das Gleichgewicht verloren hätte.
Ich klammerte mich an den Türrahmen und sah mich um. Was ich schon von außen vermutet hatte, bestätigte sich: Der Boden der Gondel war mit schwerem Teppich ausgelegt und die Sitze waren in der Form einer Ellipse angeordnet, sodass jeder Platz ein Fensterplatz war. Ich kannte diesen Zeppelin, natürlich. Schließlich hatte ich mich vor Wochen todesmutig aus eben dieser Gondel abgeseilt, um vor ihrem Besitzer zu fliehen. Rasch suchte ich die Sitze ab. Doch außer dem Schattenfürsten, seiner Eskorte und mir war niemand an Bord.
Wir wanderten in Richtung Bug.
»Wo ist denn –«, begann ich.
»Der Kanzler hatte anderweitige Verpflichtungen. Anscheinend gibt es Probleme mit ein paar außer Kontrolle geratenen Schattenreitern, die ein Auto angegriffen haben«, antwortete mein Vater, noch bevor ich meine Frage zu Ende stellen konnte. Seufzend ließ er sich in einen der Sessel fallen. »Als gäbe es nicht schon genug, worum wir uns sorgen müssen.«
Ich setzte mich neben ihn und nahm seine große, dürre Hand in meine. »Was ist passiert?«, flüsterte ich. »Was soll das heißen? Probleme mit den Schattenreitern? Ich dachte, sie gehorchen dem Kanzler aufs Wort.«
»Normalerweise schon«, sagte mein Vater. »Doch ein paar von ihnen sind heute Nacht außer Rand und Band. Erst haben sie das Mobiliar eines Restaurants zu Kleinholz verarbeitet und dann sind sie raus auf die Straße und haben sich auf das nächstbeste Auto gestürzt. Der Fahrer ist noch an Ort und Stelle gestorben.«
»Das ist ja schrecklich.« Ich schlug mir die Hand vor den Mund. »Weiß man denn schon, warum –«
»Flora«, unterbrach mich mein Vater. »Das Ganze ist unschön, aber momentan wirklich nicht mein größtes Problem. Der Kanzler kümmert sich um diese Sache.«
»Verstehe«, sagte ich. »Dann reden wir also über das Nichts. Warum hat es sich bewegt?«
Mein Vater starrte einen Augenblick lang aus dem Fenster.
»Papa?«
»Wenn wir das nur wüssten. Es geschah ohne Vorwarnung und widerspricht allem, was wir bisher über das Nichts vermutet haben«, sagte er schließlich. »Und ich bin müde, Flora. So unendlich müde.«
»Ich weiß.«
Er schloss die Augen und ich sah hinaus in die Dunkelheit, wo Dächer und Finsternis an uns vorbeizogen. Die Verantwortung für die Schattenwelt hatte meinen Vater mit den Jahren zermürbt. Oft wirkte er wie eine leere Hülle, ein Mann, dem der Fürstenjob die Lebensenergie bis auf den letzten Tropfen ausgesaugt hatte. Und nun hatte ich den Eindruck, dass auch diese Hülle langsam Risse bekam.
»Wurden viele Seelen getö–« Ich räusperte mich. »Verletzt?«
»So wie es aussieht, haben wir noch einmal Glück gehabt. Es hat hauptsächlich leer stehende Gebäude erwischt«, sagte mein Vater. Noch immer hielt er die Lider geschlossen. »Allerdings ist es verdammt nah an die bewohnten Teile der Stadt herangekommen. Beim nächsten Mal könnte es übel werden, vor allem weil …«
»Niemand weiß, wann das nächste Mal sein wird«, beendete ich den Satz für ihn, um im nächsten Moment aufzuspringen. »Ach du Kacke!«
Ich riss das Bullaugenfenster vor uns auf und starrte auf die grauweißen Flocken, die dahinter in die Tiefe rieselten. Ein merkwürdiges Gefühl machte sich in meiner Brust breit. Ein Ziehen, das mir seltsam bekannt vorkam. Als wäre da ein pulsierendes Loch in meinem Herzen, das ausgefüllt werden wollte. Das Ziehen verwandelte sich in ein schmerzhaftes Reißen, je mehr von dem Zeug vom Himmel schneite.
Ich biss mir auf die Lippe. Konnte es sein, dass … nein, das war absurd. Oder? Wie ferngesteuert schob sich meine Hand durch das Fenster hinaus in die Kälte. Behutsam fing ich eine der Flocken auf, um sie genauer zu betrachten. Ich keuchte auf, so plötzlich nahm die Intensität des Schmerzes in meiner Brust zu, und ich erkannte, dass es der Weiße Löwe war, der nach mir rief. Nein, der schrie, als drohe ihm Unheil in seinem Versteck tief unter den Fundamenten Eisenheims.
Ich schüttelte den Kopf. Was hatte das zu bedeuten? Fast meinte ich, die scharfkantige Oberfläche des Steins unter meinen Fingerspitzen zu spüren. Dabei war es doch nur Asche. Eine winzige Flocke, die in meiner Hand zu Staub zerbröselte und vom Wind davongetragen wurde. Ascheregen über einer Stadt, in der es niemals regnete.
Mein Vater, der sich schwerfällig aus seinem Sessel erhoben hatte, taumelte neben mich. »Irgendetwas läuft hier schief«, sagte er, fing ebenfalls eine der Ascheflocken auf und zerrieb sie zwischen Daumen und Zeigefinger. Die Partikel rieselten zu Boden und bildeten einen Schmutzfilm auf dem dunkelschwarzen Flor des Teppichbodens.
Ich umschlang meinen Oberkörper mit beiden Armen, weil ich das Gefühl hatte, sonst auseinanderzubrechen. »Ja«, keuchte ich. »Und zwar so was von schief.« Der Schmerz nahm mir den Atem.
Entschlossenheit trat in den Blick meines Vaters. »Aber dir wird nichts passieren, Flora, das schwöre ich. Dieser Zeppelin bringt uns direkt zum Buckingham-Palast und dort wirst du die nächsten Wochen über bleiben. Dort kann dir nichts geschehen.«
»Was?«, entfuhr es mir.
»Der Palasthügel ist der sicherste Punkt der Stadt, er ist am weitesten vom Nichts entfernt«, erklärte der Schattenfürst mit Bestimmtheit. »Bis auf Weiteres wirst du dort bleiben.«
Ich starrte meinen Vater an. »Was soll das heißen?«
»Es heißt, dass ich meine Tochter beschütze.«
2
MARMORKUCHEN
Als mich das Weckerklingeln gegen 6.30Uhr aus dem Schlaf riss, fühlte sich mein Körper an, als wäre er von einem Lkw überrollt worden. Jeder meiner Muskeln schmerzte. Meine Schultern brannten und mein Nacken war total verspannt. Am schlimmsten jedoch war das Hämmern in meinem Kopf, gleich hinter der Stirn, das heftiger wurde mit jedem Fiepen des Weckers. Schlaftrunken streckte ich meine Hand aus und tastete nach der Höllenmaschine auf meinem Nachttisch. Es polterte, als ich meine Leselampe herunterstieß. Lange, viel zu lange danach fand ich den Wecker und den dazugehörigen Aus-Knopf. Am liebsten hätte ich mich umgedreht und weitergeschlafen. Wahrscheinlich hätte ich es sogar getan, wenn das nicht bedeutet hätte, dass meine Seele gleichzeitig nach Eisenheim zurückgekehrt wäre, wo gerade die Welt unterging!
Es bedurfte all meiner Willenskraft, die Decke zurückzuschlagen und mich aufzusetzen. Wie ein Zombie schlurfte ich in Richtung Flur, wo mich das Licht der Deckenlampe blendete. Blinzelnd erreichte ich die Küche und stellte fest, dass der Kaffee bereits durchlief, während Christabel und mein Vater im Wohnzimmer flüsternd Kriegsrat hielten.
Weil ich in diesem Zustand wohl kaum zu einem klaren Gedanken fähig sein würde, steuerte ich zunächst das Bad an. Unter der Dusche ließ ich mir heißes Wasser in den Nacken prasseln, bis der Raum voller Dampf war und meine Haut sich rötete. Ohne im beschlagenen Spiegel etwas erkennen zu können, rubbelte ich mein schulterlanges Haar mit dem Handtuch durcheinander, um die braunen Strähnen anschließend wieder mühsam mit dem Kamm zu entwirren. Ich schloss die Augen, während der Föhn meinen Pony verwirbelte, dann schlüpfte ich in Jeans, Pullover und Wollsocken. In der Küche füllte ich mir einen Thermobecher Kaffee ab, dann war ich bereit.
Mein Vater saß in seinem Lehnsessel. Er trug noch immer seinen Goldfisch-Pyjama, seine Wangen wirkten matt und eingefallen und bildeten einen erschreckenden Kontrast zu Christabel, die ihr Gesicht bereits unter einer Schicht grellen Make-ups verborgen und sich die feuerrote Dauerwelle zu einer Tolle geföhnt hatte.
»Guten Morgen, Engelchen«, sagte Christabel und klopfte neben sich auf das Polster der Couch. »Setz dich zu uns.«
Erschöpft sank ich in die Kissen. Eine Weile lang sagte niemand etwas. Alle drei starrten wir in unsere Kaffeebecher, bis ich es schließlich nicht mehr aushielt. »Und?«, fragte ich. »Was sollen wir jetzt tun?«
Der Schattenfürst wiegte bedächtig den Kopf hin und her. »Wenn wir das nur wüssten.«
Wieder schwiegen wir, während mein Vater mit Daumen und Zeigefinger seine Nasenwurzel massierte und die Fische in den Aquarien an der Wand hinter ihm sich eine Balgerei um die Futterfitzelchen lieferten, die an der Oberfläche trieben.
»Ich werde mich so rasch wie möglich mit meinem Kanzler darüber beratschlagen.«
Abrupt stand ich auf. Natürlich, der Kanzler! Obwohl ich meinem Vater wieder und wieder zu erklären versucht hatte, was der Kanzler wirklich im Schilde führte, dass es ihm einzig und allein um den Weißen Löwen und sein Portal in die reale Welt ging … Mein Vater wollte es anscheinend nicht verstehen. Schon seit Monaten stieß ich auf taube Ohren, wann immer ich das Thema anschnitt. Also versuchte ich es gar nicht mehr. »Ich muss zur Schule«, sagte ich deshalb nur und überließ die beiden ihren Grübeleien.
In der Diele schnappte ich mir Schal, Jacke und Rucksack und trat kurz darauf in den nasskalten Morgen hinaus. Doch statt mich über die Blindheit meines Vaters zu ärgern, wanderten meine Gedanken, wie so oft in letzter Zeit und ohne dass ich es verhindern konnte, zu jemand anderem: Marian. Seit er sich eine eigene Wohnung gesucht und sein Biomedizinstudium angefangen hatte, sahen wir uns tagsüber kaum noch. Höchstens mal, wenn es um eine Wachablösung bei den Zwillingen ging, so wie gestern. Doch auch in den Nächten war es kaum besser. Zwar nahmen wir beide nach wie vor am Dämmerungstraining teil, doch selbst das versäumte Marian in letzter Zeit immer häufiger, um seine Schwester in den Minen zu besuchen oder vielleicht auch schlicht, weil er mir aus dem Weg gehen wollte …
Doch heute würde es anders sein, das hatte ich schon vor Wochen beschlossen. Ich hielt dem Busfahrer mein Ticket unter die Nase und ließ mich in einen der staubigen Sitze plumpsen.
In der Schule fehlte Wiebke noch immer wegen ihrer Windpocken. Die beiden Doppelstunden Mathe und Englisch brachte ich trotzdem irgendwie hinter mich. Nicht dass ich etwas vom Unterricht mitbekommen hätte, aber es gelang mir zumindest, den Anschein zu erwecken, ich würde zuhören, während ich in Wahrheit gegen meine bleierne Müdigkeit kämpfte. In der darauffolgenden Kunststunde wurde es dann schon kritischer. Tatsächlich döste ich einmal beinahe über meinen Acrylfarben ein und fand mich einen Augenblick später mit der Wange auf der frisch bepinselten roten Leinwand wieder. Meine linke Gesichtshälfte hatte glücklicherweise einen einigermaßen ansprechenden Abdruck hinterlassen, der meiner Kunstlehrerin so gut gefiel, dass ich so tat, als wäre es Absicht gewesen. Bis zum Mittag verlief der Tag also eigentlich ganz gut. Ich wurde für mein Bild gelobt! Ich, die sonst um jeden geraden Strich rang und nicht einmal die Grundregeln der Farbenlehre beherrschte.
Dann kam die Deutschstunde.
Und mit ihr das Desaster.
Herr Bachmann hatte es sich nämlich in den Kopf gesetzt, mal wieder eine seiner angestaubten Literaturverfilmungen zu zeigen. Welche, bekam ich leider schon nicht mehr mit, denn sobald er den Klassenraum verdunkelte, war es um meine Selbstbeherrschung geschehen. Mein Kopf sackte auf die Brust, dann war ich weg.
In der nächsten Sekunde erwachte ich in einem Himmelbett mit mottenzerfressenen Vorhängen unter einer Decke aus muffiger Spitze. Natürlich war auch mein Zimmer im Schattenpendant des Buckingham-Palastes vollkommen farblos. Graue Tapeten schälten sich von grauen Wänden, auf die das weißliche Licht des Kronleuchters hellgraue Muster zeichnete. Bis auf wenige Räume war das ehemals prunkvolle Gebäude eine Bruchbude. Schon lange hatte mein Vater es aufgegeben, sich um seinen Wohnsitz in Eisenheim zu kümmern. Überall hingen Spinnweben und Staub, an etlichen Stellen bröckelte das Mauerwerk.
Einmal in der Schattenwelt angekommen, war meine Müdigkeit wie weggeblasen. Mein Körper schlief schließlich, zwar im Unterricht von Herrn Bachmann (was suboptimal war), aber er ruhte sich aus. Das war alles, was zählte.
Rasch warf ich die stinkende Decke von mir und rappelte mich auf. Ich wollte gerade zur Tür hinübergehen, als jemand in der realen Welt an meiner Schulter rüttelte. Ich schlug die Augen auf und erkannte vor mir den Schnauzbart meines Deutschlehrers, der bedrohlich zitterte.
»Das darf doch wohl nicht wahr sein!«, rief Herr Bachmann. »Du schläfst schon wieder während meines Unterrichts?«
»N-nein«, stammelte ich. »Ich war nur kurz … Entschuldigung, ich hatte eine unruhige Nacht heute. Diesmal liegt es ganz bestimmt nicht am Film. Ehrlich nicht. Es tut mir leid. Jetzt bleibe ich wach.«
Herr Bachmann hob eine Augenbraue. Auch er schien unsere Diskussion im Zusammenhang mit den Buddenbrooks noch in lebhafter Erinnerung zu haben. »Na gut«, knurrte er schließlich und ließ den Film weiterlaufen.
Ich nahm mir tatsächlich vor, wach zu bleiben, denn ich wollte auf keinen Fall noch mehr Ärger riskieren. Notfalls würde ich meine Augen mit Daumen und Zeigefingern aufhalten müssen. Allerdings war ich zu müde, um meine Hände zu heben. Ich bekam gerade noch mit, wie ein junger Mann auf dem Bildschirm durch das Sankt Petersburg des 19.Jahrhunderts spazierte, dann war ich auch schon wieder eingepennt.
Durch Dunkelheit und Kälte wanderte meine Seele zurück in die Schattenwelt, wo ich auf dem Teppich in meinem staubigen Palastgemach landete und statt zur Tür doch lieber zum Fenster schlenderte (schließlich würde ich vermutlich schon sehr bald wieder aus dem Schlaf gerissen werden, da machte es wenig Sinn, irgendwohin zu gehen).
Also hockte ich mich auf die Fensterbank und wartete. Durch die verschmierten Scheiben spähte ich derweil hinunter in den Innenhof, in den gerade eine pechschwarze Kutsche einfuhr. Sie wurde von zwei mächtigen Schattenpferden gezogen, deren Schwingen von einer Art Zaumzeug auf ihrem Rücken zusammengehalten wurden. Das Gespann durchquerte den Hof, vollführte einen Halbkreis und kam schließlich vor dem Hauptportal zum Stehen.
Dann passierte eine Zeit lang überhaupt nichts. Die Schattenpferde stierten vor sich hin, während Vorhänge verhinderten, dass ich das Innere des Wagens und seine Passagiere erkennen konnte. Ich nagte an meiner Unterlippe und fragte mich, wer ausgerechnet jetzt etwas von meinem Vater wollte. Es war doch allgemein bekannt, aus welcher Zeitzone der Fürst stammte und dass er folglich um diese Uhrzeit kaum in der Schattenwelt anzutreffen sein würde …
»Also, nun reicht es mir aber!«, donnerte Herrn Bachmanns Stimme ungehalten zwischen meine Gedanken. Mit dröhnendem Kopf fand ich mich in der realen Welt wieder. Herrn Bachmanns Gesicht war von unzähligen roten Flecken überzogen und sein Atem ging schwer. »Eine Unverschämtheit ist das«, schimpfte er.
Ich rieb mir die Stirn, die sich verdächtig danach anfühlte, als sei sie kurz zuvor auf die Tischplatte vor mir geknallt. Ich ertastete sogar eine Einkerbung, die vermutlich von der Holzkante stammte. »’tschuldigung«, murmelte ich, während Herr Bachmann mich ins Klassenbuch eintrug. »Es war keine Absicht. Es ist nur …«
»So ein Verhalten dulde ich nicht.« Er fuchtelte mit seinem wulstigen Zeigefinger vor meiner Nase herum. »Das wird Konsequenzen haben.«
»Ich konnte heute Nacht wirklich kaum schlafen«, beteuerte ich. Doch Herr Bachmann würdigte mich keines weiteren Blickes mehr.
Der Film lief weiter, und ohne dass ich etwas dagegen ausrichten konnte, fielen mir erneut die Augen zu. Zum dritten Mal innerhalb von einer halben Stunde wanderte meine Seele in die Schattenwelt. Ich erreichte meinen Platz am Fenster gerade noch rechtzeitig, um zu sehen, wie jemand die Tür der Kutsche hinter sich zuzog. Jemand, der einen Dreispitz trug. Im nächsten Moment setzten sich die Schattenpferde in Bewegung. Der Wagen hatte den Eisernen Kanzler also abgeholt, überlegte ich. Und zwar eindeutig vom Palast und nicht von der Villa auf der anderen Seite des Parks, die der oberste Befehlshaber der Schattenreiter bewohnte. Die Frage, die sich stellte, war also, warum Alexander von Berg hier gewesen war.
Mitten am Tag. Ohne meinen Vater.
Die Kutsche rollte vom Hof und in die Dunkelheit der Stadt hinaus. Ich hingegen blieb in meinem heruntergekommenen Zimmer zurück und sah ihr nach, auch als sie schon längst aus meinem Blickfeld verschwunden war. Ich starrte vor mich hin und hing meinen Gedanken nach. Erst als ich Herrn Bachmanns Schnauzbart wenige Zentimeter von meinem Gesicht entdeckte, bemerkte ich, dass ich mich wieder in der realen Welt befand.
Diesmal schrie mein Deutschlehrer mich nicht an. Stattdessen schnappte er nach Luft, als fehlten ihm die Worte. »Raus« war alles, was er mir flüsternd entgegenschleuderte. »Raus aus meinem Unterricht! Sofort!«
»Oh nein, es tut mir –«, setzte ich zu einer weiteren Entschuldigung an. Allerdings hatte ich nicht damit gerechnet, wie schlecht einem vom Seelenwandern werden konnte, zumindest wenn man es so oft in so kurzer Zeit tat. Übelkeit stieg in mir auf und ließ meine Knie weich werden. Zittrig erhob ich mich und griff nach Rucksack und Jacke. »Ich glaube, ich bin krank oder so«, murmelte ich noch, dann begann ich zu würgen. Gerade noch rechtzeitig erreichte ich den Mülleimer, um mich zu übergeben.
»Es tut mir wirklich leid, Herr Bachmann«, sagte ich, sobald ich wieder dazu in der Lage war, mich zu erheben. »Aber ich bin wahrscheinlich nicht ganz gesund. Ich fühle mich schon den ganzen Tag über so fiebrig«, log ich. »Am besten, ich gehe nach Hause.«
Herr Bachmann nickte und tupfte sich mit einem Taschentuch die Schweißperlen von der Stirn.
So schnell ich konnte, verließ ich das Schulgelände.
Zu Hause ließ ich mich auf mein Bett fallen und schlief augenblicklich wieder ein. Etwa drei Stunden lang saß ich auf meiner Fensterbank in Eisenheim und hatte das Gefühl, die einzige Seele weit und breit zu sein. Dann erwachte ich davon, dass mein Handy Alarm schlug, um mich an mein Vorhaben zu erinnern. Rasch kämmte ich meine Haare, putzte mir die Zähne und trank einen halben Liter Wasser, um den bitteren Geschmack in meinem Mund loszuwerden. Dann verfrachtete ich den Marmorkuchen, den ich gestern gebacken hatte, in eine Transportbox.
Zehn Minuten später erreichte ich das Haus mit der klogrünen Fassade. Es lag nur wenige Straßen von unserer Wohnung entfernt und beherbergte oben unter dem Dach ein winziges Zweizimmerapartment, das Marian gemietet hatte. Ich klingelte und war erleichtert, als schon kurz darauf das Summen des Türöffners ertönte. Insgeheim hatte ich mir die ganze Zeit über Sorgen gemacht, Marian würde vielleicht überhaupt nicht zu Hause sein.
Das Treppenhaus war krumm und schief und hätte einen neuen Anstrich vertragen können. Pappkartons und Sperrmüll sammelten sich auf den Absätzen zwischen den Stockwerken. Kindergeschrei drang aus der Wohnung im Erdgeschoss, Technomusik aus der darüber. Ausgeblichene Fußmatten wellten sich dem geneigten Besucher entgegen, überall lagen Werbeprospekte von Supermärkten und Möbelhäusern, dazwischen alte Ausgaben des Steeler Kuriers.
Hastig stieg ich hinauf in die vierte Etage, wo Marian im Türrahmen lehnte. Er empfing mich in Jogginghose und T-Shirt. Sein Haar war noch feucht vom Duschen.
»Hey!«, begrüßte er mich überrascht. »Ist … alles in Ordnung?«
Zur Antwort streckte ich ihm die Kuchenbox entgegen. »Happy Birthday«, sagte ich. »Eigentlich wollte ich dir ja schon heute Nacht gratulieren, aber in dem ganzen Chaos ist es dann untergegangen.«
»Danke.« Zögerlich nahm Marian mir die Box aus der Hand, musterte erst ihren Inhalt und dann mich. »Willst du reinkommen? Ich habe eine Pizza im Ofen. Dazu gibt es Grünzeug.«
Ich nickte.
Nachdem ich mir Schuhe und Jacke abgestreift hatte, folgte ich ihm in das Innere seiner Studentenbude, die aus einem Schlafzimmer, in das kaum das Bett passte, und einem blau gefliesten Badezimmerchen sowie einer Wohnküche bestand. Ich war erst ein Mal hier gewesen, vor einigen Wochen, als Marian eingezogen war. Seither war es nicht ordentlicher geworden. Überall stapelten sich Bücher und Zeitschriften, selbst auf der Couch und dem Fernseher in der Ecke, dazwischen entdeckte ich Marians Gitarre und Teile seiner Eishockeyausrüstung. Am chaotischsten aber war sein Schreibtisch, der aussah, als hätte er seinen Papierkorb darüber ausgekippt. Blätter türmten sich über schmutzigen Kaffeetassen und dem Laptop, von dem lediglich eine Ecke hervorlugte.
Ich trat neben Marian, der an seiner Küchenzeile herumhantierte und eine Dose Mais in eine Schüssel kippte. »Ist es okay, dass ich vorbeigekommen bin? Ich dachte, so einen Abend will doch niemand allein verbringen, und weil deine Familie in Finnland ist und mein Vater und Christabel gerade Eisenheim retten müssen …«
»Ich freue mich, dass du da bist«, sagte Marian, ohne aufzublicken.
»Wirklich?«
»Natürlich, es ist nur … Ich bin bloß müde. War ein langer Tag. Zuerst hatte ich Vorlesung, dann noch Training. Aber es ist schön, dass du an meinen Geburtstag gedacht hast.«
Marian wusch Kopfsalat. Ich beobachtete ihn im Profil. Er sah wirklich erschöpft aus. Im Oktober hatte er als Spieler beim hiesigen Eishockeyteam angeheuert, den Essener Moskitos, und war für diese mittlerweile sozusagen unentbehrlich geworden. Denn anscheinend war er gut. Richtig gut. Sein jahrelanges Training in Finnland hatte ihm bereits etliche Anfragen aus höheren Ligen eingebracht, doch Marian wollte natürlich in Essen bei seinem Fürsten bleiben, weswegen er dort ein ziemlich großer Fisch in einem ziemlich kleinen Teich war. Christabel meinte, diese Regelung sei ideal, weil er sich bei den Moskitos etwas dazuverdiente, aber mit dem Trainer ausgehandelt hatte, nur an einem Spiel pro Woche und nicht jeder Trainingseinheit teilzunehmen, damit er gleichzeitig studieren und weiterhin für meinen Vater tätig sein konnte.
Die Küchenuhr klingelte und Marian öffnete den Ofen. »Wir können dann essen«, sagte er.
Etwa eine Viertelstunde lang kauten wir schweigend. Jeder von uns hockte an einem Ende des Sofas, zwischen uns der Teller, auf dem Marian die Pizzastücke gestapelt hatte, und die Salatschüssel. Marian betrachtete abwechselnd das Muster der Polster, die Fransen des Teppichs, einen Fleck auf dem kleinen Couchtisch vor uns. Er sah überallhin, bloß nicht zu mir. Wir aßen gemeinsam und doch war da diese unsichtbare Wand, die uns voneinander trennte.
»Heute habe ich den Kanzler im Palast meines Vaters erwischt«, begann ich irgendwann, nur um die Stille zu übertönen. »Würde mich nicht wundern, wenn er wieder irgendetwas ausheckt.«
»Mhm«, machte Marian und nahm sich noch ein Stück Pizza. Es war das erste Mal seit einer gefühlten Ewigkeit, dass wir miteinander allein waren, und offensichtlich behagte es ihm nicht.
»Marian?«
»Ja?« Er betrachtete eine auf den Boden gefallene Olive.
Ich seufzte. »Soll ich lieber wieder gehen?«
Endlich hob er den Blick. »Nein!«, entfuhr es ihm. »Nein, bitte bleib noch. Es tut mir leid.« Sein ansonsten so kantiges Gesicht wirkte mit einem Mal weich im Licht der Stehlampe. »Ich sitze echt nicht gern so weit von dir entfernt auf diesem bescheuerten Sofa, glaub mir. Aber ich habe Angst, dir zu nah zu kommen.«
Wir sahen uns an. Lange. So lange, bis ich glaubte, durch das Grün seiner Iris bis auf den Grund seiner Seele schauen zu können.
»Ich weiß«, sagte ich schließlich und schloss die Augen. »Weil du mir nicht verzeihen kannst.«
Das war es jedenfalls, was Marian mir auf dem Ball im Palast meines Vaters erklärt hatte, als wir uns das letzte Mal unter vier Augen unterhalten hatten. Es würde ihm schwerfallen, mir jemals zu verzeihen, vielleicht gelänge es ihm nie, hatte er gesagt, nachdem ich den Weißen Löwen verborgen und so getan hatte, als hätte ich all meine Erinnerungen an das Versteck des magischen Steins aus meinem Gedächtnis gelöscht. Für Marian gab es damit nun keine Möglichkeit mehr, seine Schwester zu retten, deren Seele in Gestalt eines Monsters ein trauriges Leben in den Minen unter der Stadt fristete, gebunden an das Materiophon, das ihre Eltern einst erfunden hatten, um sie zu heilen. Ich hatte all seine Hoffnungen zunichtegemacht. Dabei stimmte das gar nicht. Ich wusste sogar noch sehr gut, wohin ich den Weißen Löwen gebracht hatte. Doch ich hatte alle deswegen belogen, auch Marian. Sogar jetzt belog ich ihn, weil ich es musste. Weil der Stein zu gefährlich war. Für beide Welten. Ich hatte mich für Eisenheim entschieden und gegen unsere Liebe. Ich hatte das Richtige getan und das Wichtigste verloren.
Marian schwieg. Stattdessen hörte ich, wie der Pizzateller mit einem Klirren auf dem Boden zerschellte. Ein schwieliger Daumen wischte mir eine Träne von der Wange. Ich hatte gar nicht bemerkt, dass sie unter meinem Augenlid hervorgekullert war. »Es geht einfach nicht«, murmelte Marian. Er war jetzt ganz nah. Sein Atem streifte meine Halsbeuge und ich vergrub meine Hände in seinem seidigen Zottelhaar, barg mein Gesicht an seiner Schulter. Einen Atemzug lang klammerte ich mich an ihn, als würde ich ohne ihn auseinanderfallen. Ich sog seinen Duft ein, spürte seine Haut an meiner Wange, fühlte die Wärme seines Körpers und seine kräftigen Arme, die mich hielten.
Dann löste ich mich von ihm. Blinzelte. »Schon gut«, sagte ich und stand auf, um den Kuchen zu holen. »Nachtisch?«
»Ich liebe dich trotzdem, Flora. Das weißt du doch, oder? Möglicherweise brauche ich nur noch etwas mehr Zeit.«
»Vielleicht«, sagte ich, schnitt den Kuchen und schluckte meine Tränen herunter. Es tat weh, Marian so nah zu sein. Viel mehr, als ich erwartet hatte. Trotzdem konnte ich nicht anders.
So saßen wir also da, aßen krümeligen Marmorkuchen, fühlten uns elend, und doch genossen wir es, im selben Raum zu sein, den anderen zu sehen. Für ein paar Sekunden gelang es mir sogar, mir vorzustellen, wie es eigentlich sein sollte. Wie es hätte sein können, wenn wir beide ganz normale Menschen gewesen wären, die nichts von der Schattenwelt und alledem wussten.
Dennoch entschied ich mich, bald danach zu gehen. Marian brachte mich nach Hause. Schweigend trotteten wir nebeneinanderher. Erst als wir vor meiner Haustür angekommen waren, ließ ich meine Fingerspitzen vorsichtig über seine Handrücken gleiten, ganz kurz nur. »Ich liebe dich auch«, sagte ich.
Für den Bruchteil einer Sekunde schien Marian sich vorzuneigen, als wolle er mich küssen. Dann ließ er es aber doch bleiben. »Das war ein schöner Geburtstag«, sagte er stattdessen. »Schlaf gut.«
»Du auch.«
Ich kramte meinen Schlüsselbund aus meiner Handtasche hervor. Dennoch machte keiner von uns beiden Anstalten zu gehen, während ein Auto an uns vorbeifuhr und ein Stück weiter einparkte. Die Fahrertür wurde zugeworfen. Ein Mann mit einem Dalmatiner an der Leine kam den Gehweg entlang und quetschte sich zwischen uns durch. Gegenüber öffnete jemand ein Fenster, die Stimmen eines Spielfilms krochen in die Häuserschlucht hinab. Da endlich setzte Marian sich in Bewegung und ich verbot mir, ihm nachzusehen.
3
MATERIENBEBEN
Sobald ich eingeschlafen war, verließ ich den Palast und machte mich auf den Weg nach Graldingen, wo die reichsten Wandernden in Villen und Stadtschlössern lebten. Graldingen lag so weit entfernt von den Grenzen Eisenheims, dass man sich hier wenig an der neuerlichen Bewegung des Nichts zu stören schien. Elegante Spaziergänger flanierten über die Rue Monsieur le Coq und die angrenzenden Boulevards, in denen es von Cafés und Restaurants, Boutiquen und Buchhandlungen nur so wimmelte. Man grüßte sich fröhlich, fuhr seinen glänzenden Oldtimer spazieren oder tauschte im Schatten von Eiffelturm und Kreml den neuesten Klatsch und Tratsch. Die Damen trugen Fellumhänge und wadenlange Tageskleider mit Stehkrägen und Zierknöpfen, die sich auch an Stiefelchen und Handschuhen wiederfanden. Die Herren schwangen Spazierstöcke und zogen an ansehnlichen Zigarren, während Zeppeline den Luftraum über der Stadt bevölkerten und sich der Qualm aus den Schornsteinen des Schlotbarons als Gewitterwolke an den Horizont heftete. In den Cafés nippte man an winzigen Tassen aus chinesischem Porzellan und diskutierte über Politik, Kunst und Literatur. Von dem Ausnahmezustand, von dem mein Vater gesprochen hatte, war nicht das Geringste zu erkennen.
Wie auch? Das Nichts bedrohte Graldingen und seine betuchten Bewohner nicht. So war es schon seit Jahrhunderten: Das Nichts verschlang Teile der Stadt, aber immer die der Armen. Ob es nun gestern oder erst in einem Vierteljahrhundert passierte, spielte da überhaupt keine Rolle. Es wurde in den Zeitungen vermeldet, bildete hier und da vielleicht den Aufhänger für eine Diskussion über die Fortschritte der Wissenschaft auf diesem Gebiet. Nur die am Bordstein zusammengefegten Aschehaufen, bei deren Anblick ich schon wieder ein ganz leichtes Ziehen in der Brust spürte, erinnerten an das, was gestern geschehen war. Doch das war’s dann auch schon. In Graldingen ging das Leben weiter.
In Krummsen sah die Sache anders aus.
Ich wanderte durch die Straßen der Stadt, die nach und nach schäbiger und unbelebter wurden. Die Häuser wurden schmutziger, standen leer. Anscheinend hatten noch mehr Menschen den gefährdeten Stadtteil verlassen oder waren noch dabei, so wie die Frau, die mir mit einem Handkarren voller Habseligkeiten entgegenkam. Ich erkannte sie als die Wirtin einer Spelunke, vor der ich einmal einen Faustkampf beobachtet hatte. Als ich kurz darauf das Ladenlokal passierte, fand ich die Fenster mit Pappe verklebt, die Tür mit mehreren Balken verrammelt. Durch leere Gassen lief ich weiter, begegnete einem Mann mit einem Koffer, der an mir vorbeihastete, und erreichte schließlich Notre-Dame.
Bevor ich hineinging, umrundete ich die Kathedrale und blieb wie angewurzelt stehen, kaum dass ich an der Rückseite des Baus angekommen war. Noch immer überwältigte mich der Anblick des Nichts, die völlige Abwesenheit von allem. Das war etwas, was mein menschlicher Verstand nicht begreifen konnte. Es war so gewaltig! Kilometerhoch türmte sich das Nichts rund um die Schattenstadt auf. Eine undurchdringliche Wand und doch war da gleichzeitig gar nichts.
Ich schluckte. Das Nichts war in der vergangenen Nacht wirklich nah herangekommen; was ich gestern bei meinem Sturz bereits vermutet hatte, bestätigte sich: Es fehlten nur noch wenige Meter, dann würde es die Mauern Notre-Dames in die nebligen Klauen bekommen! Kein Wunder, dass die Menschen flohen; ich fragte mich eher, warum der Graue Bund es nicht tat. War der Großmeister zu betrunken, um eine Entscheidung zu treffen? Oder sahen die Kämpfer es als besonders mutig an, dennoch zu bleiben? Madame Mafalda jedenfalls schätzte ich als jemanden ein, der nicht tatenlos zusah und in einer Falle verharrte. Trotzdem hatte sie gestern ungerührt ihr Training abgehalten. Bedeutete das, dass sie glaubte, die Gefahr sei erst einmal gebannt? Schließlich konnten Jahre bis zur nächsten Aktivität des Nichts vergehen. Oder Minuten, dachte ich und erinnerte mich an das Ziehen in meiner Brust und die Ascheflocke, die ich aufgefangen hatte. Würde es wieder geschehen? Und wenn ja: Wann? Warum?
Meine Augen verengten sich zu Schlitzen. Es war ein bisschen so, als starrte ich einen Vulkan an. Es gab keine Logik in alledem, es machte keinen Sinn, sich den Kopf darüber zu zerbrechen. Vielleicht hätte ich stattdessen besser einmal nach oben sehen sollen, doch ich tat es nicht. Mit einem Seufzen wandte ich mich ab und klopfte an die Flügeltüren des Hauptportals von Notre-Dame.
Es dauerte eine ganze Weile, bis auf der anderen Seite Schritte zu hören waren. Endlich schwang der linke der beiden Türflügel auf und gab den Blick auf die verspiegelte Eingangshalle frei. Die Spitzenhaube des Dienstmädchens, das mich einließ, wurde hundertfach von Wänden und Treppengeländern reflektiert.
»Gnädiges Fräulein.« Das Dienstmädchen knickste vor mir, dann verschwand es auch schon wieder. Gerade noch pünktlich schlüpfte ich in den Tiberischen Saal, was Madame Mafalda mit einem Naserümpfen quittierte.
Ich achtete gar nicht darauf. Stattdessen suchte mein Blick den Raum nach einem weißblonden Schopf ab, doch Marian war nirgends zu entdecken. Obwohl er heute keine Wache bei den Zwillingen halten musste, schwänzte er das Dämmerungstraining. Schon wieder. Ein Hauch von Enttäuschung machte sich in mir breit. Doch im Gegensatz zu mir würde er sich dafür kaum Ärger mit Madame Mafalda einhandeln. Er war ohnehin so viel besser als alle anderen, was machte es da schon, wenn er eine Stunde verpasste?
»Trödel nicht so herum. Wir wollen anfangen«, befahl Madame Mafalda.
Ich trottete in meine Ecke.
Als Übungspartnerin wurde mir heute Amadé zugeteilt. Selbstverständlich hatte ich nicht die geringste Chance gegen die Tochter des Großmeisters. Doch sie war so rücksichtsvoll, mich das nicht allzu sehr merken zu lassen, indem sie sich quasi in Zeitlupe bewegte. So war es mir möglich, auch mal einen Schlag zu Ende zu führen und außerdem noch den einen oder anderen neuen Kniff zu lernen. Trotzdem war ich nach anderthalb Stunden vollkommen außer Atem. Keuchend bedankte ich mich bei Amadé, die leise vor sich hin lächelte und mir ihren Materienkiesel unter die Nase hielt.
Soll ich dir zeigen, wo ich arbeite?, stand darauf.
»Gern«, sagte ich. Seit der Eiserne Kanzler Amadé in diesem Jahr in die Finger bekommen und foltern lassen hatte, bis sie verriet, dass ich den Weißen Löwen gestohlen hatte, sprach sie nicht mehr. Sie ertrug den Klang ihrer eigenen Stimme nicht, weil er sie zu sehr an ihre Schreie erinnerte. Stattdessen spielte sie nächtelang auf ihrem Cello und kommunizierte über den faustgroßen Stein, den der Großmeister erfunden hatte.
Das Nichts ist eine Sache, aber dieser Regen …, flackerte darüber, als wir durch die Flure Notre-Dames huschten.
»Beunruhigt er dich mehr?«
Sagen wir mal so. Amadé verzog das narbige Gesicht zu einer Grimasse und drückte die Flügeltüren des Portals auf. Eisige Nachtluft schlug uns entgegen. Wenn sich das Nichts früher geregt hat, ist dabei nie etwas vom Himmel gefallen.
»Niemals?« Ich biss mir nachdenklich auf die Lippe. Vom Himmel gefallen …