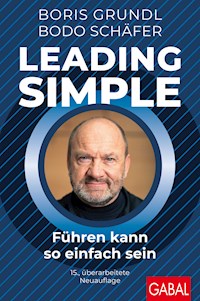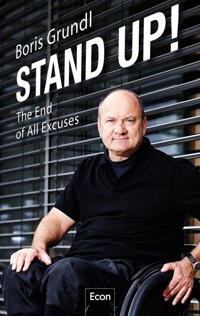22,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
In seinem Buch zeigt Boris Grundl, wie er sein Schicksal am absoluten Tiefpunkt in die eigene Hand genommen hat, um sein Leben selbst-bestimmt und frei zu führen. Für den überzeugten Optimisten liegt heute das größte Glück darin, andere Menschen zur Entwicklung ihrer Potentiale zu inspirieren. Ein bewegendes Buch über mentale Stärke und Persönlichkeitsentwicklung und die Geschichte eines unglaublichen Lebens. Er ist Mitte zwanzig und hoffnungsvoller Spitzensportler, als es passiert: ein Unfall – und Boris Grundl ist querschnittgelähmt. Doch er gibt nicht auf. Als erster Rollstuhlfahrer schließt er sein Studium der Sportwissenschaften ab. Er wird Verkäufer von Rollstühlen, steigt zum Marketing- und Vertriebsdirektor in einem Großkonzern auf. Nebenbei wird er einer der besten Rollstuhl-Rugby-Spieler der Welt. Heute ist er ein erfolgreicher Business-Coach und beeindruckt durch seine Authentizität.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Das Buch
Es passiert im Dschungel von Mexiko. Ein junger Spitzensportler springt im Urlaub von einer Klippe, bricht sich den Hals und wird kurz vor dem Ertrinken gerettet. Danach verliert er jeglichen Halt in seinem Leben. Er ist vom Hals abwärts gelähmt, landet im Rollstuhl und in der Sozialhilfe. Er scheint am Ende zu sein. Doch er gibt nicht auf. Heute ist er einer der erfolgreichsten Business-Coaches im deutschsprachigen Raum. Boris Grundl ist Unternehmer, glücklicher Familienvater, erforscht das Thema Verantwortung, hat keine finanziellen Sorgen mehr und schreibt Bücher. Wie ist so etwas möglich?
Ein bewegendes Buch über mentale Stärke, Persönlichkeitsentwicklung und die Geschichte eines unglaublichen Lebens.
Der Autor
BORIS GRUNDL ist Führungsexperte, Unternehmer, Coach und Redner. Mit seinem Leadership-Institut (www.grundl-institut.de) berät er Firmen wie Daimler, SAP oder die Deutsche Bank. Er ist Gastdozent an mehreren Universitäten, erforscht das Thema Verantwortung (www.verantwortungsindex.de) und setzt sich ehrenamtlich für Schüler ein.
Bei Econ sind von ihm folgende Bücher erschienen: Diktatur der Gutmenschen (2010), Die Zeit der Macher ist vorbei (2012) Mach mich glücklich (2014) und Verstehen heißt nicht, einverstanden sein (2017).
Econ
Besuchen Sie uns im Internet:
www.ullstein-buchverlage.de
Wir wählen unsere Bücher sorgfältig aus, lektorieren sie gründlich mit Autoren und Übersetzern und produzieren sie in bester Qualität.
Hinweis zu Urheberrechten
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten.
Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
ISBN: 978-3-8437-2159-2
9. aktualisierte und erweiterte Ausgabe 2019
© der deutschsprachigen Ausgabe
Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2019
Grafiken von Timo Wuerz: 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Grafiken von Andreas Gerhardt: 4, 7, 8
Redaktion: Michael Schickerling, schickerling.cc, München
Umschlaggestaltung: FHCM® Designagentur, Berlin
Titelfoto: © Nico Pudimat
E-Book: LVD GmbH, Berlin
Alle Rechte vorbehalten.
Nicht, was wir erleben, sondern wie wir empfinden, was wir erleben, macht unser Schicksal aus.Marie von Ebner-Eschenbach
MEIN AUFPRALL INS LEBEN
So ist es also, wenn du stirbst.
Ich bin im Wasser und habe nur diesen einen Gedanken: Ja, so muss es sein, wenn du stirbst. Ich versuche zu schwimmen. Aber ich kann nicht. Irgendwas stimmt nicht mit mir. Was ist los? Ich will mich an der Wasseroberfläche halten. Aber ich gehe langsam unter. Ich gebe einen Befehl an meine Beine wie schon Tausende Male zuvor: schwimmen. Aber sie führen die gewohnten Bewegungen, die mich zurück an die Wasseroberfläche bringen würden, mit denen ich mich einfach treiben lassen könnte, nicht aus. Es funktioniert nicht. Ich sinke weiter. Ich versuche es erneut. Nichts. Etwas ist anders als vorher. Was, begreife ich nicht. Verstehe ich nicht. Mein Gehirn ist total irritiert. Ich sinke weiter. Mein Kopf ist knapp unterhalb der Wasseroberfläche. Ich mache hektische Bewegungen, schlucke Wasser. Wie in einem schlechten Katastrophenfilm, denke ich. Ganz instinktiv fangen meine Arme an, mehr zu machen. Aha, da ist noch was. Aber es ist verdammt anstrengend. Ich habe keinen Auftrieb, weil mir die Körperspannung fehlt. Ich hänge im Wasser wie ein Sack, nehme nichts um mich herum wahr. Ich rufe auch nicht um Hilfe, so beschäftigt bin ich damit, nicht unterzugehen. Jetzt kommt die Angst. Nackte Todesangst. Je mehr ich paddele, je hektischer meine Armbewegungen werden, desto schneller scheine ich unterzugehen. Die Momente, in denen mein Kopf oberhalb der Wasseroberfläche ist, werden weniger. Ich sinke zum Grund der Lagune …
Zugleich merke ich, wie sich mein Geist weitet. Ich empfinde Ruhe, Klarheit und bin total entspannt. Mein Geist dehnt sich immer weiter aus. Wellenförmig, in konzentrischen Kreisen, horizontal. Und auch vertikal. Mein Geist steigt auf, immer höher, bis ich mich von oberhalb der Baumkrone sehen kann, wie ich im Wasser mit den Armen rudere. Von oben sehe ich den Dschungel. Die Lagune. Die Menschen am Wasser. Ich kämpfe weiter ums Überleben. Aber die Angst ist nicht mehr so stark. Dafür breitet sich die Ruhe immer weiter aus in mir. Wär das schön, wenn das für immer so bleiben könnte …
Noch aus dieser Perspektive nehme ich wahr, wie mein Freund Stefan ins Wasser läuft. Er schwimmt auf mich zu. Stefan ist ein guter Schwimmer, denke ich. Er wird mich retten. Im selben Moment bin ich zurück in meinem Körper. Es ist vorbei mit Ruhe und Klarheit. Ich habe Angst. Dann wird mir langsam klar, dass Hilfe kommt. Ich muss nicht mehr lange durchhalten. Und ich beruhige mich einigermaßen. Es dauert noch eine ganze Weile, bis Stefan es schafft, mich aus dem Wasser zu holen. Mein Körper ist zu schwer, und ich kann ihm nicht helfen. Er drückt mich gegen einen Felsen am Ufer. Mithilfe der anderen Leute schafft er es schließlich. Ich liege im Sand und schaue hinauf in die Baumwipfel. Ich atme. Ich lebe.
Aus voller Fahrt, aus unbändiger Rastlosigkeit wurde von einem Moment zum anderen ein Leben in Slow Motion. Bisher war ich gewohnt zu gewinnen – nun hatte ich verloren. Alles auf einmal: Gesundheit, Perspektive, Lebensantrieb. Alles weg.
Was blieb mir noch? Was hatte mein Leben für einen Sinn? Es kamen große Ängste und Selbstvorwürfe. Die immer gleichen Fragen quälten mich unaufhörlich. Warum war mir das passiert? Wie konnte ich mir so etwas nur antun? Wieso fühlte ich mich nur im Grenzbereich so richtig lebendig? Was war mein Leben noch wert? Was sollte aus mir werden? Von den Konsequenzen, die der Unfall für mich haben würde, hatte ich nicht die geringste Vorstellung, und fürs Erste weigerte ich mich beharrlich, darüber überhaupt tiefer nachzudenken. Große Schuldgefühle und Selbstmitleid fraßen sich in meine Seele.
Ich war gelähmt, sowohl mein Körper als auch mein Geist. In den ersten Wochen ließ ich alles nur über mich ergehen, als ob ich nichts damit zu tun hätte. Mit einer gewissen Neugierde nahm ich zur Kenntnis, wie irgendwelche Pflegekräfte mich fütterten, wie sie meine Inkontinenz versorgten, wie sie mir den Schleim aus den Bronchien absaugten und was sonst noch alles nötig war, um mich am Leben zu erhalten. Ich hatte damit nichts zu tun. Ich war mir selbst ein Fremdkörper. Wenn die Pfleger mich versorgten, fühlte ich mich wie ein Sack Kartoffeln.
Ich, der Supersportler, fühlte mich so unendlich hilflos. Das Bett, in dem ich lag, war ein sogenanntes Drehbett, das meinen Körper davon abhalten sollte, wund zu werden. Wie eine Frikadelle auf dem Grill wurde ich alle paar Stunden vom Rücken auf den Bauch und dann wieder auf den Rücken gedreht. Ich starrte an die Decke, wurde gedreht, starrte auf den Boden.
Decke. Boden. Decke. Boden. Eine Endlosschleife zwischen Decke und Boden.
Mein Blickfeld war das eines Babys im Kinderbettchen: Wer sich nicht über mich beugte, den sah ich nicht. Sogar mein Bewusstsein wurde dabei immer begrenzter.
Decke, Boden, Decke, Boden, Decke, Boden.
Meine kleine Welt beschränkte sich auf mein enges Krankenhauszimmer. Außerhalb existierte für mich nichts anderes mehr. Dieses Drehbett sollte zur Metapher für mein Leben werden: Es hatte sich alles gedreht, und zwar radikal.
Ich wusste, dass ich nicht mehr der Alte war. Obwohl ich krampfhaft versuchte, an diesem Bild nach außen festzuhalten. Diesen starken attraktiven und erfolgreichen jungen Mann gab es nicht mehr. Das konnte ich noch nicht akzeptieren. Das war nicht ich, Boris Grundl, das Tennis-Ass, der ewig gut gelaunte Sonny-Boy, der Charmeur und Frauenheld. Jetzt war ich wirklich ein Krüppel.
Nun, und was ist heute? Heute bin ich einer der gefragtesten Führungsexperten und Keynote-Speaker Europas. Ich schreibe Bücher, und als Gründer des Grundl Leadership Instituts gehören wir zu den Topadressen für Transformation von Führungskräften. Dank meiner finanziellen Freiheit ist es mir möglich, dass ich in Spanien und Deutschland lebe. Ich bin mit einer tollen Frau verheiratet und habe zwei großartige erwachsene Kinder, die bewundernswert ihren eigenen Weg gehen.
DAS LEBEN VERSTEHEN LERNEN
Vielleicht fragen Sie sich jetzt: Wie kann jemand aus so einer Niederlage, so einem tiefen Fall ins Bodenlose solch einen Sieg machen? Wie ist es dazu gekommen? Wie ist so etwas überhaupt möglich?
Ich musste lernen zu verstehen, tief zu verstehen. Zunächst erst einmal mich selbst und meine neue Situation verstehen und dann andere verstehen lernen. Beziehungen verstehen, Familie verstehen. Beruflich später Märkte verstehen, Unternehmen verstehen, Produktion verstehen, Vertrieb verstehen. Sinn verstehen, menschliche Entwicklung verstehen, Transformation verstehen. Das Leben verstehen. Und genau darum geht es: das Leben und seine Prinzipien zuerst zu verstehen lernen. Nicht: mein Leben zuerst verstehen. Denn das ist der Knackpunkt: Die meisten Menschen wollen zuerst ihr Leben verstehen, um dann das Leben zu verstehen. Und genau darin liegt der Kardinalfehler! Es geht zuerst darum, das Leben an sich zu verstehen und danach mein Leben. So wird ein Schuh daraus, und man erreicht eine gesunde Distanz zu sich selbst.
Mein Leben: Die Landkarte über das Leben entsteht fast nur durch eigene Erfahrung.
Das Leben: Die Landkarte über das Leben entsteht durch eigene und durch die Erfahrung anderer.
Heute weiß ich: Wer seine Erfahrungen durch die Erfahrungen anderer klug abgleicht, erkennt die kraftvollen Lebensgesetze viel schneller. Dadurch trifft er klügere, weitreichendere Entscheidungen, und diese werden durch wesentlich bessere Lebensergebnisse sichtbar.
Da ich zuerst mit mir und meinem Leben beschäftigt war, musste ich lernen, mir bessere Fragen zu stellen. Statt: Warum ist mir das passiert (mein Leben)? Was will mir das Leben damit mitteilen (das Leben)? Statt: Warum habe ich mir das angetan (mein Leben)? Wofür war das Ganze gut (das Leben)? Zugegeben, das war alles andere als leicht – es war eine harte Denkschule.
Die Inhalte dieser Denkschule müssen drei Aufnahmekriterien bestehen. Erstens müssen sie mich beim Nachdenken zum Handeln inspirieren, denn Inspiration ist das Ergebnis kluger Reflexion. Zweitens müssen sie nach der Handlung die gewünschten Resultate bringen. Und drittens müssen sie für die Lernwilligen in unserem Institut ebenfalls die gewünschten Ergebnisse liefern. Erst dann traue ich mich, darüber zu schreiben und zu reden.
Und das heißt noch lange nicht, dass ich diese Prinzipien selbst immer beherrsche. Oft genug scheitere ich bei deren Anwendung. Mir ist bewusst, ich scheitere jeden Tag an diesen Lebensgesetzen – ob als Partner, Vater, Mitarbeiter, Unternehmer oder einfach als Mensch. Es ist eine hohe Kunst, immer weniger zu scheitern. Das zeichnet gelebte Transformation aus: immer weniger zu scheitern. Denn jeder Sieger steht auf einem Berg von Niederlagen. Das ist mir heute klar, sehr klar sogar.
Inzwischen gelingt es mir immer öfter, danach zu leben. Denn es geht nicht um Perfektion. Es geht nicht um ein perfektes Leben. Es geht um ein stimmiges Leben. Ein berufenes Leben. Aus meiner Sicht geht es nicht darum, was »ich will« oder »nicht will«. Es geht darum, »für was ich gemeint bin«. Das ist ein ganz anderer Tenor. Ein Leben voller Sinn und Berufung. Dieser Lebenssinn entspringt einer sehr individuellen Selbstfindung. Und diese Reise nach innen macht jedes Leben einzigartig und spannend. Davon bin ich überzeugt.
Ich möchte nicht der sein, den meine Eltern in mir sehen. Ich möchte auch nicht der sein, den mein Partner in mir sehen will. Oder mein Chef. Oder die Gesellschaft. Und ich bin auch nicht der, der ich einmal war. Ich bin der, der ich bin!
In diesen Sätzen liegt für mich die Kraft eines freien und selbstbestimmten Lebens. Meine Überzeugung ist es, dass genau diese Gedanken für jeden Menschen jeden Tag immer wichtiger werden. Von dem Tag an, an dem wir über »unser Dasein« anfangen nachzudenken, bis zu unserem Tod. Denn es geht in Zukunft nicht um höher, schneller, weiter, sondern um flexibler, klarer, tiefer. Um dahin zu kommen, müssen wir lernen zu verstehen, ohne dass wir uns dem Druck aussetzen, auch einverstanden zu sein. Es ist eine hohe Kunst zu verstehen, ohne einverstanden sein zu müssen.
Mein Schicksal hat mir einige heftige und viele wunderbare Lektionen erteilt. Lektionen, welche ich erkennen und anerkennen lernen musste. Heißt das, dass meine Erkenntnisse »wahr und richtig« sind? Überhaupt nicht! Das kann und will ich nicht behaupten. Doch durch ständige Reflexion und Aktion hat sich mir ein Weltbild vermittelt, welches ich in meiner Arbeit mit Menschen zum »Selbst-darüber-Nachdenken« gerne anbiete. Wie mit diesem Buch. Deswegen öffne ich mich so weit wie möglich und so gut ich es eben bis jetzt kann, damit jeder von meinen Limitierungen, Lernprozessen und Erkenntnissen selbst profitieren kann. Denn darum geht es. Auch wenn ich mich dadurch angreifbar und verletzbar mache. Der Einsatz lohnt sich für jeden Menschen, welcher durch diese Lektüre weiterkommt.
Im Drehbett musste ich lernen zu verstehen. Einverstanden war ich mit meiner Situation zu Anfang überhaupt nicht. Und ich dachte, ich werde es auch nie sein. Doch heute bin ich selbst damit einverstanden. Ohne sie wäre ich nicht der, der ich jetzt bin. Deswegen provoziere ich bei Vorträgen gerne mit dem Satz: Ich würde noch einmal springen.
Nachdem mein Freund Stefan mich damals aus dem Wasser gezogen hatte, wusste mein Kopf: Ich bin querschnittgelähmt – auch wenn ich es noch nicht richtig begreifen konnte. Wofür ist das jetzt gut, fragte ich mich damals. Und: Was geht jetzt noch? Was ist überhaupt noch möglich? Hat dein Leben noch einen Sinn? Komischerweise hatte ich darauf ziemlich schnell eine Antwort: Du könntest mit deinem Leben ein Beispiel geben. Ein Beispiel dafür, was alles in uns Menschen steckt, besser und wahrhaftiger als bisher. Diese konkrete Vorstellung, dieses Bild gab mir all die Jahre die Kraft durchzuhalten. Immer wieder habe ich gedacht, ich müsste etwas aufschreiben, und noch im Krankenhaus in Mexiko nahm ich mir vor, alles zu dokumentieren und festzuhalten. Aber es ging nicht. Erst 2008 war ich dazu in der Lage. Erst damals verstand ich meine Geschichte selbst gut genug. Es sollte achtzehn Jahre dauern, bis ich sie erzählen konnte. Und weitere zehn Jahre bis zur heutigen Tiefe und Substanz.
Dass aber meine Geschichte so vielen anderen Menschen Inspiration und Zuversicht gibt, erfüllt mich mit großer Dankbarkeit. Auch dass ich meine Erfahrungen, mein Wissen, meine Erkenntnisse weltweit in so vielen Vorträgen, Seminaren, Coachings und Büchern weitergeben durfte – und zum ersten Mal auch auf Englisch.
Ihnen wünsche ich beim Lesen jene Impulse, die mir durch zahlreiche Briefe und Mails zurückgespiegelt wurden. Wenn Sie mögen, schreiben Sie mir: [email protected]. Ich freue mich auf Ihre Erkenntnisse.
Boris Grundl
1KONZENTRIERE DICH AUF DAS, WAS DA IST – UND MACHE DARAUS MEHR
Tu, was du kannst, mit dem, was du hast, und dort, wo du bist. Franklin D. Roosevelt
Es war wie eine Szene aus der Bounty-Werbung: Mein Körper lag im weißen Sand, über mir der blaue Himmel Mexikos. Die Sonne schien mir ins Gesicht. Ich konnte hören, wie der nahe gelegene Wasserfall in die Lagune stürzte, ein türkisblauer Spiegel umgeben vom satten Grün des Urwalds. Aber etwas stimmte nicht mit dem Hauptdarsteller dieses Spots. In dem Moment, in dem ich versuchte, meine Beine zu bewegen, wusste ich es: Ich war gelähmt. Querschnitt. Damals konnte ich die Lähmungshöhe nicht einschätzen, alle Details, die ich heute über mich weiß, waren mir nicht bekannt. Trotzdem war mir die Sache an sich sofort klar: So muss es sich anfühlen, dachte ich, während ich nach meinen Beinen tastete. Ja, so musste sich anfühlen, was ich während des Sportstudiums im Physiologiekurs über die sogenannte Querschnittläsion gelernt hatte. Um mich zu beruhigen, überprüfte ich den Rest meines Körpers: Was war noch da, was konnte ich noch bewegen? Weitere Fragen schossen mir durch den Kopf: Was blieb mir jetzt? Was hatte mein Leben noch für einen Sinn? Doch obwohl ich wusste, dass ich lediglich meine Hände bewegen konnte, war ich völlig klar. Ich war ruhig, funktionierte wie ein Roboter, als ginge es gar nicht um mich. Heute weiß ich: Das war der Schock, das Adrenalin. Ich hatte keine Schmerzen, zu dem Zeitpunkt jedenfalls nicht. Ich konnte mich nur nicht bewegen.
»Boris, kannst du mich hören?« Das Gesicht meines Kumpels und Reisegefährten Stefan tauchte über mir auf. Mit ihm hatte ich den ganzen Trip geplant; gemeinsam hatten wir zwei Studenten noch einmal ausbrechen wollen, bevor der Ernst des Lebens beginnen sollte. Er hatte mich aus dem Wasser gezogen und mir das Leben gerettet. Ja, ich konnte ihn hören. Nur bewegen konnte ich mich nicht. Dann waren da noch andere Stimmen. »Was ist mit ihm?« Unsere Reisegruppe scharte sich um mich. Zusammen mit ihr waren wir vom Hotel aufgebrochen, um dieses paradiesische Fleckchen Erde zu besuchen. Ich hörte sie klar und deutlich und gleichzeitig wie aus weiter Ferne. Ich sah erschrockene Gesichter mit aufgerissenen Augen und offenen Mündern, die sich über mich beugten, aber ich nahm die Menschen dahinter gar nicht wahr. Dafür brachen ihre Empfindungen umso stärker über mich herein, alle emotionalen Zustände von Angst über Ohnmacht bis hin zu Verzweiflung und Panik spürte ich so intensiv, dass ich das Bedürfnis hatte, ihnen zu helfen. Verrückt, wenn man sich meine Situation vor Augen hält! Das sollte mir von nun an häufiger passieren. Doch ich verbot es mir. Genauso wie ich mir verbot, die Gefühle der Gruppe an mich heranzulassen. Ich erlaubte mir nicht, Angst zu haben. Du musst funktionieren, um aus diesem verdammten Dschungel herauszukommen, dachte ich.
Ich wusste, dass etwas Furchtbares passiert war. Ich war mir sogar sicher, dass ich querschnittgelähmt war. Aber in Panik zu geraten, meinen Kopf zu verlieren, wortwörtlich außer mir zu sein statt bei mir, das gestattete ich mir nicht. Und das beantwortete auch meine Frage danach, was noch funktionierte: Mein Geist funktionierte klarer denn je, mein Überlebenswille war stark. Ich konzentrierte mich auf das, was da war, in diesem Fall auf meinen Verstand und meine Willensstärke – natürlich unbewusst. Heute denke ich, dass mir diese Haltung das Leben gerettet hat. Stefan hatte mich gerettet, indem er meinen Körper aus dem Wasser geborgen hatte. Jetzt rettete mich mein Geist ein weiteres Mal, indem er sich gegen die Angst der anderen zur Wehr setzte. Und was noch wichtiger war: Er wehrte sich gegen die unbeholfenen Versuche meiner Retter, mich wegzutragen.
»Nicht anfassen!«, waren meine ersten Worte. Ich wiederholte sie so oft, bis die Gruppe auf mich hörte. »Finger weg! Nicht anfassen!« Ich wusste, was passieren konnte, wenn sie versuchen würden, mich hochzuheben. Eine einzige falsche Bewegung konnte ausreichen, um mein Rückenmark – durch eine weitere Verschiebung der Wirbel – weiter zu beschädigen. »Holt eine Tür!«, rief ich stattdessen. »Besorgt eine Tür, auf die ihr mich legen könnt.« Keine Ahnung, woher diese Idee kam. Ich wusste nur, dass ich sie irgendwie dazu bringen musste, mich zu fixieren. Jede zusätzliche Bewegung konnte eine noch stärkere Lähmung bedeuten – oder sogar meinen Tod.
Unweit der Lagune öffnete sich der Urwald zum Meer hin. In einem Haus am Strand hatten einige aus der Reisegruppe eine Tür ausgehängt. Ich weiß noch genau, dass sie blau war. Auf dieser blauen Tür trugen sie mich zum Strand, um mich von dort auf einem Boot zum Krankenhaus zu bringen. Durch den Dschungel führten keine ausgebauten Wege, die Hauptverkehrsstraße war das Wasser. Die Strecke zum Boot kam mir vor wie 10 Kilometer – es werden in Wirklichkeit gerade mal 200 Meter gewesen sein. Dann lag ich auf meiner Tür im Boot, neben mir der wimmernde und schluchzende Reiseführer der Gruppe. Ich ließ nichts an mich heran, im Gegenteil: Ich verdrängte sogar die Gewissheit, querschnittgelähmt zu sein. Stattdessen dachte ich nur an den nächsten Schritt. Ich wollte es aus dem Dschungel heraus und ins Krankenhaus schaffen. Immerhin, du hast keine Schmerzen, dachte ich. Das stimmte. Ich stand noch immer unter Schock.
Ungefähr eine Stunde nach meinem Unfall war ich endlich im Krankenhaus, in dem das reinste Chaos herrschte. Ich lag irgendwo auf dem Gang, immer noch in Badehose, mein Körper voller Sand. Stefan telefonierte mit meinen Eltern, die vor Sorge fast durchdrehten. Auch das Finanzielle musste geregelt werden; um zu verhindern, dass sich mein Zustand verschlechterte, sollte ich schnell operiert werden. Wer würde die OP-Kosten übernehmen? Und wer würde für meinen Rücktransport aufkommen? Meine Eltern planten bereits, einen Kredit aufzunehmen. Eben noch Held der Bounty-Werbung, kam ich mir jetzt vor wie in einer schlechten Versicherungsreklame. Zum Glück fand sich dann eine Versicherung auf meinen Namen.
Natürlich mussten diese Dinge geregelt werden. Ich verstand das, aber es interessierte mich kein Stück, denn ich war in meinem eigenen Albtraum gefangen. Der Schock ließ nach, und jetzt kamen die Schmerzen wie ein Tsunami. Kein Atemzug, keine Bewegung ohne das Gefühl, dass mir jemand ein Messer von hinten in den Hals rammt und es danach in der tiefen Wunde hin- und herdreht. Willkommen in der Hölle auf Erden.
DER SCHOCK DER WAHRHEIT
Parallel dazu wurde mir langsam meine Situation bewusst. Zu den Schmerzen kamen die Ängste. Immer in Schüben, wie Ebbe und Flut. Doch nicht in Stundenintervallen, sondern in Minutenintervallen. Ein Kommen und Gehen. Der behandelnde Arzt hatte meine gebrochene Wirbelsäule im Bereich des sechsten und siebten Halswirbels mit einem Streckgerät fixiert, das über Klammern an meinem Kopf befestigt war. An den Stellen, an denen die Klammern saßen – am Hinterkopf und unterhalb des Kinns – wachsen bis heute keine Haare mehr. Ich sah aus wie der Hauptdarsteller aus Clockwork Orange und fühlte mich auch so. Mein Blickfeld war total eingeschränkt; alles, was ich sehen konnte, waren die Risse an der Zimmerdecke. Was mit meinem Körper geschah, ob ich einen Blasenkatheter bekam oder eine Infusion, ich spürte und sah es nicht.
Die Schmerzen veränderten sich. Jetzt fühlte es sich an, als würden der sechste und der siebte Halswirbelknochen herausstehen und durch die Haut austreten. Tatsächlich schmerzten die gequetschten Nerven – oder, besser gesagt, der Teil, der noch nicht zerstört war. Diesen Schmerz konnte ich noch genau lokalisieren. Die diffusen Schmerzen und die Nebenwirkungen, mit denen sich Körper und Geist gegen die neue Situation zu wehren versuchten – Phantomschmerzen, Fieberschübe, eine verschleimte Lunge –, sollten erst in Deutschland einsetzen.
Schaffte ich es, die Schmerzen zu ignorieren, kamen die Ängste. Und die immer gleichen Fragen quälten mich unaufhörlich: Was war mein Leben jetzt noch wert? Was sollte jetzt noch aus mir werden? Von den Konsequenzen, die der Unfall tatsächlich für mich haben würde, hatte ich keine genaue Vorstellung, und ich weigerte mich noch, darüber nachzudenken. So viel war klar: Vor dem Unfall war ich ein Spitzensportler gewesen. Nun wusste ich, dass ich meine Karriere als Tennisspieler und Trainer vergessen konnte. Aber da war noch meine zweite große Passion neben dem Sport – die Musik. Dann studiere ich eben Saxofon und Klarinette, sagte ich mir, die Finger tun es ja noch. Doch auch das sollte sich bald ändern. Noch – ich wusste damals nicht, wie viel Gewicht dieses unscheinbare Wort haben würde.
In Mexiko wurde ich das erste Mal operiert. Ich hatte keine Angst. Mein Arzt war Neurologe und in den USA ausgebildet worden, hatte man mir gesagt. Nach der OP nahm die Beweglichkeit meiner Finger ab, aber ich machte mir keine Sorgen. Keine Panik, dachte ich, das gehört vielleicht dazu, die Beweglichkeit wird schon wiederkommen. Sie kam nicht wieder. Dafür kam ein Learjet aus Deutschland, um mich auszufliegen, der Versicherung sei Dank. Der deutsche Notarzt war schockiert von dem Chaos im Krankenhaus und von meinem Zustand. Ich habe seine Worte noch im Ohr. Er betrat das Zimmer und begrüßte mich mit den Worten: »Um Gottes willen, nichts wie raus hier!« So verließ ich zwei oder drei Tage nach meinem Unfall das Land, in das ich vor dem sogenannten Ernst des Lebens geflohen war – und der mich hier mit voller Wucht wieder eingeholt hatte.
Ein Flug mit einem kleinen, zweistrahligen Learjet von Mittelamerika nach Deutschland verläuft nicht so schnell und unkompliziert wie mit einem Urlaubsflieger. Aus Sicherheitsgründen und zum Tanken werden zahlreiche Stopps in Kanada und Grönland eingelegt. Als wir nach einer gefühlten Ewigkeit endlich in Deutschland landeten, brachte man mich in ein spezielles Krankenhaus in Markgröningen bei Stuttgart. Endlich zu Hause. Gut? Nichts war gut! Jetzt war es vorbei mit meiner Ruhe, meiner Beherrschtheit, meiner Konzentration. Auf dem Weg vom Flughafen zum Krankenhaus fragte ich alle drei Sekunden: »Wie lange noch?« Plötzlich hatte mich die neue Realität in meiner alten Welt eingeholt. Ich wurde schier wahnsinnig. Verdrängung? Das funktionierte jetzt nicht mehr. Ich war total instabil – physisch und psychisch. Willkommen in der Wirklichkeit des Querschnitts.
SELBSTMITLEID FRISST SELBSTWERT
Als ich im Krankenhaus in Deutschland ankam, klebte noch immer der mexikanische Sand an meinem Körper, der inzwischen furchtbar stank. Ich wurde erst mal lebend obduziert. Zumindest kam es mir so vor, denn die Personen in meinem Umfeld redeten in meiner Anwesenheit über mich, als sei ich nicht gelähmt, sondern tot – oder taub. Es waren mehr die Körpersprache und der Ton meines Umfelds, welche mich erreichten. Der Ton der Worte, nicht der Inhalt. Der Inhalt sollte positiv wirken – tat es jedoch nicht. Der Ton sprach mehr als Worte. Und es wiederholte sich immer und immer wieder, wie in einer Telefonschleife: »Da ist er ja, unser Klippenspringer von Mexiko.« – »Schade drum, soll mal ein super Tennisspieler gewesen sein.« – »Ja, sieht man auch. Guck mal, die Wahnsinnsbeine! Total durchtrainiert und so braungebrannt …« – »Kann man sich gar nicht vorstellen, dass er da nichts mehr drin fühlt.« – »Also, ich könnte das nicht. Das ist doch kein Leben mehr. Auch so als Mann, ich meine, da läuft doch nichts mehr.« – »Ja, und so gar nichts alleine können. Ein Leben lang füttern, waschen, wickeln … schöne Scheiße!«
»Ich bin gelähmt, ihr Idioten, nicht taub!«, wollte ich sie anbrüllen, aber ich war völlig wehrlos und unfähig, irgendetwas zu tun. Ich konnte mir ja nicht mal den Sand vom Körper waschen. Für alles brauchte ich ihre Hilfe, und sie redeten mit der Zeit so über mich, als wäre ich überhaupt nicht anwesend. Je kleiner mein Selbstwert wurde, desto weniger war ich für sie ein zu respektierender Mensch. Heute weiß ich, dass dies nicht nur bei Gelähmten so ist.
Diese doppelte Wehrlosigkeit machte mich fertig. Gleichzeitig sprachen sie mir aus der Seele. Ich wusste selbst, dass ich nicht mehr der Alte war; den starken, attraktiven und erfolgreichen jungen Mann gab es nicht mehr. Und was war ich jetzt? Ein Krüppel. Das konnte ich nicht akzeptieren. Das war nicht ich. Nicht ich, Boris Grundl, das Tennis-Ass, der ewig gut gelaunte Sonnyboy, der Charmeur und Frauenheld. Ich hielt an meinem alten Ich fest, wollte es nicht aufgeben, nicht behindert sein. Behinderung, davon hatte ich mir als Nichtbehinderter ein Bild gemacht. So wie alle anderen. Ich war ein Fußgänger und dachte wie ein Fußgänger, auch wenn ich meine Zehen nicht mehr spüren konnte.
In den folgenden Monaten im Krankenhaus änderte sich an dieser Einstellung erst einmal nichts. Im Gegenteil: Je mehr mir meine Lage bewusst wurde, desto stärker lehnte ich sie ab. Ich lehnte mich ab. Ich sah nur das Demütigende an meiner Situation und fühlte mich nutzloser als eine Zimmerpflanze, die sich wenigstens für das Wasser, das man ihr gibt, erkenntlich zeigt, indem sie ab und zu blüht. Ich verdorrte innerlich. Auf dem Drehbett, meiner ganz persönlichen Folterbank, das meinen Körper davon abhalten sollte, wund zu werden, drehte man mich hin und her – wie ein Spanferkel. Stellen Sie sich eine Art Sandwich-Bett vor – und ich war das Fleisch mittendrin. Ich sah an die Decke, wurde gedreht, sah den Boden. Decke, Boden, Decke, Boden. Mein Blickfeld war das eines Babys. Wer sich nicht über mich beugte, den sah ich nicht, und auch mein Bewusstsein wurde zunehmend begrenzter. Meine kleine Welt beschränkte sich auf mein enges Krankenhauszimmer, außerhalb gab es für mich nichts. Vor allem aber war ich abhängig wie ein Baby, genauso wie es die Pfleger prophezeit hatten. Ich wurde gefüttert, gewaschen – und wieder umgedreht.
In den langen Nächten, wenn es still wurde auf den Krankenhausfluren, kam die Einsamkeit. Ich war ungeheuer traurig, verzweifelt und hatte Zukunftsangst: Was würde aus mir werden? Selbst versorgen konnte ich mich nicht, ich war ein Sozialfall, der von seinen Eltern und vom Staat durchgefüttert werden musste. Wie es aussah, würde ich nicht alleine wohnen können. Was war mit meinem Sportstudium, was mit Autofahren? Würde ich je einen Beruf ausüben können? Dass ich nie wieder Tennis spielen, nie wieder mein Saxofon in die Hand nehmen würde, wusste ich. Eine Alternative dazu hatte ich nicht, nicht einmal die Ahnung einer Idee, nur dieses beklemmende Gefühl, absolut nutzlos zu sein. Und wer würde mich Häufchen Elend denn noch ernst nehmen? Da ich mir selbst nichts mehr zutraute, würde auch kein anderer mehr von mir erwarten, dass ich noch etwas bewegen könnte in meinem Leben. Und die Frauen? Die finden doch einen Krüppel nicht attraktiv, bemitleiden ihn höchstens. Später kamen noch Selbstvorwürfe dazu: Warum hatte ich mir so etwas angetan?
DIE MAGIE DES WANDELS
Als mir mein Leben abhandenkam, war ich gerade fünfundzwanzig Jahre alt. Ich sah nur den Verlust, und meine Zukunft bestand für mich aus meiner Vergangenheit minus all jener Dinge, die ich nicht mehr tun konnte. Das war mein blinder Fleck. Ich sah nur, was ich verloren hatte, nicht, was noch da war. Ein paar Jahre später sollte ich erleben, wie es einem sehr prominenten Querschnittgelähmten, dem Superman-Darsteller Christopher Reeve, ähnlich erging. Reeve war wenige Zentimeter höher gelähmt als ich und hatte bis zu seinem Tod 2004 darauf gehofft, irgendwann wieder laufen zu können. Auch er konnte seine Vergangenheit nicht loslassen, wollte zurück zur Normalität, zu dem, was uns die Gesellschaft als »normal« suggeriert. Die Fernsehbilder von einem gelähmten Reeve, der unter schrecklichsten Qualen versuchte, zwei Schritte zu laufen, der umjubelt von Hunderten von Fußgängern versuchte, selbst wieder Fußgänger zu werden, machten mich damals sehr nachdenklich. »Lass es sein!«, wollte ich ihm zurufen. »Warum willst du wieder zum Fußgänger werden? Warum konzentrierst du dich auf das, was du nicht mehr hast? Konzentriere dich lieber auf das, was da ist!«
Konzentriere Dich mehr auf Deinen Einflussbereich!
Aber was ich ihm hätte sagen wollen, musste ich zuerst einmal selbst begreifen, und das sollte erst nach der zweiten Operation geschehen. Vielleicht lag es daran, dass ich auf einen Erfolg nicht eingestellt war. Auch meine Finger konnte ich inzwischen nicht mehr bewegen, und mit der Operation wollte man genau dies ändern. Die Ärzte versuchten, meinen Trizeps und Teile meiner Muskelkraft in den Händen zurückzuholen. Beim rechten Trizeps gelang ihnen das zu 60, links zu 40 Prozent. Bei den Händen erreichten sie links 7 und rechts 15 Prozent. Als ich beim Muskeltest nach der Operation den rechten Daumen wieder bewegen konnte, war ich verwundert darüber, dass die Ärzte förmlich in Jubel ausbrachen. Meine Freude war eher verhalten; es tat zwar unheimlich gut, die Ärzte so zu sehen, aber ich wollte den Tag nicht vor dem Abend loben.
Als ich langsam begriff, was das mit dem Daumen zu bedeuten hatte, flossen die Freudentränen. Was für ein Geschenk, dachte ich und begann mir auszumalen, was ich mit diesem Daumen noch alles anstellen würde. Ich konnte Buchseiten umblättern, die Knöpfe einer Fernbedienung drücken, eine Computermaus bedienen, einen Löffel halten. Vielleicht würde ich sogar Auto fahren können! Das war meine Welt – ein ganzes Universum in diesem einen Daumen. Ich hatte meine Finger völlig aufgegeben und nicht mehr mit einer Verbesserung gerechnet. Umso größer war meine Freude über den Daumen und auch über die Muskelkraft, die ich später noch in den Fingern zurückerlangen sollte.
An dieser Situation mache ich heute die wichtigste Erkenntnis meines Lebens fest. Hätte ich damals so sehr darauf gehofft, wieder »normal« zu werden, hätte ich mich nicht über die Beweglichkeit in meinem Daumen freuen können, sondern nur gedacht: Verdammt noch mal, ich will mein altes Leben zurück! Es war offensichtlich, dass ich – wie Reeve – einen Kampf mit meiner Umwelt gekämpft hatte, den ich nur verlieren konnte. Erst als ich dazu bereit war, den Kampf mit mir selbst aufzunehmen, änderte sich meine Perspektive. Es war nur ein kleiner Bruch, eine minimale Verschiebung in meiner Wahrnehmung, aber plötzlich war alles anders: Ich fühlte mich gut. Ich empfand eine tiefe Dankbarkeit. Ich freute mich über das, was da war, und ärgerte mich nicht über das, was nicht da war. Natürlich versuchte ich jeden Tag, meine gelähmten Bereiche zu aktivieren. Und das mache ich heute noch. Doch ich verliere mich nicht in einer Hoffnung oder Erwartung.
Konzentriere dich auf das, was da ist – und mache daraus mehr! Diese Erkenntnis ist zu meiner Philosophie geworden. Und dadurch, dass ich mich auf meinen Daumen konzentrierte, war da plötzlich sogar noch viel mehr als vorher. Neue Wege taten sich auf, indem ich den Daumen als Chance erkannte. Heute bin ich immer noch zu 90 Prozent gelähmt, aber ich konzentriere mich auf die 10 Prozent Muskelkraft, die mir geblieben sind und die mehr bedeuten als die 100 Prozent vor meinem Unfall. Der Daumen steht nur für die erste von vielen Türen, die sich mir öffneten. Sicher, ich habe lange um diese Erkenntnis ringen müssen. Der Weg dahin war steinig, und ich kämpfe noch heute diesen Kampf, der manchmal schmerzhaft und einsam ist.
Dabei ging es nicht nur darum zu kämpfen, sondern noch mehr darum loszulassen. Meine Freude über den Daumen war das erste Zeichen dafür, dass ich mich nicht nur schonungslos mit meiner Situation konfrontiert, sondern sie auch angenommen hatte. Und zwar nicht intellektuell – aus der Sicht eines Nichtbehinderten –, sondern emotional. Nur durch das tiefe Akzeptieren der Realität war ein solcher Perspektivwechsel möglich, und folgerichtig ergaben sich dann aus einer Krise ganz neue Chancen. Und genau das ist das Problem: Viele wissen, was zu tun wäre (intellektuell), doch schaffen es nicht bis zur emotionalen Überzeugung. Man verliert kein Gewicht, indem man weiß, wie man abnimmt (intellektuell), sondern indem man weniger Nahrung aufnimmt oder mehr Nahrung verbrennt (emotionale Einsicht). Denn den meisten fehlt es nicht an intellektuellem Erkennen, sondern an emotionaler Umsetzungskraft. Und: Die Frage ist nicht, ob eine Krise zur Chance werden kann, sondern wodurch eine Krise zur Chance wird.
Diese Erfahrung ist das Erste, was ich vermittle, wenn ich als Coach arbeite. Ich halte keinen Vortrag, in dem ich nicht darauf zu sprechen komme. Die Konzentration auf Fähigkeiten, die da sind – das ist der erste Baustein einer einfachen, aber unglaublich starken Philosophie, die sich eins zu eins auf alle Lebensbereiche übertragen lässt. Fragen Sie sich als Führungskraft einmal, was der Daumen Ihres Lebens, Ihres Unternehmens oder Ihres Jobs ist. Unter Umständen ist er gar nicht so einfach zu erkennen. Manche arbeiten jahrelang mit dem Zeigefinger, obwohl die Begabung im Daumen steckt.
Auch als Führungskraft sollten Sie einmal ein wenig die Perspektive wechseln und auf die Ressourcen Ihres Unternehmens und auf die Talente Ihrer Mitarbeiter blicken. Haben Sie schon begonnen, sich darüber zu freuen? Oder finden Sie, dass deren Begabung etwas Selbstverständliches sein sollte? Nehmen Sie nur die scheinbaren Ungerechtigkeiten wahr, sehen gar nicht, was da ist, und fragen sich: Warum arbeite ich nur in einem so vertriebsschwachen Unternehmen? Und warum ist unser Marketingbudget so niedrig? Das ist so, als würde ich sagen: »Sorry, ich kann grad nicht, ich sitze im Rollstuhl.« Immerhin haben Sie einen Vertrieb und ein Marketingbudget! Wenn Sie sich auf die Bereiche konzentrieren, die vorhanden sind, wird mehr aus ihnen und sie überstrahlen, was fehlt.
Das mit der Konzentration meine ich übrigens absolut wörtlich. Ich gebe Ihnen ein Beispiel: Ich bin mit dem Auto einkaufen und unterwegs zum Parkplatz. Es regnet in Strömen. Ich stehe in meinem Rollstuhl neben meinem Wagen und will mich auf den Fahrersitz wuchten, normalerweise eine meiner leichtesten Übungen. Aber heute ist irgendwie der Wurm drin. 10 Minuten später stehe ich immer noch da. Ich beobachte andere Passanten, die zu ihrem Auto gehen und einfach einsteigen, ohne darüber nachzudenken. Wenn jetzt mein Geist abhaut und die anderen beneidet, habe ich verloren. Ich muss bei mir bleiben. Was hilft es, andere zu beneiden? Damit komme ich auch nicht schneller ins Trockene, im Gegenteil! Ich muss mich auf das konzentrieren, was da ist. Dann sehe ich plötzlich den richtigen Weg, verstehe in diesem Fall vielleicht, was ich bisher beim Einsteigen falsch gemacht habe.
Inzwischen ist mir klar: Neid ist nichts anderes als ein undisziplinierter Geist, der abhaut und sich mit dem beschäftigt, was andere haben. Der Neidfaktor findet sich überall in unserem Alltag und hemmt uns ungemein. Dabei hilft es uns nicht weiter, uns vor Augen zu halten, was andere können oder haben. Neid lenkt nur von unseren eigenen Fähigkeiten ab.
Wer im Überfluss lebt, läuft Gefahr, alles als selbstverständlich hinzunehmen – eine der größten Zivilisationskrankheiten unserer westlichen Welt. Glücklicherweise können Sie sich frei entscheiden. Quälen Sie sich mit dem Gedanken an die Vergangenheit und an das, was Sie nicht haben? Oder beschäftigen Sie sich damit, hier und heute etwas aus dem zu machen, was Sie sind? Wenn Sie älter werden: Ärgern Sie sich über die Vergänglichkeit des Lebens, oder freuen Sie sich über die Möglichkeiten in jedem Lebensabschnitt? Diese Liste ließe sich beliebig fortsetzen.
Noch eine andere wichtige Einsicht geht mit dieser Erkenntnis einher: Wenn Sie sich auf Ihre eigenen Fähigkeiten konzentrieren, müssen Sie keinen »Kredit« aufnehmen. Sie gehen von Ihrer Person aus und bleiben mental bei sich. Und was fast noch wichtiger ist: Sie übernehmen Verantwortung für sich selbst. Ein größeres Geschenk gibt es nicht. Ich will Ihnen dazu eine letzte Geschichte erzählen, die sich noch im Krankenhaus zugetragen hat: Seit einigen Wochen hatte ich in meinem Drehbett gelegen und wünschte mir nichts sehnlicher als mehr Mobilität. Die Ärzte hatten schon mit mir über einen Rollstuhl gesprochen, aber zu Anfang war ich nicht gerade heiß darauf. Mobilität ja, Rollstuhl nein. Im Geiste war ich eben doch noch immer Fußgänger. Dann wachte ich eines Morgens auf, und neben meinem Bett stand ein Rollstuhl. Ich konnte inzwischen auch auf der Seite liegen und blickte erst aus dem Fenster, dann auf den Rollstuhl. Auf seinem Sitz lag ein Fell, damit man weich darin sitzen konnte. Er war nicht mehr ganz neu, ein Krankenhausrollstuhl eben. Und trotzdem: Ich freute mich. Ja, Sie haben richtig gelesen: Ich freute mich. Ich sah in dem Rollstuhl kein metallenes Gefängnis auf zwei Rädern, an das ich mein Leben lang gekettet bleiben sollte, sondern ein Vehikel, mit dem ich meine Unabhängigkeit zurückgewinnen konnte. Wieder hatte eine klitzekleine Verschiebung in meiner Wahrnehmung stattgefunden. Aus dem Rollstuhlgefängnis wurde zuerst ein dankbares Fortbewegungsmittel – und heute ist es so etwas wie mein Flugzeug. Damals war das eine Offenbarung und ein bedeutender Schritt in Richtung Selbstständigkeit. Noch heute vergeht kein Tag, an dem ich mich nicht über meinen Rollstuhl freue.
Die meisten Veränderungen scheitern daran, dass die Einsicht zum Wandel nur auf der intellektuellen Ebene entsteht und nicht zu einer emotionalen Einsicht wird.
Ich habe eine Entscheidung getroffen, die jeder frei ist zu treffen – auch ohne sich den Hals gebrochen zu haben. Wenn Sie wollen, gebe ich Ihnen folgenden Tipp: Nehmen Sie neue Situationen an – voll und ganz. Das ist der erste Schritt zur Bewältigung jeder Veränderung. Auch bei einer Krise! Und beschäftigen Sie sich nicht permanent mit Dingen, die Sie nicht verändern können. Das ist reine Zeitverschwendung! Wie Sie das hinkriegen? Wenn Sie morgens aufwachen, überlegen Sie sich gleich drei Dinge, über die Sie sich richtig freuen können und für die Sie dankbar sind. Was für ein Start in den Tag!
ZUM NACHDENKEN
·Wie oft am Tag verschwenden Sie Energie mit Dingen, die in Ihrem Interessenbereich jedoch nicht in Ihrem Einflussbereich liegen? Und was maht das mit Ihnen?
·Was würde passieren, wenn Sie sich bei sich selbst und bei anderen etwas mehr auf das konzentrieren würden, was da ist, anstatt auf das, was fehlt?
·Wenn sich etwas verändert: Wie schnell können Sie sich emotional auf diese Veränderung einlassen?
·Wie oft gehen Sie bei Veränderungen innerlich auf Widerstand und legen sich dadurch selbst Steine in den Weg?
2INTERPRETIERE DEIN LEBEN – SELBST
An sich ist nichts weder gut noch schlecht, das Denken macht es erst dazu.William Shakespeare
Neulich am Flughafen. Ich habe bereits eingecheckt, stehe aber noch einen Moment in der Nähe des Counters, um mich zu sortieren. Plötzlich setzt sich mein Rollstuhl wie von Geisterhand in Bewegung. Ich bremse, blicke mich um und sehe eine Mitarbeiterin vom Behindertenservice des Flughafens. Für gewöhnlich bringen diese netten Kollegen die Rollstuhlfahrer zuallererst an Bord. »Gute Frau«, sage ich, »Sie sollten einen Rollstuhlfahrer nicht einfach so wegschieben. Vielleicht möchte er da noch stehen bleiben …« – »Ich habe es ja nur gut gemeint«, antwortet sie entschuldigend. Klar, sie hat es gut gemeint. Diese Menschen haben in ihrem Job ständig mit Behinderten zu tun und sind sehr sozial eingestellt. Aber hätte sie sich wirklich Gedanken gemacht, dann wäre sie darauf gekommen, erst einmal zu fragen, ob ich ihre Hilfe überhaupt benötige. »Wie darf ich Ihnen behilflich sein?«, ist die Zauberformel jeder Flugbegleiterin, und zwar bevor sie einen Passagier zum Gate geleitet. Diese Frau war mit sich und ihrem Auftrag beschäftigt – verständlich. Doch sie hat sich dabei nicht mit meinen Bedürfnissen beschäftigt. Warum? Ganz einfach: Ihre Vorstellung von einem Rollstuhlfahrer ist nach all den Jahren, die sie diesen Job vielleicht schon macht, die eines Unmündigen. Und dieses Bild hat sie einfach auf mich übertragen. Wenn Sie mich fragen: Es ist anmaßend zu meinen, man wüsste, was der andere braucht, obwohl man ihn gar nicht gefragt hat. Das ist überheblich, immer.
Vor Jahren gingen meine Frau und ich einkaufen, ich brauchte ein paar neue Hemden. Als wir uns in einem Geschäft an eine Verkäuferin wandten, schaute diese meine Frau an und fragte: »Welche Hemdgröße hat er denn?« Mann, war ich platt! Heute würde mir das nicht mehr passieren. Inzwischen trete ich ganz anders auf und bin sehr präsent. Diese Geschichte erinnert mich stark an das Krankenhaus, als das Pflegepersonal in meiner Anwesenheit über mich redete, als sei ich überhaupt nicht da. Die Szene im Laden ist ein weiteres Beispiel dafür, wie meine Belange ignoriert wurden – solange ich es zuließ. Sicher hatte es die Verkäuferin auch nur »gut gemeint«. Meine Frau gab ihr die einzig richtige Antwort: »Warum fragen Sie ihn nicht selbst?«
Im Umgang mit Menschen passiert uns das jeden Tag: Andere meinen, sie müssten unsere Motive und unser Leben interpretieren, und jeder von uns interpretiert ständig die Motive und das Leben anderer. Als Behinderter landet man besonders schnell in einer Schublade. Sie können sicher sein: Weil ich gegen ihr Verhalten protestierte, war ich für die Frau am Flughafen ein armer Zyniker. »Ach, schon wieder so ein frustrierter Rollstuhlfahrer«, hat sie vielleicht gedacht. Indem ich mich verteidigte, entsprach ich nicht mehr ihrem Bild eines Behinderten – ich fiel aus dem Rahmen. Hätte ich mitgemacht und den Behinderten aus ihrer Vorstellungswelt gespielt, wäre für sie alles in Ordnung gewesen. Und jetzt weitergedacht: Stellen Sie sich einmal vor, ich hätte den Platz, den mir andere andauernd zuweisen wollten, angenommen – würde ich dann heute so selbstbestimmt und frei leben?
Sie können nichts dagegen unternehmen, dass andere sich ein Bild von Ihnen machen. Doch Sie haben immer die Wahl, ob sie diesem Bild entsprechen wollen oder nicht
Möchten Sie gerne weiterlesen? Dann laden Sie jetzt das E-Book.