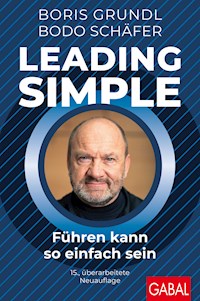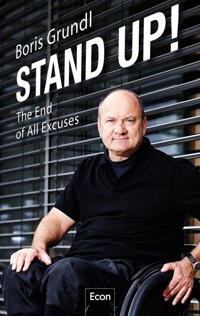14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Wer versteht, gewinnt! Verstehen ist der Erfolgsfaktor der Zukunft. Wer tief versteht, sieht klarer, erkennt, worum es im Kern geht, und trifft die besten Entscheidungen. Und wer tiefer verstehen will, muss überhaupt nicht einverstanden sein. Egal, ob es dabei um Wirtschaft, Politik, Gesellschaft oder Familie geht. Boris Grundl zeigt, wie wir uns von oberflächlichem Schwarz-weiß-Denken verabschieden und unseren Charakter formen. Wir lernen, wie wir klug hinhören, differenziert bewerten, Perspektiven wechseln und unsere Sicht erweitern. Wer verstanden hat, handelt aus Überzeugung. So bekommen wir Haltung, werden innerlich frei – und gewinnen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Das Buch
Die Welt um uns herum ist hektisch und laut geworden. Die permanente Zunahme von Komplexität und Tempo im Leben zerrt an uns, an unseren Nerven, an unseren Beziehungen und an unserer Gesundheit. Wir haben »keine Zeit«, sind »schwer beschäftigt« und wollen uns »durchsetzen«. Im Ergebnis dominiert das Trennende das Verbindende. Es entstehen überflüssige Konflikte, welche Unmengen an Zeit, Geld und Nerven kosten. Immer tiefere Risse spalten unsere Gesellschaft, fördern politische Extreme, hemmen Unternehmen, und trennen manchmal Familien.
»Verstehen ist eine Lebensaufgabe«, das sagt der Menschenentwickler und Erfolgsautor Boris Grundl. Er stellt dem Wahnsinn von »höher, schneller, weiter« sein Konzept von »flexibler, klarer, tiefer« entgegen. Mehr Substanz und Wirkung, weniger Aktionismus und Beschäftigung. Grundl weiß wovon er spricht: Er stand auf dem Gipfel und fiel ins Bodenlose – vom Spitzensportler zum zu 90 Prozent gelähmten Hartz-IV-Empfänger im Rollstuhl. Heute ist er einer der gefragtesten Führungsexperten Europas, glücklicher Familienvater und lebt in Spanien und Deutschland.
Für Boris Grundl ist »verstehen, ohne einverstanden sein zu müssen« der entscheidende Erfolgsfaktor der Zukunft. Es ist ein lohnender Weg: erst klug hinhören, dann differenziert bewerten, die Perspektive wechseln, den eigenen Standpunkt prüfen, Haltung gewinnen, konsequent handeln und schließlich der eigenen Überzeugung folgen. So entsteht innere Freiheit.
Der Autor
Boris Grundl, ist Managementberater, Unternehmer, Führungsexperte, Coach und Redner. Mit seiner Leadership-Akademie (www.grundl-akademie.de) berät er Firmen wie Daimler, SAP oder die Deutsche Bank. Er ist Gastdozent an mehreren Universitäten, erforscht das Thema Verantwortung (www.verantwortungsindex.de) und setzt sich ehrenamtlich für Schüler ein.
Bei Econ sind von ihm folgende Bücher erschienen: Steh auf! (2008), Diktatur der Gutmenschen (2010), Die Zeit der Macher ist vorbei (2012) und Mach mich glücklich (2014).
BORIS GRUNDL
Verstehen heißt nicht einverstanden sein
Econ
Besuchen Sie uns im Internet:
www.ullstein-buchverlage.de
Wir wählen unsere Bücher sorgfältig aus, lektorieren sie gründlich mit Autoren und Übersetzern und produzieren sie in bester Qualität.
Hinweis zu Urheberrechten
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten.
Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
ISBN: 978-3-8437-1653-6
© der deutschsprachigen AusgabeUllstein Buchverlage GmbH, Berlin 2017
Umschlaggestaltung: FHCM Graphics, Berlin
E-Book: LVD GmbH, Berlin
Alle Rechte vorbehalten.
Es hat nichts Edles, sich seinen Mitmenschen überlegen zu fühlen.Wahrhaft edel ist,wer sich seinem früheren Ich überlegen fühlt.
(Ernest Miller Hemingway)
PECHVOGEL ODER HANS IM GLÜCK?
Schweißgebadet wache ich auf. Es ist einer dieser Alpträume, die mich seit meiner Kindheit verfolgen: Etwas Unbestimmtes bedroht mich. Es ist hinter mir. Rechts hinter meiner Schulter, im Dunkeln. Ich kann es nicht sehen, nur fühlen. Es ist nah, ganz nah und greift nach mir. Ich habe Angst. Schreckliche Angst, und möchte weglaufen. Kann aber nicht. Ich kann mich nicht bewegen, bin total gelähmt, vollkommen hilflos. Und jetzt, mitten in der größten Angst, wache ich auf.
Dieser immer wiederkehrende Alptraum sorgte dafür, dass ich mich, schon als ich ganz klein war, jedes Jahr freiwillig gegen Kinderlähmung impfen ließ – viel zu oft, wie mir die Ärzte sagten. Das war mir egal. »Schluckimpfung ist süß, Kinderlähmung ist bitter«, so hieß es damals. Mich überzeugte das, und so impfte ich, was das Zeug hielt. Hinter jeder Muskelverspannung wähnte ich den Anfang meines Alptraums. Ein traumatisiertes Kind auf Grund eines wiederkehrenden Traums.
Doch in dieser Nacht ist etwas anders. Inzwischen bin ich kein Kind mehr: In diesem Traum bin ich zuvor von einer Klippe gesprungen und habe mir dabei den Hals gebrochen. Menschen mit schreckgeweiteten Augen stehen um mich herum, nachdem mich ein paar von ihnen nach meinem Kampf gegen das Ertrinken aus dem Wasser gefischt haben und ich an einem Strand im Sand liege.
Ich halte die Augen noch einen Moment länger geschlossen als sonst und lasse den Traum vorüberziehen, irgendwo im Nebel des Ungefähren verschwinden. Es ist so, wie es immer war, denn ich weiß: Das ist der beste Weg, den Traum da zu lassen, wo er hingehört – im Reich der Träume.
Noch ein wenig benommen öffne ich die Augen. Ich liege in einem fremden Zimmer und blicke gegen eine weißgestrichene Decke. Keine Ahnung, wo ich mich gerade befinde und wie ich hierhergekommen bin. Ich versuche, mich zu bewegen, so wie ich es nach meinen Alpträumen immer getan habe. Stück für Stück, um mich zu versichern, dass alles nur ein böser Traum war. Aber dieses Mal spüre ich nichts. Es bewegt sich nichts: kein Bein, kein Knie, nicht einmal der kleine Zeh. Ist mein Alptraum bittere Realität geworden?
Das ist der Moment, in dem mein Leben sich schlagartig ändert. Gewissheit greift um sich: Ich bin tatsächlich gelähmt! Mein schlimmster Alptraum ist wahr geworden. Er hat mich eingeholt. Auf einmal bin ich nur noch ein wacher Kopf in einem lahmen Körper. Mein altes Leben ist vorbei. Das ahne ich, und das wird in den nächsten Tagen und Wochen immer deutlicher.
Ich bin 25 Jahre alt, Student der Sportwissenschaften in Köln, durchtrainiert, attraktiv, hungrig – ja gierig nach Leben in jeglicher Hinsicht. Der prototypische Tennis- und Skilehrer! In der Tat finanziere ich mein Studium – und nicht nur das – mit Tennisstunden. Spiele in der Regionalliga. Am liebsten wäre ich Tennisprofi geworden: Auf der deutschen Rangliste stand ich bereits unter den ersten einhundert. Aber auch andere Sportarten liegen mir: In zwölf oder dreizehn Disziplinen bin ich Stadt- und Landesmeister, darunter Leichtathletik, Skispringen und Schwimmen. Meinen ersten Marathon bin ich mit siebzehn Jahren gelaufen.
Ich hatte es schon immer wissen wollen. Als kleiner Junge war mir zum Leidwesen meiner Mutter kein Baum zu hoch, als dass ich nicht bis ganz hoch in die Krone geklettert wäre. Später als junger Mann war ich immer das, was man landläufig einen smarten Typ nennt, dem so ziemlich alles in den Schoß fiel. Ein Hans im Glück! Was ich anfing, klappte einfach: Schule, Musik (Klarinette und Saxophon), Freundschaften, Sport, Studium, Mädels. Alles kein Problem! Immer im Laufschritt unterwegs. Bloß nicht stehenbleiben, immer schneller, höher, weiter! Keine Zeit nachzudenken. Immer Vollgas.
Und nun liege ich hier in einem Raum, den ich nicht kenne, wie ein Käfer auf dem Rücken in einem Bett, das nicht mein Bett ist, und bin unfähig, mich zu bewegen – schon gar nicht im Laufschritt. Wie in Franz Kafkas Erzählung Die Verwandlung. Doch es ist nicht Gregor Samsa, der da im Körper eines Käfers erwacht.
Ich höre entfernte Stimmen und Geräusche, vielleicht hinter einer Tür, ein Piepen über meinem Kopf, das ich nicht einordnen kann. Selbst den Kopf kann ich nicht drehen. Er ist mit einer Halskrause fixiert. Und meine Hände sind mit dicken Handschuhen bandagiert. Kein Vollgas mehr möglich. Das ist eine Vollbremsung. Ungewollt. Unerwartet. Unfair? Ich weiß es nicht.
Es riecht nach Desinfektionsmittel und welken Blumen. Irgendwo tropft ein Wasserhahn. Das Einzige, was mir geblieben ist, ist Zeit. Unendlich viel Zeit, wie sich in den folgenden Wochen und Monaten noch herausstellen wird. Und Gedanken, unendlich viele Gedanken.
Ich befinde mich in einem Krankenhaus. Langsam kommt die Erinnerung zurück: In Mexiko war ich doch, mit meinem Freund Stefan, mit einer Reisegruppe. Wir hatten eine Exkursion zu einer der schönsten Lagunen im mexikanischen Dschungel gemacht – ein Paradies! Und dort wollte ich mir, wie schon so oft, mal wieder etwas beweisen. Ich hatte die Jungs aus dem mexikanischen Dorf beobachtet, wie sie auf die Klippe geklettert und dann ins Wasser gesprungen waren. Ich hatte sie lachen gesehen und schreien gehört, ihre Begeisterung gespürt. Lebensfreude pur. Das wollte ich auch – das konnte ich auch, natürlich!
Und so machte ich mich auf und kletterte die Klippe hoch. Der erste Sprung von halber Höhe – das war schon geil! Da geht doch noch mehr. Höher, schneller, weiter! Langsam arbeitete ich mich mit weiteren Sprüngen immer etwas höher bis nah an den Wasserfall heran. Da stehe ich nun und konzentriere mich auf meinen Sprung. Meinen letzten Sprung. Es sollten die letzten Sekunden in meinem Leben sein, in denen ich aus eigener Kraft auf meinen Beinen stehen kann. Aber das weiß ich da noch nicht.
Als ich so dastehe und in mich gehe, höre ich auf einmal eine Stimme. Und sie sagt: »Boris, spring nicht!« Was nun folgt, ist eine Entscheidung innerhalb eines Bruchteils einer Sekunde. Ist es Intuition oder Angst, welche da zu mir spricht? Es ist nicht leicht, diese beiden Stimmen voneinander zu unterscheiden. Ich dachte, es sei Angst. Und diese wollte, ja musste ich überwinden. Ich bin schließlich Boris Grundl. Und eigentlich unbesiegbar. Also wischte ich diese innere Stimme rasch beiseite und sprang. Ohne die notwendige Körperspannung – Hals überdehnt, siebter Halswirbel gebrochen. An Armen und Beinen sofort gelähmt, zu 90 Prozent.
Die innere Stimme war also meine Intuition, die es gut mit mir gemeint hatte. Das weiß ich heute. Aber damals konnte ich Angst von Intuition noch nicht unterscheiden. Niemand konnte, ja durfte mich von irgendetwas abhalten: Ich war besessen davon, meine Grenzen zu spüren und sie im Zweifel zu überwinden.
Das war mit einem Sprung vorüber. Ich hatte meine Grenze definitiv erreicht, gar überschritten.
Aus voller Fahrt, aus unbändiger Rastlosigkeit wurde von einem Moment zum anderen ein Leben in Slow Motion. Bisher war ich gewohnt zu gewinnen – nun hatte ich verloren. Alles auf einmal: Gesundheit, Perspektive, Lebensantrieb. Alles weg.
Was blieb mir noch? Was hatte mein Leben für einen Sinn? Es kamen große Ängste und Selbstvorwürfe. Die immer gleichen Fragen quälten mich unaufhörlich. Warum war mir das passiert? Wie konnte ich mir so etwas nur antun? Wieso fühlte ich mich nur im Grenzbereich so richtig lebendig? Was war mein Leben noch wert? Was sollte aus mir werden? Von den Konsequenzen, die der Unfall für mich haben würde, hatte ich nicht die geringste Vorstellung, und fürs Erste weigerte ich mich beharrlich, darüber überhaupt tiefer nachzudenken. Große Schuldgefühle und Selbstmitleid fraßen sich in meine Seele.
Ich war gelähmt, sowohl mein Körper als auch mein Geist. In den ersten Wochen ließ ich alles nur über mich ergehen, als ob ich nichts damit zu tun hätte. Mit einer gewissen Neugierde nahm ich zur Kenntnis, wie irgendwelche Pflegekräfte mich fütterten, wie sie meine Inkontinenz versorgten, wie sie mir den Schleim aus den Bronchien absaugten und was sonst noch alles nötig war, um mich am Leben zu erhalten. Ich hatte damit nichts zu tun. Ich war mir selbst ein Fremdkörper. Wenn die Pfleger mich versorgten, fühlte ich mich wie ein Sack Kartoffeln.
Nicht nur ich war verzweifelt, auch meine Familie und meine Freunde, alle, die mich besuchten, waren es. Das sah ich in ihren Augen und an ihrer Körpersprache. Ihre Worte sollten mich aufmuntern, doch ihre Gesten sagten mir, was sie wirklich dachten: »So ein Mist, lieber Boris. Das war es dann wohl mit dir. Vorbei mit dem glänzenden Leben. Vorbei mit dem tollen Sportler. Vorbei mit der tollen Berufsperspektive. Vorbei mit dem Mädchenschwarm, da läuft als Mann wohl nicht mehr viel. Vorbei mit einem freien und selbstbestimmten Leben. Ja, und so gar nichts alleine können. Ein Leben lang füttern, waschen, wickeln … Schöne Scheiße!« Einmal hörte ich zufällig ein Gespräch zwischen zwei Therapeutinnen mit. Eine kam gerade aus dem Urlaub zurück: »Da ist ein Neuer angekommen. Ein Klippenspringer aus Mexiko. Schade drum, soll mal ein super Tennisspieler gewesen sein. Das sieht man auch. Wahnsinnsbeine! Total durchtrainiert und so braungebrannt. Schade drum.«
Das war zu viel für mich: zu viel Mitleid, zu wenig Respekt. Ich wollte diese Geschichten der anderen nicht glauben. Ich wollte ihnen beweisen, dass sie falschlagen. Doch mein Wille war gebrochen. Mein durchtrainierter Körper gab ein Bild der Stärke ab, doch ich blutete innerlich aus. Mein Energiespeicher leerte sich, und ich wusste nicht, wie ich ihn aufladen sollte. Früher hatte das wie von selbst funktioniert, über Nacht. Doch jetzt war da nichts mehr, was mich aufrichtete.
Ich ging innerlich auf Abstand, zu allem und zu allen. Und in den folgenden Wochen und Monaten im Krankenhaus änderte sich an dieser Einstellung erst einmal nichts. Im Gegenteil: Je mehr mir meine Lage bewusst wurde, desto stärker lehnte ich sie ab. Ich lehnte mich ab. Ich überspielte mein Leiden mit gekünstelter Souveränität. Ich fühlte mich nutzloser als eine Zimmerpflanze, die sich wenigstens für das Wasser, das man ihr gibt, erkenntlich zeigt, indem sie ab und zu blüht. Ich verdorrte innerlich.
Ich, der Supersportler, fühlte mich so unendlich hilflos. Das Bett, in dem ich lag, war ein sogenanntes Drehbett, das meinen Körper davon abhalten sollte, wund zu werden. Wie eine Frikadelle auf dem Grill wurde ich alle paar Stunden vom Rücken auf den Bauch und dann wieder auf den Rücken gedreht. Ich starrte an die Decke, wurde gedreht, starrte auf den Boden.
Decke. Boden. Decke. Boden. Eine Endlosschleife zwischen Decke und Boden.
Mein Blickfeld war das eines Babys im Kinderbettchen: Wer sich nicht über mich beugte, den sah ich nicht. Sogar mein Bewusstsein wurde dabei immer begrenzter.
Decke, Boden, Decke, Boden, Decke, Boden.
Meine kleine Welt beschränkte sich auf mein enges Krankenhauszimmer. Außerhalb existierte für mich nichts anderes mehr. Dieses Drehbett sollte zur Metapher für mein Leben werden: Es hatte sich alles gedreht, und zwar radikal.
Ich wusste, dass ich nicht mehr der Alte war. Obwohl ich krampfhaft versuchte, an diesem Bild nach außen festzuhalten. Diesen starken attraktiven und erfolgreichen jungen Mann gab es nicht mehr. Das konnte ich noch nicht akzeptieren. Das war nicht ich, Boris Grundl, das Tennis-Ass, der ewig gutgelaunte Sonnyboy, der Charmeur und Frauenheld. Jetzt war ich wirklich ein Krüppel.
Ich hatte viel Zeit, über mein Schicksal zu grübeln. In den langen Nächten, wenn es ganz still wurde auf den Krankenhausfluren, kam die Einsamkeit. Ich war ungeheuer traurig, verzweifelt und hatte Angst vor der Zukunft. Was würde aus mir werden? Selbst versorgen konnte ich mich nicht, ich würde ein Sozialfall sein, der von seinen Eltern und vom Staat durchgefüttert werden musste. Wie es aussah, würde ich nicht alleine wohnen können. Was war mit meinem Sportstudium, was mit dem Autofahren? Würde ich je einen Beruf ausüben können? Dass ich nie wieder Tennis spielen, nie wieder mein Saxophon in die Hand nehmen würde, das wusste ich. Eine Alternative konnte ich mir nicht vorstellen, ich hatte nicht einmal den Hauch einer Idee, nur dieses beklemmende Gefühl, absolut nutzlos zu sein. Und war ich nicht auch bloßgestellt? Wer würde mich Häufchen Elend noch ernstnehmen? Niemand würde von mir erwarten, dass ich noch etwas bewegen könnte in meinem Leben. Und die Frauen? Die finden einen Krüppel ganz bestimmt nicht attraktiv, bemitleiden ihn höchstens – und das war wirklich das Allerletzte, was ich brauchen konnte.
Ich sah keinen Ausweg. Ich sank immer tiefer in diesen Sumpf von negativer Energie. So sah mein Leben im Frühjahr 1991 aus. Keiner glaubte an mich. Am wenigsten ich an mich selbst.
Nun, und was ist heute? Heute bin ich einer der gefragtesten Führungsexperten und Keynote-Speaker Europas. Ich schreibe Bücher, und als Unternehmer mit eigener Leadership-Akademie gehören wir zu den Topadressen für Transformation von Führungskräften. Dank meiner finanziellen Freiheit ist es mir möglich, dass ich in Spanien und Deutschland lebe. Ich bin mit einer tollen Frau verheiratet und habe zwei großartige erwachsene Kinder.
Vielleicht fragen Sie sich jetzt: Wie kann jemand aus so einer Niederlage, so einem tiefen Fall ins Bodenlose einen Sieg machen? Wie ist es dazu gekommen? Wie ist so etwas überhaupt möglich?
Ich musste lernen zu verstehen, tief zu verstehen. Mich selbst verstehen. Andere verstehen. Märkte verstehen. Unternehmen verstehen. Produktion verstehen. Familie verstehen. Vertrieb verstehen. Sinn verstehen. Menschliche Entwicklung verstehen. Transformation verstehen. Das Leben verstehen. Und genau darum geht es: das Leben und seine Prinzipien verstehen lernen. Nicht: mein Leben zuerst verstehen. Denn das ist der Knackpunkt: Die meisten Menschen wollen zuerst ihr Leben verstehen, um dann das Leben zu verstehen. Und genau darin liegt der Kardinalfehler! Es geht zuerst darum, das Leben an sich zu verstehen und danach mein Leben. So wird ein Schuh daraus, und man erreicht eine gesunde Distanz zu sich selbst.
Und weil vielen diese Distanz zu sich fehlt, kreisen sie ständig um sich selbst und verlieren sich im Nebel der Egozentrik. Das ist auch der Grund, dass bei so vielen das Motiv »verstanden werden wollen« das Motiv »verstehen wollen« dominiert. Und wer lernen will, das Leben zu verstehen, lernt, dass verstehen nicht zwangsläufig heißen muss, einverstanden zu sein. Und wer mein Leben verstehen will, versteht nur, wenn er auch einverstanden ist. Was für ein riesiger Unterschied!
Da ich zuerst mit mir und meinem Leben beschäftigt war, musste ich lernen, mir bessere Fragen zu stellen. Statt: Warum ist mir das passiert (mein Leben)? Was will mir das Leben damit mitteilen (das Leben)? Statt: Warum habe ich mir das angetan (mein Leben)? Wofür war das Ganze gut (das Leben)? Zugegeben, das war alles andere als leicht – es war eine harte Denkschule.
Die Inhalte dieser Denkschule müssen drei Aufnahmekriterien bestehen. Erstens müssen sie mich beim Nachdenken zum Handeln inspirieren. Denn Inspiration ist der Wegweiser kluger Reflexion. Zweitens müssen sie nach der Handlung die gewünschten Ergebnisse bringen. Und drittens müssen sie für die Kunden unserer Akademie ebenfalls die gewünschten Ergebnisse liefern. Erst dann traue ich mich, darüber zu schreiben und zu reden.
Und das heißt noch lange nicht, dass ich diese Prinzipien selber immer beherrsche. Oft genug scheitere ich bei deren Anwendung. Doch es gelingt mir immer öfter, danach zu leben. Denn es geht nicht um Perfektion. Es geht nicht um ein perfektes Leben. Es geht um ein stimmiges Leben. Ein berufenes Leben. Aus meiner Sicht geht es nicht darum, was »ich will« oder »nicht will«. Es geht darum, »für was ich gemeint bin«. Das ist ein ganz anderer Tenor. Ein Leben voller Sinn und Berufung. Dieser Lebenssinn entspringt einer sehr individuellen Selbstfindung. Und diese Reise nach innen macht jedes Leben spannend. Davon bin ich überzeugt.
Ich möchte nicht der sein, den meine Eltern in mir sehen. Ich möchte auch nicht der sein, den mein Partner in mir sehen will. Oder mein Chef. Oder die Gesellschaft. Und ich bin auch nicht der, der ich einmal war. Ich bin der, der ich bin!
In diesen Sätzen liegt für mich die Kraft eines freien und selbstbestimmten Lebens. Meine Überzeugung ist es, dass genau diese Gedanken für jeden Menschen jeden Tag immer wichtiger werden. Von dem Tag an, an dem wir über »unser Dasein« anfangen nachzudenken, bis zu unserem Tod. Denn es geht in Zukunft nicht um höher, schneller, weiter; sondern um flexibler, klarer, tiefer. Um dahin zu kommen, müssen wir lernen zu verstehen, ohne dass wir uns dem Druck aussetzen, auch einverstanden zu sein.
Mein Schicksal hat mir einige heftige und viele wunderbare Lektionen erteilt. Lektionen, welche ich erkennen und anerkennen lernen musste. Heißt das, dass meine Erkenntnisse »wahr und richtig« sind? Überhaupt nicht! Das kann und will ich nicht behaupten. Doch durch ständige Reflexion und Aktion hat sich mir ein Weltbild vermittelt, welches ich in meiner Arbeit mit Menschen zum »Selbst-darüber-Nachdenken« gerne anbiete. Wie mit diesem Buch. Deswegen öffne ich mich so weit wie möglich und so gut ich es eben bis jetzt kann, damit jeder von meinen Limitierungen, Lernprozessen und Erkenntnissen selbst profitieren kann. Denn darum geht es. Auch wenn ich mich dadurch angreifbar und verletzbar mache. Der Einsatz lohnt sich für jeden Menschen, welcher durch diese Lektüre weiterkommt.
Im Drehbett musste ich lernen zu verstehen. Einverstanden war ich mit meiner Situation zu Anfang überhaupt nicht. Und ich dachte, ich werde es auch nie sein. Doch heute bin ich selbst damit einverstanden. Ohne sie wäre ich nicht der, der ich jetzt bin. Deswegen kokettiere ich bei Vorträgen gerne mit dem Satz: Ich würde noch einmal springen. Zugegeben, dieser Gedanke ist für viele kaum nachvollziehbar. Doch manche regt er zum tieferen Nachdenken an. Denn es geht hier nicht um mich. Einmal kam ein Zuhörer nach einem Vortrag zu mir und sagte: »Herr Grundl, ich würde gerne etwas in meinem Leben finden, für das ich gerne springen würde. Ich werde danach suchen.« Er hatte verstanden.
Doch die Frage bleibt: Wie wird aus einem zu 90 Prozent gelähmten Häufchen Elend und Sozialfall ein Mensch, der ein unabhängiges, selbstbestimmtes Leben voller Freiheit und Anerkennung lebt? Wie ist eine solche Entwicklung überhaupt möglich? Genau davon möchte ich auf den folgenden Seiten sprechen.
1VERSTEHEN ÜBERFLÜSSIG
Wer verstehen will, muss hinhören, aufnehmen. Und wer nicht hören will, muss fühlen. So war es mir ergangen. Ich hatte nicht auf meine innere Stimme gehört und hatte die Konsequenzen zu tragen.
Immer wieder ging mir im Drehbett die Situation auf der Klippe durch den Kopf.
Während meines Aufstiegs zu meinem letzten Sprung von ganz oben hatte ich gehört, wie der Wasserfall an mir vorbei in die Tiefe stürzte. Er war immer lauter geworden, und irgendwie war der Weg nach oben diesmal anders. Die Steine hatten noch glitschiger als vorher gewirkt, und das Klettern schien viel anstrengender zu sein. Vielleicht war ich einfach schon ein bisschen müde von dem ganzen Ausflug, von der Sonne. Aber da war noch etwas anderes, eine Stimme in mir sagte: »Muss das denn sein?« Aber ich hörte nicht auf diesen inneren Kompass und kletterte weiter.
»Na los, was man angefangen hat, bringt man auch zu Ende!«, trieb ich mich weiter an. »Wer A sagt, muss auch B sagen.« Außerdem war es viel leichter, von hier oben zu springen, als den ganzen Weg über die rutschigen Felsen wieder runterzuklettern. Wenn ich schon den ganzen Felsen hinaufklettere, könnte ich auch gleich springen, alles andere wäre viel zu mühsam. Außerdem hätte es nach Kapitulation ausgesehen. Überhaupt: Ich war jetzt schon von fast allen Punkten gesprungen. Dieser eine Sprung von ganz oben fehlt mir noch in meiner Sammlung. Der letzte Sprung von der höchsten Stelle. »Das bringst du jetzt noch zu Ende«, sagte ich mir!
HAKEN DRAN
Heute würde ich diesem fünfundzwanzigjährigen Jungen gerne zurufen: »Wer sagt das? Wer sagt denn, dass du musst?« Aber hätte er auf mich gehört? Wohl nicht. Ich kann ihn und das, was er tat, verstehen. Aber er und ich, wir sind uns in diesem Punkt nicht mehr sehr ähnlich. Er wollte etwas unreflektiert zu Ende bringen, durchziehen. Koste es, was es wolle. Ein Programm abspulen, funktionieren. Er wollte nach dem Urlaub sagen können: Wir waren tauchen und surfen, Boot fahren und schnorcheln, und dann bin ich auch noch von dem höchsten Punkt einer Felswand, vom Rand eines Wasserfalls, in eine Lagune gesprungen. Der Junge wollte einen Haken an die Sache machen sowie an all die anderen Abenteuer, die er bei dieser Reise schon erlebt hatte: San Diego – Haken dran, Fischen in Cabo San Lucas – Haken dran, das Mädchen rumkriegen – Haken dran, Puerto Vallarta – Haken dran, Lagunentour mit Felsensprung – Haken dran. Nicht der Weg war das Ziel, sondern das Ziel war das Ziel.
Ich fühlte mich als Mittelpunkt des Universums. Und war doch gelangweilt. Gelangweilt von der Leichtigkeit des Seins. Das sollte sich ändern.
Würde ich diese Reise heute machen, dann würde ich die Zeit nutzen, um noch näher zum Mittelpunkt meines Selbst zu reisen. Ich wäre vielleicht ein paar Mal gesprungen, vielleicht aber auch nicht, hätte diesen friedlichen Ort einfach nur bestaunt, mich von der Energie des Dschungels anstecken lassen, den Jugendlichen zugeschaut und mich mit ihnen gefreut. Mit allen meinen Sinnen »wahrgenommen«. Ich hätte alles in mir aufgesogen, mich so lange wie möglich daran zu erinnern, einfach geatmet, in mich hineingespürt, in mich hineingehört, gelebt.
Als junger Wilder, der ich damals war, hatte ich dafür noch keinen Blick und auf meiner Reise keinen Moment wirklich intensiv gelebt, gefühlt oder genossen. Dafür fehlte mir das Bewusstsein, denn es galt, ein Programm zu absolvieren, von A nach B zu reisen und jetzt noch diesen einen Sprung hier zu machen. Warum? Das fragte ich mich nicht. Sonst wäre mir vielleicht klargeworden, dass ich einem Zwang folgte. Deshalb hatte ich auch nicht mehr die Leichtigkeit der Jugendlichen, die sprangen, ohne zu planen, ohne zu funktionieren, und die aufhörten, wann immer sie keine Lust mehr hatten – und denen deshalb auch nichts geschah. Weil sie mit sich selbst stimmig waren.
INTUITION ODER ANGST
Ich stand irgendwann ganz oben, und jede einzelne Zelle meines Körpers schien zu schreien: »Lass es sein, spring nicht!« Aber ich achtete nicht auf dieses innere Signal, ignorierte, dass ich nicht eins war mit mir. Nicht bei mir war. Mein Kopf entschied rational gegen mein körperliches emotionales Empfinden, gegen mein Bauchgefühl und gegen mein Herz. Gleich würde ich springen. Ich hatte wacklige Knie, als ich auf dem Felsen stand, und ein flaues Gefühl im Magen. Die Steine unter meinen Füßen waren rutschig, ich fand kaum Halt, der Wasserfall machte hier oben ein schier ohrenbetäubendes Getöse. Ich schaute hinunter …
Heute höre ich besser auf meine Intuition, meine innere Stimme oder meinen Kompass, wie immer man es nennen will. Ich höre bei weitem nicht an allen Tagen, was mir die Stimme rät. Das »Müssen« ist immer mal wieder in mir, schreit nach Beachtung. Doch das »Dürfen« behält jetzt meist die Oberhand. Ich bin sensibilisiert und höre immer öfter in mich hinein. Wenn ich es nicht tue, falle ich früher oder später auf die Nase, und je länger ich die Signale ignoriere, desto schlimmer sind die Folgen. Es ist wichtig, die Balance zwischen inneren und äußeren Einflüssen zu halten.
Warum hatte ich damals nicht hören wollen?
Heute weiß ich, ich war viel zu viel mit mir selbst beschäftigt. Heute weiß ich, dass es vielen so geht. Meine Gedanken kreisten oft um mich selbst, innerhalb meines kleinen Tellerrands. Das nennt man wohl »Egozentrik«. Und die unterscheidet sich von Egoismus oder Egomanie. Der Egomane ist von der Angst durchdrungen, er könnte zu kurz kommen. Er ist nicht selten süchtig nach Anerkennung. Deswegen unternimmt er viel, um aufzufallen, egal, wie. Dem Egoisten fehlen Empathie und Einfühlungsvermögen für die Gefühle anderer. Egozentriker können sehr einfühlsam bei anderen sein, doch in ihrem »inneren Erleben« kreisen sie ständig um sich selbst. Unnötiges Hineinsteigern in Belanglosigkeiten oder die Tendenz zur Hypochondrie sind Ausprägungen dieser Spezies. Aus einer Mücke einen Elefanten machen, sagt der Volksmund. Oder Kritik viel zu sehr persönlich nehmen.
Ich wollte damals stark sein, souverän sein. Heute würde ich sagen, ich wollte stark wirken. Ich wollte nicht stark werden, ich wollte stark sein. Das ist ein großer Unterschied, und es kostet viel Kraft, stark wirken zu wollen, obwohl die Stärke tief im Inneren gar nicht vorhanden ist. Kraft, die der tatsächlichen Findung verlorengeht und auch noch obendrein schlecht investiert ist. Eine Menge Kompensationen – wie zum Beispiel überzogener Ehrgeiz – können dadurch entstehen.
GEFÜHLTE UNGERECHTIGKEIT
Ich stelle in meinen Seminaren meinen Zuhörern immer mal wieder die Frage: »Wenn Sie die Wahl hätten zwischen zwei Tüten. In der einen befindet sich Stärke und in der anderen die Fähigkeit, stark zu werden. Welche Tüte würden Sie wählen?« Oder ein anderes Beispiel: »In der einen Tüte ist ein erfülltes und erfolgreiches Leben. Und in der anderen stecken die Fähigkeiten dafür. Wohin greifen Sie instinktiv?« Oder ganz verwegen: »Welche Tüte willst du haben? Die mit einer Million Euro oder die mit der Fähigkeit, eine Million zu erwirtschaften?«
Die meisten entscheiden sich intuitiv nicht für die Tüte mit den Fähigkeiten, sondern für die Tüte mit dem Ergebnis. Und genau hier liegt es im Argen. Diese Menschen denken, sie sind schon etwas, und wollen nichts mehr werden, nichts mehr lernen. Sie halten sich für besser, als sie sind. Und deswegen haben sie ein Recht auf die jeweils erste Tüte. Und zwar jetzt, sofort. Bloß nicht mehr zuhören und aufnehmen, sondern gleich haben wollen. Denn eigentlich hätten sie mehr verdient. Jetzt! Alles andere ist ungerecht. Doch was steckt dahinter? Es gibt zwei Antworten: die »Selbstwertfalle« und die »Selbstvertrauensfalle«.
Die Selbstwertfalle zeigt sich in einer Überlegenheitsillusion und ist ein weit verbreitetes Phänomen. Es lässt sich sehr einfach verstehen und ist sehr schwer abzustellen. Zum Verständnis eine Frage: Was ist denn einfacher, die Defizite anderer oder die eigenen Defizite erkennen? Die Frage so gestellt, liegt es auf der Hand: Wir wissen, dass wir die Fehler anderer leichter erkennen als unsere eigenen.
Dazu passt folgende Geschichte: Zwei Ehepaare treffen sich zum Kaffeetrinken. Nach zwei Stunden gehen sie auseinander. Über wen wird im Anschluss geredet? Richtig, es wird über das jeweils andere Paar gesprochen. Und wie wird über das andere Paar geredet? Wird darüber geredet, was die anderen so toll machen und was man von ihnen lernen kann? Oder wird darüber gesprochen, wo deren Verbesserungspotential in der Beziehung liegt? Wir kennen die Antwort.
Und warum ist das so? Indem wir andere kleinerreden, fühlen wir uns selbst besser. Unser geringer Selbstwert sorgt dafür, dass wir negativ über andere sprechen, um uns selbst besser zu fühlen. Es entsteht eine Illusion von Überlegenheit, die Überlegenheitsillusion. Deswegen denkt fast jeder, er müsste eigentlich mehr verdienen: mehr Respekt, mehr Wertschätzung, mehr Liebe, mehr Geld. Alles andere wäre ungerecht. Und deswegen wäre es gerecht, mehr zu haben. Jetzt. Und deswegen ist klar, nach welcher Tüte gegriffen wird.
Auch die Selbstvertrauensfalle sorgt für den Griff in die »Jetzt-haben-wollen-Tüte« anstatt in die »Etwas-werden-wollen-Tüte«. Tief im Inneren trauen wir es uns selbst nicht zu. »Was ich hab, das hab ich!« Wir vertrauen nicht darauf, dass wir es mit unseren Fähigkeiten selber schaffen könnten. Deswegen bevorzugen wir das Ergebnis, ohne Anstrengung. Nicht mehr lernen – es bringt ja eh nichts, ich kann ja sowieso nichts machen. Deswegen wollen wir jetzt schon mehr sein und vor allem mehr haben. Hinhören, aufnehmen, lernen könnte ja als ein Zeichen von Schwäche interpretiert werden. Das könnte uns entlarven. Wer lernen muss, weiß ja noch nicht alles! Der ist noch nicht aus-gebildet, nicht komplett, vielleicht noch nicht er-wachsen. Wissen ist Macht, auch wenn es nur vorgetäuscht wird, und gezeigtes Unwissen ist Ohnmacht. Deswegen so tun als ob. »Fake it till you make it«, das machen doch alle …
So tun, als ob wir könnten, als ob wir wüssten, als ob wir alles im Griff hätten. Wir wollen nicht als »Lehrling« dastehen und lernen. Wir wollen als »wissend« dastehen und beweisen, dass wir es wissen. Wir wollen unser Wissen zeigen, wollen nichts mehr aufnehmen, gezeigt bekommen, wir wollen abgeben, unser Wissen präsentieren oder den Schein des Wissenden wahren. Die Fahrtrichtung der Einbahnstraße geht nach außen und nicht nach innen. Der Roll-Laden ist unten und nur in eine Richtung durchlässig.
Schein anstatt Sein! Das muss reichen.
Kinder sind da ganz anders. Sie saugen Wissen und Erfahrungen in sich auf. Sie nehmen die Welt in sich auf, sie staunen, sind verblüfft, überrascht von Neuem oder erschrecken vor Unbekanntem. Das erlauben sich viele Erwachsene nicht mehr: Sie haben Angst davor, als Blöde, Unwissende und damit scheinbar Schwache dazustehen.
Mir wurde diese Haltung öfters vorgeworfen. Weil ich offen war, lernen wollte und dazu noch in einem Rollstuhl sitze, wurde ich von vielen unterschätzt. Sie dachten, sie hätten mich im Griff. Sie wären mir überlegen. Und ich blieb ruhig und lernte weiter. Schließlich wurden meine Ergebnisse immer besser, und ich überholte einen nach dem anderen. Von den »Überlegenheitsillusionisten« wurde mir Scheinheiligkeit unterstellt. Der Volksmund kennt einen anderen Blickwinkel: Der Klügere gibt nach. Den Instinkt, mich kleinzumachen, habe ich für bestimmte Situationen beibehalten. Es ist interessant, wie viele selbst heute noch die Einladung annehmen, sich mir überlegen zu fühlen.
»Hör mal!«, hieß es als Kind: Achtung, es kommt eine Unterweisung, wie etwas geht beziehungsweise wie es nicht geht. Hören und zuhören wird oft damit assoziiert, dass wir in einer unterlegenen Position sind. Wir drängen uns plötzlich selbst in eine Kinderrolle, obwohl wir den Kinderschuhen längst entwachsen sein wollen, und erleben unser Gegenüber als einen maßregelnden, Recht habenden, überlegenen Erwachsenen, obwohl wir uns vielleicht gerade in einer gleichberechtigten Situation befinden.
Das große Missverständnis lautet: Ich bin nicht stark, wenn ich hören (und lernen) muss. Der Unwissende wird wie ein Kind vom Wissenden nicht ernstgenommen. Der Wissende ist der vermeintlich bessere Mensch. In den Köpfen der Menschen ist der Wissende oder derjenige, der sein Wissen zeigt oder im Zweifelsfall so tut, als würde er wissen, fast automatisch der Stärkere, der Überlegene. Er kann dominieren. Und das ist es, was viele wollen: dominieren, sich durchsetzen.
DAS OHR IST DER WEG
Hören, aufnehmen löst in den Köpfen vieler Menschen eine unterlegende Position aus. Hinhören und aufnehmen sind für viele Menschen gleichbedeutend mit Noch-lernen-müssen, und das heißt: nicht wissen. Wenn sie sich erlauben würden zu hören, würden sie damit zeigen, dass sie unwissend sind. Deswegen wollen sie nur verstehen, wenn sie mit dem Gehörten auch einverstanden sind. Sie fühlen sich nicht perfekt, weil sie eine Wissenslücke zu stopfen haben. Und das will keiner zeigen – weder sich selbst noch anderen gegenüber. Und so wird in der Konsequenz weggehört: »Weiß ich!« »Kenn ich!!« »Ich weiß Bescheid!«
Tiefes Lernen-Wollen heißt verstehen, aufnehmen, verarbeiten und umsetzen wollen. Und um tief zu verstehen, muss ich hören und die Welt in mich aufnehmen, sie hineinlassen. Zuerst in meinen Kopf aufnehmen, intellektuell. Und dann durch Erfahrungen in mein ganzes Wesen aufnehmen, emotional. Immer wieder, jeden Tag aufs Neue. Das zur Kenntnis nehmen, was tatsächlich da ist. Den Mut haben, der Wahrheit ins Gesicht zu sehen, und anerkennen, was da ist. In mir und um mich herum. Und das geht nur, wenn ich beim Verstehen-Wollen innerlich so stark bin, dass ich nicht einverstanden sein muss.
Für mich ist deswegen der Hörsinn im Lauf der Zeit immer mehr zur Metapher für eine Lebensphilosophie geworden. »Das Auge führt den Menschen in die Welt, das Ohr führt die Welt in den Menschen«, bemerkte bereits der Naturforscher Lorenz Oken. »Das Ohr ist der Weg«, heißt es sogar in den philosophischen Schriften der Upanischaden. Und bei Jesaja 55,3 in der Bibel: »Höret, so wird eure Seele leben …«
In der Zivilisation, in der wir heute leben, hören wir zu wenig bewusst hin und nehmen zu wenig vorurteilsfrei auf. Unsere Sehwahrnehmungen und damit unsere Verurteilungsqualität sind über- und unsere Hörwahrnehmungen unterproportioniert. Bei einer Umfrage des Emnid-Instituts in Bielefeld antworteten auf die Frage, welcher unserer Sinne für die Befragten persönlich der wichtigste sei, 87 Prozent der bundesdeutschen Bevölkerung mit dem Wort »sehen«.
Demgegenüber weisen Ärzte und Physiologen darauf hin, dass der Sinn, der uns eigentlich mit unseren Mitmenschen und damit der Welt verbindet, der Hörsinn ist. Das ist allein schon deshalb so, weil wir durch den Hörsinn unser wichtigstes Kommunikationsmedium aufnehmen: die Sprache.
Dazu kommt: Es ist zwischenzeitlich wissenschaftlich erwiesen, dass tiefe Gefühle wesentlich besser über den Hörkanal ausgelöst werden als über den visuellen. Denken Sie nur daran, welche Gefühle durch Musik erzeugt werden können, wenn wir plötzlich im Autoradio den Song hören, der die Background-Musik zu unserem ersten Kuss geliefert hat. Die emotionale Wirkung von Klängen hat auch einen entwicklungsgeschichtlichen Hintergrund.
Oftmals wird die Bedeutung des eigenen Hörens unterschätzt. Wenn man beim Schauen eines Films den Ton sehr leise stellt, merkt man schnell, dass emotional entscheidende Informationen fehlen und der Film sofort an Ausdruck, an Kraft, an Lebendigkeit verliert.
DIE FÄHIGKEIT ZU DIFFERENZIEREN
Differenziertes Hören ist ein wesentliches Element der Bereicherung des Menschen. Über unseren Hörsinn erfassen wir Sprache und Stimmungen, werden wir in die Lage versetzt, mit anderen Menschen zu kommunizieren, können uns aber auch in Raum und Zeit orientieren. Des Weiteren dient das Hörvermögen der Abwendung von Gefahren: Ursprünglich waren das beispielsweise Raubtiere, heute ist es hauptsächlich der Straßenverkehr. Und völlig anders als die Augen nehmen die Ohren auch noch im Schlaf Alarmsignale wahr.
Das Gehör wirkt direkt ein auf Stimmungen. Entsprechend emotional gefärbt ist das Hören für die meisten Menschen. Akustische Reize haben beim Empfänger eine starke emotionale Wirkung und bestimmen unser Verhalten. Ein Musikstück kann zu Tränen rühren. Sanfte Stimmen wirken beruhigend, während hartnäckiges Schnarchen einen zur Weißglut treiben kann. Die Werbung hat sich die emotionale Bedeutung des Tons längst zu Nutze gemacht: »Sounddesigner« arbeiten daran, etwa Rasierapparate so zu konstruieren, dass sie besonders kraftvoll und leistungsstark klingen. Chips oder Cornflakes werden mit Stoffen versetzt, die ein knuspriges Krachen im Mund erzeugen. Das Ohr isst mit. Vom Sounddesign beim Sportwagen ganz zu schweigen …
Der Hörsinn ist von allen fünf Sinnen der differenzierteste. Das Ohr differenziert um das Zehnfache präziser als das Auge. Das ist leicht zu verstehen: Wenn Rot und Grün vermischt werden, entsteht Gelb. Kommt noch Blau hinzu, entsteht Weiß. Wenn eine Klarinette und eine Oboe sich mischen, kann das Ohr sie noch immer auseinanderhalten. Das gilt auch für ein ganzes Orchester.
Das Wort »aufhören« beschreibt ein echtes Ende: Schluss, aus, vorbei! Das Wort »versehen« beschreibt das Ende einer Täuschung.
Differenzierungsqualität, vor allem mental, ist ein sehr wichtiger Faktor zur besseren Orientierung in der heutigen Zeit. Der Hörsinn ist sensibler, genauer und auch leistungsfähiger als das Auge. So werden Worte wesentlich schneller verarbeitet als Bilder. In derselben Zeit, in der ein Bild vom Gehirn verarbeitet wird, können zirka sechs bis acht Worte verarbeitet werden. Im Vergleich zum Sehsinn kann das Gehör zwei kurz aufeinanderfolgende Signale relativ gut voneinander unterscheiden. Der Mensch kann bis zu zwanzig Signale pro Sekunde als einzelne Tonereignisse, die voneinander getrennt sind, wahrnehmen. Danach erst verschwimmen diese zu einem einzigen Ton, der die tiefste hörbare Frequenz darstellt. Das Ohr des Menschen nimmt Frequenzen zwischen 16 und 20 000 Hertz wahr und macht es möglich, bis zu vierhunderttausend Töne zu unterscheiden – und sogar die Richtung, aus der sie kommen.
Doch die Reaktion auf Bilder ist schneller. Wenn wir genau hinhören, entstehen Handlungsimpulse langsamer. Wenn wir mit den Augen auf die Jagd gehen, kommen Handlungsimpulse schneller.
Lange fragte man sich in wissenschaftlichen Kreisen, wie es möglich ist, dass wir in lauten Umgebungen bestimmte Geräusche und Stimmen willentlich heraushören können. Forscher haben 2013 herausgefunden, wie genau sich unser Gehirn bei bestimmten Hörsituationen verhält. Menschen, die sich auf einer lauten Party mit einem Gesprächspartner unterhalten, können dessen Stimme allein durch Konzentration auf diese hören. Die Stimmen umstehender Personen werden zwar durch Teile des Hörzentrums wahrgenommen, doch durch die Konzentration auf die Stimme des Gesprächspartners können die anderen gehörten Stimmen erfolgreich ignoriert werden.
Der Hörsinn ermöglicht uns eine Bandbreite von Wahrnehmungsmöglichkeiten. Er hilft uns dabei, Geräusche, Töne und Stimmen zu erkennen und daraus passende Reaktionen abzuleiten. Eine der für uns Menschen wichtigsten Funktionen besteht in der Möglichkeit der Kommunikation, mit anderen und mit uns selbst. Der Hörsinn ist der einzige Sinn, welcher die Kommunikationsqualität mit uns selbst aufnehmen und erforschen kann. Das Ohr führt nicht nur die Welt in den Menschen, sondern auch den Menschen zu sich selbst. Zu seinem Kern. Zu seinem Wesen. Zu seiner Bestimmung, seiner Berufung, seinem Lebenssinn. Beides hängt für mich zusammen. Denn: Wer die Welt in sich aufnimmt, erlernt die Lebensgesetze (das Leben). Und erhält im zweiten Schritt dadurch eben auch Erkenntnisse über sein Leben.