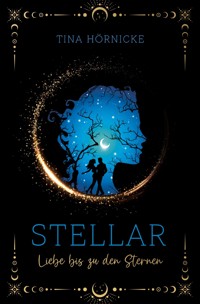
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
WAS, WENN LIEBE ZUR GEFAHR WIRD? Nach Schottland zu ziehen war nie der Plan. Doch mit 17 hat man keine Wahl. Sanny hängt fest – im winzigsten Kaff ever. Einziger Trost: Dort leuchten ihre geliebten Sterne hell wie nie. Doch dort lauert auch die Gefahr. Noch ahnt sie nichts von der Verbindung zwischen beidem, als eine Kette mysteriöser Vorfälle sie ereilt: rätselhafte Schemen, donnerlose Blitze und ein Überfall in der Nacht. – Was wollen die finsteren Vermummten von ihr, die ihr ein unlösbares Ultimatum stellen? Und was hat ihr Mitschüler, der attraktive Tänzer Darius, damit zu tun, der stets wie aus dem Nichts auftaucht, sobald Sonderbares vor sich geht? Sanny ist fest entschlossen, seinem Geheimnis auf die Spur zu kommen. Nur dass in seiner Nähe auch ihr Herz höherschlägt … EINE SAGA ÜBER STERNE UND MAGIE, TIEFEMPFUNDENE TRÄUME UND EINE VERZWEIFELTE LIEBE, EINGEBETTET IN DIE ZAUBERHAFTE SZENERIE SCHOTTLANDS - Romantasy zum Verlieben -
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 509
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Table of Contents
Titel & Autor
Titelseite
Widmung
Widmung 2
Prolog
Kapitel 1 - Blitz und Schatten
Kapitel 2 - Auf Krawall gebürstet
Kapitel 3 - Ausgeknockt!
Kapitel 4 - It’s Gonna Be Magic
Kapitel 5 - Tacheles
Kapitel 6 - Gefährliche Kräfte
Kapitel 7 - Gefühlschaos
Kapitel 8 - Blick in die Vergangenheit
Kapitel 9 - Fly Me To The Moon
Kapitel 10 - Die Gesetze der Magie
Kapitel 11 - Nachts im Museum
Kapitel 12 - Im Splitterregen
Kapitel 13 - Unsichtbare Wunden
Kapitel 14 - The Ties That Bind Us
Kapitel 15 - Vor dem Sturm
Kapitel 16 - Im Herz des Waldes
Kapitel 17 - Die Falle schnappt zu
Kapitel 18 - Sonnennächster Punkt
Kapitel 19 - Im Sog der Sterne
Kapitel 20 - Die Macht des Mondes
Kapitel 21 - Nachbeben
Kapitel 22 - Geklebte Scherben
Epilog
Mehr erfahren / Infos über neue Bücher / Rezensionen / Newsletter
Über die Autorin
Danksagung
Impressum
Tina Hörnicke
Stellar - Liebe bis zu den Sternen
Hört nie auf zu träumen
und euch werden Flügel wachsen
Für Mutti
Ich hoffe, das erreicht Dich
auf Deiner Wolke hinterm Regenbogen
Etwas flimmerte um mich herum. Hell. Dunkel. Hell … Und auch die Farben veränderten sich.
War ich vorm Fernseher eingeschlafen? Das wäre nicht das erste Mal, und die Melodie, die sanft unter die Bilder gelegt war, stützte diese Theorie. Aber das war es nicht.
Ich blinzelte. Kein Fernseher. Auch kein Wohnzimmer. Nur Dunkelheit und dazwischen immer wieder Spuren schillernden Lichts. Wie Vorhänge, die gegeneinandergeweht wurden und sich doch nur sacht berührten. Eine zarte Liebkosung, ein Streicheln. Mit ihren Perlmutttönen erinnerten sie an Nordlichter in Grün und Blau. Wie der Schimmer einer Muschel oder die Schuppen einer Meerjungfrau.
Und ich stand mitten dazwischen.
Die Lichter waren überall, bildeten einen Ozean aus Glanz in der Finsternis, der sich wellenartig in weichen Strömungen durch das Dunkel um mich herumwand. Ein Flüstern säuselte durch die Luft, zu leise, um die Worte zu verstehen. Trotzdem kam es mir vor, als riefe jemand nach mir.
Ich zögerte. Aber ich träumte doch, oder? – Dann konnte mir wohl nichts passieren. Langsam griff ich nach einem der Vorhänge und schob ihn vorsichtig beiseite. Er war ein Hauch von Nichts, löste sich aber auch nicht bei bloßer Berührung auf, wie ich halb befürchtet hatte.
Dahinter betrat ich eine zweite Welt, ebenso dunkel und funkelnd wie die erste. Nur dass die Lichter hier noch farbenfroher leuchteten. Mal erschienen sie als runde Glitzerpunkte, mal bildeten sie Trichter oder Spiralen; und sie alle waren in ständiger Bewegung.
Mir stockte der Atem und meine Nackenhaare richteten sich auf, eins nach dem anderen: Ich befand mich in einem Abbild des Universums. Die Spiralen waren Galaxien oder kosmische Nebel, die Glitzerpunkte Milliarden und Abermilliarden von Sternen. Es war das Universum ohne die Erde als Trennscheibe dazwischen. Keine Atmosphäre, keine Entfernungen. Nur Licht und Dunkelheit in ihrer ganzen vollkommenen Pracht.
Ich wollte einen Blick über die Schulter werfen, da hörte ich wieder das Flüstern. Aber es war kein Flüstern mehr. Eine vollklingende, fast singende Stimme rief klar und deutlich meinen Namen: „Sanny … o Sanny, komm zurück zu uns! Wir haben dich so vermisst.“
Mama!, war mein erster Gedanke.
Mein Herz übersprang einen Schlag und zog sich sehnsuchtsvoll zusammen. Dann schlug es umso schneller weiter. Doch obwohl die Stimme mich an die meiner Mutter erinnerte, war es doch nicht ihre. Es war auch nicht die einer einzelnen Person, sondern ein Kollektiv, das wie aus einem Munde gesprochen hatte.
Ich schluckte die aufkommende Enttäuschung herunter und schaute mich nervös um, aber es war niemand zu sehen. Unter mir, über mir, um mich herum waren nichts als Sterne, Asteroidengürtel, Nebel und Planeten, mal schwächer, mal stärker leuchtend. Auch der Vorhang hinter mir war verschwunden.
Es gab keinen Weg zurück.
Ich räusperte mich. „Was … wer seid ihr?“, fragte ich ins Nichts hinein. Leiser, wispernd beinahe, fügte ich hinzu: „Und wer bin ich?“
Ein neuerlicher Schauder kroch über meinen Rücken. Die Antwort schien mir wichtig – das entscheidende Teil in einem Puzzle, das ich noch nicht verstand.
Ich dachte schon, ich würde gar keine Antwort mehr erhalten, als noch einmal leise die sanfte, weibliche Stimme ertönte. Sie kam so sehr aus dem Off, dass es schien, als spräche das All selbst zu mir, was mir noch mehr unter die Haut ging. „Du bist ein Kind der Sterne. Habe Mut und Vertrauen. Dann wirst du deinen Weg finden.“
Äh? Was? Einige Wimpernschläge war ich unfähig, Worte zu formen. „Und … was soll das für ein Weg sein?“, fragte ich dann doch in die Unendlichkeit hinein.
Aber dieses Mal reagierte niemand. Der Traum war so plötzlich vorbei, wie er begonnen hatte. Nach dem Aufwachen verschwamm er zwar, aber seine Essenz hatte sich klar in meine Erinnerung eingeprägt und ließ mich zutiefst verwirrt zurück. Es hatte sich nicht angefühlt wie ein Traum. Aber das war es doch gewesen, oder?
Eine blöde Idee, so kurz vor dem Abi umzuziehen und die Schule zu wechseln? – Yep. Aber an so was hat Papas Personalchef wohl nicht gedacht, als er ihm vor sechs Monaten eine betriebsbedingte Kündigung auf den Schreibtisch geknallt hat. Und auch nicht der nette Berater vom Arbeitsamt, der ihm damit gedroht hat, die Bezüge zu streichen, wenn er sich nicht überregional bewirbt. Pah – überregional. Tatsächlich hatte es uns ins Ausland verschlagen, mitten nach Schottland, in das verträumteste Nest, das ich jemals gesehen hatte.
„Erde an Sanny! Meine Mom bringt mich um, wenn ich schon wieder den Bus verpasse.“ Die ungeduldige Stimme und das dazugehörige Zerren an meiner Schulter gehörten zu Rhea, der quirligen, zarten Halbkoreanerin, die mich an meinem zweiten Tag an der Dunly High School unter ihre Fittiche genommen hatte und mir seitdem nicht von der Seite wich. Kaum zu glauben, dass das schon drei Monate her war. „Hey! Jemand zu Hause?“ Sie wedelte theatralisch mit der Hand vor meinem Gesicht herum. „Träumen kannst du später noch, jetzt komm endlich!“
Erwischt! Zu Tagträumen neigte ich wirklich. Schnell stopfte ich mein Handy zurück in meine Schultasche. Samt Sophias letzter Textnachricht, die mich gedanklich hatte abdriften lassen. Und doch war da dieser sehnsüchtige Stich. Seit ich Sophia in Frankfurt hatte zurücklassen müssen, schrieben und telefonierten wir zwar täglich, aber das war einfach nicht dasselbe. Ich vermisste es, mit ihr am Mainufer entlangzuschlendern und die Kinos unsicher zu machen. Sie war die einzige Freundin, die nach Mamas Tod noch zu mir durchgedrungen war. Alle anderen hatte ich abgeblockt und in die Flucht geschlagen.
Ungeduldig zog Rhea mich auf den Schulhof hinunter. Wir hüpften so schnell über die Stufen, dass meine straßenköterblonden Locken bei jedem Schritt mitwippten.
Dass ich Rhea gefunden hatte – oder eher sie mich –, war eine Fügung des Schicksals gewesen. Sie hatte mich mit ihrer herzlichen Unnachgiebigkeit überrollt und sich partout geweigert, sich abwimmeln zu lassen. Zum Glück. Denn seither briefte sie mich über die Macken der Lehrer, half mir, die Massen an Stoff nachzuarbeiten, die in Deutschland nicht auf dem Lehrplan standen (Hilfe! Ich hätte heulen können, vor allem bei Chemie), und sie lenkte mich von meinem Kulturschock ab. Ich hatte in der Stadt gelebt, solange ich denken konnte, und nun war ich auf einmal irgendwo im Nirgendwo. Hier gab es zwar nicht nur Moore, alte Gemäuer und diese lilafarbenen Disteln, die sich wie Teppiche über die Wiesen zogen, sondern auch unzählige Seen, und in ein, zwei Stunden war sogar die Küste zu erreichen, aber ich befand mich dennoch in einer völlig anderen Welt, in der ich mir oft genug wie ein Fremdkörper vorkam.
Ich beschleunigte meine Schritte. Der Bus war bereits hinter dem Schulzaun aufgetaucht und kam ruckartig mit quietschenden Reifen zum Stehen. Dan, der schnauzbärtige Busfahrer, neigte manchmal zu Dramatik. Ich vermutete ja, dass sein Herz am rechten Fleck saß, aber Zuspätkommern gegenüber zeigte der mürrische Glatzkopf keine Gnade. Wir waren gerade aus dem Tor gehechtet, da setzten sich die Reifen genauso quietschend wieder in Bewegung und ließen uns nur die Aussicht auf die sich entfernenden Rücklichter.
„Mist, Mist, Mist – Au!“ Rhea stampfte mit dem Fuß auf – und rieb sich anschließend den Knöchel. Während ich direkt in Dunly wohnte und mehr Rhea zuliebe den Bus nahm als aus wirklicher Notwendigkeit, ersparte sie sich mit der Fahrt einen etwa halbstündigen Fußmarsch ins Nachbardorf. Ihr Blick flog zu ihrer Armbanduhr. „Wenn ich renne, bin ich vielleicht noch halbwegs pünktlich.“ Noch im Reden war sie in einen ambitionierten Sprint verfallen, lädierter Fuß hin oder her. Sie wurde auch dann nicht langsamer, als sie mir über die Schulter zurief: „Wir sehen uns nachher. Vergiss die Nachos nicht.“
Seit unserer ersten Woche hatte es sich eingebürgert, dass Rhea und ich jeden Freitag einen Filmeabend machten. Und zwar immer bei ihr, da ihre Mutter freitags zum Bowling fuhr und wir damit freie Bahn zum hemmungslosen Kichern, Heulen und Herumalbern hatten. Als Ausgleich dafür, dass wir Rheas Getränke- und Taschentücher-Vorrat plünderten, sorgte ich für den Knabberkram. Und da ich tatsächlich noch nichts gekauft hatte, machte ich mich direkt auf den Weg zum Superm… äh, ich meinte: Dorfladen. Ich musste mich noch immer daran gewöhnen, dass in dieser Kleinstadt die Geschäfte freitags schon um 14 Uhr schlossen. Klingt nach Hintertupfingen? – Schlimmer! Dunly war einfach winzig. Inzwischen war es 13.53 Uhr und ich musste mich sputen.
Ich joggte über die kopfsteingepflasterte Straße, vorbei am Juwelier an der Ecke und den typischen grauen Sandsteinhäusern, die sich hier dicht aneinanderdrängten. Dann durchquerte ich den kleinen Park und lief an der Burgruine entlang, der Dunly seinen Namen verdankte. Auf der anderen Straßenseite sah ich, wie die Kassiererin den Schlüssel hochhielt, um die Ladentür von innen abzusperren, und erhöhte mein Schritttempo zusehends. Also ehrlich, da schlossen sie schon so früh und dann auch noch eher dichtmachen? Komm schon, Ampel, spring um! Rot, Rot, Rot – Grün. Jetzt musste ich noch mal einen Zahn zulegen.
Da sah ich aus dem Augenwinkel auf einmal etwas aufblitzen. Aus Richtung der Ruine. Nicht wie das Aufblitzen einer Armbanduhr in der Sonne. Nein, einen richtigen, verästelten, gewaltigen Blitz, der die Luft zum Knistern brachte und so sehr blendete, dass er flackernde Flecken in meinem Sichtfeld hinterließ, so als hätte ich zu lange in die Sonne gestarrt. Eine seltsame Spannung erfüllte die Luft und es roch eigenartig, auch wenn ich nicht darauf kam, wonach genau. – Und war das da etwa ein … ein Schatten?
Mein Herzschlag stockte. Ich blieb mitten auf der Straße stehen. Und blinzelte. Eindeutig, an der Seite des Turms lehnte eine dunkle Gestalt. Ich blinzelte noch einmal – und sie war verschwunden. Aber … Wo ist er hin?
Mein Herz schlug weiter – und bummerte wie verrückt. Ein fernes Motorengeräusch riss mich aus meiner Starre. Schnell lief ich weiter, bevor ich noch überfahren wurde.
Ich musste mir das eingebildet haben. Die Sonne schien. Es war kein Wölkchen am Himmel. Es konnte kein Sommergewitter in der Nähe sein. Aber das musste es doch gewesen sein, oder? – Ein Sommergewitter.
Doch was war mit dem Schatten?
Hinter der halb verglasten Tür des kleinen Ladens hatte mir die Verkäuferin bereits den Rücken zugewandt, aber ich konnte mich nicht darauf konzentrieren. Dieser Blitz war mir durch Mark und Bein gefahren. Alles um mich herum schien für eine Sekunde zum Stillstand gekommen zu sein. Und in der Luft lag etwas … etwas Sonderbares. Ein ganz merkwürdiges Gefühl, als sei etwas nicht richtig, nicht … real.
Ich prallte mit dem Kopf fast gegen die Scheibe und klopfte geistesabwesend dagegen. Eine Sekunde hatte ich vergessen, dass sich auch die Türen hier nicht automatisch öffneten wie bei einem klassischen Supermarkt. Anstatt mich jedoch zu ärgern, glitt mein Blick noch mal auf die andere Straßenseite, zu Dunly Castle. Mir schauderte, aber ich wusste nicht, warum.
Halb von einer Baumgruppe verdeckt zeichnete sich die wuchtige Fassade der Burg vor dem hellblauen Himmel ab. Menschenleer und verlassen. Nichts als Stein, umgeben vom Grün der Bäume. Und doch huschte mein Blick unruhig über den vierstöckigen Palas und den daran angrenzenden Turm, denen beiden das Dach fehlte. Und über die schmalen Fensteröffnungen, die mich zu beobachten schienen, als wären es riesige, schwarze Augen. Doch da war nichts. Kein Blitz, kein Schatten. Das leise Rascheln von ein paar Ästen, die sich im Wind wiegten, ja. Aber sonst nichts.
„Wir schließen. Wollten Sie noch was?“ Die rundliche Verkäuferin musterte mich verwundert, als ich erschrocken zu ihr herumfuhr. Ich war so gebannt gewesen, dass ich gar nicht gehört hatte, wie sie neben mich getreten war.
„Haben Sie das gesehen?“, fragte ich tonlos und wandte mich erneut dem Castle zu. „Den Blitz?“
Sie schenkte mir einen schiefen Blick. „Hier hat’s seit Wochen nicht gewittert. Und ich will mich weiß Gott nicht beklagen. Zwei Wochen Sonnenschein am Stück, das kriegt man hier nicht oft.“
„Hm“, machte ich nachdenklich. Die Verkäuferin ließ sich noch weiter über das ungewöhnlich warme und trockene Wetter aus, doch ich hörte gar nicht richtig hin. Meine Gedanken drehten sich immer noch um das, was ich soeben beobachtet hatte. Oder beobachtet zu haben glaubte.
„Kann ich denn was für Sie tun?“ Die ältere Dame neigte besorgt den Kopf, zog aber den Ladenschlüssel aus ihrer Hosentasche. Erst jetzt bemerkte ich, dass im Ladeninneren das Licht bereits gelöscht war.
„Äh …“, murmelte ich ertappt. Hitze schoss mir in die Wangen. „Tut mir leid, aber … haben Sie noch Nachos? – Und Chips?“
Mit einem nachsichtigen Lächeln verschwand sie zwischen den Regalen. Wieder schwenkte mein Blick zurück zur Burg. Doch dort blieb alles ruhig. Und auch als ich fünf Minuten später mit meinen Einkäufen zurück auf die Straße trat, blieb die Gestalt verschwunden. Wie ein Geist, der in Luft verpufft war. Aber ich hatte mir das doch nicht nur eingebildet. Sie, ER, war da gewesen. Ein Mann ganz in Schwarz, der lässig an der Burgfassade gelehnt hatte.
Die zwei Knabbertüten in meiner rechten Hand, meine Schultasche locker über der linken Schulter streifte ich über das Burggelände, um Spuren zu suchen. Der Bereich unmittelbar um die eigentliche Ruine war von einem eisernen Zaun umringt und nicht öffentlich zugänglich, doch jedes andere Fleckchen inspizierte ich genau, bog Grashalme auseinander, streckte mich, um in verwinkelte Ecken zu spähen. Doch auch nach mehreren Rundgängen fand ich nichts Ungewöhnliches. Keine weiteren Blitze, keine geschwärzten Stellen im Gemäuer oder auf dem Rasen, kein Brandgeruch, keine gespaltenen Baumstämme oder auch nur versengten Äste.
Auch den Park durchkämmte ich, aber ich konnte einfach nichts entdecken. Das Areal rund um Dunly Castle war und blieb verlassen. Wenn hier wirklich jemand gewesen war, war er längst fort.
„Du halluzinierst, Fredrich.“ Kopfschüttelnd ließ ich mich auf einem moosbewachsenen Stück Mauer nieder, das früher zur Befestigungsanlage der Burg gehört haben musste, mir aber kaum noch bis zum Knie reichte. Allen Indizien zum Trotz rann ein unheilvolles Kribbeln vom unteren Ansatz meiner Wirbelsäule bis in meinen Nacken. Mir kam es noch immer vor, als würde etwas in der Luft liegen. Etwas Angsteinflößendes. Als gäbe es hier eine Präsenz, die mich beobachtete, mir auflauerte. Mir war die ganze Zeit, als könnte ich ihre kühlen Blicke auf mir spüren. Dieses ungute Gefühl begleitete mich den gesamten Weg nach Hause und sollte mich auch den Rest des Tages nicht mehr loslassen.
Als ich den Schlüssel im Schloss drehte, war Papa noch nicht da, aber daran war ich mittlerweile gewöhnt. Die Verpackungsmittelfabrik, in der er arbeitete, war so chronisch unterbesetzt, dass er regelmäßig Doppelschichten schob und meist erst am späteren Abend hier aufschlug. Trotzdem hätte ich ihn gern hiergehabt. Vielleicht wäre ihm ja eine plausible Erklärung für meine mysteriöse Beobachtung eingefallen.
So aber kam mir das Haus – ein typischer, hellgrauer Sandsteinbau mit Erkern und weiß gestrichenen Sprossenfenstern – kühl und fast ein wenig abweisend vor. Es gehörte der Schwester meiner Mama, Tante Margie, die es wiederum von meinen Großeltern geerbt hatte. Meine Oma war Schottin gewesen, mein Opa Amerikaner. Dementsprechend war ich als Kind schon einmal hier gewesen. Aber das war so lange her, dass ich mich nur noch verschwommen an die grünen Hügel des Glen Ghrian erinnern konnte, die das Tal säumten, in dessen Senke Dunly lag. Und an den Japaner am Loch Ness mit der Seeungeheuer-Mütze aus grünem Plüsch auf dem Kopf.
Da Tante Margie den Großteil des Jahres auf Dienstreise war, hatte sie uns das Haus günstig zur Miete überlassen, nachdem sie Papa schon bei der Jobsuche unter die Arme gegriffen hatte. Im Gegenzug hielten wir alles in Schuss und pflegten den Garten.
Ich bahnte mir einen Weg in die Küche, vorbei an den letzten Umzugskartons, die unausgepackt den Flur bevölkerten. Obwohl wir nun schon seit Monaten hier lebten, war da immer noch ein Gefühl von Vorläufigkeit, als schwebte ich in einem Zwischenzustand. Nicht fremd, aber auch nicht zu Hause. Nicht ganz Deutsche, aber auch keine echte Schottin.
Zum wiederholten Mal fragte ich mich: Wo gehörte ich eigentlich hin?
Verbissen ignorierte ich die Enge in der Magengegend, welche diese Frage stets begleitete, und flüchtete mich in meine Schulbücher. Ich hatte einen ganzen Stapel Hausaufgaben vor mir – und fing besser damit an, wenn ich die alle schaffen wollte. Es musste gut in der Schule laufen, wenn Papa sich keine Sorgen um mich machen sollte. Und das sollte er auf keinen Fall! Schlimm genug, dass er mitbekommen hatte, dass ich am liebsten bei Oma und Opa in Frankfurt geblieben wäre. Aber natürlich hätte ich Papa nie alleingelassen. Beide Optionen waren scheiße gewesen – Pest und Cholera.
Also brütete ich über meinen Büchern, doch meine Gedanken schweiften immer wieder ab. Plötzlich ging ein Ruck durch mich hindurch. Ich setzte mich kerzengerade auf: Könnte es ein Geist gewesen sein? – Dieser Schatten, beim Castle? Würde doch passen, in der Nähe einer Burg! … Aber – ein Geist, am helllichten Tag? – Neee, eher nicht.
Doch was konnte es dann gewesen sein?
„Ähm, Sanny, alles klar?“
Ich fuhr zusammen und brauchte eine Sekunde, bis ich Rhea gewahr wurde, die mich mit Sorgenfältchen musterte. Ihre zierlichen Schultern wurden gerahmt vom hölzernen Eingangsbereich ihres schnuckeligen Elternhauses und das einsetzende Klimpern des Windspiels an der Decke holte mich endgültig ins Hier und Jetzt zurück.
„Sorry, ich war gerade irgendwie abgelenkt.“
„Ach, wär’ mir gar nicht aufgefallen!“ Rhea hob ironisch eine Augenbraue. Dann zog sie mich ins Haus und in eine kurze Umarmung. „Ist echt alles okay?“
„Klar“, platzte ich eine Spur zu schnell und laut heraus, aber entweder bemerkte Rhea das nicht oder sie beschloss, darüber hinwegzugehen. Auch jetzt am Abend spukten mir die Ereignisse des Nachmittags noch immer im Kopf herum, Gespenster oder nicht. Was hatte es nur damit auf sich? Oder war es doch nur meine Fantasie, die mir Streiche spielte?
Bevor ich wieder abdriften konnte, drückte ich Rhea die schwer erkämpften Knabbereien in die Hand und folgte ihr ins Untergeschoss, das sie als kleine Wohnung quasi für sich hatte, mit Schlafzimmer, Gäste-WC und einer Kammer, die sie als Nähzimmer nutzte.
Im Wohnzimmer, wo schon alles für einen gemütlichen Fernsehabend vorbereitet war, ließ ich mich auf die Couch plumpsen. „Sag mal, gibt’s hier eigentlich öfter Wetterleuchten oder so?“
„Wetterleuchten?“ Rhea, im Schneidersitz auf ihrem Lieblingssessel, runzelte die Stirn.
„Na ja, Blitz und Donner, nur ohne Regen. – Und ohne Donner.“
„Süße, ich weiß, was Wetterleuchten ist, aber wie kommst du jetzt da drauf?“
„Ich dachte nur, ich hätte vorhin einen Blitz gesehen. In der Stadt, beim Castle …“
Rhea drückte den Zeigefinger gegen ihre Unterlippe und legte den Kopf schief. „Also, hier war nichts. Kein Gewitter weit und breit. War’s vielleicht ein Blitzer?“
„Hm.“ Das überzeugte mich kein Stück, aber welche andere Erklärung konnte es geben? Ich tippte mir nachdenklich gegen das Kinn und machte den Mund auf, um Rhea von dem Schemen zu erzählen, aber da hielt sie mir plötzlich etwas vor die Nase, das sie sich mit flinken Fingern vom Sideboard geangelt hatte.
„Na, was sagst du? Hast du Lust?“ Rheas dunkle Augen leuchteten. Das Etwas in ihrer Hand entpuppte sich als hölzerne Schatulle mit glänzendem Cover. Es zeigte eine Spirale, zusammengesetzt aus bunten Mosaiksteinchen. Darunter stand: The Art of Tarot.
„Ist das neu?“ Bewundernd strich ich über den wunderschön gestalteten Deckel. Rhea hatte ein Faible für Tarotkarten, aber dieses Deck hatte ich noch nie bei ihr gesehen. Seit Wochen übte sie in den Schulpausen die Bedeutungen der einzelnen Karten. Dafür diente ihr sonst allerdings ein abgegriffenes Set ihrer Oma, das nicht mehr ganz vollständig war.
Rhea strahlte mich an und trommelte die Fingerspitzen gegeneinander. „Geschenk von Granny. Mega, oder? – Wollen wir?“
Wäre ich nicht sowieso neugierig gewesen, hätte ich allein wegen ihres hoffnungsvollen Hundeblicks kaum Nein sagen können. „Und wie funktioniert das?“
„Ich mische – du ziehst.“ Schon hatte Rhea mir das Kästchen aus der Hand geschnappt und hielt mir kurz darauf den Stapel hin. „Wir brauchen zwei davon.“
Fasziniert beobachtete ich, wie Rhea die gezogenen Karten mit dem Rücken nach oben vor mir ablegte, eine links, eine rechts. Ich war mir nicht sicher, ob ich wirklich an die Kraft des Tarots glaubte, aber ich wollte mich auch nicht davor verschließen.
„Es gibt mehr, als das Auge sieht“, hatte Mama immer wieder zu mir gesagt und mir dabei eines ihrer warmen Halbmondlächeln geschenkt.
Mit aller Macht drängte ich die Wehmut zurück, die brennend in mir aufstieg, und hörte Rhea zu.
„Die erste Karte steht für das Jetzt. Aber bevor wir nachsehen, was sie zeigt, müssen wir noch festlegen, ob sie den Ist-Zustand markiert, also deine Ausgangslage, oder etwas, das es im Augenblick zu vermeiden gilt.“
„Dann das Ist.“ Meiden klang nach Problemen. Die wollte ich lieber – ähm … meiden. Ich setzte mich gerader in den Polstern auf. „Und?“
Rhea drehte die erste Karte um und ich beugte mich gespannt vor. Zögerlich las ich: „Der Narr. O-kay … Und was heißt das? Dass ich dumm bin?“ Ich sah Rhea schief von der Seite an.
„Nein.“ Sie lächelte. „Aber er steht zum Beispiel für Unwissenheit oder Unerfahrenheit. Vielleicht dafür, dass du mit etwas noch nicht so vertraut bist?“
„Wenn das mal nicht auf Chemie anspielt“, scherzte ich.
Chemie war noch nie mein Lieblingsfach gewesen. Da half es nicht gerade, dass ich zusätzlich zu den ganzen Formelgleichungen auch noch die englischen Fachausdrücke pauken musste. Halb-Schottin hin oder her – so was hatte Mama mir definitiv nicht beigebracht.
„Käse! Ich kenne niemanden, absolut niemanden, der so viel lernt wie du. Also sei schön ruhig.“
Touché. Aber mir blieb ja keine andere Wahl, wenn ich nicht heillos untergehen und Papa enttäuschen wollte.
Grinsend deckte Rhea die zweite Karte auf, die für die Zukunft stand – und stutzte. „Der Gehängte“, hauchte sie.
Ich lachte nervös. „Dann wird’s rosig für mich?“ Mir wurde leicht flau im Magen.
Auch Rhea wirkte zerknirscht, aber sie gab sich alle Mühe, mir aufmunternd zuzulächeln. „Stimmt schon, ist jetzt nicht die beste Karte. Aber jede Karte hat zwei Seiten – einen Licht- und einen Schattenaspekt. Also kein Grund zur Panik. Die spiegeln sich gegenseitig. Das heißt, es gibt immer Deutungen, die in die entgegengesetzte Richtung gehen.“ Meinen Magen beruhigte das kein Stück.
„Beim Gehängten ist beides etwas problematisch“, erklärte Rhea weiter. „Er steht für eine Prüfung oder eine Krise, Ohnmacht oder ein Opfer. Er kann allerdings auch für Erlösung stehen, das wäre dann der Lichtaspekt. Aber generell wird er schon eher negativ gedeutet.“
Prüfung, Krise, Ohnmacht, Opfer. Der Knoten in meinem Bauch schnürte sich immer enger zu. „Vielleicht heißt das ja, dass ich Chemie verkacke“, unkte ich, um mich davon abzulenken.
„Ach, hör schon auf!“ Rhea boxte mich spielerisch gegen die Schulter. Und doch ließ mich der vage Verdacht nicht los, dass in den Karten mehr Wahrheit lag, als wir beide ahnten.
Der Blitz und der Schemen verfolgten mich bis in meine Träume. Noch im Aufwachen spürte ich den Schauder, der mir im Schlaf die Schultern hinabgekrochen war. Fröstelnd schlang ich die Arme um den Oberkörper, bevor ich die Erinnerung abschüttelte und mich entschlossen aufsetzte. Ich musste wissen, was es damit auf sich hatte – und ich würde es herausfinden.
Keine Minute später hämmerte ich in die Tasten meines PCs und sammelte sämtliche Infos zu blendenden Blitzen ohne Gewitter, zu Schatten und sogar zu Burggespenstern. Wenn ich Pech hatte, hatte ich eine Augenkrankheit. Netzhautablösung oder Glaskörpertrübung waren die häufigsten Ergebnisse in Sachen Lichtblitze und Schatten im Sichtfeld. – Uääh!
Aber dann nur so punktuell? Ich hatte ja sonst keine Beschwerden. Meine Augen waren super! – Also doch nur ein Fantasiestreich?
Für weitere Recherchen blieb mir leider keine Zeit. Nächste Woche standen die letzten Klausuren an, deren Zensuren mit in die Abschlussnoten einfließen würden. Seufzend klappte ich meinen altersschwachen Laptop zu und vergrub mich in meinen Büchern. Seit Tagen büffelte ich wie eine Irre – und hatte immer noch das Gefühl, nicht mal die Hälfte zu kapieren.
Mein Zimmer war so mit Haftnotizen zugekleistert, dass man kaum noch die Tapete sah. Einzig meine Astroposter hatte ich ausgespart, aber auch vor den Schränken nicht haltgemacht.
Als ich schließlich gähnend in die Küche schlurfte, hielt Papa die Milchflasche in der Hand – eine steile Falte zwischen den Brauen. „Meinst du, du kannst den Stoff jetzt trinken?“, flachste er, sah mich aber beschwörend an. „Mensch, Sternchen, meinst du nicht, du übertreibst es mit der Lernerei?“
Tatsächlich zierte selbst die Milch ein Klebezettel voller chemischer Formeln, denn auch im Kühlschrank hatte ich mich ausgetobt.
Okay, nichts anmerken lassen! Bemüht unbekümmert lächelte ich Papa ins Gesicht und winkte ab. „Ach, keine Sorge, Paps! ’ne gute Woche noch, dann wird alles wieder easy. Wenn erst mal die Klausuren rum sind, stehen die Noten, und ruckzuck sind Ferien.“
Papa kniff die Lippen zusammen. „Trotzdem musst du auch mal Pause machen. Das versteht doch jeder, wenn du den Stoff noch nicht so draufhast wie die anderen.“
Das mochte ja sein, aber ich wollte nicht, dass er sich über so was den Kopf zerbrach.
Übertrieben lässig zuckte ich die Schultern. „Mach ich doch – bin gleich noch mit Rhea unterwegs.“ Dass wir vorhatten, gemeinsam zu lernen, verschwieg ich lieber und machte mich schnell daran, den Tisch zu decken.
Nach dem Essen flitzte ich ins Bad, kaute beim Zähneputzen das Periodensystem durch und schlüpfte anschließend in kurze Klamotten – Jeans-Shorts und ein hellblaues Shirt, das meine Lieblingsastronautin zeigte: Samantha Cristoforetti, die erste europäische Kommandantin der ISS.
Auch in aller Frühe war es momentan schon angenehm warm. Deshalb hatte ich mich mit Rhea im Freien verabredet – und dafür mit voller Absicht den Park neben dem Castle vorgeschlagen. Mich beschlich noch immer das Gefühl, ich hätte dort etwas Entscheidendes übersehen. Wenn ich nur wüsste, was.
Ich war extra schon eine halbe Stunde vor unserer Verabredung da, um mich noch mal in Ruhe umzusehen. Dabei fielen mir an der Burg tatsächlich ein paar neue Details auf: Im Turm war ein Wappen eingemeißelt, das Ritterrüstungen mit Federbüschen auf den Helmen und die Symbole dreier Monde über einer vielstrahligen Sonne zeigte. Außerdem zog sich eine Inschrift über die gesamte Fensterbreite, die allerdings zu verwittert war, um sie zu entziffern. Und die offen stehende Rückseite des Gebäudes – dort, wo die Mauern nicht überdauert hatten – erlaubte einen Blick auf dunkle Eisengitter, die an mehreren Stellen in den Boden eingelassen waren, sowie auf einen alten, steinernen Kamin. Aber ich entdeckte leider nichts, das man mit einem Blitz oder einem dunklen Schatten in Verbindung bringen könnte.
Auch die Info-Steintafel, die an der Vorderseite der Ruine angebracht war, las ich durch:
Dunly Castle
Erbaut im Jahre 1404 (heutiges Erscheinungsbild)
Von 1502 bis 1589 Wohnsitz des Clans McDonnell
Um 1600 aufgegeben und dem Zerfall überlassen
1992 grundsaniert
Dunly Castle wurde auf den Grundfesten einer Burganlage des späten 12. Jahrhunderts errichtet.
Älteste urkundliche Zeugnisse weisen darauf hin, dass es an diesem Ort zuvor eine keltische Kultstätte gegeben haben könnte. Darüber besteht jedoch kein wissenschaftlicher Konsens.
Hm. Das deckte sich mit den Informationen, die ich im Internet gefunden hatte. Einzig die Angabe mit der Kultstätte war mir neu. Was konnte das gewesen sein? Ein Steinkreis? Ein Grab?
Jedenfalls brachte mich das alles nicht weiter.
Seufzend ließ ich mich auf eine Parkbank fallen, zog meine Karteikarten hervor und begann zu lernen. Aber ich konnte mich einfach nicht konzentrieren. Nachdem ich die gleichen Stichpunkte fünfmal von Neuem angefangen hatte, ohne mir irgendwas zu merken, gab ich auf. Ich blickte über meine Schulter, zur Burgruine. Doch mit Ausnahme von ein paar Zitronenfaltern, die über die Wiese flatterten, bewegte sich hier überhaupt nichts.
Keinerlei Anzeichen für paranormale Aktivitäten.– O Mann, ich hab eindeutig zu viel Akte X geschaut! Rhea hatte ein Faible für die alte Mystery-Serie – und ihren Hauptdarsteller. Trotzdem spannte ich mich unwillkürlich an. Dabei war das einzig Ungewöhnliche, dass das Areal verlassen war. Mal wieder. Außer mir war niemand hier. Keine Spaziergänger oder Touristen – und das an einem wunderschönen Juniwochenende. Das war schon ein wenig seltsam. Oder war das auf dem Land normal? – Wahrscheinlich.
Ich ließ die Haare schwingen, um meinen Kopf frei zu bekommen, und guckte zurück auf meine Karten. Dabei kam es mir vor, als hätte mir die Formel für Salpetersäure schon das Hirn zerfressen. Ich schloss die Augen und wiederholte sie im Kopf, um sie mir besser einzuprägen; da glaubte ich auf einmal, einen Luftzug im Nacken zu spüren. Sofort stellten sich die feinen Härchen unterhalb meines Haaransatzes auf und eisige Kälte breitete sich über mein Rückgrat aus – trotz der für Schottland untypischen Wärme. Langsam richtete ich mich auf, wandte meinen Kopf nach hinten – und sah aus dem Augenwinkel einen Schatten hinter einem Baum verschwinden. Blinzelnd sprang ich auf die Füße. Etwas Bläulich-Weißes drang aus dem Gebüsch neben dem Baum – ein Flackern, das sich jäh zu einem Gewirr leuchtender Blitze verdichtete, die jedoch innerhalb von Sekundenbruchteilen wieder verloschen.
Ich schnappte nach Luft. Das war keine Einbildung gewesen! Dieses Mal war ich mir absolut sicher.
Erneut lag ein Knistern in der Luft, die Spannung darin schien greifbar. Meine Locken entwickelten ein Eigenleben, zarte Strähnchen lösten sich daraus und schwebten elektrisch geladen in die Höhe. Ein Prickeln lief über meine Haut.
Dieses Mal entwischst du mir nicht! Schwungvoll warf ich meine Tasche über die Schulter und wollte zum Gebüsch stürmen, da ließ mich Rheas Stimme mitten in der Bewegung erstarren: „Sanny? – Hey! Stopp! Wo willst du hin?“ Hastig sah ich mich nach ihr um. Mein Herz machte einen unangenehmen Hüpfer. „Die haben total überzogen beim Training, sorry. – Hau doch nicht gleich ab.“
Irgendwo im Hinterkopf erinnerte ich mich daran, dass sie von ihren Taekwondo-Stunden sprach, aber für solche Gedanken hatte ich jetzt keine Zeit.
„Rhea, da vorne …“, stammelte ich, doch als ich mich wieder in Richtung Baum umdrehte, sah alles ernüchternd normal aus. Kein Flimmern, keine Blitze. Selbst meine Haare waren zurück im Ursprungszustand. „Wart’ mal kurz“, rief ich ihr dennoch zu. Ich ließ meine Tasche fallen, lief hinüber zum Gebüsch und teilte mit meinen Händen vorsichtig die dicken Zweige.
Nichts. Kein Rauch, keine Asche, keine Feuerwerkskörper. Keine Hinweise auf irgendetwas, das die Blitze ausgelöst haben könnte. Nur dieser eigenartige Geruch hing wieder in der Luft. Und es war ungewöhnlich still. Die Vögel – sie singen nicht mehr, wurde mir schlagartig bewusst.
Ich blickte mich hektisch um, untersuchte die ganze Gegend, doch es war nichts Außergewöhnliches zu erkennen.
„Kann ich dir irgendwie helfen?“, fragte Rhea, als ich noch einmal hinter die nächstgelegenen Bäume spähte. Sie trat neben mich und musterte mich zweifelnd. „Hast du was verloren?“
Wieder wurde ich nicht fündig. Rhea und ich waren allein.
Wenn jemand hier gewesen war, wollte er nicht, dass man ihn fand, und achtete darauf, keinerlei Spuren zu hinterlassen.
„Nein …“, antwortete ich zerstreut und warf einen letzten Blick in das Gebüsch. „Ich dachte nur, ich hätte was gesehen … eine Katze … oder so.“ Rhea würde mich für verrückt erklären, wenn ich ihr gestand, was ich wirklich gesehen hatte. Genau wie Papa. – Hatte ich es denn gesehen? Eben war ich mir noch so sicher gewesen … Doch nun stiegen neue Zweifel in mir auf.
Ohne Vorwarnung rümpfte Rhea die Nase: „Sag mal, riechst du das auch?“
„Komisch, oder?“, stimmte ich zu.
„Ist das … Ozon?“
Ich wäre ihr am liebsten um den Hals gefallen. Der Geruch hatte tatsächlich etwas von Ozon, auch wenn es nicht genauso roch. Trotzdem war es ein Indiz, das meine Beobachtung stützte. Das zeigte, dass nicht nur ich die Auswirkungen des Blitzes wahrnehmen konnte. Einen Atemzug lang wollte ich ihr alles erzählen, aber da hatte sie sich schon bei mir untergehakt und zog mich in Richtung der Bänke: „Können wir dann? – Ich muss um halb zwei wieder zu Hause sein.“
Und mein Impuls, sie einzuweihen, verpuffte.
Zusammen pflanzten wir uns auf die Bank neben der Infotafel und fragten uns gegenseitig die Formeln ab. Doch meine Augen huschten immer wieder hinüber zu den Büschen – und jedes Mal, wenn ich an das dachte, was ich gesehen hatte, regte sich wieder dieses feine Frösteln in meinem Nacken. Etwas ging hier vor sich – aber was nur?
Die nächste Woche verging ganz ohne weitere mysteriöse Begebenheiten. Dafür war es dieses Mal sehr spät geworden bei Rheas und meinem allfreitäglichen Streaming-Abend. Am liebsten wäre ich über Nacht bei ihr geblieben, aber so spät konnte ich Papa nicht mehr anrufen, damit er sich keine Sorgen machte. Also trat ich kurz vor Mitternacht auf die schmale Straße. Eine kühle Böe fuhr mir durch die Haare. Die nächtliche Stille, die sich wie ein schwarzes Tuch über dem Glen Ghrian ausbreitete, erschlug mich beinahe. Erschauernd zog ich meine Strickjacke enger um meine Schultern und erhöhte das Tempo meiner Schritte, mein Herzschlag ein stetiges Hämmern in meinem Hals.
Eigentlich war es die perfekte Nacht für mich. Trotz des lebhaften Windes war die Luft noch immer lau, es duftete nach Ginsterblüten und frisch gemähtem Gras und das Hochgefühl des Sommers lag in der Luft. Das Allerbeste aber war der Himmel, über den sich deutlich sichtbar das glänzende, geschwungene Band der Milchstraße spannte, gerahmt von weiteren glitzernden Sternen. Der Fluss, der sich in der Ferne durch das Tal schlängelte, warf ihren Schein schwach schimmernd zurück und verlieh der Nacht einen geheimnisvollen Glanz.
Die Sterne hatten mich schon immer fasziniert. Schon bevor Mama gestorben war, doch seit ihrem Tod ganz besonders. Wie von selbst tastete ich nach dem Armband mit den goldenen Sternchenanhängern, das sie mir geschenkt hatte, kurz bevor sie gestorben war, und strich mit den Fingern darüber. Wann immer Sterne am Firmament über mir aufblitzten, hatte ich das Gefühl, dass sie mir nahe war. Dass sie einer der leuchtenden Punkte war, irgendwo da oben. Dass sie über mich wachte, mich beschützte.
Doch bei der ganzen Lichtverschmutzung in der Stadt hatte ich von Glück reden können, wenn wenigstens der große Wagen oder Cassiopeia zu sehen waren, deren Sterne besonders hell strahlten. Fast alle anderen Sternbilder waren dafür viel zu blass. Klar, ich hatte Sophia immer wieder mit ins Planetarium geschleift. So oft, bis ich alle Shows auswendig kannte. Aber echte Sterne waren so viel besser als jede Simulation der Welt. Und hier in Dunly, wo nach 23 Uhr sogar die Straßenlaternen abgeschaltet wurden, war der Sternenhimmel atemberaubend. Seinem Ruf zum Trotz war bereits das schottische Frühlingswetter recht sonnig gewesen und hatte mir einige unverhofft klare Sternstunden geschenkt.
In jeder anderen Nacht wäre ich, den Kopf tief in den Nacken gelegt, in träumerischer Zeitlupe nach Hause gestolpert, um diesen Anblick so lange wie möglich zu genießen. Doch nicht in dieser.
Irgendetwas war hier, das mich beobachtete … lauerte …
Ich spürte seine Augen wie glühende Punkte auf meinem Nacken. Oder war ich nur überreizt, weil wir zu viele Folgen Akte X geschaut hatten? Rhea stand auf den Hauptdarsteller und es interessierte sie kein bisschen, dass der gute Mann inzwischen auf die 60 zuging – eine ihrer diversen Schwärmereien.
Schöne Scheiße! Hätte ich sie bloß zu einer RomCom überredet! Oder zur neuen Staffel Bridgerton. Luke Newton war sowieso viel süßer als dieser Mulder-Typ – und er jagte auch keine Aliens!
Wieder erschauerte ich. Mein Atem ging stoßweise. Viel zu schnell und viel zu laut in der tiefen Stille dieser Nacht. Ich wagte nicht, hinter mich zu blicken. Und verfluchte das Knirschen meiner Absätze auf dem geschotterten Weg. Nach einigen Metern hielt ich den Druck nicht mehr aus, der sich immer intensiver in mir aufbaute, und rannte los, obwohl das den Lärm nur schlimmer machte.
Bestimmt benahm ich mich lächerlich. Ich konnte ja nicht mal jemanden hören, geschweige denn sehen. Aber das Gefühl, beobachtet und womöglich verfolgt zu werden, war stärker.
Ich hätte auf Rhea hören und darauf warten sollen, dass ihre Mutter nach Hause kam, um mich heimzufahren, doch ich hatte auf der halben Stunde Fußweg bestanden – wegen des wunderschönen Sternenhimmels, aber auch in der Hoffnung, dank der klaren Luft den Kopf freizubekommen. Ich dachte immer noch viel zu häufig an die rätselhaften Blitze und die schattenhafte Gestalt beim Castle. Vor allem seitdem Chemie überstanden war.
Ich hatte gehofft, die Bewegung an der frischen Luft würde mich entspannen. Doch nun war genau das Gegenteil der Fall. Mit keuchendem Atem rannte ich den Weg entlang und strauchelte ein paarmal, als ich an Steinen hängenblieb. Die Trasse war schmal, kaum mehr als ein Feldweg, und steckte voller Unebenheiten.
Endlich kamen die ersten Häuser in Sicht. Ich tauchte in die enge Gasse ein, hetzte um die nächste Häuserecke. Meine linke Seite begann unangenehm zu stechen. Verflixt! Warum hatte ich nicht mehr Sport gemacht? Meine letzte Joggingsession mit Sophia war ein Vierteljahr her. Und der Sportunterricht hier war nur ein mickriger Ersatz dafür. Meine ganze Kondition war futsch.
Da vorne – die weißen Sprossenfenster meines Zuhauses blitzten vor mir auf.
Sofort löste sich die Anspannung in meinem Inneren ein wenig. Als sich meine Finger um meinen Schlüssel legten, wurde mir noch leichter in der Brust. Beherzt lief ich auf den Eingang zu – und fror mitten in der Bewegung ein. Das erleichterte Seufzen, das sich in mir aufgestaut hatte, blieb mir in der Kehle stecken.
Ein Schatten! In meinem Augenwinkel!
Ich wirbelte herum, doch da war – nichts. Oder nichts mehr … Zitternd atmete ich aus, sah mich noch mal hektisch um, blinzelte mehrmals. Aber ich konnte beim besten Willen niemanden entdecken. Keinen Menschen und auch kein Tier. War es doch eine Katze gewesen, die im Gebüsch verschwunden war? – Oder spielte meine Wahrnehmung mir Streiche?
Ich unterdrückte das Bedürfnis, laut loszulachen. Langsam wurde ich echt paranoid. Und doch wummerte mein Herz wie verrückt gegen meine Rippen, als ich den Schlüssel im Schloss drehte und die angenehme Kühle des Hausflurs mir entgegenschlug. Schnell drückte ich die Tür hinter mir zu und lehnte mich mit dem Rücken dagegen. Nacheinander strich ich nochmals über die blitzenden Anhänger meines goldenen Armbands, bis sich das heftige Pochen in meiner Brust legte und sich auch meine Atmung Stück für Stück stabilisierte.
So viele rätselhafte Vorkommnisse auf einmal – konnte das noch Zufall sein? Oder sah ich mittlerweile hinter jeder Ecke Gespenster?
Am nächsten Morgen schaltete ich den Fernseher ein. Das tat ich sonst nie so früh am Tag, aber zusätzlich zu der Tasse Kaffee, die auf dem Wohnzimmertisch dampfte, brauchte ich noch etwas anderes, um mich aufzuputschen. Ich hatte selten so miserabel geschlafen. Kreisend fuhr ich mir mit beiden Händen über die dröhnende Stirn, nahm einen vorsichtigen Schluck aus der heißen Tasse und sank in meinen Sessel.
Den Großteil der Nachrichten hatte ich bereits verpasst, mein Mund öffnete sich zu einem herzhaften Gähnen und ich wollte schon auf den Musikkanal umschalten, als das Bild neben der Nachrichtensprecherin umschwenkte und ein funkelndes Objekt auf dunklem Untergrund zeigte. Mit einem Schlag war ich hellwach und beugte mich erwartungsvoll vor.
„Für Furore unter Sternenforschern sorgt zurzeit Komet Irania“, verkündete die Sprecherin. „Mit seinem rund dreißig Millionen Meilen langen Schweif ist der ‚gigantische Schneeball‘ in den frühen Morgenstunden bereits mit bloßem Auge zu erkennen. Aktuell befindet sich der leuchtend helle Schweifstern noch außerhalb der Erdumlaufbahn, wird sie jedoch am 25. Juni passieren und seinen sonnennächsten Punkt am 6. Juli erreichen. Der Komet wird dabei eine Helligkeit erzielen, wie sie zuletzt nur Hyakutake 1996, Hale-Bopp 1997 und McNaught 2007 aufweisen konnten.
Zum Sport …“
Yes! Ich klatschte vor Freude in die Hände und machte einen Luftsprung. So einen hellen Kometen hatte ich mir schon immer herbeigewünscht. Ich kam aus dem Grinsen gar nicht mehr heraus.
KOMET BEOBACHTEN!!!, schrieb ich in mein Notizbuch, das selbst über und über mit Sternen bedeckt war, und unterstrich das Ganze gleich dreimal.
Das muss ich unbedingt Sophia erzählen! Und Rhea! Und Papa!
Im Gegensatz zu anderen stellaren Ereignissen wie Sonnen- und Mondfinsternissen waren Kometen völlig unvorhersehbar – und dadurch nur umso aufregender.
Überschäumend vor Euphorie trippelte ich durch die Wohnung und machte mein gesamtes Umfeld kirre mit meiner kribbeligen Vorfreude. Zum Glück sah Papa es mir nach, dass ich beim Frühstück – und selbst noch beim Abendessen – über kaum etwas anderes reden konnte. Er kannte das schon von mir – und freute sich über alles, was mich glücklich machte.
Am liebsten hätte ich sofort damit losgelegt, Irania mit meinem eigenen Teleskop zu beobachten, doch leider wurde daraus an diesem Wochenende nichts. An der dichten Wolkendecke war auch nach drei Stunden Wachehalten auf dem Balkon und vier Tassen Kaffee nichts zu rütteln.
Die Anzeige meines Radioweckers sprang auf 7 Uhr um, als Rhea sonntagfrüh ihre dicke Wolldecke zurückschob und sich gähnend aus ihrem Mantel schälte.
Mit hängenden Schultern schob ich die Balkontür für sie auf. „Lust auf Frühstück?“
„Gerne. – Und Sanny?“ Sie kletterte in mein Zimmer und sah sich zwinkernd nach mir um. „Morgen ist auch noch ein Tag.“
Ich lächelte. „Danke.“ Rhea war nicht gerade begeistert gewesen, die halbe Nacht mit mir durchzuwachen, auch weil gleich Montagmorgen um acht die letzte Matheklausur anstand, aber mir zuliebe war sie dennoch geblieben.
Trotzdem. Warum musste das Wetter ausgerechnet jetzt umschwenken?
In der Nacht von Sonntag auf Montag hatte ich ebenso wenig Erfolg bei meinen Kometen-Beobachtungs-Versuchen. Andererseits war das wiederum gut für meine Konzentration bei der Klausur. Diesmal hatte ich mich auf den Wetterbericht verlassen und konnte mich nach einem kurzen Kontrollblick aus dem Fenster um 3 Uhr morgens wieder umdrehen und noch ein bisschen Kräfte tanken.
Mit der Konzentration war es kurz nach der Klausur aber Knall auf Fall vorbei!
„Die Aufgabe mit der Wurzelgleichung war doch total Banane“, schimpfte ich lautstark vor mich hin, während ich nach Mathe hinter Rhea den Pausenhof betrat, „und dann auch noch mit ’nem Fehler drin. Wenn der Fletcher die nicht aus der Wertung nimmt, krieg ich ’nen … – Hey!“
Ich wäre mit voller Wucht in Rhea hineingelaufen, hätte ich nicht in letzter Sekunde die Notbremse gezogen. Sie war aus unerfindlichem Grund mitten auf dem Weg erstarrt wie festgewachsen. Ich folgte ihrem gebannten Blick, konnte aber nichts Spektakuläres ausmachen.
„Ist hier irgendwo ’n Feuer ausgebrochen?“, scherzte ich. Aber Rhea hörte gar nicht zu.
„Hey, Primaballerina! Hast den Schwanz eingezogen, was?“, hörte ich in diesem Moment Ben Bright aus der Parallelklasse blöken.
Ich reckte den Kopf, um zu sehen, woher seine Stimme kam und wen er diesmal beleidigte. Das tat er nämlich allzu gern. Sich aufspielen. Alles an ihm schrie: Möchtegern. Die schwarze Lederkluft, die Sonnenbrille, die Kippe im Mundwinkel. Nur leider wollten das neunzig Prozent unseres Jahrgangs nicht kapieren.
Mit seinen platinblonden, kurzen Locken erinnerte er irgendwie an ein Schaf. Einzig die auffällige Silberschnalle an seinem schwarzen Lederarmband trübte dieses Bild. Im Licht eines verirrten Sonnenstrahls, der durch die dichte Wolkendecke brach, blitzte sie auf, und für einen atemlosen Sekundenbruchteil wunderte ich mich: Konnte er etwas mit dem Blitz bei der Burg zu tun haben?
Doch sogleich verwarf ich den Gedanken wieder. Es gab keinerlei Begleiterscheinungen. Kein Knistern. Keinen Gestank. Keine Spannung in der Luft.
Manchmal war eine Reflexion eben nur das: eine Reflexion.
Dafür aber fesselte Bens Gegenüber meine Aufmerksamkeit. Der Junge hatte kurzes, rotblondes Haar, das ihm wild vom Kopf abstand, und funkelte den Lederjackenträger mit in die Hüften gestemmten Händen an.
„Zieh Leine, Ben! Und kümmer’ dich um deinen Scheiß!“ Seine Stimme – akzentuiert und eindringlich – kannte ich nicht, aber ich hatte das unbestimmte Gefühl, ihn irgendwo schon mal gesehen zu haben.
„Ich würde aber gerne über dich reden – und deine ‚Karriere‘.“ Ben malte Anführungszeichen in die Luft und lachte ein dreckiges, schadenfrohes Lachen. „Oder warte – du hast ja keine mehr!“
Mich überkam eine spontane Welle der Sympathie für den Angegriffenen, während sich heiße Wut in meinem Bauch aufstaute. Wer gab Ben das Recht, so über andere herzuziehen? Was immer bei dem Jungen mit der Sturmfrisur vorgefallen war, er sah nicht aus, als wollte er, dass es vor der gesamten Schule breitgetreten wurde. Verständlicherweise.
Eine plötzliche Windböe fegte über den Schulhof, blies mir die Locken ins Gesicht und brachte auch die Haare des Rotblonden weiter durcheinander.
Meine Gedanken ratterten und ratterten: Woher kannte ich ihn nur?
„Du bist viel zu armselig, als dass ich mir das geben müsste. – Ciao.“ Er hatte einen leichten Akzent, südländisch, glaubte ich. Jedenfalls machte er auf dem Absatz kehrt, zeigte Ben einen erhobenen Stinkefinger und würdigte ihn keines weiteren Blickes, während er mit bebenden Schultern im Naturwissenschaftsgebäude verschwand. Ben grinste hämisch, folgte ihm aber nicht.
„Was, bitte, war das denn?“, fragte ich Rhea, während ich sie sanft mit mir in Richtung Hauptgebäude zog.
„Er hat verloren“, murmelte sie abwesend.
„Wer hat was verloren?“
„Darius. Er hat die Meisterschaft vergeigt.“
Verwirrt kratzte ich mich an der Wange – bis mir ein Licht aufging. Mein Kopf ruckte zu ihr herum. „Das war Darius? – Der Tänzer? Dein Crush?“
Rhea nickte und seufzte auf unmissverständliche Weise. Ihre Augen hatten einen verträumten Ausdruck angenommen.
Natürlich! Deshalb war er mir so bekannt vorgekommen.
Rhea hatte mir Videos von ihm gezeigt. „Wow!“
„In natura ist er besonders scharf, oder? Wart’s ab, bis du ihn tanzen siehst.“
„Hab ich ja schon“, schmunzelte ich. In den Videos war er ein wahrer Wirbel aus Energie gewesen. So schnell, dass man kaum sein Gesicht sehen konnte. Vermutlich hatte ich ihn deswegen nicht sofort erkannt. Bei den ganzen Saltos und Schrauben war es schwer gewesen, hinterherzukommen. Aber seine Performance hatte mich beeindruckt. Wie er seinen Körper in Verbindung mit der Melodie dazu genutzt hatte, Gefühle zu transportieren. Der Schmerz und der Zorn waren praktisch greifbar gewesen. Und dabei hatte er Sprünge und Drehungen hingelegt, die mich sprachlos zurückgelassen hatten.
„Das ist wie bei Konzerten. Live dabei sein oder die Aufzeichnung Anschauen ist ein Riesenunterschied.“
Ich war zwar noch nie auf einem Konzert gewesen, pflichtete Rhea aber bei.
„Und er hat echt verloren?“, hakte ich vorsichtig nach. „Bei dieser Meisterschaft? Im … wie hieß das noch mal?“
„Bei den Landesmeisterschaften im Contemporary.“ Sie stieß geräuschvoll die Luft aus. „Ich sag’s ja; er ist richtig, richtig gut. Ist bis zum Halbfinale gekommen und hat dann von jetzt auf gleich alles vergeigt. Als hätte er mir nichts, dir nichts Arme und Beine gegen linke Hände und Füße getauscht.“
„Und warum hast du nichts davon erzählt?“ Normal hielt sie mit solchen Infos doch nicht hinterm Berg.
„Wann denn? Das war erst gestern Abend. – Krass, dass er so schnell schon wieder hier ist.“
Dabei war ‚schnell‘ relativ. Ich hatte Darius während meiner Zeit in Dunly noch kein einziges Mal zu Gesicht bekommen, weil dem Turnier ein Trainingslager vorausgegangen war, für das er wegen seiner herausragenden tänzerischen Leistungen sogar über Wochen hinweg vom Unterricht befreit worden war. Eine Ehre, die sonst nur Popstars und Schauspielern zuteilwurde. Nicht dass es in diesem Kaff welche gegeben hätte.
„Na ja“, rempelte ich freundschaftlich mit der Schulter gegen Rheas. „Das wäre doch die Gelegenheit für dich. Vielleicht braucht er ja wen zum Trösten.“ Ich zwinkerte ihr zu.
Rhea seufzte nochmals traurig. „Vielleicht. Aber das bringt mir alles nichts. Er schwebt in höheren Sphären.“ Fragend hob ich eine Braue. „Er ist jetzt nicht total abgehoben oder so und er ist auch kein typischer Einzelgänger, aber … man kommt irgendwie nicht an ihn ran, wenn du verstehst, was ich meine.“
„Ähm, nee, aber macht nichts.“ Ich neigte mitfühlend den Kopf. „Also keine Chance?“
Rhea ließ die Schultern herabsacken und schüttelte den Kopf.
„Und was ist mit Ben? – Wird der Darius weiter Probleme machen?“
„Ach was.“ Rhea machte eine wegwerfende Geste. „Der hat doch mit jedem ein Problem, vor allem mit sich selbst.“
In diesem Augenblick fegte ein weiterer Luftstoß über den Hof, noch kräftiger als der zuvor, und riss meine Haare in die Höhe. Auch der wolkenverhangene Himmel wurde immer düsterer, sodass wir uns schnell ins Gebäude verzogen. Es konnte ohnehin jede Sekunde klingeln.
Ich spürte die Musik bis in die Spitzen meiner kleinen Finger. Dort pulsierte meine Wut, mein Schmerz, all die angestauten Gefühle, die sich nur dann entluden, wenn ich tanzte.
Jetzt aus der Streckung in die Pirouette – drehen, einmal, zweimal, dreimal. Danach die Rolle und der Sprung. Ein Überschlag, zwei, drei, vier, fünf. Ich konnte die Abfolge im Schlaf, folgte ihr ganz selbstverständlich. Es fühlte sich so natürlich an wie Laufen oder Atmen.
Und doch spürte ich mich jedes Mal so intensiv wie bei nichts anderem. Das Heben und Senken meiner Brust. Die Kraft meines Körpers als Ventil meiner Emotionen. Die Energie und Macht meiner Gefühle.
Jetzt noch der finale Schwung, der allerletzte Salto und dann –
„Darius, da ist jemand für dich. Scheint dringend.“ Alans Stimme hallte von den Wänden des Trainingsraums wider und katapultierte mich zurück ins Hier und Jetzt – in diese andere Welt, die nicht das Tanzen war.
Ich stockte mitten im Sprung, verlor das Gleichgewicht und rollte mich ungeschickt am Boden ab. Immerhin zerrte ich mir nichts dabei. Missmutig rappelte ich mich auf und grollte: „Cazzo, Alan!“
Doch mein Trainer zuckte nur die bulligen Schultern und deutete zum Ausgang. „Sie wartet oben in deinem Zimmer.“
Sie? Die Gedanken rasten durch meinen Kopf, während ich die Treppe zu meinem Hotelzimmer hinaufhastete. Das konnte eigentlich nur eines bedeuten. – Aber wieso?
Ich schob die Tür auf – und meine Befürchtung bestätigte sich: Vor mir stand meine Mutter mit zuckenden Augen, die wallenden, schwarzen Haare leicht zerwühlt. Bei jemandem, der sonst die Perfektion auf Beinen war, genügte das als Warnzeichen. Das zweite war, dass sie zweihundert Meilen Fahrt auf sich genommen hatte, nur um mich persönlich rundzumachen, statt mich mit einem ihrer unterkühlten Telefonanrufe zu beehren.
„Darius“, begrüßte sie mich mit der Andeutung eines Nickens. Berührungen oder gar Umarmungen waren von ihr nicht zu erwarten. Sie scannte mich von oben bis unten und ich verschränkte meine Arme über dem verschwitzten T-Shirt. In ihrer Nähe konnte ich mich nie recht entscheiden zwischen dem Drang, den Unbeteiligten zu mimen, während ihre Tiraden auf mich einprasselten, und dem Trotz, der schon immer in mir geschwelt hatte. Den ich nie ausgelebt hatte bis auf dieses eine Mal. Obwohl sie fast zwei Köpfe kleiner war als ich, vermittelte sie mir immer wieder den Eindruck, auf mich herabzublicken.
„Mutter.“ Ich zwang mich, ihr in die Augen zu sehen. Es war nur eine Ahnung – ein winziges Aufblitzen, der Hauch einer Rötung –, aber irgendetwas stimmte nicht.
Romina?!, schoss es mir durch den Kopf und ein Adrenalinstoß durchzuckte mich. War das möglich?
„Was ist los?“, platzte ich heraus.
Sie verzog keine Miene. „Du musst nach Hause kommen. Sofort.“
Ich starrte sie an. Ein Windstoß zerrte an der Decke des Tischchens vor dem Fenster und verwirbelte meine Haare. Mutter warf mir einen tadelnden Blick zu, aber ich ignorierte sie. „Was ist passiert?“
„Pack deine Sachen! Ich erwarte dich in einer halben Stunde unten im Wagen.“ Als wäre damit alles gesagt, wandte sie sich ab und wollte schon wieder zurück durch die Tür, aber ich versperrte ihr den Weg.
„Was ist passiert?“, wiederholte ich mit mehr Nachdruck.
Es gab nicht viele Themen, die meine Mutter aus der Ruhe brachten. Romina gehörte dazu. Konnte das wirklich sein? Wieder war da dieses leise Kitzeln des Adrenalins, das warme Aufwallen von Hoffnung, der altvertraute Schmerz.
Meine Mutter sah mich schneidend an, ganz die Matriarchin. Als Oberhaupt der Familie war sie es gewohnt, dass wir ihren Befehlen folgten, ohne sie zu hinterfragen. „Fabio ist außer Kontrolle“, antwortete sie dennoch.
Ungläubig riss ich die Augen auf. Fabio? Mein Musterbruder, der immer alles richtig machte, Tradition und Familie über alles stellte und ganz in seiner Rolle aufging, außer Kontrolle?
„Er hat seine Kräfte nicht im Zaum. Du musst uns helfen, ihn zu zügeln.“
Meine Augen wurden sogar noch größer. Wenn einer mit seinen Kräften haushalten konnte, dann doch wohl Fabio.
Erst im nächsten Moment ging mir die volle Tragweite ihrer Worte auf. Ich sollte mitkommen – jetzt?! Wenn ich vor dem Ende des Turniers aufbrach, würde ich disqualifiziert werden. Dann konnte ich die Meisterschaft vergessen.
Ich schluckte, versuchte aber, es mir nicht anmerken zu lassen. Ich hatte mir all das hier erkämpft. Hart. Ich hatte trainiert wie ein Irrer. Ich war über meinen Schatten gesprungen und hatte es mit aller Macht durchgedrückt, eine aktive Tanzkarriere zu starten. Gegen den Widerstand meiner Familie. Auch wenn ich von Anfang an gewusst hatte, dass sie zeitlich begrenzt sein würde. Dass ich das Tanzen wieder würde aufgeben müssen. Dass es Wichtigeres gab, sobald sich meine Kräfte regten. Auch wenn ich immer noch nicht einsah, warum nicht beides gehen sollte. Das Tanzen und meine Aufgabe.
Meine Gedanken überschlugen sich, während ich durch das Hotelzimmer schritt, um Zeit zu schinden. Dann sagte ich betont ruhig: „Okay. Überleg dir, ob du dir lieber ein Zimmer nimmst oder sofort zurückfährst. Ich komme übermorgen nach, direkt nach dem Finale.“
Es war ein schwacher Versuch, aber den war es mir wert. Ich wollte diesen Pokal unbedingt. So eine Chance würde so schnell nicht wiederkommen – wenn überhaupt jemals.
Da ertönte ein gewaltiges Donnergrollen – und ich bereute auf der Stelle, das Fenster nicht geschlossen zu haben. Es folgte ein hoher Pfeifton und in der Vitrine hinter mir ging klirrend ein Glas zu Bruch. Splitter bedeckten jeden Winkel des gläsernen Untergrunds. Im Gegensatz zu mir – und offenbar meinem Bruder – hatte unsere Mutter ihre Kräfte sehr wohl unter Kontrolle und nutzte sie mit Vorliebe, um uns ihren Willen aufzuzwingen.
Ich ballte meine Finger so fest zu Fäusten, dass das Weiße der Knöchel zum Vorschein kam. Normalerweise wäre ich jetzt eingeknickt. Ich knickte doch immer ein. Aber dieses Mal nicht!
„Ich komme nicht mit.“ Meine Stimme klang erstaunlich fest. Das Gewicht, das auf meinen Oberkörper drückte, seit sie hier aufgekreuzt war, schien auf einmal halb so schwer.
In ihren Augen begann es bedrohlich zu funkeln.
„Wir hatten eine Vereinbarung, Mutter! Ich komme erst nach, wenn das Finale war“, beharrte ich.
Sie brodelte, das spürte ich, aber sie wahrte die Beherrschung. Sie tat noch einen Schritt auf mich zu und fasste meine Hand, die noch immer zur Faust geballt war. Der Duft ihres Parfums umwehte mich und ihre Finger waren überraschend warm – genau wie ihre Stimme, als sie nun an mich appellierte. „Darius, mein Junge.“
So nannte sie mich sonst nie. Dieses Vokabular war Fabio vorbehalten. Gegen meinen Willen entspannten sich meine Finger ein wenig. Schon als kleiner Junge hatte ich mich so sehr nach ihrem Zuspruch gesehnt, dass ich nach Strohhalmen griff, sobald sie mir einen hinstreckte. Ein Automatismus, gegen den ich nur mit Mühe ankam. „Wir brauchen dich. Ich wäre nicht hier, wenn es nicht wichtig wäre. Ich mache mir große Sorgen um deinen Bruder.“
Schon versteifte ich mich wieder. Das Fünkchen Wärme, das in mir geglommen hatte, überzog sich mit einer Kruste aus Eis. Natürlich ging es ihr um Fabio. Was sonst?
„Aber nicht nur das“, fuhr sie fort. „Es sind Dinge am Werk, die wir noch nicht verstehen. Irgendetwas bringt Fabio dazu, seine Kräfte einzusetzen, willkürlich und gedankenlos. Ich muss wissen, was dahinter steckt. Oder wer.“
Ich zog die Stirn kraus. „Du meinst, die Jäger könnten …“
„Die Jäger oder eine andere, mächtige Kraft.“
Meine Gedanken wirbelten wild durcheinander. Das änderte alles!
Hatten unsere Kräfte sie auf den Plan gerufen? Fabios und meine Initiation war erst wenige Wochen her, unsere Fähigkeiten noch ganz frisch. Und wie Vampire das Blut schienen die Jäger unsere Kräfte zu wittern. Genau wie damals …
Etwas in meiner Brust krampfte sich zusammen, als die Erinnerungen auf mich einströmten. Der alte Schmerz, den ich nur beim Tanzen zuließ und sonst fest in mir verschloss.
„Aber wenn es wirklich die Jäger wären, hätte Fabio sie doch bemerkt – und es dir erzählt“, protestierte ich. Fabio hatte keine Geheimnisse vor ihr.
Doch wenn sie es tatsächlich waren … Dann würde es zum Kampf kommen. Früher oder später. War ich schon bereit dafür? Der bloße Gedanke gab mir das Gefühl, keine Luft mehr zu bekommen. Andererseits – jedes Zusammentreffen mit ihnen war auch eine Chance. Eine Möglichkeit, herauszufinden, was in jener Nacht passiert war. Auch wenn so viele Jahre vergangen waren …
„Selbst wenn sie es nicht sind – sie werden die Energie spüren, die er entfesselt hat. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie sich zeigen. Wir müssen vorbereitet sein.“ Anstatt sich auf weitere Diskussionen einzulassen, wandte meine Mutter sich zum Gehen, ihr Gesicht die gewohnte emotionslose Maske.
Die Luft um uns schien plötzlich bleischwer. Wenn die Jäger involviert waren, hatte ich keine andere Wahl. Ich musste sie begleiten. Egal, was das für mich bedeutete. Pokal ade.
Ich stand da wie gelähmt, mit einem Mal unendlich müde.
Mir nach wie vor den Rücken zugekehrt, wiederholte sie: „Ich erwarte dich.“
Dann trat sie durch die Tür, ohne sich die Mühe zu machen, sie hinter sich zu schließen. Und ich würde ihr folgen.
Am Mittwoch huschte ich nach dem Sportunterricht kurz vor Pausenende noch mal schnell zurück in die Umkleide. Ich hatte mein Handy im Schließfach liegen lassen (ein bisschen schusselig bin ich schon, ich geb’s ja zu). Ich stürzte gerade wieder aus der Tür, um nicht zu spät zu kommen, da hätte ich ihn beinahe umgerannt – Fabio Belasco aus meinem Jahrgang.
„Oh, sorry!“, stieß ich mit einem Quietschen hervor, gefühlte zwei Millimeter von seiner Nasenspitze entfernt.
Wie allen Mädchen der Schule war auch mir Fabio aufgefallen – optisch äußerst positiv mit den scharf geschnittenen Zügen, den rabenschwarzen, leicht gelockten Haaren, dem kantigen Kinn und den tiefblauen Augen, charakterlich jedoch mit einem dicken Frage- und Ausrufungszeichen versehen, was der aktuelle Zwischenfall noch unterstreichen sollte.
Anstatt zurückzuweichen, wie ich es erwartet hätte, rührte er sich nicht von der Stelle. Stattdessen unterzog er mich einer ausführlichen Musterung. Ein eigenartiger Ausdruck lag in seiner Mimik, der für mich nur schwer zu deuten war.
War das etwa eine Anmache? Dann stellte er sich echt dämlich an, so finster, wie er guckte. Außerdem wirkte er seltsam angespannt.
„Hab ich irgendwas auf der Nase?“ Ich ärgerte mich, dass meine Stimme leicht zitterte. Da fiel mein Blick auf die Uhr über dem Türrahmen. Blitzartig erwachte ich aus meiner Erstarrung. „Shit, schon zwei vor zwölf! Komm, wir müssen uns beeilen!“
Ich streifte seinen Oberarm, doch Fabio machte keinerlei Anstalten, mir zu folgen, als ich mit meiner Tasche über der Schulter in Richtung Hauptgebäude sprintete. Auf halbem Weg sah ich mich noch mal nach seiner schlanken Gestalt um, aber von dem dunkelhaarigen, schwarz gekleideten Hünen fehlte jede Spur. Als ob er sich in Luft aufgelöst hätte. Auch während des Matheunterrichts glänzte er durch Abwesenheit.
„Was der wohl vor der Sporthalle wollte?“, zischte ich Rhea zu, als unser Mathelehrer Mr Fletcher bei der Anwesenheitskontrolle Fabios Fehlen registrierte.
„Hm. Wie wäre es mit Flirten?“ Rhea schürzte die Lippen.
„Ha-ha“, erwiderte ich, wurde aber doch ein wenig rot. Kam schließlich nicht jeden Tag vor, dass einer der heißesten Jungs der Schule einem derart nahe kam.
Heiß und verstockt, fügte ich in Gedanken hinzu.
„Vielleicht hatte er auch Streit mit Darius“, überlegte Rhea laut.
„Darius?“ Der schon wieder.
„Ja, kommt öfter vor.“
„Und warum?“
„Geschwisterliebe?“ Rheas Mundwinkel kräuselten sich ironisch.
Ich schlug mir die Hand vor die Stirn. „Scheiße – stimmt ja!“ Das hatte ich total vergessen. Darius war Fabios Zwillingsbruder. Das hatte Rhea vor einer Ewigkeit erwähnt. Aber die beiden waren so unterschiedlich, dass ich von allein nie auf den Gedanken gekommen wäre, dass sie verwandt sein könnten.
Ich räusperte mich schnell, da der Fletcher mahnend in unsere Richtung blickte. Gedankenverloren betrachtete ich die Karos in meinem Heft. Welche Überraschungen Dunly wohl noch alles für mich parat hielt?





























