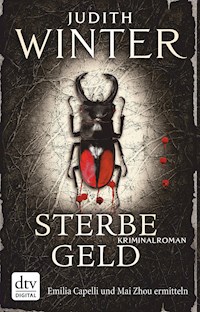
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Emilia Capelli und Mai Zhou
- Sprache: Deutsch
Ausgelöscht Ein kleiner Junge wählt den Notruf der Polizei. Er schwebt in höchster Gefahr. Doch die Polizeibeamten kommen zu spät – der Junge und seine Familie wurden kaltblütig ermordet. Acht Monate später: Die Ermittlerinnen Emilia Capelli und Mai Zhou stehen vor einer Zerreißprobe. Ein Kollege wird im Einsatz getötet. Und bald deutet alles auf eine undichte Stelle in den eigenen Reihen … Zwei Fälle von höchster Brisanz für Capelli und Zhou.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 527
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Judith Winter
Sterbegeld
Kriminalroman
dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, München
Dies ist ein Roman, auch wenn einige der in diesem Buch beschriebenen Orte tatsächlich existieren. Einige Schauplätze habe ich der Geschichte, die ich erzählen wollte, angepasst. Andere sind frei erfunden – genau wie die Personen und Ereignisse, von denen dieses Buch handelt.
Prolog
Die schönste List des Teufels ist es, uns davon zu überzeugen, dass es ihn nicht gibt …
Charles Baudelaire
Sein Atem …
Sie hört ihn, dicht an ihrem Ohr.
Nichts anderes. Nur das. Ein ruhiges, gleichmäßiges Geräusch. Dennoch dringt es bis tief ins Mark ihrer Knochen. Wie eine Punktionsnadel, die von einem unsichtbaren Chirurgen mit gnadenloser Präzision geführt wird. Ein und aus. Ein stetes An- und Abschwellen von Schmerz und Entsetzen.
»Mach die Augen auf!«
Nein, denkt sie. Ich will nicht!
Ich KANN nicht!
Der harte, kalte Lauf der Waffe in ihrem Rücken belehrt sie eines Besseren. Sie ist nicht in der Position, sich zu widersetzen. Und noch darf sie sich nicht aufgeben. Noch ist nicht alles verloren. Noch gibt es den Hauch einer Chance. Für ihren Sohn. Für sie selbst. Vielleicht kann sie ihn irgendwie aufhalten. Oder aber er geht einfach wieder, wenn das hier erledigt ist.
Das hier …
Wenn das hier erledigt ist …
Eine Welle von Eis überschwemmt ihren Körper. Was immer er vorhat.
Noch vorhat, korrigiert ihr Verstand, und sie hat alle Mühe, nicht ohnmächtig zu werden bei dem Gedanken an das, was hier, ein paar Meter von ihr entfernt, geschehen ist. So nah, dass sie fast glaubt, die Wärme spüren zu können, die noch immer von dort ausgeht. Erlöschendes Leben. Blut. Tod.
Der Gedanke an ihre kleine Tochter legt sich um ihre Kehle wie ein Eisenring. Aber sie hat auch noch etwas anderes gesehen. Etwas, das ihr einen Schimmer von Hoffnung gibt. Etwas, das seinem wachen Blick entgangen ist. Für das es sich zu kämpfen lohnt …
»Augen auf!«
Seine Stimme ist leise, fast zärtlich.
Aber das kann sie nicht täuschen. Er meint sehr ernst, was er sagt. Und wenn sie seinem Willen nicht entspricht, wird er keine Sekunde zögern, ihr das Genick zu brechen.
Ihre Augen brauchen einen Moment, um sich wieder an das Licht zu gewöhnen. Und noch immer spürt sie den Lauf der Waffe zwischen ihren Schulterblättern.
Wenn zufällig jemand da draußen im Garten stünde, denkt sie, während sich ihr Blick in die spiegelnde Scheibe der Terrassentür krallt. Dahinter klebt Novemberdüsternis. Wenn einer der Nachbarn vielleicht noch einmal vor die Tür gegangen ist, um zu rauchen oder verstreutes Spielzeug einzusammeln. Oder die Katze hereinzulassen. Sie klammert sich an den Gedanken wie ein Ertrinkender an einen Strohhalm.
Wenn irgendwer durch Zufall zu ihnen hereinsähe …
Zur Arbeitstheke. Zu dem, was er dort angerichtet hat.
Ein leises Schluchzen dringt aus ihrem Mund, es klingt so fremd, so weit entfernt, dass sie kaum realisiert, dass der Laut von ihr ausgegangen ist. Und doch bohrt sich die Waffe augenblicklich wieder fester in ihren Rücken. Wenn da jemand wäre, betet sie sich in wachsender Verzweiflung vor, wieder und wieder. Wenn nur einer unserer Nachbarn zur rechten Zeit durch die Fenster zu uns hereinschauen würde …
Mach dir nichts vor. Eure Nachbarn sind genauso berechenbar wie ihr selbst.
Milla und Andre, das nette Pärchen zur Linken, sitzen um diese Uhrzeit längst mit Chips und Bionade im Wohnzimmer, und das geht zur anderen Seite hinaus. Und Jason, ihr Sohn, ist zwar einer von den ganz Aufgeweckten, aber selbst wenn er tatsächlich noch wach sein sollte, hockt er vermutlich auf seinem Bett, das wie ein Rennwagen aussieht, und spielt auf seinem Tablet herum. So wie immer. Dafür steht Bernburgs auf der rechten Seite die Garage im Weg. Genauer gesagt sogar zwei Garagen, die haben sie absichtlich direkt nebeneinandergebaut, weil sie auf diese Weise alle ein bisschen mehr Abstand gewinnen. In dieser Gegend, wo die Parzellen klein sind und man für jeden Quadratmeter Boden ein kleines Vermögen auf den Tisch legen muss, ist das gar nicht unüblich.
Kaum zu glauben, denkt sie schaudernd, aber bei der Planung dieses Hauses haben wir Abstand und Sichtschutz noch für eine gute Idee gehalten.
Wer hätte aber auch ahnen können, dass …
Weiter kommt sie nicht, denn seine Hand, die andere, die keine Waffe hält, taucht mit einem rot-weißen Küchenhandtuch neben ihrem Kopf auf.
»Und jetzt lächle!«
Sie schüttelt verständnislos den Kopf und versucht, ihn anzusehen, doch die Hand in ihrem Nacken duldet nicht, dass sie den Kopf wendet. Sein erschreckend ruhiger Atem an ihrem Ohr ist alles, was sie von ihm mitbekommt.
»Hast du nicht gehört?«
Sie schluckt. In ihren Ohren pocht das Blut wie ein Presslufthammer. »Ich fürchte, ich verstehe nicht ganz, was …«
Seine Hand biegt ihren Kopf zurück, und zum ersten Mal an diesem Abend kann sie ihm direkt in die Augen sehen. »Und jetzt«, flüstert er, nachdem sein Blick ihr klargemacht hat, was Sache ist, »halt endlich die Klappe und lächle!«
EINS
Es ist gefährlich, anderen etwas vorzumachen, denn es endet damit, dass man sich selbst etwas vormacht.
Eleonora Duse
1Polizeieinsatzzentrale Frankfurt, 10. November 2014, 19.46 Uhr
FRAP2
Polizeinotruf.
ANRUFER
Hallo?
FRAP2
Ja, ich höre Sie … Was ist Ihr Problem?
ANRUFER
Meine Mama … Sie blutet.
FRAP2
Es tut mir leid, aber ich kann dich kaum verstehen. Du musst lauter sprechen.
ANRUFER
Das geht nicht.
FRAP2
Wieso nicht?
ANRUFER
Sie können mich hören.
FRAP2
Wer?
ANRUFER
Sie sind unten. Sie müssen herkommen … BITTE!
FRAP2
Keine Sorge. Es wird alles wieder gut. Ich schicke sofort jemanden los, der euch hilft. Aber du musst jetzt ganz ruhig bleiben, okay? … Sag mir, wie du heißt!
ANRUFER
Leon.
FRAP2
Wie alt bist du, Leon?
ANRUFER
Sechs.
FRAP2
Du machst das ganz toll, Leon. Und jetzt verrätst du mir auch noch deinen Nachnamen, ja?
ANRUFER
Svensson. Leon Svensson. Aber … Sie müssen herkommen … Schnell! Es geht ihr schlecht!
FRAP2
Du meinst deine Mama?
ANRUFER
Ja.
FRAP2
Okay, Leon, wo seid ihr, du und deine Mama?
ANRUFER
Zu Hause.
FRAP2
Ist sonst noch jemand bei euch?
ANRUFER
Papa. Und Pippa. Aber sie antwortet nicht.
FRAP2
Wer ist Pippa?
ANRUFER
Meine Schwester.
FRAP2
Wie alt ist sie?
ANRUFER
…
FRAP2
Leon? Hörst du mich? … Rede mit mir!
ANRUFER
Drei … Pippa ist drei, aber … Sie bewegt sich nicht. Und … Mama weint.
FRAP2
Keine Angst, Leon. Meine Kollegen sind schon unterwegs. Sie sind gleich bei euch. Weißt du, wie die Straße heißt, in der ihr wohnt?
ANRUFER
Spenderstraße.
FRAP2
Prima. Und weißt du auch die Hausnummer?
ANRUFER
Sechzehn.
FRAP2
Okay, super. Du machst das richtig gut … Ist das ein Haus oder eine Wohnung?
ANRUFER
Ein Haus.
FRAP2
Wo bist du gerade?
ANRUFER
In meinem Zimmer.
FRAP2
Ist das im ersten Stock?
ANRUFER
Ja.
FRAP2
Und deine Mama ist unten?
ANRUFER
Ja. Sie weint.
FRAP2
Hör mir jetzt gut zu, Leon. Du rührst dich nicht von der Stelle, bis die Polizisten bei euch sind, hast du mich verstanden? Geh auf gar keinen Fall nach unten, ganz egal, was passiert! Hörst du?
ANRUFER
…
FRAP2
Leon?
ANRUFER
Mama!
FRAP2
Keine Sorge, die Kollegen sind gleich bei euch. Und dann helfen sie deiner Mama, versprochen. Aber du musst jetzt unbedingt weiter mit mir reden, verstehst du? So kannst du deiner Mama am besten helfen und …
ANRUFER
(flüsternd) Ich glaube, er kommt hier rauf …
FRAP2
Wer? Dein Vater?
ANRUFER
(flüsternd) Er ist auf der Treppe.
FRAP2
Weißt du, wie man eine Tür abschließt?
ANRUFER
(flüsternd) Ja. Aber … Da ist kein Schlüssel drin.
FRAP2
Okay, Leon, hör mir zu: Du nimmst jetzt das Telefon und versteckst dich! Hast du verstanden? Such dir irgendeinen Platz, wo er dich nicht sehen kann. Unter dem Bett, zum Beispiel.
ANRUFER
Aber …
FRAP2
Tu, was ich dir sage! Schnell!
ANRUFER
…
FRAP2
Leon?
ANRUFER
…
FRAP2
Leon, hörst du mich?
ANRUFER
…
FRAP2
Leon!
2Frankfurt-Eschborn, Spenderstraße, 10. November 2014, 19.58 Uhr
Von außen wirkte das Haus völlig normal. Hinter den hohen Fenstern brannte Licht, vor der Garage parkte ein silberner Audi, und neben der Haustür hing ein auf alt getrimmtes Holzschild mit der Aufschrift WILLKOMMEN. Daneben stand ein Weidenkorb mit Zierkürbissen.
Nichts wies auch nur im Geringsten darauf hin, dass hier erst vor wenigen Minuten etwas Schlimmes geschehen sein sollte. Und doch empfand Polizeihauptmeister Nico Kröger eine diffuse Bedrohung, als er gemeinsam mit seiner Kollegin Tonja Frentsch auf die erleuchtete Haustür zuging. Kröger war Mitte dreißig und wahrhaftig nicht gerade das, was man zart besaitet nannte. Umso mehr erstaunte ihn die Gänsehaut, die sich beim Anblick des Hauses auf seinem ganzen Körper breitmachte, obwohl es für Mitte November außergewöhnlich mild war.
»Kannst du irgendwas hören?«, fragte Tonja, und ihm fiel auf, dass sie ungewohnt leise sprach.
Vielleicht spürte sie das Gleiche wie er …
Er schüttelte den Kopf und machte ihr ein Zeichen zu klingeln.
Sie trat einen Schritt zurück, während der angenehm warme Dreiklang in der Stille des Hauses verhallte.
Eine gehobene Gegend. Neue Häuser mit neuen Carports und teuer angelegten Gärten, in denen Markenspielgeräte und TÜV-geprüfte Hüpfburgen um die Aufmerksamkeit des verwöhnten Nachwuchses buhlten. Kurzum: eine Gegend für junge Familien, in deren Leben Geld bestenfalls eine untergeordnete Rolle spielte.
»Soll ich noch mal?«, fragte Tonja, und Kröger registrierte die Anspannung in ihrer Stimme, auch wenn sie sich alle Mühe gab, cool zu klingen.
Er nickte und sah an der Fassade von Nummer Sechzehn hinauf. In den Katalogen des Bauträgers lief dieses quadratische graue Etwas bestimmt unter der Rubrik »moderne Stadtvilla«, doch Kröger empfand die puristische Schlichtheit als seelenlos. Was wird der Kasten gekostet haben?, überlegte er, während auch das neuerliche Klingeln seiner Kollegin nicht die leiseste Reaktion im Inneren des Gebäudes hervorrief. Dreihundertfünfzig- oder vierhunderttausend? Ohne Grundstück, verstand sich. Denn dafür legte man in dieser Gegend locker noch mal hundertachtzigtausend auf den Tisch.
Vielleicht doch ein Einbruch, dachte Kröger, und überrascht stellte er fest, dass er diese Vorstellung entschieden beruhigender fand als … Ja, als was eigentlich? Er fühlte, wie seine Kiefermuskulatur verkrampfte.
»Es könnte auch ein Fall von häuslicher Gewalt vorliegen«, hatten die Kollegen in der Einsatzzentrale angemerkt. »Zumindest befindet sich offenbar auch der Familienvater im Haus.«
Warum ist es dann so still?, dachte Kröger mit wachsender Beunruhigung, während sein Blick an einem schmalen Fenster im Obergeschoss hängen blieb. Diese Stille war geradezu gespenstisch. Als ob eine finstere Macht einen Bann über diesen Ort gesprochen hätte. Zugleich hatte er das Gefühl, beobachtet zu werden, ohne dass sein Verstand auch nur das geringste Indiz gefunden hätte, das diese Annahme unterstützte.
»Seltsam, findest du nicht?«, bemerkte Tonja in diesem Augenblick, und Kröger registrierte, dass sie kurz über ihre Schulter blickte. Zur Straße, wo ihr Wagen stand.
»Was meinst du?«
Sie schüttelte den Kopf. »Keine Ahnung. Es ist nur … Ich hab irgendwie kein besonders gutes Gefühl bei der Sache.«
Ich auch nicht, dachte er. Doch das behielt er lieber für sich. »Sehen wir uns mal dahinten um!«, entschied er stattdessen.
»Okay.«
An der Schmalseite des Hauses führte ein gepflasterter Weg in den rückwärtigen Garten. Kröger ging voran, und instinktiv tastete seine rechte Hand nach dem Verschluss seines Holsters.
Die Sträucher, die das große, leicht abschüssige Grundstück begrenzten, würden noch ein paar Jahre brauchen, bis sie einen echten Sichtschutz boten. Und auch der Rollrasen war offenkundig erst im letzten Sommer verlegt worden. Mit seinen noch immer klar erkennbaren Bahnen wirkte er entschieden provisorisch. Fast so, als ob man ihn jederzeit wieder einrollen und mitnehmen könnte, wenn man zum Beispiel fliehen musste.
Kröger runzelte die Stirn. Er neigte nicht zu drastischen Assoziationen. Aber irgendetwas an diesem Haus machte ihm Angst. So viel stand fest …
Automatisch suchte sein Blick die Nachbargrundstücke ab. Denn das hier war mitnichten eine Alleinlage. Im Gegenteil: In einer Gegend wie dieser war man von allen Seiten umgeben von Menschen, und genau das spürte man auch. Oder? Er lauschte. Doch bis auf ein entferntes Motorengeräusch war nichts zu hören.
Zögernd ging er weiter.
Die Außenbeleuchtung wurde über Bewegungsmelder gesteuert, der hintere Teil des Gartens zusätzlich von einer Reihe futuristisch anmutender Laternen erhellt. Und auch das Haus selbst schien vom Erdgeschoss bis unters Dach hell erleuchtet zu sein. Ein Umstand, der sich für Kröger nur sehr schwer mit den Informationen in Einklang bringen ließ, die sie erhalten hatten.
Im Laufe der Jahre war er zu unzähligen Fällen von häuslicher Gewalt gerufen worden, und seine Erfahrung hatte ihn gelehrt, dass nach dem Sturm in der Regel eine ganz spezielle Form von Ruhe einkehrte. Oft nutzten die Täter die Minuten, die nach einem Notruf zwangsläufig vergingen, um Ordnung zu schaffen. Um Blut fortzuwischen und das zerbrochene Geschirr zusammenzufegen. Und nicht zuletzt auch dazu, ihre Ehefrauen auf eine gemeinsame Version der Geschehnisse einzuschwören.
Aber traf das auch in diesem Fall zu?
War es im Haus mit der Nummer Sechzehn deshalb so still?
Hier ist viel zu viel Licht, dachte Kröger unbehaglich. Irgendetwas stimmt da nicht! Und auch mit Ruhe nach dem Sturm hatte das hier nur bedingt zu tun. Die Ruhe, die er meinte, war geprägt von schlechtem Gewissen, einer unterschwelligen Hektik und dem Bestreben, beim Eintreffen der Polizei eine möglichst glaubhafte Vorstellung abgeben zu können. Doch über diesem Haus hier … Über diesem Haus lag etwas Lauerndes.
Die Formulierung, die sein Verstand gewählt hatte, ließ Kröger leise erschauern.
Etwas Lauerndes, Böses …
Irgendeine dunkle Macht, die hinter diesen kahlen grauen Mauern gewütet hatte und deren Schatten noch immer da war, spürbar, mitten in diesem Meer von Licht.
An der Hausecke blieb Kröger stehen. Aus den Augenwinkeln sah er, dass seine Kollegin ihre Waffe gezogen und entsichert hatte. Nach allem, was die Leitstelle ihnen mitgeteilt hatte, war der Notruf durch einen Jungen erfolgt. Durch ein Kind. Der Gedanke verstärkte das Brennen, mit dem sein Magen üblicherweise auf erhöhten Stress reagierte, doch Kröger schob ihn beiseite. Genau wie das Bild seines kleinen Sohnes, das für einen Augenblick vor ihm aufblitzte. Er musste sich auf die Fakten konzentrieren. Alles andere war nicht nur sinnlos, sondern im Zweifelsfall sogar gefährlich.
Der Junge, der in diesem Haus lebte, hatte die 110 gewählt und gesagt, seine Mutter sei verletzt. Er sprach von Blut und von einer Schwester, die sich nicht bewegte. Die Kollegen in der Einsatzzentrale hatten die Sache sehr ernst genommen. Und die wussten in aller Regel sehr gut einzuschätzen, wann es tatsächlich brannte – und wann sich jemand lediglich einen Scherz erlaubte.
Kröger spähte um die Ecke. Eine Terrasse aus Teakholz. Und bodentiefe Fenster.
Sie sind unten …
Hinter sich hörte er die angespannten Atemzüge seiner Kollegin. Er bedeutete ihr, ihm zu folgen, und ging auf die erste der beiden Terrassentüren zu. Dahinter erkannte er eine elegante graue Couchgarnitur und an der Wand gegenüber einen riesigen Flatscreen-Fernseher.
Gardinen? Fehlanzeige.
Ein Leben auf dem Präsentierteller …
Der Junge, der den Notruf gewählt hatte, war in großer Angst gewesen. Obwohl die Kollegin in der Zentrale alles getan hatte, um ihn zu beruhigen, war es ihr nicht gelungen. Wieder und wieder hatte der Sechsjährige beteuert, dass in seinem Elternhaus Schlimmes geschehe. Und irgendwann hatte er nicht mehr geantwortet …
Vielleicht ist er den Anweisungen der Kollegin gefolgt und hat sich versteckt, überlegte Kröger. Doch wenn er ehrlich war, glaubte er nicht daran. Laut Protokoll hatte die Telefonverbindung noch exakt 105 Sekunden bestanden, nachdem Leon Svensson der Beamtin zum letzten Mal geantwortet hatte. Erst dann war sie aus bislang ungeklärtem Grund unterbrochen worden.
105 Sekunden, echote es hinter Krögers Stirn.
Und: Sie sind unten …
Er trat noch dichter an die Tür und spähte durch die blank geputzte Scheibe. Aber auch hier war auf den ersten Blick nichts Auffälliges zu entdecken. Alles schien teuer, sauber und aufgeräumt.
»Vielleicht war es doch falscher Alarm.« Die Hoffnung in der Stimme seiner Kollegin klang brüchig.
Kröger sparte sich eine Erwiderung und klopfte laut und vernehmlich gegen das Glas. »Hallo? Jemand zu Hause?«
Wie erwartet rührte sich nichts.
»Polizei«, rief Kröger, noch lauter als zuvor. »Bitte öffnen Sie!«
»Versuchen wir’s dahinten«, schlug Tonja vor und wies mit dem Kinn auf die zweite Terrassentür.
Er nickte, auch wenn ihnen beiden klar war, dass man seine Rufe überall im Haus gehört hatte.
Genau wie zuvor die Klingel …
Kröger sah auf die Uhr. Seit Eingang des Notrufs waren exakt siebzehn Minuten vergangen. Nicht wirklich viel Zeit. Aber er wusste nur zu gut, was in siebzehn Minuten alles geschehen konnte.
Eine Veränderung in Tonjas Haltung ließ ihn aufmerken. »Was ist?«
Seine Kollegin hatte sich an ihm vorbeigeschoben und blickte durch die Glastür in eine riesige offene Küche. »Da drüben!« Ihre Stimme wollte ihr nicht länger gehorchen. »Bei der Theke!«
Vor einer Kochtheke, die ein Vermögen gekostet haben musste, standen mehrere Barhocker mit bunten Ledersitzen. Unter einem von ihnen lag eine reglose Gestalt. Das Kind trug einen bunten Teddy-Schlafanzug und wirkte geradezu winzig im Schatten der monströsen Arbeitstheke. Wie eine Puppe, die irgendwer achtlos in eine Ecke geschleudert hatte.
Kröger zögerte keine Sekunde. Er riss eine der Steinplatten an sich, die die Kräuterspirale im hinteren Teil der Terrasse begrenzten, und schleuderte sie mit voller Wucht gegen die Scheibe. Die Fenster waren dreifach verglast, und er brauchte mehrere Versuche. Dann endlich zerbarst die Scheibe in tausend Scherben.
»Oh, mein Gott!«, rief Tonja und stürzte zu dem leblosen kleinen Körper.
Doch für das Mädchen im Teddy-Schlafanzug kam jede Hilfe zu spät. Und auch der Mann, der auf der Rückseite der Theke in seinem Blut lag, war bereits seit mindestens einer halben Stunde tot.
Kröger hob seine Waffe und richtete sie auf die einzige Tür, die sich etwa auf Höhe des Essbereichs befand. Vermutlich führte sie in die Diele des Hauses. »Ruf Verstärkung!«
Seine Kollegin nickte und tastete mit zitternder Hand nach ihrem Funkgerät, doch was sie sagte, nahm Kröger nur noch am Rande wahr. Zu sehr war er bereits mit der Frage beschäftigt, die aus der Spurenlage hier unten zwangsläufig folgte: Wenn der Mann dort hinter der Theke der Vater war, vor wem, um Gottes willen, hatte sich Leon Svensson dann derart gefürchtet?
Er ist auf der Treppe …
Kröger hielt den Atem an und öffnete die Schiebetür, die wie erwartet in die Diele führte. In seinen Adern pulste das Adrenalin. Die Kollegin in der Zentrale hatte gesagt, dass der Junge zuletzt im ersten Stock gewesen sei. In seinem Zimmer.
Krögers Finger schlossen sich fester um den Griff seiner Waffe.
Die breite Treppe, die ins Obergeschoss hinaufführte, war genauso schnörkellos wie der Rest des Hauses. Aber … Er stutzte. War das nicht Blut, dort auf der dritten Stufe?
Das Hämmern in seinem Brustkorb wurde stärker. Es schienen nur ein paar Tropfen zu sein, doch weiter oben entdeckte er noch eine Stelle, die verdächtig aussah. So, als ob sich eine verletzte Person in einem unbeobachteten Moment die Treppe hinaufgeflüchtet hätte, nicht ahnend, dass die Blutstropfen auf den Stufen ihre Anwesenheit verrieten.
Was hat dieser elende Bastard hier bloß angestellt?, durchfuhr es Kröger, als seine Augen unvermittelt an der Haustür hängen blieben.
»Was ist da?«, flüsterte Tonja, die in diesem Moment aus dem Wohnzimmer trat, die Waffe im Anschlag und das Funkgerät noch am Ohr.
Anstelle einer Antwort zeigte Kröger auf das milchige Glas, auf dessen Rückseite man vage die Umrisse des Weidenkorbs erahnen konnte. »Die Tür ist auf.«
Tonja verstand die Bedeutung seiner Worte sofort, und er konnte die Schockwelle ihrer Erschütterung beinahe körperlich spüren.
»Ja«, nickte Kröger. »Wer immer das getan hat: Er war noch hier, als wir ankamen …«
3Frankfurt-Eschborn, Spenderstraße, 10. November 2014, 21.51 Uhr
»Sind Sie okay?«
Nico Kröger nickte.
Doch sie wussten beide, dass sie sich etwas vormachten.
Kriminalhauptkommissar Hartmut Rosenthal setzte sich neben seinen jungen Kollegen auf den Rand der Kräuterspirale vor der Haustür. Wir halten es beide nicht aus, in diesem Haus zu bleiben, dachte er. Nicht nach allem, was diese Bestie da drin angerichtet hat. Vier Tote.
Erik Svensson (37), Investmentberater.
Seine Frau Sonja (34), eine studierte Kunsthistorikerin.
Und die gemeinsamen Kinder Pippa (3) und Leon (6).
Rosenthal wusste, er würde die Bilder der leblosen Körper nie wieder loswerden. Dabei war er sonst durchaus nicht zimperlich. Oder leicht zu erschrecken. Aber da war dieser Ausdruck im Gesicht der ermordeten Frau. Der unauslöschliche Ausdruck von blankem Entsetzen in den erstarrten Pupillen.
Dabei hatte der Täter Sonja Svensson aller Wahrscheinlichkeit nach weder gefoltert noch vergewaltigt, das hatte der Notarzt ihnen – natürlich mit der üblichen Vorsicht – bereits bestätigt. Rein körperlich war die junge Mutter bis auf die Würgemale, die ihr Mörder ihr zugefügt hatte, unversehrt. Und doch musste sie in ihrem Zuhause, das eigentlich ein sicherer Ort sein sollte, höllische Qualen ausgestanden haben.
Rosenthal zog eine Schachtel Zigaretten aus der Manteltasche und hielt Kröger die Packung unter die Nase.
Doch der schüttelte nur den Kopf.
Hinter ihnen, im Haus, arbeiteten die Kollegen von der Spurensicherung auf Hochtouren. Der tote Familienvater und seine kleine Tochter lagen im Erdgeschoss. Rosenthal fröstelte, als das Bild des blutüberströmten Mädchens vor ihm aufblitzte. Die Leiche der Frau hatten sie im ehelichen Schlafzimmer im ersten Stock gefunden. Im Zimmer daneben ihren Sohn. Leon. Seit bei seiner Mutter im Zuge ihrer zweiten Schwangerschaft Diabetes diagnostiziert worden war, hatte er gewusst, wie man den Notruf wählt. Rosenthal hatte sich die Aufzeichnung bereits angehört. Ein tapferer kleiner Junge. Im nächsten Sommer wäre er in die Schule gekommen …
Hör auf!, schalt er sich, während er dem Rauch seiner Zigarette nachblickte. Diesen Job kann man nur bewältigen, wenn man es schafft, Distanz zu halten. Distanz zu all dem Grauen. Und zu den Bildern, die dazu neigen, sich irgendwo tief im Kopf festzusetzen …
Der junge Kollege von der Streife rieb sich die Stirn. »Ihr Körper war …«
Rosenthal hob den Kopf. »Was?«
»Der Körper der Frau«, wiederholte Kröger, kaum hörbar. »Er war noch warm, als der Notarzt ihn …«
»Ich weiß«, nickte Rosenthal.
»Wenn wir gleich bei unserer Ankunft diese verdammte Haustür aufgebrochen hätten …« Er brach ab und hustete trocken. »Wenn wir sofort hineingegangen wären, anstatt uns mit der Terrasse aufzuhalten …«
Rosenthal zog an seiner Zigarette, während er seinen Blick über die Lampen im hinteren Teil des Gartens gleiten ließ. Ein hartes, kaltes Licht. »Das hätte nichts genützt. Sie war bereits tot.«
»Und wenn nicht?« In Krögers Augen lag pure Verzweiflung. Und die stumme Bitte: Erlös mich. Sag mir etwas, das mir hilft!
»Fahren Sie nach Hause.«
Der junge Kollege rührte sich nicht von der Stelle.
Hat das wirklich noch sein müssen?, durchfuhr es Rosenthal, während er sich im selben Atemzug für den Gedanken schämte. So kurz vor der Pensionierung? Auf der Zielgeraden meiner Karriere? Ein solcher Fall?
Eine komplette Familie ausgelöscht.
Vier Menschen, die sich niemals etwas hatten zuschulden kommen lassen.
Zumindest sah es auf den ersten Blick so aus. Rosenthal verzog das Gesicht. In seiner langen Karriere war er ausgesprochen vorsichtig geworden, was diese Dinge anging. Auch wenn die ersten Aussagen von Nachbarn und Bekannten eine ziemlich eindeutige Sprache sprachen: Nett seien sie gewesen, die Svenssons. Hilfsbereit und aufgeschlossen. Gute Eltern obendrein. Stets bemüht, alles richtig zu machen.
Rosenthal seufzte und schielte wieder zu Nico Kröger hinüber. Der Junge würde zusammenbrechen, kein Zweifel. Die Frage war nur, wann …
»Fahren Sie jetzt heim«, wiederholte er mit Nachdruck. Und nach kurzem Zögern fügte er hinzu: »Sie brauchen sich keine Vorwürfe zu machen. Sie haben getan, was Sie konnten.«
Aus Krögers Kehle stieg ein heiseres Lachen auf, und trotz der ungemütlichen Temperaturen stand ein feiner Schweißfilm auf seiner Stirn.
Rosenthal stand auf und trat seine Zigarette aus. »Ich muss wieder rein«, erklärte er. »Bleiben Sie, wo Sie sind, ich schicke Ihnen einen Arzt …«
Nun sah Kröger doch hoch. »Ich brauche keinen Arzt.«
»Doch«, entgegnete Rosenthal, ohne sich noch einmal zu dem jungen Kollegen umzudrehen. »Glauben Sie mir …«
Acht Monate später …
4Frankfurt Hauptfriedhof, Trauerhalle, 7. Juli 2015, 16.46 Uhr
Die Trauerhalle des Frankfurter Hauptfriedhofs verfügte über einhundertfünfzig Sitzplätze, und an diesem heißen Nachmittag im Juli blieb kein einziger von ihnen frei. In jeder Nische und sogar in den Ein- und Durchgängen drängten sich Menschen: Freunde. Kollegen. Nachbarn. Sie alle waren gekommen, um Thorsten Mohr die letzte Ehre zu erweisen.
Der junge Beamte der Sonderermittlungsgruppe »Calibri« war am vergangenen Donnerstag im Zuge einer missglückten Razzia erschossen worden. Während seine Kollegen die Lagerräume eines Kaufhauses nach illegalen Waffen durchsucht hatten, war Mohr einem Verdächtigen auf das Dach des Gebäudes gefolgt und dort in einen Hinterhalt geraten. Und wie immer, wenn ein Polizist in Ausübung seines Dienstes den Tod gefunden hatte, schlugen die Emotionen hohe Wellen: Seit Tagen standen die Telefone nicht still. Hinweise gingen ein, und wildfremde Menschen bekundeten ihre Anteilnahme und ihr Entsetzen. Doch nicht einmal die Organisatoren des Gedenkgottesdienstes hatten offenbar mit einer derart großen Anzahl Trauergäste gerechnet.
Kriminalhauptkommissarin Emilia Capelli, genannt Em, schielte nach links, wo einer der Ordner mit angespannter Miene in sein Headset sprach. Während er auf Antwort wartete, wanderten seine Blicke aufmerksam von Tür zu Tür, was sie in dem beunruhigenden Gefühl bestärkte, dass irgendetwas nicht stimmte. Schon bei ihrer Ankunft hatte sie den Eindruck gehabt, dass jenseits der allgemeinen Trauer und Betroffenheit noch etwas anderes lauerte. Etwas, das sich einfach nicht greifen ließ. Doch bislang war es ihr nicht gelungen, der Ursache ihrer Empfindungen auf die Spur zu kommen.
Sie atmete tief durch und sah hinauf zu der über dreißig Meter hohen Kuppel des Gebäudes, die entfernt an das römische Pantheon erinnerte. Durch die runden Fenster fiel strahlendes Sonnenlicht herein und tauchte die dunklen Rücken der Trauernden in lichte Streifenmuster.
Ein paar Reihen vor ihr saß Zhou neben Alexander Decker und dessen Partner Carsten Pell. Beide gehörten derselben Ermittlungsgruppe an wie der Verstorbene, und ihre Gesichter verrieten, dass ihnen durchaus bewusst war, wie knapp sie selbst erst vor wenigen Tagen dem Tod entronnen waren.
Ems Blick glitt weiter, den Gang entlang. Direkt vor dem Altar war der Sarg aufgebahrt, ein schlichtes Modell aus hellem Holz, das inmitten der zahllosen Kränze und Gestecke fast ein wenig verloren wirkte. Am Mikrofon gaben sich unterdessen die Redner die Klinke in die Hand. Der Bürgermeister hatte bereits gesprochen. Und der Polizeipräsident. Dazu Vertreter des Landtags und der Polizeigewerkschaft. Augenblicklich war Norman Kusch an der Reihe, Mohrs Vorgesetzter. Er lobte den jungen Beamten als ehrgeizigen Ermittler und beliebten Kollegen und pries auch Mohrs soziales Engagement, insbesondere für schwerkranke Kinder und deren Familien.
»Als unmittelbar Betroffener«, sagte Kusch, den der unaufgeregt-sachliche Tonfall seiner Ansprache spürbar Mühe kostete, »setzte Thorsten Mohr sich besonders für die Belange von Eltern ein, die durch die lebensbedrohliche Erkrankung eines ihrer Kinder täglich vor neuen, schwierigen Herausforderungen stehen.«
Sein Blick suchte die Witwe, die sich für Ems Empfinden bemerkenswert tapfer hielt. Martina Mohr trug ein schlichtes schwarzes Etuikleid und war entgegen aller Erwartungen tatsächlich in Begleitung ihrer Kinder gekommen. Dass sie den beiden die schmerzvolle Prozedur des öffentlichen Abschiednehmens nicht ersparte, würde garantiert nicht nur auf Beifall stoßen, doch Em konnte nicht umhin, Martina Mohrs Mut zu bewundern. Neben ihr presste die sechsjährige Ann-Christin mit steinerner Miene einen bunten Stoffhasen an sich, während die Finger ihres dreijährigen Bruders immer wieder an den Gurten seiner Atemmaske zupften. Em wusste, dass der Junge an Mukoviszidose litt, jener tückischen Stoffwechselerkrankung, die in Deutschland Jahr für Jahr bei rund 200 Neugeborenen diagnostiziert wurde und gegen die es – zumindest bislang – noch kein Heilmittel gab.
Von Zeit zu Zeit griff Martina Mohr nach den Händen ihres Sohnes und legte sie sanft auf die Lehnen seines Rollstuhls zurück. Es waren die ruhigen, liebevollen Gesten einer Frau, die an Ausnahmesituationen gewöhnt und sich ihrer Verantwortung bewusst war.
Wie viele Schicksalsschläge verkraftet ein Mensch?, überlegte Em, während sich nun auch Norman Kusch vom Rednerpult verabschiedete. An seiner Stelle trat wieder der Pastor ans Mikrofon. Die Anwesenden erhoben sich zu seinem kurzen Gebet. Dann schulterten die acht Sargträger – allesamt uniformierte Polizisten – die sterblichen Überreste Thorsten Mohrs und trugen den Sarg zu dem vor der Halle wartenden Leichenwagen. Die Trauergemeinde folgte in gebührendem Abstand. Martina Mohr schob den Rollstuhl ihres Sohnes vor sich her, während sich eine ältere Dame, vermutlich eine der Großmütter, um ihre kleine Tochter kümmerte.
In einem Pulk junger Männer entdeckte Em ihren alten Freund Tom Ahrens, mit dem sie in der Zeit ihrer Ausbildung manch lustigen Abend verbracht hatte. Er schien frisch vom Friseur zu kommen und blinzelte angestrengt in das helle Sommerlicht vor der Halle. Und so tragisch der Anlass, so profan war der Gedanke, der Em bei seinem Anblick durch den Kopf ging: Um ein Haar hätte Tom Zhous Platz eingenommen …
Dann wären wir Kollegen gewesen.
Mehr noch: Partner.
Doch Makarov hatte Mai Zhou den Vorzug gegeben, und Tom hatte sich notgedrungen anderen Aufgaben zugewandt. In der Abteilung für Rauschgiftdelikte war Thorsten Mohr einer seiner engsten Kollegen gewesen, und auch für Tom galt, dass er an diesem Tag nicht nur einen Freund zu Grabe trug, sondern zugleich sein eigenes Überleben feierte. Eine Erkenntnis, die Em einen leisen Schauer über den Rücken jagte.
»Frierst du?«, hörte sie eine Stimme hinter sich fragen.
Decker …
»Nein«, entgegnete sie hastig.
»Du siehst aber so aus.«
»Mir ist nicht kalt, okay?« Ihr Ton war schroff, aber sie riss sich zusammen, als sie in das ungewohnt fahle Gesicht ihres Kollegen blickte. »Alles klar bei dir?«
»Sicher. Ich muss nur endlich raus hier. Diese verbrauchte Luft schlägt einem total auf den Kreislauf …«
Em nickte zustimmend, auch wenn sie beide wussten, dass die verbrauchte Luft nicht sein Problem war. »Ein bisschen Sonne wird uns guttun.«
Decker nickte. Irgendwann murmelte er: »Wir haben zusammen gegessen, an dem Mittag. Thorsten hatte ’ne Pizza mit doppelt Käse und meinte noch, das gibt Kraft.« Sein Lachen klang verloren. »Und ein paar Stunden später sind wir zusammen da rein, verstehst du?«
Em hatte nicht die leiseste Ahnung, was sie sagen sollte. Also schwieg sie. Ganz abgesehen davon, dass es manchmal tatsächlich besser war, wenn man einfach die Klappe hielt.
»Gottverdammte Scheiße, so was«, knurrte Decker, als sie das Kondolenzbuch passierten, das neben dem Eingang auslag.
»Ja«, sagte Em und betrachtete das Porträtfoto Thorsten Mohrs, das hinter dem aufgeklappten Buch stand. »So kann man das ausdrücken.«
In der Traueranzeige war das Spendenkonto der Deutschen Gesellschaft zu Bekämpfung von Mukoviszidose vermerkt worden. Doch Em wusste, dass es auch noch eine interne Sammlung zugunsten der Hinterbliebenen gegeben hatte. Nach allem, was sie gehört hatte, würde Norman Kusch der Witwe im Anschluss an die Trauerfeier einen Scheck überreichen. Geld, das Martina Mohr unter Garantie gut gebrauchen konnte. Klinikaufenthalte und diverse Spezialtherapien verschlangen dem Vernehmen nach Unsummen.
»Thorsten hätte an dem Tag eigentlich frei gehabt«, bemerkte Decker, der Ems Gedanken zu erraten schien. »Aber er war immer froh, wenn er bezahlte Überstunden machen konnte.«
»Was man so Überstunden nennt«, versetzte ein großgewachsener Kahlkopf, der neben ihnen ging und die letzte Bemerkung aufgeschnappt hatte.
Decker war augenblicklich auf hundertachtzig. »Was willst du damit andeuten?«, schnappte er, indem er sich drohend vor dem Glatzkopf aufbaute.
Doch der schien nicht so leicht zu beeindrucken zu sein und reckte angriffslustig das Kinn vor. »Komm wieder runter, ja? Ist doch schließlich nichts Neues, was ich sage.«
Bevor Em reagieren konnte, hatte ihr Kollege den Mann bereits am Revers gepackt. »Hast du irgendein Problem, Freundchen? Oder bist du bloß eins von diesen perversen Arschlöchern, denen es Laune macht, einen Kollegen zu diffamieren, der sich nicht mehr verteidigen kann?«
Der Angegriffene schlug Deckers Hände weg. Sein Gesicht war knallrot. »Wag es noch ein einziges Mal, mich anzufassen!«
»Und ob ich das wage!« Ihr Kollege sah aus, als wollte er auf den Mann losgehen, doch Em bekam ihn an der Schulter zu fassen.
»Alex!«, mahnte sie sanft, aber eindringlich. »Das bringt doch nichts.«
»Dieser Bastard beleidigt einen Mann, der mein Freund gewesen ist«, echauffierte sich Decker, während die Menschentraube in ihrem Rücken immer größer wurde. Das hier roch nach Ärger, und den ließen die Leute sich auch bei einer solchen Gelegenheit nur ungern entgehen. »Thorsten ist noch nicht mal unter der Erde, und diese Scheißkerle fangen schon an, mit Dreck zu werfen.«
»Genau das ist der Punkt«, hörte Em in diesem Moment die ruhige, angenehm tiefe Stimme ihrer Partnerin hinter sich. »Es ist Dreck, Alex, nichts weiter. Und es ist deines verstorbenen Freundes nicht würdig, dass du auf so was überhaupt reagierst.«
Em, die das aufbrausende Temperament ihres Kollegen kannte, erwartete Widerspruch. Doch zu ihrer Überraschung beruhigte sich Decker. Er schaute an ihrer Schulter vorbei, und sie konnte förmlich zusehen, wie sich seine markanten Züge entspannten.
»Du hast recht«, erwiderte er. »Der Mist, den dieser Scheißkerl verzapft, ist nicht der Rede wert.« Dann warf er dem Pöbler einen letzten, verächtlichen Blick zu, zupfte sein Jackett zurecht und wandte sich ab.
Carsten Pell trat neben ihn und legte ihm beruhigend die Hand auf den Arm. »Hey, Mann. Idioten gibt es überall. Und schließlich wissen wir beide, wie die Wahrheit aussieht.« Er wandte sich Em zu. »Wir treffen uns später übrigens noch im Penny Lane, um auf Thorsten anzustoßen. Bist du dabei?«
»Na, klar.« Sie lächelte ihm zu. »Ist doch Ehrensache.«
Decker sah hoch. »Kommst du auch?«
Die Frage richtete sich an Zhou, doch die schüttelte den Kopf. War ja klar, dachte Em mit einem Anflug von Ärger. Wann immer es auch nur entfernt auf Zwischenmenschliches hinausläuft, kneift sie!
»Ich habe Nachtdienst.«
»Schade«, sagte Decker.
»Ja«, nickte Zhou. »Das finde ich auch.«
Em glaubte ihr kein einziges Wort.
5JVA Frankfurt I, Besucherraum, 7. Juli 2015, 16.59 Uhr
Das Gespräch begann wie aus dem Lehrbuch.
Karel Schubert erledigte die Formalitäten, passierte ohne Probleme die Sicherheitskontrollen und wurde von einem Vollzugsbeamten in einen schmucklosen Besucherraum der JVA Frankfurt I geführt, wo der Untersuchungshäftling mit der Haftnummer G1–104 bereits auf ihn wartete.
Karel nahm auf dem grauen Plastikstuhl Platz, stellte seine Aktentasche neben sich auf den Boden und entnahm ihr eine Mappe mit Dokumenten, die er vor sich auf den Tisch legte. »Guten Tag, Herr Bormann.«
»Tag.«
»Mein Name ist Karel Schubert.«
Der Mann im grauen Sweatshirt verzog keine Miene. Sein Blick war klar und konzentriert, dabei jedoch zu keiner Zeit unangenehm oder aufdringlich. Im Gegenteil: Armin Bormann wirkte wie der nette Nachbar von nebenan. Distanziert und zugleich seltsam vertraut. Jemand, den man schon sein halbes Leben kennt, ohne ihm je wirklich nahegekommen zu sein, den man flüchtig grüßt, wenn man ihm auf der Straße begegnet, und der spontan und unkompliziert mitanpackt, wenn man eine Waschmaschine geliefert bekommt und keine Ahnung hat, wie man das sperrige Monster in seinen Keller bugsieren soll. Einer wie du und ich, dachte Karel mit einem Anflug von Irritation, und ihm fiel ein, dass er in der Akte gelesen hatte, Bormann habe noch am Tag seiner Festnahme die Schaukel der Nachbarskinder repariert.
Zwei Kinder …
Ein Garten mit Spielgeräten …
Eine Schaukel und ein Trampolin …
Karel zuckte innerlich zusammen, als unvermittelt wieder Fragmente der Tatortfotos vor seinem inneren Auge aufblitzten: Die riesige Blutlache in der Küche. Daneben ein vergessenes Spielzeugauto, ein gelber Truck. Der leblose kleine Körper in einem Schlafanzug mit Teddybären. Und die schreckensstarren Augen Sonja Svenssons, deren Entsetzen die Kamera der KTU-Techniker auf höchst eindrückliche Weise festgehalten hatte.
Wie passt das zusammen?, überlegte er, während sein Blick zu dem glatt rasierten, durchaus nicht unattraktiven Gesicht auf der anderen Seite des Tisches zurückkehrte. Passte es überhaupt? Oder war Armin Bormann ebenfalls ein Opfer? War er einfach nur jemand, den man über die Planke zu schicken versuchte, weil er in der ersten Vernehmung durch die Behörden gelogen hatte und die Staatsanwaltschaft einen Sündenbock brauchte?
»Woll’n Sie was trinken?«, fragte eine Stimme in seinem Rücken mehr aus Routine denn aus Höflichkeit.
Karel drehte sich um. »Nein, danke.«
Der Beamte nickte und zog sich wieder zurück. Bormann wurde erst gar nicht gefragt, und Karel glaubte einen Hauch Amüsement in den graublauen Augen zu erkennen.
»Sie wissen, weshalb ich hier bin?«
»Ja, ich habe das Schreiben gelesen.«
Gelesen vielleicht, dachte Karel, allerdings hast du mit keiner Silbe darauf reagiert. »Dann wissen Sie ja auch, dass ich vom Landgericht Frankfurt mit Ihrer Vertretung beauftragt wurde«, stellte er sachlich fest, und dieses Mal war dem Mann auf der anderen Seite des Tisches sogar noch das Nicken zu viel.
Er lächelte nur. Ein kühles, unbeteiligtes Lächeln, das irgendwo in den Tiefen seiner Augen verglomm.
Karel musterte den Programmierer aufmerksam. Er hatte nicht viel Zeit gehabt, sich auf dieses Treffen vorzubereiten, und die Akte zu dem Fall umfasste bereits jetzt mehr als ein halbes Dutzend Ordner. Doch Karel hatte schon als Student die Kunst des raschen und doch gründlichen Querlesens beherrscht. Dergestalt hatte er Polizeiberichte, Zeitungsartikel und Vernehmungsprotokolle überflogen und war zu dem Schluss gekommen, dass trotz des umfangreichen Materials, das die Ermittlungsbehörden zusammengetragen hatten, bislang allenfalls ein Bruchteil dieser mysteriösen Geschichte erzählt war. Ein Umstand, der jeden anderen unter Garantie eher abgeschreckt hätte. Doch Karel fühlte sich herausgefordert.
»Es tut mir leid, aber ich muss vorab ein paar Dinge klären«, schickte er voraus. »Sonst macht dieses Gespräch nicht den geringsten Sinn.«
Bormann blickte ihn unverwandt an. Er war gut aussehend, aber deutlich kleiner, als Karel erwartet hatte, und wirkte sehnig und trainiert. »Tun Sie sich keinen Zwang an.«
»Zunächst muss ich Sie fragen, ob Sie damit einverstanden sind, dass ich Ihre Vertretung übernehme.«
»Hab ich eine Wahl?«
Karel rang sich ein Lächeln ab. »Sicher.«
»Die da wäre?«
»Es steht Ihnen frei, jederzeit einen anderen Strafverteidiger zu benennen, der Sie vor Gericht vertritt.«
Bormann lehnte sich zurück und verschränkte die Arme vor der Brust. »Ich bin kein großer Freund von Anwälten«, entgegnete er lakonisch.
Ja, dachte Karel, das ist kaum zu übersehen!
»Wie Sie bereits wissen, werden Sie leider nicht um eine Vertretung herumkommen«, stellte er mit einer gewissen Genugtuung fest. »Da Sie sich einer Mordanklage ausgesetzt sehen und es in diesem Land Gesetz ist, dass der Beschuldigte bei einem derart schwerwiegenden Verbrechen nicht ohne juristischen Beistand …«
»Sage ich ja«, fiel Bormann ihm ins Wort, und Karel setzte in Gedanken ein dickes Ausrufezeichen hinter die Punkte Selbstbewusstsein und Intelligenz.
Er war ein Mann, der sich sogar im Rahmen des Denkens um Neutralität bemühte. Doch in diesem Fall, das musste er zugeben, fiel ihm die Unvoreingenommenheit, die er von sich selbst erwartete, ganz und gar nicht leicht. Immerhin wurde Armin Bormann eines der abscheulichsten Verbrechen bezichtigt, die in den letzten Jahren in diesem Land verübt worden waren, und er tat wenig bis nichts dazu, den Verdacht, der gegen ihn bestand, zu entkräften.
Seit Anfang Dezember des vergangenen Jahres saß er nun in Untersuchungshaft. Während dieser Zeit hatte er bereits zwei Pflichtverteidiger verschlissen. Der zweite, Karels unmittelbarerer Vorgänger, hatte sofort nach Verlesen der Anklageschrift durch die Staatsanwaltschaft einen Befangenheitsantrag gegen einen der drei Richter gestellt und damit immerhin eine kurze Prozesspause erreicht. Doch die geschenkte Zeit wäre ungenutzt verstrichen, gäbe es da nicht diese rührige Nachbarin, die sich aus Gründen, die Karel bislang noch nicht überblickte, Bormanns Rettung auf die Fahnen geschrieben hatte. Er kannte Cassandra Neubert bislang nur vom Telefon, doch er hatte bereits eine ziemlich genaue Vorstellung von der Witwe, der er jetzt zumindest so etwas wie einen leisen Hoffnungsschimmer verdankte. Eine Perspektive. Etwas, auf dem sich aufbauen ließ. Vorausgesetzt, der Mann, um den es ging, war auch bereit, sich helfen zu lassen …
Karel versuchte, Bormanns Blick einzufangen. »Sie müssen keineswegs mit mir vorliebnehmen«, wiederholte er mit Nachdruck, denn das Letzte, wonach ihm der Sinn stand, war die Aussicht, den allerersten Strafprozess seiner Karriere zu verlieren, nur weil sein Mandant keinen Bock auf Hilfe hatte. »Das Einzige, womit Sie sich abfinden müssen, ist die Tatsache, dass Sie einen Verteidiger brauchen.«
»Was soll’s?«, gab Bormann mit erstaunlich unbewegter Miene zurück. »Einer von eurer Zunft ist so gut wie der andere.«
Letzteres sah Karel definitiv anderes, doch er verkniff sich auch dieses Mal eine entsprechende Erwiderung.
Stattdessen schob er die Hand in die Brusttasche seines Jacketts und förderte den billigen roten Kugelschreiber zutage, mit dem er bereits während des Studiums Seminare und Vorlesungen protokolliert hatte. Nach dem Abschluss hatten ihn mehrere namhafte Kanzleien aus ganz Europa umworben, doch Karel hatte beschlossen, dass er noch nicht über die Erfahrung verfügte, die sein Anspruch an sich selbst und sein juristischer Ehrgeiz ihm auferlegten. Deshalb war er fürs Erste in Frankfurt, dem Ort seiner Ausbildung, geblieben. Seit ein paar Monaten arbeitete er für die mittelständische, aber angesehene Sozietät Meerwald und Schaller, deren Büros nur einen Steinwurf von der Fressgasse entfernt lagen. Und wenn er ehrlich war, fühlte er sich dort ausgesprochen wohl. Die beiden Seniorpartner erteilten ihm klare Anweisungen und ließen ihm dennoch genügend Freiheiten, um eigene Erfahrungen zu sammeln. Im Augenblick war Karel allerdings nicht mehr so sicher, ob die Sache mit der Freiheit ihm nicht doch ein wenig zu weit ging. Immerhin saß er hier mit einem Mann, der laut Anklageschrift eine vierköpfige Familie ermordet hatte …
Er atmete tief durch und zog ein zweiseitiges Schriftstück aus seiner Aktentasche. »Um Sie vertreten zu können, muss ich Sie bitten, mir diese Vollmacht hier zu unterschreiben.«
Bormann griff nach dem Kugelschreiber und kritzelte seinen Namen unter das Dokument, ohne auch nur hinzusehen. Dann schob er beides über den Tisch zurück.
»Es ist Ihnen bekannt, dass sich Ende letzter Woche noch eine weitere Zeugin gemeldet hat?«
Bormann nickte.
»Und kennen Sie auch den Inhalt ihrer Aussage?«
»Ja.«
»Haben Sie etwas dazu zu sagen?«
»Nein.«
Karel versuchte, sich von der Einsilbigkeit seines Gesprächspartners nicht beeindrucken zu lassen. Doch es wollte ihm nicht gelingen.
Eigentlich müsste der Kerl aus Freude über diese Entwicklung Luftsprünge machen, dachte er, während er für sich noch einmal die Fakten resümierte: Laut Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft hatte sich Bormann am Abend des 10. November vergangenen Jahres auf bislang noch unbekannte Weise Zugang zum Haus der Familie Svensson in Eschborn verschafft. In der Wohnküche, wo die Familie gerade mit den Vorbereitungen für das Abendessen beschäftigt gewesen war, hatte er ohne Zögern das Feuer eröffnet.
Erik Svensson, der 37-jährige Familienvater, und seine dreijährige Tochter Pippa waren auf der Stelle tot gewesen. Der sechsjährige Leon hingegen hielt zum Zeitpunkt der Tat ein Tablet unter seinem Pullover versteckt, das die beiden Schüsse, die Bormann auf ihn abgab, abgefangen hatte. Die Wucht der Schüsse warf den Jungen zu Boden, wobei er sich eine leicht blutende Wunde am Hinterkopf zugezogen hatte. Doch die hatte er im Zustand des Schocks vermutlich genauso wenig gespürt wie die Prellungen am Brustkorb.
Was danach geschehen war, lag auch mehr als acht Monate nach der grausigen Tat noch immer weitgehend im Dunkeln. Fest stand nur, dass es Leon Svensson irgendwie gelungen war, sich in sein Kinderzimmer im ersten Stock zu schleichen. Um exakt 19 Uhr 46 hatte er den Notruf gewählt.
Karels Blick blieb an der schnörkellosen Unterschrift seines unfreiwilligen Mandanten hängen.
Aus dem Protokoll des knapp vierminütigen Gesprächs mit der Notrufzentrale ging hervor, dass Sonja Svensson zu diesem Zeitpunkt ebenfalls noch am Leben gewesen sein musste. Doch als die Polizei siebzehn Minuten später das Haus durchsuchte, waren beide, Mutter und Sohn, tot gewesen. Leon war durch einen Kopfschuss gestorben. Seine Mutter war erwürgt worden.
Karel biss sich auf die Lippen.
»Und Sie bleiben dabei, dass Sie am Tatabend nicht im Haus der Svenssons gewesen sind?«, wandte er sich wieder an Bormann.
»Ja.«
»Auch nicht früher an diesem Tag?«
»Nein, auch nicht früher.«
Karel warf einen flüchtigen Blick in die Notizen, die er sich gemacht hatte. »Aber vorher sind Sie sehr wohl mal dort gewesen, nicht wahr?«
»Ja.«
»Wie oft?«
Achselzucken, eher gelangweilt als ratlos. »Zwei- oder dreimal.«
»Warum haben Sie bei der ersten Befragung behauptet, das Haus in der Spenderstraße nie betreten zu haben?«
»Ich war nervös.«
»Sie haben gelogen«, korrigierte Karel unsentimental.
»Na und?« Bormanns milchig trübe Augen schweiften ab. »Ich wusste, was passiert ist. Und ich … Na ja, ich habe sofort begriffen, dass ich mich in Schwierigkeiten bringe, wenn ich zugebe, dass ich hin und wieder da gewesen bin.«
»Wieso?«, gab Karel zurück. »Wenn Sie mit der Familie befreundet waren …«
»War ich aber nicht.«
»Richtig.« Seine Finger strichen über die Ecke des Aktendeckels. »Waren Sie nicht. Und genau hier liegt unser Problem.«
Bormann reagierte nicht.
Karel fixierte einen Punkt zwischen seinen Brauen. »Sie haben Ihre Beziehung zu Sonja Svensson explizit als flüchtig bezeichnet.«
»Und?«
»Was hatten Sie dann in ihrem Haus zu schaffen?«
Bormann gab ein Stöhnen von sich, das deutlich machte, dass er sich seiner Meinung nach bereits zur Genüge zu diesem Sachverhalt geäußert hatte. »Sie hat mich ein- oder zweimal um Rat gefragt. Wegen ihrer Fische.«
Vor Karels innerem Auge tauchten die Bilder aus dem Schlafzimmer des ermordeten Ehepaars auf. Riesige Schrankfronten in hellem Holz, ein Boxspringbett, ein gemauerter Durchgang zum Badezimmer und davor, auf einem kleinen Podest, ein imposantes Aquarium. »Sie züchten Fische, nicht wahr?«, fragte er mit einem kurzen Blick in seine Notizen.
»Das ist nur ein Hobby«, winkte Bormann ab.
Karel ignorierte die Einschränkung. »Wie lange machen Sie das schon?«
»Keine Ahnung. Ein paar Jahre.«
»Verkaufen Sie die Tiere auch privat?«
»Nein, nur an Händler.«
»Haben Sie Sonja Svensson mal einen Fisch verkauft?«
»Nein.«
»Haben Sie ihr einen geschenkt?«
»Nein.« Jetzt klang er entnervt. »Ich habe ihr, soweit ich mich erinnere, nur mal irgendein Medikament empfohlen. Das war alles.«
Soweit ich mich erinnere …
Karel atmete tief durch. »War Frau Svenssons Mann da zufällig dabei?«
Bormann verdrehte die Augen. »Nein.«
»Wieso nicht?« Karel hob betont unschuldig den Blick. »Immerhin war es doch auch sein Aquarium, oder nicht?«
»Ich glaube, eigentlich gehörte es dem Jungen.«
»Sie meinen Leon?« Er wollte sehen, wie sein Gegenüber auf den Namen reagierte. Doch Bormann zuckte nicht mal mit der Wimper.
»Ja, genau.«
»Aber Erik Svensson war bei der genannten Gelegenheit nicht dabei?«, insistierte Karel.
»Er konnte nicht. Er ist beruflich viel unterwegs.«
War, korrigierte ihn Karel in Gedanken. Erik Svensson ist tot.
»Sind Sie Sonja bei Ihren Besuchen in der Spenderstraße irgendwie …«, er suchte eine Weile nach einem passenden Wort, »… nähergekommen?«, entschied er sich schließlich für eine möglichst unverfängliche Formulierung.
Bormann lachte. »Sie wollen wissen, ob ich mit ihr geschlafen habe?«
Seine Direktheit ließ Karel zusammenzucken, aber er nickte. »Es wäre durchaus hilfreich, die Wahrheit zu kennen.«
»Nein, ich habe nicht mit ihr geschlafen.«
»Waren Sie in sie verliebt?«
Wieder Lachen. »Nein. Ganz und gar nicht.«
»Aber sie war sehr hübsch.«
»Sind Sie verliebt in jede Frau, die gut aussieht?«
Treffer, dachte Karel.
Bormann taxierte ihn einen Moment lang, bevor er hinzufügte: »Sie war ganz einfach eine nette Frau, mit der man sich gut unterhalten konnte. Nicht mehr und nicht weniger.«
»Worüber haben Sie sich unterhalten?«
»Über Fische, zum Beispiel.«
Karel legte seinen Stift zur Seite, stand auf und sah seinem unfreiwilligen Mandanten direkt in die Augen. »Wollen Sie hier raus?«
Der abrupte Themenwechsel brachte Bormann spürbar aus dem Gleichgewicht. »Wie bitte?«
»Ich hätte gern gewusst, ob Sie für den Rest Ihres Lebens in einer Achtquadratmeterzelle mit Aluklo hocken und geschmuggelte Pornoheftchen konsumieren möchten«, wiederholte Karel, ohne eine Miene zu verziehen. »Oh, verstehen Sie mich bitte nicht falsch: Falls ja, wäre das absolut okay für mich. Ich meine, so was muss jeder für sich selbst entscheiden, nicht wahr? Und Lebensqualität ist letztendlich immer eine Frage der persönlichen Auslegung. Aber falls Sie das nicht wollen …« Er lehnte sich quer über den Tisch, bis sein Gesicht unmittelbar vor Bormanns schwebte. »Falls Sie das nicht wollen, sollten Sie langsam mal aufhören, mich zu verarschen, Freundchen. Und zwar ein für alle Mal, haben wir uns verstanden?«
6Frankfurt Hauptfriedhof, 7. Juli 2015, 17.54 Uhr
»Capelli!«
Makarov bemühte sich, zu ihr aufzuschließen, was im dichten Gedränge auf den Wegen rund um Thorsten Mohrs Grab gar nicht so einfach war. Die Zeremonie war beendet, die meisten Trauergäste strebten mehr oder weniger erleichtert dem Ausgang entgegen. Andere standen noch in kleineren Grüppchen zusammen und sprachen ein paar Worte, und hier und da wagte sogar schon wieder jemand ein Lachen.
»He, Capelli! Augenblick bitte!«
»Was gibt’s?«
»Kann ich Sie kurz sprechen?«
Em zog verwundert die Stirn in Falten. »Sicher«, sagte sie. Und ein wenig ungläubig fügte sie hinzu: »Jetzt?«
Ihr Boss hob beinahe entschuldigend die Hände. Eine Geste, die alles andere als typisch für ihn war. »Es dauert nicht lange.«
»Okay …«
»Wie wär’s, wenn ich Sie mitnehme, und wir reden unterwegs?« Er zeigte zu einem der Seitenwege, und überrascht stellte Em fest, dass dort ein Auto parkte.
Ein dunkler Ford.
Augenblicklich kam das Gefühl zurück, das sie seit Beginn dieser Trauerfeier verfolgt hatte. Ein diffuser Eindruck von Anspannung und Doppelbödigkeit. Als sie den Kopf wandte, blickte sie ihrem Vorgesetzten direkt in die Augen.
»Ich lese Sie in fünf Minuten vorn am Seitenausgang auf«, verkündete er in einem Tonfall, der keinen Widerspruch duldete.
»Ist gut.«
Er nickte. »Und bringen Sie Ihre Partnerin mit.«
Em öffnete den Mund, um etwas zu sagen, doch ihr Boss hatte sich bereits umgedreht und steuerte mit entschlossenen Schritten auf den Ford zu.
Kopfschüttelnd blickte sie ihm nach. Dann sah sie sich nach Zhou um.
Sie stand ein paar Meter entfernt und unterhielt sich angeregt mit Sebastian Koss, dem Psychologen des Präsidiums. Er ließ sich in letzter Zeit auffallend oft in der Abteilung für Kapitaldelikte blicken, was in Em insgeheim den Verdacht nährte, dass er an Zhou interessiert war.
»Tut mir leid, aber ich muss sie Ihnen kurz entführen«, erklärte sie ohne jeden Anflug von Bedauern, während sie ihre Partnerin kurzerhand am Arm fasste und mit sich fortzog. »Ist was Privates.«
»Sehen wir uns gleich noch?«, rief Koss ihnen nach.
Doch bevor Zhou reagieren konnte, hatte Em bereits den Kopf geschüttelt. »Sie hat Nachtdienst.«
»Oh.« Koss schaffte es irgendwie, nicht allzu enttäuscht zu wirken. »Tja dann …«
»Warum habe ich das Gefühl, dass Sie schadenfroh aussehen?«, fragte Zhou, als sie außer Hörweite waren.
Doch Em dachte gar nicht daran, ihr zu antworten. »Der arme Junge mag Sie«, stellte sie stattdessen in völlig wertfreiem Ton fest.
Zhou verzog keine Miene. »Das beruht auf Gegenseitigkeit.«
Ems Grinsen hätte nicht breiter sein können. »Soooo?«
»Erzählen Sie mir nicht, dass Sie einen hochinteressanten fachlichen Austausch über die Auswirkungen präfrontaler Läsionen unterbrochen haben, um mir zu sagen, dass mein Gesprächspartner mich mag.«
»Warum nicht? Ist doch ’ne schöne Erkenntnis.«
Zhou blieb stehen. »Spaß beiseite«, sagte sie, und Em glaubte tatsächlich, in ihrer warmen Stimme einen Hauch von Ungeduld auszumachen. »Worum geht’s?«
»Makarov will uns sprechen.«
Über die ebenmäßigen Züge ihrer Partnerin breitete sich ein Ausdruck von Erstaunen. »Jetzt?«
»Genau dasselbe habe ich ihn auch gefragt«, lachte Em.
»Und?«
»Wir treffen ihn in fünf Minuten am Ausgang.«
Ihre Partnerin schüttelte verständnislos den Kopf. Doch sie folgte ihr klaglos zum Ausgang neben dem Grünflächenamt.
Der Ford wartete bereits, als sie dort ankamen.
Em sah, dass Makarov im Fond saß, und überließ Zhou den Beifahrersitz. »Na schön, da wären wir.« Seufzend ließ sie sich neben ihren Boss auf die Rückbank fallen. »Also, was gibt’s?«
Makarov gab dem Fahrer ein Zeichen und kam ohne Umschweife zur Sache, während sich der klimatisierte Wagen beinahe lautlos in Bewegung setzte. »Haben Sie von den Gerüchten gehört, die seit Kurzem im Umlauf sind?« Er kniff die Augen zusammen und musterte Ems Gesicht. »Oh ja, das haben Sie«, konstatierte er in der ihm eigenen trockenen Art.
»Was heißt hier Gerüchte?« Em konnte es auf den Tod nicht ausstehen, wenn sich ihre Gesprächspartner einbildeten, ihre Mimik deuten zu können. »Auf den ersten Blick gibt es keine plausible Erklärung für Mohrs Tod«, fuhr sie fort. »Die Aktion, die ihn das Leben gekostet hat, war gut geplant und das Risiko von den Verantwortlichen als entsprechend überschaubar eingestuft. Trotzdem ist der Mann tot, und natürlich will niemand an irgendetwas schuld sein.« Sie funkelte ihn an. »Ist doch klar, dass da ein paar Idioten hingehen und sich was zusammenspinnen …«
»Ganz so einfach gestaltet sich die Sachlage leider nicht«, gab Makarov zurück, während Zhou sich beinahe den Hals verrenkte, um alles mitzubekommen.
»Sondern?«, hakte Em nach.
»Wie Sie wissen, war Thorsten Mohr finanziell oft ein wenig klamm …«
»Sein Sohn ist krank.«
»Richtig.« Makarovs Finger strichen über die Naht des Ledersitzes. »Und die Therapien verschlingen Jahr für Jahr Unmengen an Geld. Außerdem kann Mohrs Frau seit der Geburt nicht mehr arbeiten gehen, weil sie sich rund um die Uhr um ihren Sohn kümmern muss.« Er hielt inne und blickte mit unbewegter Miene zum Seitenfenster hinaus. »Das ist die eine Seite der Geschichte.«
»Und was ist die andere?«
Makarov ließ sich auffallend viel Zeit, bevor er sich dazu durchrang, ihr zu antworten: »Die andere Seite der Geschichte ist, dass sich bei den Kollegen von der Ermittlungsgruppe Calibri in der letzten Zeit die Pannen häufen …«
»Scheiße«, entfuhr es Em. »Wollen Sie damit sagen, dass Thorsten Mohr ein doppeltes Spiel gespielt hat?«
Ihre Empörung hätte Glas zum Schmelzen gebracht. Und auch Zhou machte ein Gesicht, als hätte ihr gerade jemand mit voller Wucht in die Magengrube geschlagen.
»Intern gibt es bereits seit Längerem Hinweise auf eine undichte Stelle.« Makarov blickte noch immer aus dem Fenster, doch es machte nicht den Eindruck, als würde er wahrnehmen, was er dort sah. »Allerdings ist es den Kollegen von der Dienstaufsicht bislang leider nicht gelungen, den Maulwurf zu identifizieren.«
Zhous sorgfältig gezupfte Augenbrauen schnellten in die Höhe. »Die Innenrevision ist mit dem Fall befasst?«
Er nickte. »Zwei Kollegen vom Dezernat für Interne Ermittlungen waren schon Anfang letzter Woche bei mir im Büro, um mich über den Sachverhalt zu informieren.«
Em atmete tief durch. Die unerwartete Eröffnung ihres Vorgesetzten zog ihr buchstäblich den Boden unter den Füßen weg. Sie konnte einfach nicht glauben, was er ihnen da erzählte. Die Sonderermittlungsgruppe »Calibri« bestand seit drei Monaten, und das erklärte Ziel der abteilungsübergreifenden Spezialeinheit war die Überwachung und Zerschlagung einer kriminellen Organisation, die dem Vernehmen nach von dem kroatisch-deutschen Waffenschieber Dragan Petrovic geleitet wurde. Der beschaffte nicht nur alles, was das Herz von Terroristen höherschlagen ließ, sondern kontrollierte darüber hinaus stetig wachsende Abschnitte des Frankfurter Straßenstrichs. Aus ihrer, sprich: Makarovs, Abteilung gehörten nur zwei Beamte zum Team der SEG Calibri. Und wenn sich die Innenrevision bereits vor einer Woche an ihren Vorgesetzten gewandt hatte, konnte das eigentlich nur eines bedeuten …
»Die Interne verdächtigt Decker oder Pell?« Em hörte ihr eigenes Lachen, das sich irgendwo zwischen den teuren Ledersitzen verfing. »Das ist hoffentlich nicht Ihr Ernst, oder?«
»Bislang wird niemand verdächtigt«, berichtigte Makarov sie ruhig, aber bestimmt. »Aber natürlich bekommen in einem solchen Zusammenhang auch scheinbar harmlose Vorfälle einen ganz bestimmten Beigeschmack.«
»Zum Beispiel?«
Auf dem Gesicht ihres Vorgesetzten erschien ein neuer Ausdruck. »Zum Beispiel, wenn im Umfeld eines der Beteiligten plötzlich eine größere Summe Bargeld auftaucht …«
Em beugte sich vor. »Wollen Sie uns nicht endlich ins Bild setzen, worauf das hier hinausläuft?«
»Das«, antwortete Makarov, »würde ich gern jemand anderem überlassen, wenn es Ihnen nichts ausmacht.«
Er zeigte nach rechts, wo eine breite Toreinfahrt auf ein dicht begrüntes Privatgrundstück führte. Eine hellgelb gestrichene Jugendstilvilla stand ein wenig versteckt hinter einer Gruppe von Linden.
Der Wagen hielt direkt vor der Haustür, wo bereits ein dunkelblauer BMW parkte.
»Wo sind wir?«, fragte Zhou.
»An einem Ort, wo man ungestört reden kann.« Makarov schenkte ihr ein reichlich gequältes Lächeln. Dann löste er seinen Gurt und hievte seine Massen aus dem Auto. »Also dann, meine Damen, wenn Sie mir bitte folgen wollen.«
7Sachsenhausen, Wendelsweg, 7. Juli 2015, 18.16 Uhr
»Möchten Sie einen Kaffee?«
Karel Schubert bejahte. Abgesehen davon, dass er tatsächlich einen brauchen konnte, blieb ihm angesichts des reich gedeckten Tisches kaum eine andere Wahl. Cassandra Neubert schien trotz der Hitze alles aufgefahren zu haben, was Kühlschrank und Speisekammer zu bieten hatten. Neben einer Etagere voller selbst gebackener Muffins stand eine Platte mit Schnittchen. Außerdem gab es eine Schale Obst, ein Tablett mit verschiedenen Erfrischungsgetränken und – Karel hätte am liebsten laut losgelacht – einen mit Erdbeeren und Trauben gespickten Käse-Igel.
Mord als Event, dachte er und rührte mit einem sarkastischen Lächeln einen Schuss Milch in seinen Kaffee.
»Bitte, greifen Sie zu!«, forderte ihn seine Gastgeberin auf. »Sie haben doch unter Garantie noch nicht zu Abend gegessen, oder?«
Karel sparte sich den Hinweis, dass er sich an normalen Wochentagen für gewöhnlich frühestens um zehn eine Pizza oder eine Portion Fritten reinzog, und lud pflichtschuldig ein Stück Ciabatta mit Parmaschinken auf den Teller, der neben seiner Kaffeetasse stand.
»Und?«, erkundigte sich Cassandra Neubert, nachdem sie sich ebenfalls Kaffee eingeschenkt und auf dem Stuhl ihm gegenüber Platz genommen hatte. »Wie schätzen Sie die Sache ein? Haben wir eine Chance, dass Armin freikommt?«
Nicht, wenn er sich weiter so kooperativ zeigt, dachte Karel. Doch das würde er erst einmal für sich behalten.
»Es wird nicht einfach werden«, wählte er eine deutlich bekömmlichere Formulierung. »Aber ich sehe da durchaus gewisse Möglichkeiten …«
Das war offenbar genau das, was sie hören wollte, denn sie stieß einen erleichterten Seufzer aus und lehnte sich zurück. »Gott, bin ich froh, dass Sie das sagen«, bekannte sie. »Ich finde keine Ruhe, seit dieser abscheuliche Verdacht aufgekommen ist. Und es wird wirklich Zeit, dass diese Farce ein Ende hat.«
Karel nickte nur. Er wusste, wie absolut zwecklos es war, Frauen wie Cassandra Neubert irgendetwas erklären zu wollen, das ihnen nicht in den Kram passte. Auf der anderen Seite war ihm natürlich auch bewusst, wie viel sein Mandant – und damit letztendlich auch er selbst – der Hartnäckigkeit dieser Frau zu verdanken hatte. Da war es das Mindeste, dass er ihr einen kurzen Besuch abstattete. Außerdem wollte er sich unbedingt ein eigenes Bild von ihr machen, bevor sie einander vor Gericht begegneten. Denn der eigene Eindruck war durch nichts auf der Welt zu ersetzen.
Er nippte an seinem Kaffee und beobachtete, wie seine Gastgeberin eine Rispe Trauben und ein paar Wassermelonenstückchen auf ihren Teller lud.
Ihr Mann war Abteilungsleiter bei einem großen, internationalen Süßwarenkonzern gewesen, und irgendwie war es Cassandra Neubert gelungen, seine Alkoholexzesse bis zu seinem Tod zumindest so weit unter dem Deckel zu halten, dass er seinen Job nicht verloren hatte. Nebenbei hatte sie zwei Töchter und drei Pflegekinder großgezogen und in der Vergangenheit hin und wieder für Armin Bormanns Mutter genäht. Nachdem sie gestorben war, hatte sie den Bormanns sporadisch im Haushalt geholfen, doch mehr als eine lose Freundschaft war daraus offenbar nicht entstanden. Trotzdem hatte Cassandra Neubert vom ersten Augenblick an wie eine Löwin für Bormann gekämpft. Sie hatte Anwälte konsultiert, eigene Nachforschungen angestellt und schließlich sogar einen Privatdetektiv beauftragt, die Hintergründe der Bluttat noch einmal genauestens zu recherchieren. Und der hatte nicht nur einen Nachbarn aufgetan, der zur Tatzeit einen silbernen Audi in der Nähe des Svensson-Hauses beobachtet hatte (Bormann hingegen fuhr einen schwarzen Toyota), sondern auch eine alte Klassenkameradin von Sonja Svensson, die ihm einen höchst bemerkenswerten E-Mail-Wechsel vorgelegt hatte.
Darin sagte Sonja ihre Teilnahme an der 15-Jahrfeier ihres Abiturs in Delmenhorst ab, obwohl sie zu ähnlichen Anlässen immer gern in ihre alte Heimat gereist war. Doch dieses Mal, wenige Wochen vor ihrem gewaltsamen Tod, hatte sie erklärt, leider nicht dabei sein zu können.
Petra Heyen, die Organisatorin, hatte ihrer alten Schulfreundin daraufhin eine enttäuschte Mail zurückgeschrieben, in der sie noch einmal nachhakte, ob Sonja es nicht vielleicht doch irgendwie einrichten könne. Es sei immer so lustig gewesen, wenn sie einander in den vergangenen Jahren gesehen hätten, und in Hessen seien doch schließlich auch noch Herbstferien.
Sonja war bei ihrer Absage geblieben, woraufhin Petra Heyen gemailt hatte: Ich hoffe, deine Gründe sind es wert …
Und genau an dieser Stelle begann er, der kurze, aber vielsagende Mail-Wechsel, den Karel inzwischen auswendig kannte:
pjheyen
Ich hoffe, deine Gründe sind es wert!
Sonja995fft
Sei nicht sauer. BITTE! Wäre echt supergern gekommen, aber bei mir ist grad einiges los … Ich hab da jemanden kennengelernt und ausgerechnet an dem WoEnde wollen wir was zusammen machen.
pjheyen
jemanden kennengelernt??? bist du mit Erik auseinander?
Sonja995fft
Nein. Ist bloß alles ein bisschen kompliziert grade. Aber aufgeschoben ist ja nicht!!! ;-(
pjheyen
Uiiii ---- dann halt die Ohren steif! Ich grüß den Rest von dir!
Hinter dem letzten Ausrufezeichen prangte ein weinender Smiley.
Tja, dachte Karel, offenbar hat sie tatsächlich bedauert, nicht hinfahren zu können. Aber wen, um Himmels willen, meinte sie mit »wir«?
Ausgerechnet an dem WoEnde wollen wir was zusammen machen …
Wer war Sonja Svensson so wichtig gewesen, dass sie das fünfzehnte Treffen ihres Abschlussjahrgangs für ihn sausenließ? Ein heimlicher Liebhaber?





























