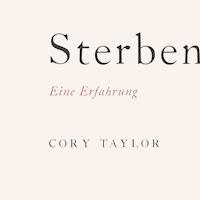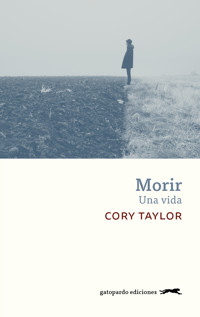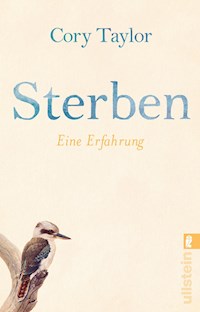
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Shortlisted für den Stella Prize 2017 2015 erfährt die australische Schriftstellerin Cory Taylor, dass sie nicht mehr lange zu leben hat. In nur wenigen Wochen verfasste sie dieses Buch, das kurz vor ihrem Tod 2016 erschien. Auf bemerkenswerte Weise reflektiert sie über den Sinn der Zeit, die ihr noch bleibt. Sie lässt uns teilhaben an ihrer Erfahrung, was das Sterben sie gelehrt hat. Sie wird erfasst von der transformativen Kraft des Prozesses, in dem sie sich befindet, und es gelingt ihr, sich diesem kreativ und ehrlich zu stellen. Cory Taylor hat uns allen mit diesem Buch etwas Wertvolles geschenkt. Klug, schlicht und zutiefst weise sind ihre Gedanken über das Sterben, die zugleich eine Hymne an das Leben sind. »Wenn wir selbst an unser Ende gelangen, können wir auf einen solch lebhaften Rückblick und eine solch klare Vorausschau nur hoffen.« Julian Barnes
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Das Buch
»Wenn wir selbst an unser Ende gelangen, können wir auf einen solch lebhaften Rückblick und eine solch klare Vorausschau nur hoffen.« Julian Barnes
2015 erfährt die australische Schriftstellerin Cory Taylor, dass sie nicht mehr lange zu leben hat. Und so verfasste sie in nur wenigen Wochen dieses ungewöhnliche Buch, das kurz vor ihrem Tod erschien und nun rund um den Globus veröffentlicht wird.
Auf bemerkenswerte Weise reflektiert sie darin über den Sinn der Zeit, die ihr noch bleibt. Sie lässt uns teilhaben an ihrer Erfahrung, was das Sterben sie gelehrt hat. Der universellen Frage über ein Leben nach dem Tod begegnet sie als nicht-religiöser Mensch in einer sie selbst überraschenden spirituellen Form.
Sie erfasst die transformative Kraft des Prozesses, in dem sie sich befindet, und es gelingt ihr, sich diesem kreativ und ehrlich zu stellen.
Cory Taylor hat uns allen mit diesem Buch etwas Wertvolles geschenkt. Klug, schlicht und zutiefst weise sind ihre Gedanken über das Sterben, die zugleich eine Hymne an das Leben sind.
Die Autorin
Cory Taylor (1955 – 2016) gehört zu den renommiertesten Schriftstellern Australiens. Sie war Drehbuchautorin und hat zudem zwei Romane veröffentlicht, die beide ausgezeichnet wurden. Ihr erster Roman Me and Mr. Booker erhielt den Commonwealth Writers Prize (Pacific Region) und ihr zweiter Roman My Beautiful Enemy war nominiert für den Miles Franklin Literary Award.
CORY TAYLOR
Sterben
Eine Erfahrung
Aus dem australischen Englisch von Ulrike Kretschmer
Besuchen Sie uns im Internet:
www.ullstein-buchverlage.de
Wir wählen unsere Bücher sorgfältig aus, lektorieren sie gründlich mit Autoren und Übersetzern und produzieren sie in bester Qualität.
Hinweis zu Urheberrechten
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten.
Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
ISBN: 978-3-8437-1561-4
Die Originalausgabe erschien 2016 unter dem Titel Dying – A Memoirim Verlag The Text Publishing Company, Melbourne, Australia.
Allegria ist ein Verlag der Ullstein Buchverlage GmbH
© 2016 by Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin
© der Originalausgabe 2016 by Cory Taylor
Übersetzung: Ulrike Kretschmer
(einschließlich der Gedichtzeilen von T. S. Eliot)
Lektorat: Vera Baschlakow
Umschlaggestaltung: Rothfos & Gabler, Hamburg
E-Book: LVD GmbH, Berlin
Alle Rechte vorbehalten.
Für Shin
Vor etwa zwei Jahren kaufte ich über das Internet ein Medikament aus China, mit dem ich meinem Leben ein Ende setzen kann. Das bekommt man entweder auf diese Weise, oder man reist nach Mexiko oder Peru und kauft es ohne Rezept bei einem Tierarzt. Anscheinend muss man ihm nur erzählen, man wolle ein krankes Pferd einschläfern, und kriegt, so viel man will. Dann nimmt man es entweder in seinem Hotelzimmer in Lima ein und überlässt es seiner Familie, sich um die Einzelheiten der Überführung nach Hause zu kümmern, oder schmuggelt es im Koffer durch die Flughafenkontrollen und hebt es sich für den späteren Gebrauch auf. Ich hatte nicht die Absicht, meines sofort zu benutzen, und war nicht in der körperlichen Verfassung, die weite Reise nach Südamerika anzutreten, und wählte deshalb die China-Option.
Mein Medikament aus China ist ein Pulver. Ich bewahre es gemeinsam mit einem Abschiedsbrief in einem luftdicht verschlossenen Beutel an einem sicheren und geheimen Ort auf. Den Abschiedsbrief habe ich schon vor über einem Jahr geschrieben, einige Tage, bevor ich mich einer Gehirnoperation unterziehen musste. Der Teil meines Gehirns, der die Bewegungen meiner Gliedmaßen auf der rechten Körperseite kontrolliert, war von einem Melanom befallen – der Krebs war unheilbar, und es gab keine Garantie, dass er nach der Operation nicht zurückkehren würde. Zu dieser Zeit hatte ich auch an anderen Stellen meines Körpers bereits Metastasen, beispielsweise in meinem rechten Lungenflügel, unter der Haut an meinem rechten Arm und eine große knapp unterhalb meiner Leber. Eine weitere drückte auf meine Harnröhre und hatte 2011 das Einsetzen eines Plastikstents notwendig gemacht, um die Funktion meiner rechten Niere aufrechtzuerhalten.
Die Diagnose hatte ich 2005 bekommen, kurz vor meinem fünfzigsten Geburtstag, nachdem sich bei einer Biopsie herausgestellt hatte, dass der Leberfleck auf der Rückseite meines rechten Knies ein Melanom in Stadium IV war. Seitdem ist meine Krankheit barmherzig langsam fortgeschritten. Erst nach drei Jahren tauchte der Krebs in den Lymphknoten meines Beckens auf, und es dauerte nochmals ein paar Jahre, bis er weiter gestreut und auch andere Körperstellen befallen hatte. Ich musste mich zwei Mal operieren lassen, erholte mich danach aber immer gut, und dazwischen blieb ich von ernsthaften Symptomen verschont. Damals schaffte ich es tatsächlich, die Krankheit vor allen außer meinen engsten Freunden geheim zu halten. Aber mein Mann, Shin, wusste die ganze Wahrheit, da er mich zu den regelmäßigen Untersuchungen und Terminen bei Spezialisten begleitet hatte. Unseren beiden Söhnen im Teenageralter allerdings hatte ich die Einzelheiten erspart, in dem Versuch, nehme ich an, sie vor allzu großem Schmerz zu schützen, denn das war mein Job als ihre Mutter. Als mich Ende Dezember 2014 ein Anfall vorübergehend hilflos wie ein Baby machte, war das Offensichtliche nicht mehr zu leugnen.
Also beraumten wir ein Familientreffen in unserem Haus mitten in Brisbane an – Shin, unser jüngerer SohnDan, seine Freundin Linda, unser älterer Sohn Nat und seine Frau Asako, die alles stehen und liegen ließen und aus Kyoto nach Hause geflogen kamen, wo sie seit zwei Jahren lebten. In den darauffolgenden Tagen kämpften wir uns durch den Papierkram, der wichtig für sie ist, sollte das Schlimmste eintreten: mein Testament, ihre Vollmachten, meine Bankkonten, die Steuer, meine Pension. Es gab mir das Gefühl, die letzten Dinge zu regeln, und ihnen half es, glaube ich, weil sie sich dadurch nützlich fühlten. Ich verriet ihnen sogar, dass ich mich für Sterbemittel interessierte, und fügte scherzhaft hinzu, ich wünschte sie mir zu Weihnachten. Mein Marilyn-Monroe-Geschenkpaket nannte ich sie.
»Was gut genug für sie war, ist auch gut genug für mich«, sagte ich. »Selbst wenn ich es nie benutze: Allein zu wissen, dass es da ist, vermittelt mir ein Gefühl der Kontrolle.«
Ich denke, sie hatten dafür Verständnis. Zumindest widersprachen sie mir nicht.
Mein Abschiedsbrief war wie eine Entschuldigung geschrieben. Es tut mir leid, steht da. Bitte verzeiht mir, aber sollte ich aus der Narkose erwachen und schwer behindert sein, nicht mehr gehen können und vollständig von der Fürsorge anderer abhängen, ziehe ich es vor, mein Leben zu beenden. Ich wiederholte auch, was ich ihnen schon hundert Mal persönlich gesagt hatte: wie sehr ich sie alle liebte, wie viel Freude sie mir gebracht hatten. Danke, schrieb ich. Sprecht mit mir, wenn ich nicht mehr da bin, ich höre euch. Ich war mir nicht sicher, ob das stimmte, doch näher sollte ich einem irgendwie gearteten metaphysischen Glauben nie kommen. Außerdem ergab das zu dieser Zeit tatsächlich einen gewissen Sinn, denn ich schrieb an die Lebenden – vom Standpunkt der Toten aus.
Ich brachte die Operation gut hinter mich, nicht völlig unbeschadet, aber auch nicht allzu versehrt. Der Tumor in meinem Gehirn wurde erfolgreich entfernt. Mein rechter Fuß wird zwar nie wieder ganz der alte sein, sodass ich humpeln muss, alles andere auf der rechten Seite kann ich jedoch normal bewegen. Und ich bin immer noch da, auch mehr als ein Jahr nach dem Eingriff. Nichtsdestotrotz bleibt meine Lage ernst. Melanome kann man nicht heilen. Derzeit werden ein paar Medikamente getestet, allerdings mit unterschiedlichen Ergebnissen. Ich habe selbst an drei solchen Tests teilgenommen, kann aber nicht mit Bestimmtheit sagen, ob eines der Medikamente den Verlauf der Krankheit verlangsamt hat. Mit Sicherheit kann ich sagen, dass mir trotz der allerbesten Bemühungen meines Onkologen schließlich die Behandlungsoptionen ausgegangen sind. Da wurde mir klar, dass ich mich meinem Ende näherte. Ich wusste nicht, wann oder wie genau ich sterben würde, lange nach meinen sechzigsten Geburtstag würde ich es jedoch nicht schaffen.
Da sich meine Gesundheit stetig verschlechterte, rückte das Thema Selbsttötung für mich immer mehr in den Mittelpunkt. Ich war sogar schon so weit gegangen – ein Novum für mich –, das Gesetz zu brechen und Strafverfolgung zu riskieren, als ich mir das nötige Mittel dafür beschafft hatte. Es ruft nach mir, Tag und Nacht, wie ein heimlicher Liebhaber. Ich bringe dich von all dem fort, flüstert es. Das Pulver wirkt direkt auf das Schlafzentrum des Gehirns ein und braucht dafür nicht einmal die Zeit, in der man einen Satz vollendet. Was also könnte einfacher sein, als eine tödliche Dosis zu schlucken und nie wieder aufzuwachen? Das wäre doch sicherlich die bessere Alternative, als einen langsamen und grausamen Tod zu sterben!
Und doch zögere ich, denn was auf den ersten Blick eine saubere Lösung zu sein scheint, ist alles andere als das. Da wäre zunächst einmal die Durchführbarkeit einer solchen Handlung. Die Gesetzeslage in Australien schreibt vor, dass ich das Mittel allein einnehmen müsste, damit ausgeschlossen ist, dass irgendjemand anders an meinem Tod beteiligt war. Die Selbsttötung an sich ist zwar kein Verbrechen, die Beihilfe zur Selbsttötung aber ist illegal und wird mit einer längeren Haftstrafe geahndet. Zum anderen kann ich auch die emotionalen Auswirkungen, die meine Tat auf andere hätte, nicht außer Acht lassen, führte ich sie nun in einem Hotelzimmer oder auf einem einsamen Pfad im Busch aus. Ich frage mich, ob ich das Recht habe, eine Reinigungskraft im Hotel zu traumatisieren oder einenBuschwanderer, der zufällig das Pech hat, meine Leiche zu finden. Am wichtigsten aber sind für mich die Auswirkungen, die mein Freitod auf Shin und die Jungs haben würde: So sehr ich auch versucht habe, sie auf die Möglichkeit vorzubereiten, so sehr würde sie das tatsächliche Ereignis im Mark erschüttern. Es macht mir beispielsweise zu schaffen, dass auf meinem Totenschein Suizid als Todesursache stünde, mit allem, was der Begriff heutzutage impliziert: Angststörungen, Hoffnungslosigkeit, Schwäche, der Geruch von Kriminalität – alles meilenweit von etwa der japanischen Tradition des Seppuku, des ritualisierten Ehrenfreitods, entfernt. Der Umstand, dass die eigentliche Todesursache Krebs war, würde unter den Tisch fallen, ebenso wie die Tatsache, dass ich in keinster Weise verrückt bin.
Angesichts all dieser Hindernisse betrachte ich meine düstere Zukunft mit dem ganzen Mut, den ich aufbringen kann. Ich habe Glück: Ich habe einen exzellenten Palliativspezialisten und einen außergewöhnlichen ambulanten Pflegedienst gefunden, die mir neben meiner Familie und meinen Freunden alle Unterstützung, die ich mir nur wünschen kann, bieten. Sollte ich allerdings den Wunsch äußern, meinem eigenen Leben ein Ende setzen zu wollen, stünde mir diese Unterstützung legalerweise nicht mehr zur Verfügung. Ich wäre absolut auf mich allein gestellt. Im Gegensatz zu Ländern wie Belgien und den Niederlanden verbieten unsere Gesetze weiterhin jede Form von Sterbehilfe für Menschen in meiner Situation. Warum eigentlich? Ich frage mich zum Beispiel, ob diese Gesetze nicht eine tiefe Aversion vieler Ärzte gegen die Vorstellung widerspiegeln, die Kontrolle über den Sterbeprozess in die Hände des Patienten zu legen. Ich frage mich, ob diese Aversion vielleicht in dem allgemeineren Glauben der Ärzte wurzelt, der Tod sei eine Art Versagen. Und ich frage mich, ob dieser Glaube nicht weiter in die Welt gesickert ist und dort die Gestalt einer Aversion gegen das Thema Tod als solches angenommen hat, als ob die nackte Tatsache der Sterblichkeit aus unserem Bewusstsein verbannt werden könnte.
Eine wirklich absurde Vorstellung, denn wenn der Krebs einen etwas lehrt, dann das: Wir sterben, scharenweise, unaufhörlich. Man muss sich nur in das überfüllte Wartezimmer einer Onkologieabteilung in einem großen Krankenhaus setzen und ist von sterbenden Menschen umgeben. Trifft man sie auf der Straße, sieht man es ihnen nicht an, doch hier stehen sie Schlange; sie warten auf die neuesten Untersuchungsergebnisse, um herauszufinden, ob sie dem Tod diesen Monat gerade noch einmal ein Schnippchen geschlagen haben. Ein schockierender Anblick, wenn man ihn nicht gewohnt ist. Und unvorbereiteter als ich hätte man nicht sein können. Ich kam mir vor, als sei ich aus einer Scheinwelt unversehens in die Wirklichkeit gestolpert.
Deshalb habe ich angefangen, dieses Buch zu schreiben. Die Dinge sind nicht, wie sie sein sollten. Für so viele Menschen ist der Tod zu etwas Unaussprechlichem, zu einem monströsen Schweigen geworden. Dochdas hilft den Sterbenden wenig, die jetzt wahrscheinlich einsamer sind als jemals zuvor. Jedenfalls bin ich das.
•
Ich hatte noch nie jemanden sterben gesehen. Bis meine Mutter dement wurde, hatte ich noch nicht einmal jemanden ernsthaft krank gesehen. Mit meiner Mutter ging es zunächst langsam und dann rasant bergab. Gegen ihr Ende hin war sie als die Mutter, die ich so geliebt und bewundert hatte, kaum wiederzuerkennen. Ich war außer Landes, als sie schließlich starb, in den Monaten vor ihrem Tod jedoch war ich bei ihr undmusste die qualvollen Verwüstungen, die die Krankheit mit ihr anrichtete, mit ansehen, den Schmerz und die Erniedrigung, den Verlust der Unabhängigkeit und des Verstandes.
Sie war in einem Heim untergebracht, als sie starb; der Ort war von einer solch anhaltenden Verzweiflung geprägt, dass allein das Betreten des Gebäudes meine ganze Willenskraft erforderte. Als ich sie zum letzten Mal sah, stand ich hilflos daneben, während ihr eine junge japanische Altenpflegerin den Hintern abwischte. Meine Mutter hielt sich mit all ihrer mageren Kraft an einem Waschbecken fest, damit die Pflegerin ihr eine frische Windel um den welken Po wickeln konnte. Der Blick, mit dem meine Mutter mich ansah, als sie sich zu mir, die ich im Türrahmen stand und sie beobachtete, umdrehte, erinnerte mich an ein Tier, das unaussprechliche Qualen erleiden muss. In diesem Moment wünschte ich mir, der Tod würde sie rasch holen und damit die Tortur, die sich jetzt ihr Alltag nannte, beenden. Doch sie hörte nicht auf, zwölf weitere Monate lang nicht. Hartnäckig hielt sich ihr Körper, als ihr Geist längst das Gelände geräumt hatte. Etwas Grausameres und Unnötigeres hätte ich mir nicht vorstellen können. Damals wusste ich schon, dass ich Krebs hatte, und ein Teil von mir war dankbar dafür. Zumindest würde mir ein Tod wie der meiner Mutter erspart bleiben. Ein Grund zum Feiern.
Es war meine Mutter, die mich zuerst in die Debatte um das Thema Sterbehilfe verwickelte. Sie wiederum traf das erste Mal auf die Bewegung Tötung auf Verlangen, wie es damals hieß, als sie zwischen sechzig und siebzig war. Ich wusste, dass sie sich kontinuierlich für die Belange der Bewegung einsetzte, da sie großen Wert darauf legte, mir davon zu erzählen. Ich habe dem zu dieser Zeit weit weniger Beachtung geschenkt, als ich hätte sollen. Meine Mutter bat mich um Hilfe, wobei aber nicht klar war, welche Art von Hilfe sie wollte. Vielleicht nur ein wenig Ermutigung, sich etwas näher mit dem Problem zu beschäftigen und sich im Ernstfall die nötigen Mittel zu verschaffen. Ich stand der ganzen Sache wenig aufgeschlossen gegenüber. Meiner Mutter ging es gut und mir auch, und so schien die Diskussion um Sterbehilfe eine rein akademische zu sein. Als ihre Argumente dafür dann allmählich konkret und dringend wurden, hatte es meine Mutter zu lange aufgeschoben, die Theorie in die Praxis umzusetzen. Außerdem war sie da schon so verwirrt, dass selbstder wohlmeinendste Arzt der Welt ihr nicht mehr hätte helfen können, trotz all der Jahre, die sie sich für die Angelegenheit eingesetzt hatte.
Ich war auch nicht da, als mein Vater starb, ebenfalls in einem Pflegeheim und ebenfalls infolge von Demenz. Meine Eltern hatten sich rund fünfunddreißig Jahre zuvor scheiden lassen, mein Vater und ich waren zerstritten. Was mir allerdings immer lebhaft in Erinnerung bleiben wird, ist die Fantasielösung, die er sich für die Demütigungen des Alters zurechtgelegt hatte. Er erzählte uns – mir, meiner Mutter und meinen älteren Geschwistern –, er wolle eines Tages auf den Pazifik hinaussegeln und sich ertränken. Er scheute jedoch wiederholt vor der ersten Hürde: Er kaufte sich nie ein Boot. Er kaufte sich Zeitschriften über Boote und kreiste Anzeigen in der Rubrik »Zu verkaufen« mit dem Stift ein. Dann fuhr er viele Kilometer, um sich ein Boot anzusehen, dessen Geräusch er mochte, fand aber immer wieder einen Grund, es nicht zu kaufen. Das Geld war zu knapp, oder er wollte nicht allein mit dem Boot rausfahren. Einmal fragte er sogar meine Mutter, ob sie nicht einen Anteil vom Boot kaufen und mit an Bord gehen wollte, doch sie lehnte das Angebot ab. Vielleicht hätte sie ihn beim Wort nehmen sollen. Vielleicht hätten sie gemeinsam auf Nimmerwiedersehen in den Sonnenuntergang segeln sollen. Stattdessen lebten sie weiter und starben schlecht.
Zweifelsohne beeinflusste mein Schrecken darüber, wie meine Eltern aus dieser Welt schieden, mich dahingehend, mir zu überlegen, wie ich es einmal besser machen könnte, wenn ich an der Reihe war. Deshalb trat ich kurz nach meiner Krebsdiagnose in die Fußstapfen meiner Mutter und schloss mich Exit International an, weil ich mich in Sachen Sterbehilfe auf den neuesten Stand bringen wollte. Ich trat auch Dignitas in der Schweiz bei, wo Ausländer legal Sterbehilfe bekommen können, vorausgesetzt, sie leiden an einer unheilbaren Krankheit. Ich holte Informationen ein, um die Wahlmöglichkeiten zu erkunden, die mir jenseits der von meinen Ärzten angebotenen zur Verfügung standen. Dabei liegt es mir fern, die Ärzte, die sich im Laufe der Zeit um mich gekümmert haben, schlechtzumachen. Jeder einzelne war außergewöhnlich, und natürlich schulde ich ihnen großen Dank. Doch abgesehen von dem Palliativspezialisten, dem ich mich anvertraut habe, hat mir gegenüber keiner meiner Ärzte jemals das Thema Tod zur Sprache gebracht, was mir immer noch ein Rätsel ist.
Ein weiterer Beweggrund also, mich Exit anzuschließen, war der, dass ich damit ein Forum hatte, um über Sterbehilfe zu reden. Damit konnte ich dem Tabu, das meine Ärzte anscheinend davon abhielt, offen über etwas so Wichtiges zu sprechen, die Stirn bieten. Ist es nicht seltsam, dass es trotz der Allgegenwart des Todes so wenige Gelegenheiten gibt, öffentlich über das Sterben zu diskutieren? Die Exit-Treffen sind meiner Erfahrung nach die einzigen Gelegenheiten, bei denen Menschen über den Tod als Tatsache des Lebens reden können.
Die Stimmung bei diesen Versammlungen ist optimistisch. An meinen Ortsgruppentreffen nehmen in der Regel etwa vierzig Mitglieder teil. Viele von ihnen sind schon älter, doch es sind auch ein paar Jüngere darunter, die sich, aus welchen Gründen auch immer, über Mittel und Wege zu sterben austauschen wollen. Den Versammlungen haftet unweigerlich etwas Heimliches an, da bereits Ratschläge zum Thema Suizid als strafbare Handlung ausgelegt werden können. Das allerdings macht die Stimmung nur noch ausgelassener. Nicht zu vergessen den Humor. Habt ihr schon gehört? Tom, fast neunzig, ist mit seiner Heliumflasche auf den Friedhof im Ort gezogen und hat dort einmal kräftig daran geschnüffelt. Offensichtlich hat er gedacht, die Toten könne man mit nichts mehr schocken. Und, ach ja: Jeder, der an einem Auffrischungskurs in Sachen Helium interessiert ist, sollte sich bitte so schnell wie möglich in die Liste für den nächsten Workshop eintragen, die Anzahl der Teilnehmer ist begrenzt. Es könnte jedes Treffen jeder beliebigen Interessensgruppe sein, ein Kegelclub oder die Freunde der heimischen Vogelwelt – abgesehen davon, dass es nach der Kaffeepause wieder darum geht, was leichter anzuwenden ist und schneller wirkt, Zyanid oder Stickstoffgas.
Was ich an diesen Treffen am meisten schätze, ist die Atmosphäre der Kameradschaft. Es erfordert Mut, sich mit dem eigenen Tod auseinanderzusetzen, und, wie ich schon sagte, es macht auch unsäglich einsam. Gefährten zu finden, die ebenso wie man selbst das Bedürfnis verspüren, mehr wissen zu wollen, die Initiative zu ergreifen und unser aller Schicksal, der Sterblichkeit, ins Gesicht zu lachen, ist ein Geschenk. Ganz anders als die Erfahrung des Krankenhauswartezimmers, wo die Herde dicht zusammengedrängt und trostlos beieinandersitzt, die Fernseher an den Wänden plärren und du dein schmutziges kleines Geheimnis hütest, bis zu dem Zeitpunkt, an dem dein Name aufgerufen wird. Ob die Nachrichten nun gut oder schlecht sind – die Botschaft ist dieselbe. In Krankenhäusern sprechen wir nicht über den Tod, dort sprechen wir über Behandlungen. Ich gehe aus den Gesprächen immer mit dem Gefühl heraus, als sei meine Menschlichkeit, mein Menschsein durch die Begegnung gemindert worden, als ob man mich allein auf meine Krankheit reduziert hätte, als sei alles andere, das mich ausmacht, von mir abgefallen. Von meinen Exit-Treffen hingegen kehre ich gestärkt nach Hause zurück und bin mir ganz sicher, dass Camus recht hatte: Der Suizid ist tatsächlich die einzig ernsthafte philosophische Frage.
Möchten Sie gerne weiterlesen? Dann laden Sie jetzt das E-Book.