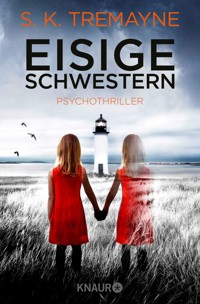6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Psychothrill an der atemberaubenden Küste Cornwalls - der neue Roman von Bestseller-Autor S.K. Tremayne ("Eisige Schwestern") Rachel hat es endlich gut getroffen. Nach langen Single-Jahren hat sie den Anwalt David Kerthen kennengelernt und zieht mit ihm in sein Herrenhaus auf den Klippen von Cornwall. Mit den besten Absichten, auch für Davids Sohn aus erster Ehe, den 9-jährigen Jamie, eine gute Mutter zu sein. Denn Davids erste Frau kam auf tragische Weise in einer der überfluteten Zinngruben an Cornwalls Küste uns Leben. Doch Jamie verändert sich, scheint von düsteren Visionen geplagt - und platzt schließlich mit einem Satz heraus, den Rachel nicht mehr vergessen kann: " An Weihnachten wirst du sterben ... und meine Mummy kommt zurück."
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 474
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
S. K. Tremayne
STIEFKIND
Psychothriller
Aus dem Englischen von Susanne Wallbaum
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Rachel hat es endlich gut getroffen. Nach langen Single-Jahren hat sie den Anwalt David Kerthen kennengelernt und zieht mit ihm in sein Herrenhaus auf den Klippen von Cornwall. Mit den besten Absichten, auch für Davids Sohn aus erster Ehe, den 9-jährigen Jamie, eine gute Mutter zu sein. Denn Davids erste Frau kam auf tragische Weise in einer der überfluteten Zinngruben an Cornwalls Küste ums Leben.
Doch Jamie verändert sich, scheint von düsteren Visionen geplagt – und platzt schließlich mit einem Satz heraus, den Rachel nicht mehr vergessen kann: »An Weihnachten wirst du sterben … und meine Mummy kommt zurück.«
Inhaltsübersicht
Widmung
Vorbemerkung
178 Tage vor Weihnachten
162 Tage vor Weihnachten
149 Tage vor Weihnachten
136 Tage vor Weihnachten
110 Tage vor Weihnachten
109 Tage vor Weihnachten
102 Tage vor Weihnachten
82 Tage vor Weihnachten
77 Tage vor Weihnachten
76 Tage vor Weihnachten
73 Tage vor Weihnachten
72 Tage vor Weihnachten
56 Tage vor Weihnachten
39 Tage vor Weihnachten
35 Tage vor Weihnachten
34 Tage vor Weihnachten
32 Tage vor Weihnachten
30 Tage vor Weihnachten
21 Tage vor Weihnachten
19 Tage vor Weihnachten
16 Tage vor Weihnachten
10 Tage vor Weihnachten
9 Tage vor Weihnachten
8 Tage vor Weihnachten
3 Tage vor Weihnachten
Heiligabend
Heiligabend
Heiligabend
Heiligabend
Weihnachten
Weihnachten
Weihnachten
Sommer
Dank
Für Danielle
Vorbemerkung
Die Morvellan Mine ist erfunden. Natürlich geht diese Fiktion zurück auf die beeindruckenden historischen Bergwerke entlang der zerklüfteten Küste von West Penwith, Cornwall. Besonders anregend waren dabei die früheren Zinn- und Kupferminen Botallack, Geevor und Levant.
Seit vermutlich viertausend Jahren wird in Cornwall Zinn abgebaut. Meine Großmutter mütterlicherseits, Annie Jory, war zehn, als sie anfing, in einer der ergiebigen Zechen von St. Agnes, im Norden Cornwalls, zu arbeiten – als eines jener »Grubenmädchen«, deren Aufgabe es war, mit dem Hammer Erzbrocken zu zerschlagen.
Dieses Buch ist entstanden im Gedenken an meine kornischen Vorfahren, die Bauern waren, Fischer, Schmuggler und Bergleute.
178 Tage vor Weihnachten
Die Stollen reichen bis unters Meer. Diesen Gedanken werde ich nicht los. Die Stollen reichen bis unters Meer. Anderthalb Kilometer, vielleicht auch noch weiter.
Ich stehe in meinem riesigen neuen Zuhause am Fenster des Alten Esszimmers und schaue nach Norden: zum Atlantik, den Klippen von Penwith und einer düsteren Silhouette. Das ist die Morvellan-Mine: eine schwarze Zwillingsgestalt aus Schacht- und Maschinenhaus.
Selbst an einem wolkenlosen Junitag wie heute wirken die Überreste von Morvellan seltsam traurig, vage vorwurfsvoll. Als wollten sie mir etwas erzählen, scheiterten aber an dem Versuch. Sie bleiben auf beredte Weise stumm. Geräusche macht nur der Atlantik; tosende Wellen, die mit den Gezeiten über die Stollen dahinjagen.
»Rachel?«
Ich drehe mich um.
In der Tür steht mein Mann. Strahlend weißes Hemd, makelloser dunkler Anzug, fast so dunkel wie sein Haar; der Wochenendbart ist verschwunden.
»Ich habe dich überall gesucht.«
»Entschuldige. Ich bin herumgegangen. Hab mich umgesehen. In deinem schönen Haus.«
»Es ist unser Haus, Liebes. Unseres.«
Lächelnd kommt er näher, und wir küssen uns. Es ist ein Morgenkuss, ein Ich-muss-zur-Arbeit-Kuss, der zu nichts weiter führt – und trotzdem macht er mich an, löst dieses verstörende, köstliche Gefühl in mir aus: Es kann jemand solche Macht über mich haben, und genau danach sehne ich mich.
David nimmt meine Hand. »Also. Dein erstes Wochenende in Carnhallow …«
»Mhm.«
»Erzähl – ich will wissen, wie’s dir geht! Ich weiß, es ist eine Herausforderung – so abgelegen und so viel zu tun. Ich könnte verstehen, wenn du Bedenken hättest.«
Ich ziehe seine Hand an meine Lippen und küsse sie. »Bedenken? Blödsinn! Ich finde es wunderbar! Ich liebe dich, und ich liebe dieses Haus. Alles liebe ich, die Herausforderung, Jamie, die Abgeschiedenheit; ich finde es wunderbar, wunderbar, wunderbar.« Ohne ein Zwinkern schaue ich ihm in die grüngrauen Augen. »Ich war noch nie so glücklich, David. In meinem ganzen Leben nicht. Es fühlt sich an, als wäre ich da angekommen, wo ich immer sein sollte. Und bei dem Mann, für den ich bestimmt bin.«
Wie überschwenglich! Was ist aus der resoluten, feministisch denkenden Rachel Daly geworden, die ich mal war? Wo steckt sie? Meine Freundinnen würden die Nase rümpfen über mich. Noch vor einem halben Jahr hätte ich selbst die Nase gerümpft: eine Frau, die ihre Freiheit und ihren Job und ihr vermeintlich aufregendes Londoner Leben aufgibt, um mit einem älteren, reicheren, größeren Witwer vor den Traualtar zu treten. Jessica, eine meiner besten Freundinnen, hat gelacht, als ich sie in meine Pläne einweihte. Mein Gott, Süße, du heiratest ein Klischee!
Für einen kurzen Moment hat das weh getan. Aber mir ist schnell klargeworden, dass es keine Rolle spielt, was meine Freundinnen denken, denn sie sind nach wie vor dort, in London, quetschen sich in überfüllte U-Bahnen und hocken in trostlosen Büros, wo sie kaum genug verdienen, um die monatlichen Raten für ihr Haus zu bezahlen. Sie krallen sich an London fest wie Bergsteiger auf halbem Weg nach oben an den Felsen.
Und ich klammere nicht mehr. Ich bin weit weg mit meinem Mann und seinem Sohn und seiner Mutter, hier unten am äußersten Ende von England, ganz im Westen von Cornwall, wo England, wie ich feststelle, anders ist, felsiger, eine Gegend aus verträumtem Granit, der glitzert, wenn es geregnet hat; eine Gegend, in der Flüsse sich verborgen durch Wälder winden, schroffe Klippen verschwiegene Buchten abschirmen, abgelegene Heidemoor-Täler herrliche Häuser beherbergen. Häuser wie Carnhallow.
Sogar den Namen finde ich wunderbar. Carnhallow.
Tagträumend lehne ich den Kopf an Davids Schulter. Als wollten wir tanzen.
Doch das Klingeln seines Handys bricht den Bann. Er holt es hervor, schaut aufs Display, hebt mit zwei Fingern mein Kinn, um mir noch einen Kuss zu geben, und entfernt sich dann, das Telefon schon am Ohr.
Wahrscheinlich hätte ich diese Geste früher machohaft gefunden. Jetzt bewirkt sie, dass ich Sex will. Aber das will ich ständig: Sex mit David. Schon in dem Augenblick, als mein Freund Oliver in der Galerie sagte: Komm, ich stell dir jemanden vor, ihr werdet euch gut verstehen, ich mich umdrehte und ihn sah – zehn Jahre älter und zwanzig Zentimeter größer als ich –, wollte ich Sex.
Ich wollte David bei unserem ersten Date drei Tage später; ich wollte ihn, als er mir den ersten Drink ausgab; ich wollte ihn, als er flirtend einen gut plazierten Witz machte; ich wollte ihn, als wir über den verregneten März sprachen und er einen Schluck Champagner trank und sagte: »Ach, wo Sergeant März im Gefecht steht, bezieht Captain April das Hauptquartier, und General Juni kommt mit seinen Damen hinterher«; und als er mir von seinem Haus mit der langen Geschichte erzählte und ein Foto von seinem schönen Sohn zeigte, wollte ich ein bisschen mehr als Sex.
Das war einer der Momente, in denen ich mich verliebt habe: als mir dämmerte, dass David sich von sämtlichen Männern unterscheidet, mit denen ich bislang zu tun hatte, und dass er vollkommen anders ist als ich. Eine Frau, die in einer Sozialwohnung im Südosten von London aufgewachsen ist. Die als junges Mädchen viele Bücher verschlungen hat, um der Realität zu entkommen. Die Kühlregale in Supermärkten nicht mag, weil sie sie an die Zeiten erinnern, als ihre Mutter das Geld für die Heizung nicht aufbringen konnte.
Und dann David.
Wir waren in einer Bar in Soho. Wir waren angetrunken. Kurz davor, uns zu küssen. Er zeigte mir noch einmal das Foto von diesem bezaubernden Jungen. Ich weiß nicht, wieso, aber im selben Augenblick stand es fest. Ich wollte auch so ein Kind haben. Mit solchen einmalig blauen Augen und dem dunklen Haar seines gutaussehenden Vaters.
Ich wollte, dass David mehr erzählte: von seinem Haus, dem kleinen Jamie, der Geschichte seiner Familie.
Er lächelte.
»Rund um Carnhallow House ist Wald. Der Ladies Wood. Er zieht sich durch das ganze Carnhallow-Tal, bis hinauf zum Moor.«
»Okay. Wald. Ich mag Wald.«
»Es sind vor allem Vogelbeerbäume, dazwischen ein paar Eschen, Haselnusssträucher und Eichen. Die Vogelbeerbäume werden in alten angelsächsischen Urkunden erwähnt und seitdem immer wieder, daher wissen wir, dass es sie seit der Zeit der normannischen Eroberung gibt. Das bedeutet, dass diese Bäume seit tausend Jahren dort stehen. Im Carnhallow-Tal.«
»Ich verstehe nicht …«
»Weißt du, was mein Nachname bedeutet? ›Kerthen‹ ist kornisch. Weißt du, was es heißt?«
Ich schüttelte den Kopf und versuchte, mich zu konzentrieren, mich nicht ablenken zu lassen vom Champagner und von den Fotos von dem Jungen, von dem Gedanken an das Haus und alldem.
»Du findest das vielleicht seltsam, David, aber Kornisch habe ich in der Schule nicht gelernt.«
Er lachte. »›Kerthen‹ heißt Vogelbeerbaum. Und das bedeutet, dass wir Kerthens seit tausend Jahren im Carnhallow-Tal leben, unter den Vogelbeerbäumen, von denen wir unseren Namen haben. Trinken wir noch einen?«
Er beugte sich zu mir herüber, um einzuschenken, und küsste mich auf den Mund. Zum ersten Mal. Zehn Minuten später stiegen wir in ein Taxi. Länger brauchte es nicht.
Die Erinnerungen treten in den Hintergrund; ich bin zurück im Jetzt, als David das Telefonat beendet und mit gerunzelter Stirn auf mich zukommt.
»So, tut mir leid, aber ich muss jetzt wirklich los. Ich darf den Dreizehn-Uhr-Flieger nicht verpassen – sie schieben schon Panik.«
»Es hat doch was, unentbehrlich zu sein.«
»Ich glaube nicht, dass irgendein Anwalt für Unternehmensrecht unentbehrlich ist. Selbst Bratschisten sind wichtiger.« Er lächelt. »Nur dass die Leute im Unternehmensrecht absurd überbezahlt sind. Und was machst du heute?«
»Mich weiter umsehen, denke ich. Bevor ich irgendetwas anrühre, will ich mich wenigstens ein bisschen auskennen. Ich meine, ich weiß ja noch nicht mal, wie viele Zimmer das Haus hat.«
»Achtzehn«, sagt er. Runzelt die Stirn und schickt hinterher: »Glaube ich.«
»David! Hör dir mal zu! Puh. Wieso weißt du nicht, wie viele Zimmer dein Haus hat?«
»Wir werden sie alle durchprobieren. Versprochen.« Er streift die Manschette zurück und schaut auf seine silberne Uhr. »Wenn du wirklich nachforschen willst – Ninas Bücher sind im Gelben Salon. Die, in denen sie für die Restaurierung gestöbert hat.«
Den Namen zu hören versetzt mir einen kleinen Stich, aber ich lasse mir nichts anmerken.
Nina Kerthen, geborene Valéry. Davids erste Frau. Viel weiß ich nicht über sie: Ich habe ein paar Fotos gesehen, ich weiß, dass sie schön war, Pariserin, jung, vornehm, blond. Ich weiß, dass sie vor anderthalb Jahren durch einen Unfall in der Morvellan Mine ums Leben gekommen ist. Ich weiß, dass ihr Mann und vor allem ihr Sohn – mein brandneuer, achtjähriger Stiefsohn Jamie – noch immer trauern, auch wenn sie es zu verbergen suchen.
Und ich weiß, sehr genau, dass es zu meinen Aufgaben hier in Carnhallow gehört, etwas zu retten: diesem traurigen, liebenswerten kleinen Jungen die beste Stiefmutter der Welt zu sein.
»Ich schau mal rein«, sage ich leichthin. »In die Bücher. Vielleicht bekomme ich ein paar Anregungen. Und du solltest jetzt losfahren; sieh zu, dass du den Flieger kriegst!«
Er dreht sich noch einmal um, will mir einen Kuss geben, doch ich weiche aus.
»Nein – nicht. Wenn du mich küsst, endet das im vierzehnten Zimmer, und dann wird es sechs.«
Das ist nicht gelogen. David lacht. Dunkel, sexy.
»Heute Abend skypen wir, und am Freitag sehen wir uns.«
Damit geht er.
Ich höre am Ende langer Flure Türen zufallen und kurz darauf das Grollen des Mercedes-Motors. Danach herrscht Stille: die besondere Carnhallow-Stille, in der wie ein Flüstern von ferne die See zu hören ist.
Ich nehme mein Telefon zur Hand und öffne die Notizen-App.
Es wird nicht einfach, die von Nina begonnene Restaurierung des riesigen Hauses weiter voranzutreiben. Ein gewisses künstlerisches Talent wird mir helfen: Ich habe am Goldsmiths College Fotografie studiert. Was sich als komplett nutzlos erwiesen hat, denn ich habe den Abschluss genau zu der Zeit gemacht, als mit Fotografie kein Geld mehr zu verdienen war, und so habe ich am Ende Fotografie unterrichtet. Kinder, die nie im Leben selbst Fotografen werden würden.
Das war, nehme ich an, auch ein Grund, warum ich das Leben in London nur zu gern aufgegeben habe: Die Sinnlosigkeit fing an, mir zuzusetzen. Ich habe nicht einmal mehr Fotos gemacht. Nur Busfahrten durch den Regen, heim in meine enge, teilgemietete Wohnung in Shoreditch. Die ich mir eigentlich nicht leisten konnte.
Und jetzt, da ich gar keinen richtigen Job habe, kann ich – Ironie des Schicksals – diese künstlerische Begabung nutzen.
Bewaffnet mit meinem Telefon, mache ich mich auf den Erkundungsgang, versuche, mir eine Art inneren Lageplan von Carnhallow House zu schaffen. Seit einer Woche bin ich jetzt hier, aber wir haben die meiste Zeit im Schlafzimmer, in der Küche oder am Strand verbracht und das herrliche Sommerwetter ausgenutzt. Meine Sachen aus London liegen zum großen Teil noch in den Kisten. Sogar ein Koffer von unserer Hochzeitsreise steht noch unausgepackt da, von unserem großartig hedonistischen, sagenhaft kostspieligen Aufenthalt in Venedig, wo David mich in »Harry’s Bar« am Markusplatz zu seinem Lieblingsmartini eingeladen hat: eiskaltem Gin in einem Shot-Glas, »vergiftet mit einem Spritzer Wermut«, wie er sagte. Ich mag Davids Art, Sachen zu beschreiben.
Aber das ist schon Geschichte. Meine Zukunft ist das hier: Carnhallow.
Ich breche in südliche Richtung auf wie ein Polarforscher, gehe durch die Neue Halle, mustere Mobiliar und Dekoration, mache mir Notizen. Die Wandpaneele sind gotisches Faltwerk, vermute ich, die Bilder Holzschnitte, Motive aus den vielen kornischen Zinn- und Kupferminen, die den Kerthens einmal gehört haben: die Stollen und Tunnel von Botallack und Morvellan, die Schächte und Lagerstätten von Wheal Chance und Wheal Rose. Außerdem alte Fotos, wehmütige Aufnahmen aus der Blütezeit der Minen, zum Bild erstarrte Arbeitsszenen einer vergessenen Industrie, Männer in Warnweste, die Schubkarren vor sich herschieben, rauchende Schornsteine, im Hintergrund das Meer.
Am Ende der Neuen Halle kommt eine große Flügeltür. Was dahinterliegt, weiß ich: der Gelbe Salon. Ich stoße die Tür auf, trete ein und schaue mich – halb sehnsüchtig, halb hilflos – um.
Denn dieser bereits restaurierte Raum mit den bleiverglasten Fenstern und dem Blick über die nach Süden gelegenen Beete und Rasenflächen ist wahrscheinlich der schönste von allen – und daher derjenige, der mich am meisten einschüchtert.
Er ist der Maßstab; ich will, dass am Ende alles so eindrucksvoll ist. Das wird nicht einfach; Nina hatte einen erlesenen Geschmack. Andererseits zeigt der Gelbe Salon auch, was in dem Haus steckt. Wenn ich anschließen kann an das, was Nina begonnen hat, wird Carnhallow am Ende wunderschön sein. Und meins.
Die Vorstellung ist so überwältigend, dass mir schwindlig wird. Und froh ums Herz.
Ich habe ein paar Notizen zum Gelben Salon im Handy gespeichert. Allerdings geht aus ihnen nicht viel mehr hervor, als dass ich keine Ahnung habe. »Ein blaues Schwein auf dem Tisch«, steht da, »18.-Jahrhundert-Urnen?«, und: »Mameluckensäbel«. Außerdem: »Spielkarten von Davids Vater«, »sie haben Chouette gespielt« und: »Messing mit Schildpatt-Inlay«.
Was fange ich damit an? Womit fange ich an? Einmal habe ich schon flüchtig in Ninas Büchern geblättert: bändeweise kluge, aber auch komplizierte Ausführungen zu georgianischen Möbeln und viktorianischem Silber, Bücher voller Wörter, die einen verzaubern und zugleich verwirren: Hamstone-Ecksteine, Aurora-Tapeten, alte Epergnen.
Das klingt alles so exotisch und sonderbar und nach unfassbarem Luxus. Ich bin in einer vollgestopften kleinen Sozialwohnung aufgewachsen. Unser kostbarster Besitz war ein überdimensionierter Fernseher, vermutlich gestohlen. Jetzt werde ich Tausende für »silberne Stuart-Fingerschalen« ausgeben und sie »mit Rosenwasser füllen«. Wie es aussieht.
Gedankenverloren, sorgenvoll und fasziniert zugleich, bewege ich mich durch den Raum und bleibe schließlich vor einer Ecke mit einem polierten Beistelltischchen stehen. Cassie, die thailändische Haushälterin, hat hier eine silberne Vase hingestellt, darin Lilien und Rosen. Aber irgendwie passt die Vase nicht. Vielleicht fange ich damit an. Nur das. Ein erster Schritt, dann folgt der nächste.
Ich lege mein Handy weg und rücke die Vase behutsam zurecht – plaziere sie in der Mitte des Tisches.
Es ist immer noch nicht richtig. Vielleicht sollte sie etwas nach links versetzt stehen, eben nicht in der Mitte? Keine gute Fotografin rückt ihr Objekt genau in die Bildmitte.
Zehn Minuten lang versuche ich, die optimale Position für diese Vase zu finden. Ich stelle mir Nina Kerthen vor, wie sie hinter mir steht und in mühsam verhohlenem Entsetzen den Kopf schüttelt. Und schon kehren die Selbstzweifel zurück. Nina Kerthen hätte das hingekriegt, da bin ich mir sicher. Perfekt hätte sie es gemacht. Das Haar wäre ihr in die Stirn gefallen beim konzentrierten Hinschauen und Blinzeln, blonde Strähnen vor den leicht schräg stehenden, klugen blauen Augen.
Seufzend gebe ich auf und starre hinunter auf den Tisch. Dunkel spiegelt sich mein Gesicht in dem lackierten Eibenholz. Quer über die Tischplatte verläuft ein Riss, der das Bild zweiteilt. Das passt.
Ich höre immer wieder, ich sei attraktiv, und trotzdem empfinde ich mich nicht als schön: mit meinem roten Haar und den Sommersprossen und der keltischen hellen Haut, die nie braun wird. Stattdessen fühle ich mich wie mit Mängeln behaftet; angeknackst. Kaputt. Und wenn ich mich genau anschaue, sehe ich keine Spur von Schönheit: nur die tiefer werdenden Linien um die Augen, viel zu viele für mein Alter – gerade mal dreißig.
Ein angenehmer Lufthauch streift mich. Er kommt durchs offene Fenster herein, bringt den Duft der Blumen mit und weht die dummen Gedanken fort, erinnert mich an mein Selbstwertgefühl. Nein. Ich habe keinen Knacks; genug der Selbstzweifel. Ich bin Rachel Daly, und ich habe schon andere Herausforderungen überstanden als die, die passende Tapete aufzutreiben oder herauszufinden, was eine Tazza ist.
Die achtundsiebzig Zimmer können warten und ebenso der Westflügel. Ich muss an die frische Luft. Rasch stecke ich das Telefon ein, gehe zur Ost-Tür, öffne sie und halte das Gesicht in die unbeteiligte, herrlich warme Sonne. Und dann schaue ich hinaus auf den Rasen. Auf die wunderbaren Gärten.
Die Gärten von Carnhallow, so habe ich gehört, waren das Einzige, worum Davids Vater, Richard Kerthen, sich noch gekümmert hat, während er auf direktem Weg zum Herzinfarkt das Vermögen der Kerthens verspielte. Und Nina hat an den Gärten offenbar wenig verändert. Deshalb fühle ich mich hier draußen besser: Im Schatten der kornischen Ulmen kann ich mich ganz unbefangen an dem frisch gemähten Rasen erfreuen, an den Beeten, die in allen Farben des Sommers blühen. Und ich kann den tiefen Wald ins Herz schließen, der das Haus schützend umgibt, als sei es ein Schatzkästchen inmitten einer Dornenhecke.
»Hallo.«
Ich zucke zusammen und drehe mich um. Da steht Juliet Kerthen, Davids Mutter. Sie lebt und versorgt sich trotzig allein in ihrer Wohnung, die vom ansonsten baufälligen, kein bisschen restaurierten Westflügel abgezweigt ist. Ihr sind erste Anzeichen von Alzheimer anzumerken, aber sie befindet sich noch, wie David es formuliert, »im Stadium vornehmer Verleugnung«.
»Schöner Tag«, sagt sie.
»Ja, herrlich, oder?«
Wir sind uns schon ein paarmal begegnet. Ich mag sie sehr: Sie hat einen regen, lebhaften Geist. Ob sie mich mag, weiß ich nicht. Noch habe ich mich nicht getraut, mehr auf sie zuzugehen, mich mit ihr anzufreunden, mit einem Blaubeer-Apfel-Kuchen an ihrer Tür aufzukreuzen. Denn Juliet Kerthen mag alt und gebrechlich sein, sie schüchtert mich trotzdem ein. Blaue Augen, hohe Wangenknochen; sie ist die Tochter von Lord Carlyon, entstammt also auch einer alten kornischen Familie. In ihrer Gesellschaft empfinde ich überdeutlich, dass ich ein Arbeiterklasse-Mädchen aus Plumstead bin. Wahrscheinlich würde sie meinen Kuchen etwas gewöhnlich finden.
Dabei ist sie absolut freundlich. Das Problem liegt bei mir.
Sie schirmt die Augen mit der flachen Hand gegen die Sonne ab. »David sagt immer, das Leben ist wie ein vollendeter englischer Sommertag: schön, gerade weil es etwas so Besonderes und so vergänglich ist.«
»Das klingt sehr nach David, ja.«
»Wie lebst du dich denn hier ein, meine Liebe?«
»Gut. Wirklich gut.«
»Ja?« Sie kneift die Augen zusammen und mustert mich mit freundlicher Miene.
Ich mustere sie meinerseits. Sie ist gekleidet, wie alte Damen sich nun mal kleiden, aber hübsch. Ein Kleid, das an die dreißig Jahre alt sein mag, eine braune Kaschmir-Strickjacke, robuste, teure Schuhe, wahrscheinlich vor vierzig Jahren in Truro maßgefertigt und jetzt von Cassie gewienert; Cassie, die jeden Tag einmal bei ihr reinschaut, um sich zu vergewissern, dass die alte Dame noch am Leben ist.
»Du findest es nicht zu wuchtig?«
»Ach nein, na ja, vielleicht ein bisschen, aber …«
Juliet lächelt mitfühlend. »Nimm es nicht so schwer. Ich weiß noch, wie ich das erste Mal mit Richard nach Carnhallow gekommen bin. Es war ein Martyrium. Das letzte Stück der Fahrt. Diese grässlichen kleinen Straßen von St. Ives hier herüber. Ich glaube, Richard war sogar stolz darauf, dass es so abgelegen ist. Dazu noch die lange Geschichte. Möchtest du eine Tasse Tee? Ich habe ausgezeichneten Pu Erh. Ihn immer allein zu trinken ist langweilig. Gin wäre auch da. Ich kann mich gar nicht entscheiden.«
»Ja. Tee wäre schön. Vielen Dank.«
Ich folge ihr um den Westflügel herum zur Nordseite des Hauses. In der Ferne glänzt silbern die See im Sonnenlicht. Die Bergwerksgebäude hoch auf den Klippen rücken in unser Gesichtsfeld. Ich rede weiter über das Haus, versuche, Juliet – und vielleicht auch mich selbst – davon zu überzeugen, dass ich voller Optimismus bin.
»Schon verrückt, wie versteckt es liegt. Carnhallow, meine ich. In dieses kleine Tal gekuschelt; so ein sonniges Plätzchen. Und trotzdem ist man nur ein paar Kilometer von den Mooren entfernt, wo alles so karg ist.«
Sie dreht sich um und nickt. »Allerdings. Wobei das Haus auch eine ganz andere Seite hat. Das ist geschickt gemacht. Richard meinte immer, es beweist, dass an der Legende etwas dran ist.«
Ich ziehe die Brauen hoch. »Das heißt?«
»Na ja, die andere Seite des Hauses geht nach Norden, da schaut man zu den Minen rüber, zu den Klippen.«
Da ich kein Wort verstehe, schüttele ich nur den Kopf.
»Hat David dir die Legende nicht erzählt?«, fragt sie.
»Nein, ich kann mich jedenfalls nicht erinnern. Ich meine, er hat jede Menge Geschichten erzählt. Von den Vogelbeerbäumen. Dem Bösewicht Jago Kerthen …« Was ich nicht sagen will, ist: Vielleicht habe ich nach dem vielen Champagner bei unserem ersten Date und dem wilden Sex danach die Hälfte von dem, was er erzählt hat, vergessen – was sehr gut möglich ist.
Juliet dreht sich etwas und schaut zu den Silhouetten der alten Bergwerksgebäude hinüber. »Also gut. Das ist die Legende: Die Kerthens, heißt es, müssen über eine besondere Kraft verfügt haben, einen sechsten Sinn oder eine Art Hellsichtigkeit, denn sie haben immer neue ergiebige Zinn- und Kupferlagerstätten aufgetan, während andere Spekulanten bankrottgingen. Es gibt eine kornische Bezeichnung für Leute mit dieser Gabe: tus-tanyow. Das heißt so viel wie ›Menschen aus Feuer, Menschen mit dem besonderen Licht‹.« Sie lächelt arglos. »Mit der Zeit wirst du mitbekommen, dass die Einheimischen sich die Geschichte erzählen. Im ›Tinner’s‹ zum Beispiel, das ist ein nettes Pub in Zennor, da musst du unbedingt mal hin, aber lass die Finger von der Starry Gazy Pie. Wie auch immer, Richard hat sie jedenfalls oft heruntergeleiert, die Legende. Weil die Kerthens ihr Haus, das auf Morvellan ausgerichtet ist, auf den Grundmauern des alten Klosters erbaut haben, und zwar mehrere hundert Jahre bevor in Morvellan Zinn entdeckt wurde. Für Leute, die empfänglich für so was sind, heißt das natürlich, dass an der Legende etwas dran ist. Als hätten die Kerthens gewusst, dass sie Zinn finden würden. Ja, ich weiß, wir wollten reingehen und eine Tasse Pu Erh trinken – und Gin; vielleicht verträgt sich das ja ganz gut.«
Strammen Schrittes umrundet sie die nordwestliche Ecke des Hauses. Und ich, dankbar für die freundschaftliche Geste und die Ablenkung, folge ihr. Denn ihre Geschichte beunruhigt mich in einem Maße, das ich mir selbst nicht erklären kann.
Am Ende ist es doch nur ein Histörchen über die alte Familie, die so viel Wohlstand anhäufen konnte, indem sie junge Männer in die Minen hinunterschickte. Wo die Stollen bis unters Meer reichen.
162 Tage vor Weihnachten
David zeichnet mich. Die Sonne steht hoch am Himmel; wir sitzen auf dem duftenden Rasen, neben uns ein Silbertablett mit einem Krug voll frisch gepresstem Pfirsich-Zitronen-Saft. Ein Strohhut sitzt schräg auf meinem Kopf. Carnhallow House – mein großes, schönes Haus – glüht im Sonnenlicht. Noch nie bin ich mir so vornehm vorgekommen. Vielleicht war ich noch nie so glücklich.
»Nicht bewegen«, sagt er. »Halt noch eine Sekunde still. Ich bin gerade bei deiner hübschen Nase. Nasen sind schwierig. Da kommt’s auf die richtigen Schatten an.«
Er wirft einen konzentrierten Blick in meine Richtung und wendet sich dann wieder dem Zeichenblatt zu; mit kleinen, schnellen Bewegungen führt er den Bleistift, schattiert und schraffiert.
Er ist ein sehr guter Künstler, wahrscheinlich – das wird mir allmählich klar – ein viel besserer als ich. Viel talentierter. Ich kann auch ein bisschen zeichnen, aber bei weitem nicht so sicher und schon gar nicht so schnell.
Diese künstlerische Seite von David zu entdecken war eine der größten Freuden dieses Frühsommers. Dass er sich für Kunst interessiert, wusste ich bereits, schließlich habe ich ihn auf einer Vernissage in Shoreditch kennengelernt. Und in Venedig konnte er mir so viel zeigen, nicht nur die gängigen Tizians und Canelettos, sondern auch die Brancusis in der Peggy Guggenheim Collection, das barocke Deckengemälde von San Pantalon oder auf Torcello die Madonna, deren Blick so wachsam ist, so gequält und zugleich voller Liebe. Voll der ewig währenden mütterlichen Liebe. Sie war so schön und so traurig, dass mir die Tränen kamen.
Aber dass David Kunst auch hervorbringt, und zwar ziemlich gekonnt, habe ich erst begriffen, als ich nach Carnhallow kam. Im Salon und in seinem Arbeitszimmer hängen einige Frühwerke: halb abstrakte Bilder von Hügeln und Mooren und Stränden; typische Penwith-Landschaften. Sie sind so gut, dass ich sie anfangs für teure Künstlerarbeiten hielt; ich dachte, Nina hätte sie in einem Auktionshaus in Penzance erstanden, sie seien Teil ihrer hingebungsvollen Restaurierungsmaßnahmen.
»So«, sagt er. »Die Nase ist fertig. Jetzt der Mund. Münder sind einfach. Es dauert zwei Sekunden.« Er lehnt sich zurück und schaut das Bild an. »Ha. Super.«
Zufrieden schlürft er einen Schluck Saft. Warm scheint die Sonne auf meine nackten Schultern. Im Ladies Wood zwitschern die Vögel. Es würde mich nicht wundern, wenn sie plötzlich unisono sängen. Das ist es. Ein Augenblick vollendeten Glücks. Der Mann, die Liebe, die Sonne, das wunderschöne Haus in dem wunderschönen Garten in einer wunderschönen Ecke von England. Es drängt mich, etwas Nettes zu sagen, mich der Welt erkenntlich zu zeigen.
»Du bist richtig gut, das weißt du, oder?«
»Wie?«
Er zeichnet schon wieder. Tief versunken, ganz männliche Konzentration. So gefällt er mir. Die Stirn gerunzelt, aber nicht im Zorn. Ein Mann bei der Arbeit.
»Im Zeichnen. Ich habe das schon mal gesagt, ich weiß, aber du hast wirklich Talent.«
»Na ja«, sagt er wie ein Teenager. Dazu lächelt er sehr erwachsen, während seine Hand energisch über das Papier fährt. »Vielleicht.«
»Hast du dir nie gewünscht, dein Geld damit zu verdienen?«
»Nein. Ja. Nein.«
»Was denn nun?«
»Als ich in Cambridge fertig war, habe ich ganz kurz daran gedacht. Ich hätte es gern versucht, aber die Option hatte ich nicht: Ich musste arbeiten und Geld verdienen, jede Menge langweiliges Geld.«
»Weil dein Vater euer Vermögen verspielt hatte?«
»Sogar das Familiensilber hat er versetzt. Um diese schwachsinnigen Spielschulden zu bezahlen. Er hat es verscherbelt wie ein Junkie den Fernseher. Ich musste es zurückkaufen – das Kerthen-Silber, und sie haben mich richtig abkassiert.« David seufzt, trinkt noch einen Schluck. Lichtreflexe funkeln auf dem Glas, als er es neigt. Er kostet den Geschmack aus, die erfrischende Kühle, und schaut an mir vorbei, hinüber zu den sonnengesprenkelten Bäumen.
»Das Geld wurde natürlich sowieso knapp; es war nicht nur die Schuld meines Vaters. Carnhallow zu unterhalten war absurd kostspielig, aber die Familie hat es all die Jahre versucht. Obwohl schon um 1870 die meisten Bergwerke Verlustgeschäfte waren.«
»Warum?«
Er hebt den Bleistift und tickt damit gegen seine weißen Zähne. In Gedanken ist er bei dem Bild, und so fällt seine Antwort auch aus. »Ich muss dich wirklich mal nackt zeichnen. In Brustwarzen bin ich extrem gut. Eine echte Begabung.«
»David!« Ich lache. »Ich will das wissen. Ich will’s verstehen. Wieso haben die Bergwerke Verluste gemacht?«
Schon wieder ins Zeichnen vertieft, sagt er: »Weil der Bergbau hier hart ist. Im kornischen Boden liegen immer noch mehr Zinn und Kupfer, als in viertausend Jahren gewonnen werden konnten, aber es ist praktisch unmöglich, da heranzukommen. Und schon gar nicht profitabel.«
»Wegen der Felsen? Weil alles unter dem Meer liegt?«
»Genau. Du hast Morvellan gesehen. Das war unsere einträglichste Mine – im achtzehnten und neunzehnten Jahrhundert. Aber es ist extrem gefährlich; die Erze sind kaum zugänglich.«
»Erzähl weiter.«
»Dass Morvellan auf den ersten Blick anders ist – mit den zwei Häusern –, hat einen Grund. Die meisten Schächte in Cornwall lagen offen, nur die Pumpen wurden durch Mauern geschützt, vielleicht weil den Maschinen mehr Bedeutung beigemessen wurde als den Menschen. Aber da auf den Felsen, oberhalb von Zawn Hanna, mussten die Kerthens sich etwas einfallen lassen. Weil die See an der Stelle so nah ist und wegen der häufigen Stürme waren wir gezwungen, den Eingang zum Schacht genauso zu schützen – mit einem eigenen Haus, gleich neben dem Maschinenhaus.« Er starrt mich an und an mir vorbei, sein Blick scheint direkt zu den Minen zu wandern. »So ist eher zufällig diese merkwürdige diagonale Symmetrie entstanden.« Langsam rollt er den Stift zwischen den Fingern hin und her. »Wenn du das mal mit den offenen Minen in Australien oder Malaysia vergleichst – da liegt das Zinn direkt an der Oberfläche. Die können es mit einem Plastikspaten ausbuddeln. Deshalb ist der Bergbau in Cornwall ausgestorben. Viertausend Jahre Tradition und dann ein Niedergang innerhalb weniger Generationen.«
Seine Stimmung hat sich verdüstert. Ich spüre, dass ihn finstere Gedanken umtreiben, an Nina, die in der MorvellanMine ertrunken ist. Es ist wohl meine Schuld, dass unser Gespräch diese Richtung genommen hat. Hin zu den Klippen und den Grubeneingängen. Ich muss den Kurs korrigieren.
»Willst du mich wirklich nackt zeichnen?«
Sein Lächeln kehrt zurück. »Ja! Auf jeden Fall, ja.« Lachend reißt er das Blatt mit der fertigen Zeichnung aus dem Block und legt den Kopf schräg, um seine Arbeit zu begutachten. »Hm. Nicht schlecht. Aber bei der Nase habe ich doch etwas falsch gemacht. Brustwarzen kann ich wirklich besser. Gut …«, er schaut auf die Uhr, »… ich hab versprochen, dass ich Jamie zur Schule fahre …«
»Am Wochenende?«
»Er hat ein Fußballspiel, schon vergessen? Er ist total aufgeregt. Kannst du ihn dann abholen? Ich treffe mich mit Alex, in Falmouth.«
»Natürlich. Mach ich. Ich liebe dich.«
»Wir sehen uns zum Abendessen. Du bist ein sehr gutes Modell.«
Noch ein sanfter Kuss, dann geht er zu seinem Wagen, verschwindet um die Hausecke, ruft Jamie. Als wären wir bereits eine Familie. Sicher und glücklich. Dieses Gefühl wärmt mich genauso wie die Sommersonne.
Ich bleibe einfach sitzen, schläfrig, die Augen halb geschlossen. Süßes Nichtstun. Herrlich. Sicher, ich habe einiges vor, aber nichts, das sofort geschehen müsste. Ich höre Stimmen im Haus und auf der Auffahrt, dann die Autotüren. Je weiter sie sich entfernen, durch den Wald und hinauf zum Moor, desto schwächer wird das Motorengeräusch. Vogelzwitschern tritt an seine Stelle.
Plötzlich wird mir bewusst, dass ich mir Davids Zeichnung noch gar nicht angeschaut habe. Neugierig, vielleicht auch skeptisch – ich lasse mich nicht gern zeichnen, ebenso wenig, wie ich mich gern fotografieren lasse; ich habe es nur David zuliebe getan – beuge ich mich vor und angele mir das Blatt Papier.
Die Zeichnung ist erwartungsgemäß gut. Innerhalb einer Viertelstunde hat er mich erfasst, von der leichten Trauer um meine Augen, die nie ganz verschwindet, bis hin zu dem offenen, aber auch unsicheren Lächeln. Er sieht mich, wie ich bin. Und trotzdem erscheine ich auf seiner Zeichnung auch schön: Der Schatten des Hutes ist schmeichelhaft. Das Bild zeigt meine Liebe zu David, sie lebt in meinem glücklich-schüchternen Blick.
Er sieht meine Liebe, und darüber freue ich mich.
Es gibt nur eine Schwäche. Die Nase. Ich habe, wie mir häufig gesagt worden ist, eine hübsche Stupsnase. Aber er hat nicht meine gezeichnet. Die Nase auf dem Bild ist schärfer, leicht gebogen, viel schöner; diese knöcherne Struktur gehört zu jemand anders, zu jemandem, den er Tausende Male gezeichnet hat, so dass die Nase schon ein Automatismus ist. Und ich weiß auch, zu wem sie gehört. Ich habe die Fotos und Zeichnungen gesehen.
Auf Davids Bild sehe ich aus wie Nina.
Die Zeichnung liegt im Gras, sie ist mir aus der Hand gefallen. Ich muss in der wärmenden Sonne eingenickt sein. Ein kurzer Blick in die Runde sagt mir, dass alles wie immer ist. Nur die Schatten sind länger geworden. Trotzdem ist es noch schön, es herrscht strahlender Sonnenschein.
Ich schlafe viel hier in Carnhallow, und ich schlafe gut. Als hätte ich nach fünfundzwanzig Jahren Mit-Wecker-Schlafen etwas nachzuholen. Manchmal ist das Urlaubsgefühl so übermächtig, dass mein latent immer vorhandenes schlechtes Gewissen erwacht. Und mit ihm eine Spur Einsamkeit.
Noch habe ich hier unten keine richtigen Freunde, deshalb bin ich während der vergangenen Wochen, wenn ich nicht im Haus war, durch die rauhe Landschaft von Penwith gefahren und gewandert. Die Schornsteine der stillgelegten Zechen sind tolle Fotomotive, genau wie die vom Salz angefressenen Fischerdörfer und die schroffen Buchten, in denen sich – außer an extrem stillen Tagen – die Wellen mit voller Kraft gegen die Felsen werfen. Aber mein Lieblingsort ist immer noch Zawn Hanna, die Bucht am Ausgang unseres Tals. Oben auf dem Steilufer steht die MorvellanMine, aber ich achte nicht auf die schwarzen Gestalten, sondern schaue hinaus aufs Meer.
Wenn ein seltener Sommerregen dafür sorgte, dass ich im Haus blieb, habe ich weiter an meinem inneren Carnhallow-Lageplan gebastelt. Habe die achtundsiebzig Zimmer gezählt und festgestellt, dass es tatsächlich achtzehn sind, je nachdem, ob man die kleinen, armseligen, staubigen Kammern ganz oben mitzählt, in denen vermutlich die Dienstboten gewohnt haben, wobei in ihnen atmosphärisch auch noch etwas von den Klosterzellen nachhallt, die einmal auf diesem Grund und Boden gestanden haben, in diesem lieblichen kleinen Tal.
An manchen Tagen kommt es mir, wenn ich allein da oben bin und der Seewind durch die Vogelbeerbäume fegt, vor, als hörte ich im Wind die Mönche sprechen: Ave Maria, gratia plena: Dominus tecum …
Oft halte ich mich auch im Salon auf, dem Raum, der mir neben der Küche und den Gärten der liebste ist in Carnhallow. Inzwischen habe ich die meisten Bücher durchgesehen, von Ninas Fachliteratur über altes Tafelsilber und Meissener Porzellan bis hin zu Davids vielen Monographien über Künstler der Moderne: Klee, Bacon, Jackson Pollock. Besonders liebt er abstrakte Expressionisten.
Letztes Wochenende habe ich ihn eine Stunde lang dasitzen und die schwarzen und roten Kleckse eines Mark-Rothko-Bildes anstarren sehen; danach klappte er das Buch zu, sah mich an und sagte: »Wir sind doch alle Astronauten, oder? Interstellare Astronauten, so tief eingetaucht ins Schwarze, dass wir nie zurückkommen.« Damit stand er auf und kredenzte mir in einem georgianischen Tumbler Plymouth Gin.
Meine größte Entdeckung allerdings war weder Porzellan noch ein Kunstwerk, sondern ein eselsohriges Fotoalbum, das sich zwischen zwei fetten Bildbänden versteckte, van Dyck und Michelangelo.
Ich schlug das zerfledderte kleine Buch auf und fand beeindruckende Schwarzweißbilder von den alten Kerthen-Minen, von Männern bei der Arbeit dort.
Meiner Schätzung nach stammen die Fotos aus dem neunzehnten Jahrhundert. Ich schaue sie mir nahezu täglich an. Was mich am meisten fasziniert, ist, dass die Bergleute praktisch ohne Licht gearbeitet haben: Sie hatten nur die Kerze, die in ihrem Filzhut steckte und einen schwachen, flackernden Schein verbreitete. Was bedeutet, dass der Augenblick, in dem der Magnesiumblitz des Fotografen explodierte, der einzige in ihrem Leben war, in dem sie deutlicher sehen konnten, wo sie eigentlich arbeiteten, wo sie Stunde um Stunde gruben und hackten und bohrten. Einen kostbaren Moment lang war es hell, dann setzte die lebenslange Finsternis wieder ein.
Der Gedanke an die Grubenarbeiter, die sich unter dem Flecken Erde, auf dem ich mich befinde, ihr Leben lang abgerackert haben, bringt mich auf die Beine. An die Arbeit, Rachel Daly.
Die Zeichnung wird gefaltet und zu den zitronig riechenden Gläsern auf das Tablett gelegt, das aufgeheizt ist von der Sonne. Ich trage es ins Haus, in die kühle, geräumige Küche. Dann öffne ich meine Notizen-App. Es gibt nur noch zwei wichtige Bereiche, die ich erkunden muss: Ich habe sie mir bis zuletzt aufgehoben, weil sie in Carnhallow House die größte Herausforderung darstellen.
Das eine sind die verschiedenen Keller.
Am Tag meiner Ankunft hat David mir dieses unheimliche Labyrinth einmal gezeigt; seitdem bin ich nie wieder unten gewesen. Weil es dort schrecklich ist: ein Wirrwarr trostloser, schmuddeliger Gänge, wo rostige Glocken baumeln, die nie wieder jemand zu hören braucht.
Es gibt mehrere Treppen nach unten. Ich nehme gleich die erste neben der Küche. Knipse wenig vertrauenerweckende Lampen an, achte darauf, wo ich auf den ächzenden Holzstufen hintrete, und schaue mich um.
An Türen, von denen die Farbe abblättert, hängen alte Schilder: Bürstenraum, Geschirrkammer, Dienstbotenkammer, so geht es weiter, eine endlose Flucht, die sich im Schatten verliert. An der Stirnseite des Ganges erkenne ich den hohen steinernen Bogen über der Tür zum Weinkeller. David und Cassie sind oft hier unten: Dieser Teil des riesigen Kellers wird tatsächlich genutzt. Offenbar hat der Weinkeller – wenn auch zugemauerte – Spitzbogenfenster, ein Relikt aus der Zeit vor tausend Jahren, als das hier noch ein Kloster war. Eines Tages werde ich mich in diesen Keller setzen und den Staub von französischen Etiketten pusten; etwas über Wein lernen, so, wie ich mir auch alles andere hier langsam aneigne. Heute aber will ich mir nur einen Überblick verschaffen.
In dem Gang, der in die entgegengesetzte Richtung führt, finde ich weitere Schilder an weiteren Türen: Backstube, Putzkammer, Molkerei. Unfassbar, wie viel Geröll und alter Krempel sich in diesen Gängen stapelt, sie teilweise regelrecht verstopft. Eine vorsintflutliche Nähmaschine. Ein halbes uraltes Motorrad, in Einzelteile zerlegt und dann hier vergessen. Zerbrochene Tonpfeifen, die bestimmt zweihundert Jahre alt sind. Ein halb vermoderter viktorianischer Kleiderschrank. Eine auffällige Lampe, vielleicht aus Schwanenfedern gemacht. Ein riesiges Pferdekutschenrad. Es ist, als hätten die Kerthens es im Verlauf ihres Aussterbens, ihrer Auflösung, ihres Zerfalls nicht geschafft, sich von etwas zu trennen, weil das ihren Niedergang auf zu schmerzhafte Weise gezeigt hätte. Also liegt alles hier unten versteckt. Begraben.
Das Telefon noch in der Hand, lege ich eine Pause ein. Die Luft steht. Es ist kalt. In einer Ecke lauern ohne erkennbaren Grund zwei riesige alte Kühlschränke. Sofort male ich mir aus, in einem davon eingesperrt zu sein. Gekrümmt in dem muffigen Innenraum zu hocken und gegen die Tür zu hämmern; ausgesetzt in einem Kellergang, den nie wieder jemand betreten wird. Ein tagelang sich hinziehendes Sterben in einem Quader von einem Sarg.
Mich schaudert. Als ich weitergehe und mich nach links wende, stoße ich auf eine noch ältere Tür. Das Mauerwerk mutet hier mittelalterlich an, und auf dem Holzschild, das an einem Nagel hängt, steht: GEIST.
Geist?
Wie, Geist? Gibt’s hier was für den Geist? Wohnt hier ein Geist? Das Schild nervt.
GEIST.
Ich überwinde meine Angst und drücke gegen die Tür. Die Angeln sind eingerostet: Ich muss mich mit der Schulter dagegenstemmen, bis die Tür schließlich unter lautem Krachen auffliegt. Als hätte ich etwas kaputt gemacht. Mir ist, als starre das Haus mich missbilligend an.
Hier drinnen ist es besonders dunkel. Einen Lichtschalter kann ich nicht entdecken; das einzige bisschen Helligkeit kommt aus dem Gang hinter mir. Langsam gewöhnen sich meine Augen an die Schwärze. In der Mitte des kleinen Raums steht ein ramponierter Holztisch. Er ist entweder sehr alt oder nicht gut behandelt worden. In einem Regal sind Flaschen aufgereiht, allesamt mit einer grauen Staubschicht bedeckt. Um einige der Flaschenhälse hängt ein dünnes Kettchen mit einem winzigen Schild; wie Halsbänder für winzige Sklavenmädchen. Ich gehe näher heran, um zu lesen, was – krakelig mit Feder und Tinte geschrieben – auf den Schildchen steht.
Mutterkraut. Wermut. Beinwell. Königskerze.
Geist.
GEIST.
Ich glaube, ich verstehe. Hier wurde destilliert. Geist hergestellt. Hier wurden Heilmittel gemixt und Tinkturen angerührt.
Als ich mich zum Gehen wende, fällt mein Blick auf etwas, das ich hier am wenigsten vermutet hätte. Drei oder vier große Pappkartons, in einer Ecke gestapelt, halb verdeckt von einer Kiste mit alten Glasbehältern. Auf den Kartons steht in schwungvoller Schrift: Nina.
Das also sind ihre Sachen? Die Sachen der Toten, der toten Mutter, der toten Ehefrau. Kleidung oder Bücher vielleicht. Die noch nicht weggeworfen werden konnten.
Jetzt fühle ich mich wirklich fehl am Platz, unbefugt, wie ein Eindringling. Ich habe nichts Schlimmes getan, ich bin die neue Ehefrau, und David möchte, dass ich mich umschaue, damit ich in der Lage bin, diesen verstaubten Irrgarten zu restaurieren, aber dass ich in den Raum quasi eingebrochen bin und nun vor diesen traurigen Kartons stehe, treibt mir die Röte ins Gesicht.
Ich zwinge mich, nicht loszurennen; gehe gemessenen Schrittes zur Treppe und steige sie hinauf. Erleichtert atme ich durch. Dann erinnert mich ein Blick auf die Uhr daran, dass ich Jamie bald abholen muss, was bedeutet, dass mir gerade noch genug Zeit für meine letzte Aufgabe bleibt.
Es gibt noch einen Teil des Hauses, den ich sehen möchte: den vollkommen verwaisten Westflügel. Und sein Kernstück, den Alten Saal. David sagt, er sei beeindruckend.
Ich aber habe noch keinen Fuß in diesen Teil des Hauses gesetzt. Nur das karge Äußere gesehen. Ich gehe durch den Flur hinter der großen Treppe, wechsle vom Ost- in den Westteil und vom Heute zum Damals.
Hier muss es sein. Eine große, schwere Naturholztür; keine Farbe. Als Griff dient ein in sich verdrehter schmiedeeiserner Ring. Er lässt sich nur mit Mühe bewegen, aber am Ende schwingt die Tür doch auf. Zum ersten Mal betrete ich den Alten Saal.
Hohe gotische Bleiglasfenster. Wohl vom Kloster übrig geblieben. Die Decke hat ein Gewölbe. Es ist kalt. Der Raum ist nichts als Stein, kein Teppich, kein einziges Möbelstück. David hat erzählt, dass sie hier früher die Bergarbeiter ausbezahlt haben. Ich sehe es vor mir: grobschlächtige Männer, die stoisch in der Schlange stehen und warten, dass sie aufgerufen werden, jeder bei seinem Nachnamen. Die Bergwerk-Oberen stehen, die kräftigen Arme verschränkt, dabei und schauen zu.
Der Raum ist imposant, aber auch erdrückend. Mich fröstelt, ich komme mir vor wie ein Kind. Das muss etwas mit der Größe zu tun haben. Erst hier, im eiskalten, leeren Herzen des Hauses, werden mir die Dimensionen von Carnhallow wirklich bewusst. Es ist riesig, es verschlingt einen. Hier erst begreife ich, dass ich in einem Haus bin, das groß genug für fünfzig Leute ist. Drei Dutzend Bedienstete und eine große Familie.
Heute leben hier gerade mal vier. Und einer davon, David, wird die meiste Zeit in London sein.
Drei Uhr nachmittags. Zeit, meinen Stiefsohn aufzusammeln. Ich laufe nach draußen, setze mich in den Mini, werfe den Motor an – und fahre langsam den engen Weg entlang, sanft bergan durch den in Sonnenlicht badenden Wald. Hier muss man aufpassen beim Fahren, aber die Straße ist schön. Sie regt die Fantasie an. Eines Tages werden meine Kinder hier spielen. Sie werden in diesem großartigen Haus aufwachsen – mit viel Raum, umgeben von schönen Dingen, Stränden, Bäumen … Im Frühling werden sie sich an wilden Glockenblumen erfreuen, im Oktober Pilze sammeln. Und Hunde wird es geben. Glücklich umhertollende Hunde, die auf den Lichtungen im Ladies Wood moosige Stöcke holen.
Als ich schließlich auf die Hauptstraße stoße, biege ich in westliche Richtung ein, so dass ich zur Linken das grün-steinige Moor habe und zur Rechten das tobende Meer. Die mäandernde Landstraße führt durch nahezu alle ehemaligen Bergwerksdörfer von West Penwith.
Botallack, Geevor, Pendeen. Morvah.
Hinter Morvah kommt eine Gabelung: Ich halte mich links und fahre durch höher gelegenes kahles Moor zu Jamies Schule, einer privaten Grundschule.
Zweimal links, ein, zwei Kilometer weiter durchs Moor, und die Landschaft hat ein anderes Gesicht. Hier unten an der Südküste ist die See ruhiger; eine glatte Fläche mit Tupfen von Sonnenlicht. Ich parke neben dem Tor zum Schulhof, stoße die Autotür auf und registriere, dass die Luft weicher ist.
Jamie Kerthen wartet schon. Er kommt auf mich zu. Obwohl Samstag ist, trägt er seine Schuluniform. Weil »Sennen« eine Schule mit strengen Regeln ist; hier müssen die Schüler Uniform tragen, wann immer sie sich auf dem Schulgelände aufhalten. Das gefällt mir. Das will ich für meine Kinder auch. Regeln und Disziplin. Und noch andere Dinge, die ich nicht hatte.
Ich lächle meinem Stiefsohn zu. Und muss dem Drang widerstehen, ihm entgegenzulaufen und ihn in die Arme zu schließen und zu drücken. Dafür ist es noch zu früh. Aber mein Beschützerinstinkt ist echt. Für immer und ewig möchte ich ihn beschützen.
Jamie erwidert mein Lächeln halbherzig – dann bleibt er stehen, als hätte er Wurzeln geschlagen, und sieht mich lange aufmerksam und sehr konzentriert an. Als müsse er überlegen, wer ich bin und was ich hier mache. Obwohl wir nun schon seit Wochen zusammenleben.
Ich gebe mir Mühe, gelassen zu bleiben. Sein Benehmen ist seltsam – aber ich weiß, dass er immer noch um seine Mutter trauert.
Es wird nicht besser, als eine andere Mutter mit ihrem Sohn an uns vorbeikommt. Ich kenne sie nicht. Ich kenne niemanden in Cornwall. Aber an dieser Isoliertheit wird sich nichts ändern, wenn die Leute denken, dass ich komisch bin und hier nicht reinpasse. Also strahle ich sie an und sage, etwas zu laut: »Hallo, ich bin Rachel. Ich bin Jamies Stiefmutter!«
Die Frau sieht zunächst mich an und dann Jamie. Der immer noch reglos am selben Fleck steht und mich fixiert.
»Ach … ja, hallo.« Sie errötet leicht. Sie hat ein hübsches rundes Gesicht und einen leicht affektierten Ton und wirkt peinlich berührt von dieser lauten fremden Frau und ihrem misstrauischen Stiefsohn. Wen wundert’s? »Wir sehen uns bestimmt bald mal, aber … äh … ich muss jetzt wirklich los«, sagt sie.
Nimmt ihren Sohn bei der Hand und stürmt davon. Einmal dreht sie sich noch um und mustert mich irritiert. Wahrscheinlich tut ihr der arme, eingeschüchterte Junge mit seiner unmöglichen Stiefmutter leid. Ich lächle weiter und wende mich Jamie zu.
»Hallo! Alles in Ordnung? Wie war das Spiel?«
Wie lange will er denn noch wie angewurzelt dastehen und schweigen? Das halte ich nicht aus. Ein paar schreckliche Sekunden dauert es noch, dann gibt er endlich nach.
»Zwei zu null. Für uns.«
»Super! Das ist doch toll.«
»Rollo hat einen Strafstoß verwandelt und dann einen Kopfball gemacht.«
»Das ist absolut großartig! Du kannst es mir unterwegs noch ausführlich erzählen. Kommst du?«
Er nickt. »Okay.«
Nun wirft er seine Sporttasche auf die Rückbank, steigt ein, lässt den Sicherheitsgurt zuschnappen, holt, sobald ich den Motor anlasse, ein Buch hervor und fängt an zu lesen. Behandelt mich wieder wie Luft.
Ich lege den Gang ein, wende, fahre los, versuche, mich auf die engen Straßen zu konzentrieren, aber es lässt mir keine Ruhe.
Wenn ich es mir recht überlege, ist das nicht das erste Mal, dass Jamie sich mir gegenüber komisch benimmt, so als traue er mir nicht, aber heute ist es am krassesten.
Warum diese Wandlung? Als ich ihm in London zum ersten Mal begegnet bin, hat er immerzu gelacht und geplappert; an unserem ersten Tag sind wir wunderbar miteinander ausgekommen. Es war auch der erste Tag, an dem ich tatsächlich Liebe für seinen Vater empfunden habe. Die Art, wie Vater und Sohn miteinander umgingen, ihr freundschaftlicher, vertrauter Ton, das wechselseitige Verstehen, der Respekt – dieses Im-Trauern-vereint-Sein – all das hat mich berührt und beeindruckt. Sofort habe ich mir solch väterliche Liebe für mein eigenes Kind gewünscht. Ich wollte, dass der Vater meiner Kinder genau so ist wie David. Ich wollte, dass er dieser Vater ist.
Sex, Begehren und Freundschaft waren bereits da – David hatte mich schon sehr für sich eingenommen –, aber erst durch Jamie ist aus diesem Gemisch Liebe geworden.
Und trotzdem, das wird mir jetzt deutlich, hat er sich, seit ich in Carnhallow wohne, immer mehr zurückgezogen. Er ist distanziert, wachsam. Als teste er mich. Als spüre er, dass etwas seltsam ist. Dass mit mir etwas nicht stimmt.
Im Rückspiegel sehe ich ihn vage in meine Richtung schauen. Seine Augen sind groß und blass-veilchenblau. Er ist wirklich ein schöner Junge, außergewöhnlich.
Bin ich oberflächlich, weil seine Schönheit es mir leichter macht, Jamie Kerthen zu lieben? Selbst wenn – ich kann nicht anders, es ist einfach so. Ein schönes Kind hat eine Wirkung, der man sich kaum entziehen kann. Und zugleich weiß ich, dass sich hinter seiner knabenhaften Schönheit eine große Traurigkeit verbirgt, was meine Liebe nur noch intensiviert. Die Mutter, die er verloren hat, werde ich nie zu ersetzen vermögen, aber ich kann seine Einsamkeit lindern, das auf jeden Fall.
Eine schwarze Strähne ist ihm in die weiße Stirn gefallen. Wäre er mein Sohn, ich würde sie ihm aus dem Gesicht streichen.
Auf einmal beginnt er doch zu reden. »Wann fährt Papa wieder?«
Meine Antwort kommt hastig. »Montagmorgen, wie immer, übermorgen. Aber er wird nur ein paar Tage weg sein. Ende der Woche kommt er wieder, mit dem Flugzeug. Das ist nicht so lange, überhaupt nicht lange.«
»Ah, okay. Danke, Rachel.« Er stößt einen tiefen Seufzer aus. »Ich wünschte, Papa würde länger zu Hause bleiben. Ich wünschte, er müsste nicht so viel weg.«
»Ich weiß. Mir geht’s genauso.«
Wie gern würde ich etwas Aufbauenderes sagen, aber unser neues Leben ist nun einmal, wie es ist: David pendelt nach London, Montagmorgen bis Freitagabend. Immer per Flugzeug, vom Flughafen in Newquay. Wenn er nach Hause kommt, heizt er mit seinem Silber-Metallic-Mercedes über die A30 und legt die letzten Kilometer auf kleinen, sich durchs Moor windenden Straßen zurück.
Es ist ein mörderisches Pensum, aber nur durch die wöchentliche Pendelei kann er seinen lukrativen Anwaltsjob in London behalten und trotzdem ein Familienleben in Carnhallow führen, was er um jeden Preis will. Schließlich leben die Kerthens seit tausend Jahren in Carnhallow.
Jamie schweigt. Wir brauchen fünfundzwanzig Minuten für die Strecke. Als wir schließlich da sind – die Sonne scheint immer noch –, greift er sich die Sporttasche und steigt aus. Wieder habe ich das Bedürfnis zu sprechen, mit ihm zu reden. Es weiter zu versuchen. Irgendwann muss doch eine Bindung entstehen. Also plappere ich vor mich hin, während ich in meiner Tasche nach dem Schlüssel grabe. Du könntest mir noch mehr von dem Fußballspiel erzählen. Meine Lieblingsmannschaft war Millwall – da bin ich aufgewachsen, sie waren nie besonders gut, aber … Dann stocke ich.
Jamie runzelt die Stirn.
»Was ist los, Jamie?«
»Nichts«, sagt er. »Nichts.«
Der Schlüssel gleitet ins Schloss, und ich öffne die große Tür. Die ganze Zeit schaut Jamie mich so seltsam an. Verwirrt. Ungläubig. Als wäre ich eine unheimliche Bilderbuchfigur, die unerklärlicherweise zum Leben erwacht ist.
»Doch. Es ist was.«
»Was, Jamie?«
»Letzte Nacht hatte ich einen seltsamen Traum.«
Ich nicke, versuche es erneut mit einem Lächeln. »Aha?«
»Ja. Ich hab von dir geträumt. Du warst …«
Er verstummt. Aber das darf ich nicht zulassen. Träume sind wichtig, vor allem die in der Kindheit. In ihnen kommen unbewusste Ängste zum Vorschein. Ich kann mich gut an meine eigenen erinnern. Um Flucht ging es darin, um verzweifeltes Weglaufen vor einer Gefahr.
Jamie tritt unbehaglich von einem Fuß auf den anderen. Wie jemand, der beim Lügen ertappt worden ist.
Aber er lügt nicht, das ist eindeutig.
»Er war schlimm. Der Traum. Da warst du, und …« Er zögert, schüttelt den Kopf und schaut auf die Bodenfliesen im Hauseingang. »Und deine Hände waren ganz voll Blut. Das Blut war da und ein Hase. Es war ein Hase, ein Tier, und Blut. Überall an dir war Blut. Von oben bis unten. Und du hast gezittert und geweint.«
Jetzt schaut er zu mir auf. Sein Gesicht verrät, wie aufgewühlt er ist. Aber nicht vor Trauer, da sind keine Tränen. Eher sieht es aus wie Ärger, vielleicht sogar Hass. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Und kann sowieso nichts sagen, denn er verschwindet ohne ein weiteres Wort im Haus. Ich bleibe allein zurück im herrschaftlichen Eingang von Carnhallow House. Total verwirrt.
Von ferne höre ich die See gegen die Felsen der MorvellanMine donnern und beides, Felsen und Bergwerk, Stück für Stück zerstören. Gnadenlos. Eine Form von Grausamkeit, die nie enden wird.
149 Tage vor Weihnachten
»Verdejo?«
David Kerthen nickte dem Kellner zu. Warum nicht einen Schluck trinken? Es war Freitagmittag, und er war praktisch auf dem Weg nach Hause, hatte endlich einmal früh Feierabend gemacht und nicht erst um zehn Uhr abends. Also konnte er trinken. Bis der Flieger in Newquay landete, würde er wieder nüchtern sein. Auf der A30 bestand ohnehin kaum die Gefahr, kontrolliert zu werden. Die Polizei in Cornwall konnte bemerkenswert unfähig sein.
Außerdem half ihm der Wein vielleicht zu vergessen. In der vergangenen Nacht hatte er zum dritten Mal in Folge von Carnhallow geträumt. Diesmal von Nina, wie sie durchs Haus wanderte, allein und nackt.
Das hatte sie oft getan: nackt herumlaufen. Sie hatte es erotisch gefunden, so wie er es erotisch gefunden hatte; die blasse Haut im Kontrast zu den Klostermauern und Azeri-Teppichen.
Er trank einen Schluck Verdejo und dachte an den Abend, an dem sie von ihrer Hochzeitsreise gekommen waren. Sie hatte gestrippt, und sie hatten getanzt, sie nackt, er im Anzug. Der Champagner eiskalt. Sie hatten die Teppiche in der Neuen Halle aufgerollt, um besser tanzen zu können; er hatte die Arme um ihre schlanke Taille gelegt und die Hände verschränkt, und irgendwann hatte sie sich aus diesem Griff gewunden und war vor ihm weggelaufen, ein aufregender Schatten, der sich immer weiter in dunkle Flure zurückzog, ein verwischtes Bild jugendlicher Nacktheit.
Die Erinnerungen brachten ihn um. Sie waren so überglücklich gewesen am Anfang. So wahnsinniger Sex. Der verfolgte ihn immer noch in seine Träume; Träume, die aufgeladen waren mit brennendem Begehren oder kindlicher Bedürftigkeit, und immer folgte Bedauern.
Er sah auf die Uhr. Halb zwei. Oliver verspätete sich. An ihrem Tisch saß niemand weiter, aber ansonsten war das dunkle, gediegene japanische Restaurant proppenvoll.
Er knöpfte sein Jackett auf und schaute sich um, beobachtete das Volk von Mayfair, fühlte dem modernen London auf den Zahn. Der Wohlstand hier hatte etwas Verdorbenes: Die City strotzte vor Erfolg. Man konnte den Überfluss förmlich riechen, und es roch nicht immer gut. Aber man konnte sich daran berauschen, und es sollte auch nicht anders sein. Denn David selbst war ein Nutznießer von Londons kommerziellem Triumph. Als gutsituierter Kronanwalt hatte er hier im »Nobu« einen festen Tisch; er hatte ein schickes Büro im ruhigen georgianischen Marylebone und, das war das Beste, ein Jahresgehalt von einer halben Million Pfund, das es ihm ermöglichte, Carnhallow zu restaurieren.
Aber er musste dafür auch ackern. Stunden über Stunden. Wie lange hielt er das durch? Zehn Jahre? Fünfzehn?
Im Augenblick jedenfalls brauchte er mehr Alkohol. Also trank er Verdejo. Allein.
Er war beim Mittagessen nicht gern allein. Es erinnerte ihn zu sehr an die Tage nach Ninas Sturz. Die düsteren, einsamen Mahlzeiten im Alten Speisezimmer, während seine Mutter in ihr Altenteil geflüchtet war. Als er daran dachte, wie begierig er nach der Beerdigung gewesen war, wieder ins Büro zu kommen, zuckte er zusammen. Sich die Woche über um Jamie zu kümmern, das hatte er seiner Mutter und der Haushälterin überlassen. Letzten Endes war er weggelaufen. Weil er es einfach nicht ertragen hatte, dass all die unterschiedlichen Emotionen sich zu übermächtiger Reue bündelten. London war sein Fluchtpunkt gewesen.
Er leerte das Glas. Als er dem Kellner bedeutete, er möge nachschenken, sah er Oliver auf den Tisch zusteuern.
»Entschuldige. Mein letztes Meeting hat länger gedauert. Sind wir wenigstens so spät dran, dass es schon wieder hip ist?«
»Ja. Eine Woche nachdem sie ihren Michelin-Stern verloren haben.«
Grinsend nahm Oliver Platz. »Sieht nicht so aus, als hätte das dem Geschäft geschadet.«
»Trink einen Schluck. Du siehst aus, als könntest du’s gebrauchen.«
»Das kannst du laut sagen. Puh. Warum bin ich bloß in den öffentlichen Dienst gegangen? Ich dachte, ich diene dem Land, und dann stellt sich heraus, dass ich einer Clique von Schwachköpfen diene. Politiker. Bestellen wir den Kohlenfisch?«
Der Kellner stand mit gezücktem Stift bereit.
David kannte die Karte auswendig. »Inaniwa-Pasta mit Hummer, Tuna Tataki. Und diese Kohl-Sache mit Miso.«
Der Kellner nickte.
»Wir sind schon zu lange Freunde«, sagte Oliver. »Du weißt genau, was ich will. Wie eine Ehefrau.« Feierlich hob er das Glas.
David tat nichts lieber, als auf ihre Freundschaft anzustoßen. Oliver war der Einzige, den er aus der Westminster School noch hatte, und allein die schiere Dauer machte ihre Freundschaft in seinen Augen kostbar. Sie waren schon so lange so eng miteinander verbunden, dass sie eine Art Privatsprache entwickelt hatten. Wie jene seltenen Idiome in Neuguinea, die noch von genau zwei Leuten gesprochen wurden. Starb einer von beiden, ging ein ganzes System verloren, mitsamt seinen Geheimnissen, Metaphern und Erinnerungen.
Der Dritte in ihrem Bund war bereits tot. Edmund. Auch Anwalt. Schwul. In der Schule waren sie eine Dreiergang gewesen. Ein Verschwörertrio.
Nun, dreiundzwanzig Jahre später, saßen sie zu zweit da und spielten einander die alten Schulhofwitze zu. Und redeten über Rachel.
»Ich mein ja nur …« Oliver lehnte sich zurück. Sein rundes Gesicht war leicht gerötet von der Strapaze, einen Dreihundert-Pfund-Lunch zu sich zu nehmen. »Na ja, ich hätte nicht gedacht, dass es so weit geht. So schnell.«
»Aber du hast uns zusammengebracht.«
»Okay, ich habe euch einander vorgestellt, ja. Mir war auch klar, dass sie dir gefallen würde.«
»Und wieso?«
»Sie ist klug. Sie ist klein. Mit ihr kann man sich hervorragend sehen lassen.« Er griff zur Serviette und tupfte sich die Lippen ab. »Ich finde, Gott hat sie für dich gemacht.«
»Und warum bist du dann so überrascht?«