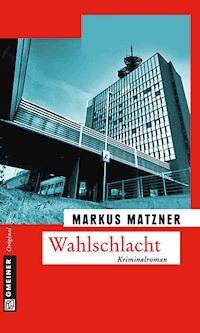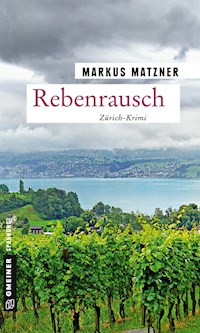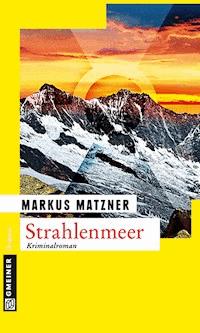
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: TV-Journalisten Vontobel und Ettlin
- Sprache: Deutsch
Der Schweizer TV-Journalist Mario Ettlin wird von seiner Vergangenheit eingeholt. Die besorgte Mutter einer ehemaligen Schulkollegin meldet sich bei ihm, weil ihre Tochter einer radikalen Ökosekte beigetreten ist. Gleichzeitig wird ein Toter gefunden, der kein unbeschriebenes Blatt ist: Als Besitzer eines Bauunternehmens soll er bei den geheimen Aufräumarbeiten des größten Schweizer Nuklearunfalls mitgeholfen haben. Brisant wird es, als eine Verbindung zwischen den beiden Fällen entdeckt wird.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 440
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Markus Matzner
Strahlenmeer
Kriminalroman
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2014 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung: Julia Franze
E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © vencav – Fotolia.com
ISBN 978-3-8392-4352-7
Zitat
Trittst im Morgenrot daher,
Seh’ ich dich im Strahlenmeer …
(Schweizer Nationalhymne, 1. Strophe)
Vorrede
Am 21. Januar 1969 kam es im kleinen Ort Lucens, mitten in der Schweiz, zu einem folgenschweren Unglück in einem unterirdischen atomaren Versuchsreaktor.
Obschon die ›offizielle‹ Schweiz lange Zeit nur von einem Zwischenfall sprechen wollte, gehört das Unglück heute zu den 20 größten Nuklearpannen der Welt.
Doch das weiß kaum jemand.
Kapitel 1
»Dort drüben liegt er«, flüsterte der Mann mit aufgerissenen Augen, als dürfte er keinen unnötigen Lärm machen. Selbst sein Hündchen, das neben ihm hockte, hechelte lautlos. Jean-Jacques Trümpi nickte, weil er als Zürcher Kriminalpolizist die Bestürzung in den Gesichtern derer, die unvermittelt auf einen Toten trafen, zur Genüge kannte. Und er wusste aus Dutzenden von Fällen, dass so eine Begegnung nie schön war.
Schweigend stapfte er über den morastigen Boden und folgte dem anderen zur Leiche, die zwischen verkrüppelten Tannenbäumchen wie hingeworfen wirkte. Das Hündchen zerrte an der Leine und kläffte, bis es vom Herrchen beruhigt wurde. Der Beamte sah sich um und blickte zum Juraausläufer hoch, der Lägern hieß. Trotz des dämmrigen Lichts konnte man die bläulich schimmernde Radarkuppel der Flugsicherung ausmachen, die von hier aus den Schweizer Flugverkehr überwachte. Ein dünnes Schneehäubchen zollte dem nur zögerlich fortziehenden Winter seinen letzten Respekt. Die vorherrschenden Farben waren beim Hügelzug oben, wie hier unten in dieser Mulde, morastiges Braun, dreckiges Grün und undefinierbares Grau. Es war schneidend kalt. Kein Wunder, dachte Trümpi, hieß einer der hiesigen Flurnamen ›Winteler‹. In diesem unansehnlichen Farbenbrei wirkte der auffällig rote Schal, der wie eine Geschenkmasche um den Hals des Toten gebunden war, doppelt deplatziert.
Dem Kriminalpolizisten erschien dieses Stück Stoff fast befremdlicher als die Leiche, die wie ein gestrandetes Nilpferd in einer Wasserpfütze lag. Der ganze Rücken war dreckverschmiert, wohl die Folge eines Kampfes, wie der Polizist vermutete. Der Mann, mindestens siebzig Jahre alt, schien alles andere als sanft entschlafen zu sein. Im Gegenteil wirkten seine Augen noch jetzt angsterfüllt, sein aufgerissener Mund deutete einen verzweifelten Schrei an.
Trümpi blickte auf seine Uhr. Die Kollegen von der Spurensicherung müssten bald eintreffen, ebenso sein Chef Severin Martelli. Dieser würde dann wie üblich den Feldherrn mimen und die Ermittlungen von einem erhöhten Beobachtungsposten aus überwachen. So übertrieben engagiert er ihn früher eingeschätzt hatte, mittlerweile empfand er für ihn eine Art Respekt, nicht zuletzt wegen seiner Arbeit bei den Mordfällen auf dem Areal des Deutschschweizer Fernsehens01. Damals hatte Trümpi etwas eigenmächtig agiert, aber dadurch das Verschwinden zweier Fernsehleute aufdecken können. Martelli hatte ihn zwar deswegen gescholten und eindringlich befragt, sich aber dann hundertprozentig hinter ihn gestellt und die interne Untersuchung im Sande verlaufen lassen. Seitdem verband die beiden Männer eine Art stilles Übereinkommen, sich nicht unnötig in die Quere zu kommen und gegebenenfalls am gleichen Strick zu ziehen. Und das würde wohl auch in diesem Fall so sein, dachte Trümpi. Da er nach wie vor keine Sirenen vernahm, widmete er sich in Ermangelung von Alternativen dem Zeugen, der den Toten gefunden hatte.
Er heiße Harry Zweifel, gab dieser an und sei mit seinem Hündchen wie jeden Morgen spazieren gegangen. Da habe Clio plötzlich wie verrückt an der Leine gerissen und ihn gleichsam hierher geführt. Diesen Anblick werde er seines Lebtags nicht mehr vergessen, fügte er mit bedauernswertem Unterton an. So schrecklich!
Ja, antwortete Trümpi mechanisch, das sei kein schöner Anblick, und man gewöhne sich auch nicht dran. Wann er denn mit dem Hund die Leiche gefunden habe?
»Es muss zwischen halb acht und acht Uhr gewesen sein, aber ich habe vor lauter Aufregung vergessen, auf die Uhr zu schauen.«
»Kein Problem, wir werden es anhand Ihres Anrufes bei uns auf der Zentrale herausfinden. Kennen Sie den Toten?«
Zweifel zuckte zusammen. Als müsste er in seinem Kopf alle Eventualitäten durchgehen, die auch ihn als Finder irgendwie verdächtig machen könnten, räusperte er sich, bevor er antwortete.
»Ja«, sagte er dann, »den Toten kenne ich. Er heißt Alois Hungerbühler, kommt, also kam von Niederwenigen. Bis vor Kurzem war er noch Chef einer großen Baufirma, vor zwei Jahren hat er sie seinem Sohn übertragen. Und das Gelände hier«, Zweifel machte eine ausladende Bewegung hin zur Mulde und dem leicht erhöhten Waldstück, »das nennt man bei uns das Stinkloch, weil hier vor Jahren alles Mögliche vergraben und verschachert wurde.«
»Eine illegale Deponie?«
»Wahrscheinlich war sie nicht illegal, aber das Zeug, das hier während der Jahre versenkt wurde, möglicherweise schon. Man munkelt, dass es sich um giftige Industrieabfälle gehandelt hat, manche behaupten sogar, es sei radioaktives Zeug aus einer atomaren Versuchsanstalt gewesen. Aber das halte ich für ein Hirngespinst!«
Der Polizist quittierte die plötzliche Redseligkeit seines Gegenübers mit keiner Miene. Er notierte sich den Namen des Toten und schrieb daneben: ev. in Zusammenhang mit illegaler Abfalldeponie.
Dann hörte er heranfahrende Autos. Na endlich, dachte er. Binnen weniger Minuten verwandelte sich die ruhige Waldsenke in einen Tatort, der wie eine Theaterbühne vom Licht greller Scheinwerfer geflutet wurde. Während zwei Beamte Absperrungsbänder spannten, suchten andere in weißen Overalls bereits nach Spuren und Gegenständen, die bei der Aufklärung des Tathergangs helfen könnten. Trümpi ging zu seinem Chef, stellte sich neben ihn und betrachtete ebenfalls die Senke zu ihren Füßen.
Was er von der Sache halte, fragte ihn Martelli unverblümt.
Trümpi schmunzelte in sich hinein. Noch vor wenigen Monaten hätte ihn der Chef weder gefragt noch richtig beachtet. Trümpi war nur wegen einer internen Umstrukturierung der Kripo zugeteilt worden, kam sich lange wie ein aufgegriffener Schiffbrüchiger in einer fremden Abteilung vor, weil sich weder Martelli noch sonst irgendwer für seine Arbeit interessiert hatte. Nun war es augenscheinlich anders. Der fast zwanzig Jahre jüngere Leiter der Kripo Zürich Nord wollte von der Erfahrung und vom Wissen des bald pensionierten Trümpi profitieren und behandelte ihn zuvorkommend.
»Für mich passt da vieles nicht zusammen«, begann der Alte bedächtig, »obwohl der Tote keine äußeren Verletzungen aufweist, wirkt sein scharlachroter Schal wie eine Blutspur.«
Martelli musste lachen. Das war ihm noch gar nicht aufgefallen, aber jetzt sah er diesen Umstand ebenfalls.
Die Kollegen gingen ihrem Handwerk professionell und ohne Hektik nach. Während ein Mediziner die Leiche untersuchte und einem anderen die Befunde diktierte, schoss ein Beamter aus allen Winkeln unzählige Fotos, sodass es immer wieder blitzte.
Zweifel, der ein weiteres Mal befragt wurde und geduldig dasselbe erzählte, hätte schon nach wenigen Minuten heimgehen können. Doch angesichts des Spektakels, das sich vor seinen Augen abspielte, mutierte er zum Gaffer und informierte per SMS seine Kollegen. Sehr zum Ärger der Beamten tauchte schon bald ein Dutzend weiterer Zaungäste auf, die sich zu ihrem Bekannten gesellten und lautstark fachsimpelten. Sie alle waren fast ein wenig enttäuscht, als nach zwei Stunden der Spuk vorüber war und die Mulde wieder sich selbst überlassen wurde.
Natürlich war nach so einem aufregenden Morgen die Lust am Debattieren noch nicht gestillt und so zog man, auch wegen der herrschenden Kälte, ins Gasthaus Engel nach Schleinikon um. Hungerbühlers Tod hatte sich anscheinend schnell herumgesprochen, weshalb die Beiz02 für einen gewöhnlichen Freitagmorgen gut besetzt war. Schnell reichten die Gäste weitere Theorien, Vermutungen und alte Geschichten herum, welche die Mülldeponie betrafen. Einer wusste gar zu erzählen, dass er einen kannte, der behauptet hatte, vor Jahrzehnten mehrere schwere Lastwagen mit mannshohen Fässern gesehen zu haben, auf denen das gelbschwarze Symbol für Radioaktivität aufgemalt worden war. Einige nickten, andere verwarfen diese Theorie.
»So ein Blödsinn«, antwortete Zweifel, »wo hätten die solche Fässer vergraben wollen? Sicher nicht auf dieser kleinen Mülldeponie!«
»Vielleicht haben sie die ja nicht vergraben, sondern im alten Militärstollen deponiert, von dem mir mein Vater mal erzählt hat«, insistierte der Erste tapfer, kam jedoch nicht weit mit seiner Theorie, weil mehrere andere die Existenz eines Militärstollens verneinten. Auch Zweifel gehörte zu dieser Fraktion:
»Ich geh doch seit Jahren mit meinem Hund da spazieren. Aber von einem Militärstollen hab ich noch nie was gesehen!«
»Wobei schon irgend etwas an diesem Gerücht mit den Stollen dran sein muss«, mischte sich nun Josy, der Engel-Wirt, ein. »Auch mein Großvater hat mal etwas davon erzählt. Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg hat das Militär da mal Sprengungen durchgeführt, aber damals bedeutete geheim halt noch geheim.«
01 Siehe »Wahlschlacht«, Gmeiner-Verlag 2013
02 Beiz: Schweizerisch für Kneipe, Gaststätte
Kapitel 2
»Musst du heute wirklich arbeiten?«
Die Stimme von Nico Vontobel kaschierte seinen Unmut nicht, auch wenn sie noch etwas schlaftrunken klang. Einmal mehr hatte seine Lebensgefährtin Hanni Pulver einen Aushilfsjob beim Deutschschweizer Fernsehen angenommen und arbeitete bereits seit bald zwei Wochen wieder an ihrer alten Wirkungsstätte. Dabei hatte sie sich vorgenommen, bei dieser Institution nie wieder zu arbeiten. Sie wollte kein Rädchen mehr sein in dieser menschenverachtenden Medienwelt.
Nico schmollte, weil sie die Zeit nicht mit ihm verbrachte und er – der freiwillige Frührentner – einmal mehr nicht so recht wusste, was er mit diesem kalten Märztag anfangen sollte. Wenn es nach ihm gegangen wäre, hätten sie den Winter in den Cinque Terre verbracht, wären um diese Zeit schon vom Frühling umgaukelt worden. Doch Hanni konnte oder wollte nichts überstürzen, musste noch die stolze Kündigungsfrist von drei Monaten einhalten und ließ sich darüber hinaus überreden, kurzfristig zwei vakante Stellen zu übernehmen.
»Ich werde noch eingehen wie eine vergessene Zimmerpflanze, die kein Wasser bekommt«, jammerte Nico.
»Ist ja nur noch heute«, meinte sie versöhnlich, »was kann ich dafür, dass die Genesung meiner Kollegin etwas länger dauert. Doch ab Montag wird sie wieder arbeiten können, und dann bin ich nur noch für dich da!«
Weil Nico noch immer die Nase rümpfte und die Dringlichkeit des befristeten Einsatzes partout nicht verstehen wollte, fuhr Hanni spöttisch fort: »Ab nächster Woche können wir dann wieder unsere täglichen Ausflüge zum Friedhof machen, zweimal die Woche ins Altersturnen gehen und an jedem Mittwochnachmittag Karten spielen, nachdem wir im Altersheim zu Mittag gegessen haben. Okay?«
Sie gab ihm, der immer noch im Bett lag, einen flüchtigen Kuss auf die Stirn und verließ grinsend das Schlafzimmer. Nico wusste nicht so recht, ob er ihren Humor immer so lustig finden sollte. Zwar fühlte er sich nicht so alt, doch sein Pass zeigte an, dass er heuer das offizielle Ruhestandsalter erreichen würde. Das gab ihm zu denken. Kurze Zeit später vernahm er das Brummen der Espressomaschine, was in ihm augenblicklich ein unstillbares Verlangen nach Kaffee auslöste. Er hasste sich dafür, diesen albernen, konditionierten Reflexen nicht gewachsen und daher manipulierbar zu sein. Schließlich bedeutete dies eine regelrechte Abhängigkeit, zumal er sich den Kaffeekonsum, ebenso wie das Rauchen, abgewöhnt hatte und er erst mit Hanni wieder rückfällig geworden war. Wenigstens bei Kaffee. Die Lust nach Zigaretten war tatsächlich vergangen, seit er nicht mehr in der Tretmühle des Deutschschweizer Fernsehens arbeitete.
Er stand auf, zog sich einen Morgenmantel an und schlurfte in seinen Pantoffeln in die Küche. Hanni blickte ihn überrascht an.
»Du stehst schon auf?«
»Brauche einen Kaffee. Außerdem muss ich mir nochmals dein Gesicht einprägen, damit ich es nicht vergesse. Siehst verdammt gut aus!«
»Schmeichler! Also ich muss jetzt los. Kochst du uns was heute Abend?«
»Ja, aber bei mir drüben! Muss sowieso Holz hacken und nach den Hühnern schauen.«
»Müssen wir wirklich in diese kalte Hütte?«
»Na, hör mal, das ist meine Heimat! Außerdem tut es deinem unterforderten Kreislauf gut, die 54 Treppen hochzusteigen! Aber keine Angst, es wird schön gemütlich sein, wenn du kommst!«
»Okay, bis später, Küssli!«
Und während Hanni schnellen Schrittes ihre Wohnung verließ, setzte sich Nico an den Küchentisch und trank seinen Kaffee. Wenigstens der war perfekt, dachte er. Ganz im Gegenteil zum Wetter, das sich immer noch grau in grau präsentierte. Immerhin, die Aussicht sein Häuschen, das auf der gegenüberliegenden Seite des Limmattals lag, für allfällige Frühlingstage fit zu machen, erhellte seine Laune. Er konnte es gar nicht mehr erwarten, seinen Garten herzurichten, den Pflanzen beim Wachsen zuzusehen und die bestmöglichen Früchte und Gemüse zu ernten. Außerdem hatte er sich überlegt ein Rebfeld in Weiningen zu pachten, um auch in Sachen Wein unabhängiger zu werden. Die Verhandlungen mit einem Winzer waren schon weit gediehen. Er würde rund 300 Reben pflegen und hegen und den Wein bei ihm keltern lassen. So gesehen war der Tag eigentlich gar nicht so schlecht, dachte er zufrieden und schlug die Tageszeitung auf. Wie immer überflog er zuerst die letzte Seite mit den vermischten Meldungen und las sich von hinten bis zur Titelseite durch. Die Schlagzeile des Tages war – wie konnte es auch anders sein – der nationalrätliche03 Ausstieg aus dem Atomausstieg. Entgegen früheren Beteuerungen seitens der Schweizer Regierung, vermehrt auf alternative Energien zu setzen, fuhr die große Kammer seit ihrer neuen Zusammensetzung, die so bürgerlich wie schon lange nicht mehr war, einen atomfreundlichen Kurs. Heute würde auch der Ständerat über dieses Geschäft beraten und die Insider in Bundesbern erwarteten alle, dass auch der kleine Rat in der Atomfrage kippen würde. Kein Wunder angesichts des horrenden Preisanstieges von Kohle, Gas und Erdöl. Einzig Uran war weltweit günstig zu haben und von den Parlamentariern, die von der Stromlobby massiv geködert wurden, brach einer nach dem anderen ein. Nico hätte sich grün und blau ärgern können, wie leichtfertig sich die vom Volk gewählten Vertreter um die Frage der Endlagerung foutierten. Einfach Augen zu und durch, das war offensichtlich das Credo dieser Leute. In früheren Jahren wäre Nico auf die Barrikaden gestiegen, hätte sich der Widerstandsbewegung angeschlossen und gegen die Atomlobby gekämpft. Umso mehr wunderte er sich über die heutige Jugend. Da regte sich niemand auf, dass sie von den älteren Generationen eine Hypothek aufgelastet bekamen, welche sie nie mehr abzahlen konnten. Im Gegenteil: Anstatt nachhaltiger zu leben, stimmten auch die Jungen in den Kanon des Konsumrausches ein, verbrauchten Strom und Energie, als gäbe es kein Morgen mehr und verloren jede kritische Distanz. So gesehen hätte man nur noch pessimistisch in die Zukunft blicken können, doch Nico wollte wenigstens für sich und sein Leben eine Art Gegensteuer schaffen, so viel wie möglich selber produzieren und möglichst ressourcenschonend leben, was, wie er zugeben musste, gar nicht so einfach war.
03 Im Schweizer Parlament bilden der National- und der Ständerat die Legislative, während der siebenköpfige Bundesrat als Regierung die Exekutive ausübt. Der Nationalrat, als große Kammer, besteht aus 200 Mitgliedern (die Sitzverteilung pro Kanton entspricht der Bevölkerungsverteilung), der Ständerat aus 46 Vertretern (pro Kanton zwei).
Kapitel 3
Als der Ermittlungsleiter der Zürcher Kriminalpolizei, Severin Martelli, zusammen mit seinen Leuten in den Engel in Schleinikon eintrat, wurde es augenblicklich still. Dreißig Augenpaare betrachteten die Polizisten, wie sie sich lässig an die Bar stellten und Kaffee bestellten. Josy, der Engel-Wirt, beeilte sich, seiner in die Jahre gekommenen Kaffeemaschine die gewünschten Unterscheidungen zwischen Schale04, Latte Macchiato und Espresso zu entlocken. Er machte sich nicht schlecht als Barista und stellte schon nach wenigen Minuten die Getränke auf den Tresen. Fast unterwürfig fragte er, ob die Polizisten schon etwas gefunden hätten.
Woher er wisse, dass sie Polizisten seien, fragte Martelli gespielt naiv, da es ihm eigentlich zuwider war, auf blöde Fragen zu antworten. Doch weil ihn die Ruhe im Gasthaus nervte und er ohnehin wusste, dass alle zuhörten, antwortete er gleich selber.
»Ja, wir waren eben draußen beim Fundort der Leiche und sind nun da, um von Ihnen allfällige Beobachtungen oder Fakten zu hören. Meine Leute werden sich nun an die Tische verteilen und sind ganz Ohr!«
Selbst die von Martelli erwähnten Polizisten waren erstaunt über die neue Methode der flächendeckenden Beizenvernehmung, doch sie fügten sich dem Befehl. Den Älteren im Team waren Martellis unkonventionelle Vorgehensweisen durchaus bekannt, den Jüngeren war es nach der Polizisten-Ausbildung nur recht, wenn sie aus der Theorie und in die Praxis geführt wurden. Und da eilte Martelli ein ausgezeichneter, obgleich beinharter Ruf voraus. Alle wussten, dass sie in dessen Abteilung das Wort Freizeit kaum mehr brauchten und dass sie sich mit Haut und Haar ihrer Arbeit verschreiben mussten.
Zur Freude des Chefs entwickelten sich erstaunlich muntere Gespräche an den Tischen, auch wenn viele der vorab lautstark vorgetragenen »sicheren« Informationen nur noch auf laue Vermutungen oder Gerüchte zusammenschrumpften.
Nur einer blieb stumm: der Wirt, Josy Bitterlin.
Martelli hielt ihm eine Visitenkarte vor das Gesicht und legte sie mit Bedacht auf den Tresen. »Vielleicht fällt Ihnen ja auch noch was ein oder auf.«
Josy nickte fast unmerklich, um dann in die Küche rüberzugehen. Martelli war sich nicht sicher, ob er die Körpersprache des Wirtes richtig verstanden hatte, dennoch folgte er ihm. Die Küche war verwaist, dafür stand eine weitere Tür offen, die in den Wohntrakt führte. Martelli stieg ein etwas muffiger Geruch in die Nase. Als er vorsichtig weiterging und in den ersten Raum blickte, sah er Josy vor einem alten Bücherregal stehen. Er blätterte in einem Fotoalbum. Immer noch wortlos hielt er dem Beamten eine Doppelseite mit Schwarz-Weiß-Fotos unter die Nase.
»Die hat mein Vater gemacht. Von ihrer Existenz weiß aber fast niemand!«
Martelli betrachtete die Fotos. Alles, was er sah, waren dunkle Lastwagen in einem dunklen Wald. Fragend blickte er deshalb zum Wirt.
»Blättern Sie um!«, forderte der ihn auf. Martelli gehorchte und sah ein Bild, das einen zigarrenförmigen Behälter zeigte, auf dem mit deutlichen Buchstaben ›Achtung Radioaktivität‹ aufgemalt war.
»Mein Vater meinte, dass das Militär hier radioaktive Abfälle oder dergleichen entsorgt hat. Von einem Unfall, der im Welschland passiert war. Denen ist, wie man lesen konnte, ein Versuchsreaktor um die Ohren geflogen, damals Ende der 60er-Jahre. Und dann haben sie die verseuchten Abfälle hier in der Lägern vergraben. In einem alten Militärstollen, von dem niemand was wusste, weil er geheim war!«
Martelli blickte erneut auf die Fotos, um dann die entscheidende Frage zu stellen:
»Und was hat das mit dem Tod von Alois Hungerbühler zu tun?«
Josy drehte sich zum Fenster, atmete tief ein und meinte, ohne dem Polizisten in die Augen zu blicken:
»Hungerbühler, so erzählte Großvater einst meinem Vater, war maßgeblich an der Erweiterung des Stollens beteiligt gewesen. Zuerst als Oberleutnant der Genietruppen, dann als privater Bauunternehmer, der direkt mit dem Militärdepartement zusammengearbeitet hat. Er baute einige Festungen, Stollen und Sonderbauten – stets unter absoluter Geheimhaltung.«
»Und woher wusste ihr Großvater davon?«
»Er war Baggerführer und hat für Hungerbühler gearbeitet. Bis man ihn 1974 in die Frühpensionierung schickte, weil er gesundheitlich angeschlagen war. Er starb 1976 an Darmkrebs. Zwar hätte er seinem Chef nie Vorwürfe gemacht, doch für die Familie war klar, dass ein Zusammenhang bestehen musste zwischen der Arbeit, die Großvater verrichtet hatte und seinem Gesundheitszustand. Und schon früher hegten meine Eltern den Verdacht, dass es im Baugeschäft des Hungerbühlers nicht mit rechten Dingen zu- und herging. Deshalb hat mein Vater auch die Fotos gemacht. Heimlich. Erst als ich den Dachstock dieses Hauses vor einigen Monaten renovierte, fand ich die Bilder. Und ich wusste sofort, dass sie unglaublich heiß waren. Und mir war auch sogleich klar, dass der Unfall, bei dem mein Vater 1979 starb, kein Zufall war!«
Josy Bitterlin drehte sich abrupt um. Seine Miene schien emotionslos, doch Martelli sah in dessen Augen ein flackerndes Feuer der Wut. Aber bevor er etwas sagen konnte, fuhr der Wirt bereits selber fort:
»Nur glauben Sie jetzt ja nicht, dass ich etwas mit dem Tod des Hungerbühlers zu tun habe! Das ist für mich Schnee von gestern. Hätte ich mich rächen wollen, hätte ich das anders machen können. Schon längst.«
»Aber Sie haben die Fotos ja erst seit Kurzem!«
»Die Fotos waren nur der letzte Beweis, dass damals etwas nicht gestimmt hat. Doch wir wussten es auch so. Warum hätte Großvater eine derart große Abfindung erhalten, wenn mit seiner Frühpensionierung alles normal verlaufen wäre?«
»Wie groß war denn diese Abfindung?«
»Groß genug, um dieses Restaurant samt Umschwung kaufen zu können. Damit ermöglichte er meinem Vater eine Existenz und unserer Familie ein eigenes Dach über dem Kopf.«
04 Schale: Schweizerisch für Milchkaffee
Kapitel 4
Es war mittlerweile Nachmittag geworden. Die Beamten der Kripo Zürich Nord hatten sich im Büro des Einsatzleiters Severin Martelli zusammengefunden und die bisherigen Fakten des Falles Hungerbühler auf einer übergroßen Wandtafel mit farbigen Schreibern grafisch dargestellt. Zum einen hatte die Vermutung – und mehr war das noch nicht – des Engel-Wirtes Anlass zum Reden gegeben. Dann stand auch der merkwürdige Umstand zur Debatte, dass der 80-jährige Hungerbühler gestern wie üblich um 18 Uhr das Abendessen im Alters- und Seniorenheim Alpenblick eingenommen hatte, aber dann aus welchen Gründen auch immer die Residenz in Zürich-Höngg wieder verlassen und sich zu fortgeschrittener Nachtstunde mit seinem späteren Mörder getroffen hatte. Was war so dringend gewesen, dass es keinen Aufschub bis zum Morgen verkraftete und wer hätte den alten Mann zu einem solchen Ausflug verleiten können?
Hier tappte das Team rund um Martelli ebenso im Dunkeln wie bei der Frage, welche Rolle der Sohn des Toten spielte. Als man Titus Hungerbühler den Tod seines Vaters mitteilte, reagierte er anders als erwartet. Er zeigte keinen Anflug von Trauer oder Gram, was ihn sofort verdächtig machte. Gemäß seiner Aussage beschränkte sich der Kontakt zum Senior lediglich auf die üblichen Zusammenkünfte an Weihnachten, Ostern und Geburtstagen. Das letzte Treffen war demnach fast drei Monate her.
Nicht minder verwirrend erschien der Bescheid der Gerichtsmedizin, wonach der Tod die Folge eines Herzstillstands gewesen war, hervorgerufen durch Stress und Überanstrengung. Angesichts des anatomischen Zustandes des Herzens, so meinte der Mediziner lapidar, sei das erstaunlich, denn dieser Muskel war für sein Alter erstaunlich rüstig. Doch das war nicht das einzige Rätsel. Bei der Obduktion wurde ein rund fünfzehn Jahre alter Port gefunden. Dieses Teil, erklärte der Gerichtsmediziner, würde in der Regel Krebspatienten unterhalb des Schlüsselbeins eingesetzt, um ihnen chemotherapeutische Medikamente intravenös geben zu können. Allerdings sei in der Krankenakte des Toten nirgends von einer Krebserkrankung die Rede. Selbst der Hausarzt, der das Seniorenheim betreute, wusste nichts davon.
»Wenn Hungerbühler eine Krebsbehandlung über sich hat ergehen lassen müssen, von der man nichts wissen durfte, dann wird sie wohl nicht im Unispital erfolgt sein«, mutmaßte Enzo Baldini, einer der Ältesten im Team von Martelli. Dass er es schon so viele Jahre an der Seite des launischen Chefs ausgehalten hatte, lag wohl an der Tatsache, dass beide von italienischen Eltern abstammten, die in den 60er-Jahren in die Schweiz gekommen waren und blieben. Diese Gemeinsamkeit, die aus den beiden Polizisten gleichsam Schicksalsgefährten machte, war offenbar von Bestand. Sie teilten in etwa ähnliche Kindheitserlebnisse, waren eine Teilmenge dieser ›Tschinggen‹ gewesen, wie man die Italiener in der Schweiz damals abschätzig genannt hatte. Dabei waren sie hier geboren worden, hatten die Schule wie alle anderen Kinder durchlaufen und sprachen akzentfrei den hiesigen Dialekt. Sie wurden noch vor der Rekrutenschule eingebürgert und waren fortan gespaltene Seelen. Im Pass Schweizer, im Herzen Italiener. Das prägte und hallte bis zum heutigen Tag nach. Secondos05 mussten hierzulande stets mehr leisten, so lautete ihre Überzeugung, wenn sie gleichviel erreichen wollten.
»Was gibt es denn für private Kliniken in der Region, die bei genügend Kleingeld auch mal etwas verschwiegener agieren?«, fragte Reto Zuppinger in die Runde. Der kleine, aber durchtrainierte Mittdreißiger gehörte ebenfalls zum Stammteam. Dank seines hemdsärmeligen Auftretens besaß er einen guten Draht zum einfachen Volk.
»Private Kliniken gibts hierzulande so häufig wie Verkehrskreisel«, meinte der Chef. »Die Frage ist mehr, wieso man eine Krebsbehandlung geheim halten musste und zum Zweiten, welche Art von Krebs behandelt wurde!« Martelli blickte in die Runde und wandte sich an Baldini und die danebensitzende Jungpolizistin Lena Salzmann. »Enzo, du und Lena, ihr geht mal die Kliniken durch.« Die Angesprochenen nickten, derweil fuhr Martelli fort und wandte sich an Zuppinger und dessen Kollegen Lukas Rütimann. »Ihr beiden klärt ab, was die Familie über die Krebssache und den Alten weiß. Da muss doch im Archiv der Firma irgendetwas zu finden sein und erstellt einen Stammbaum dieser Sippe.«
Die Leute erhoben sich von ihren Sitzen, als Martelli nochmals eine Frage in die Runde warf: »Wer von euch hat schon mal gehört, dass es Ende der 60er-Jahre in der Schweiz einen atomaren Unfall gegeben hat?«
Die anderen blickten ihn fragend an. »Mir sind nur Tschernobyl und Fukushima bekannt«, antwortete Salzmann als Erste.
»Genauso ging es auch mir«, meinte der Chef. »Dabei muss es mitten in der Schweiz, in einem unterirdischen Versuchsreaktor, bös gekracht haben. Möglicherweise gab es sogar Tote. Mindestens aber eine erhebliche Verstrahlung. Wer könnte mir da Licht ins Dunkel bringen?«
»Vielleicht ein Militärhistoriker«, schlug Baldini vor.
»Frag doch den Trümpi. Der hat schon mehr Jahre auf dem Buckel als wir und ist ein wandelndes Lexikon. Vielleicht weiß er was!« In Rütimanns Gesicht stand ein breites Grinsen, denn alle wussten nur zu gut, dass sich der Chef mit diesem etwas sturen und eigenwilligen Beamten nach wie vor schwertat, weil er ihn nicht so recht fassen konnte. Erst in letzter Zeit hatte er ein gewisses Maß an Respekt für den Alten entwickelt und wollte von seinem Wissen profitieren, da Trümpi kurz vor seiner Pensionierung stand.
»Gute Idee, wo ist der überhaupt?«, antwortete der Chef zum Erstaunen der Anwesenden, bis ihm einfiel, dass er ihn ja heute Morgen erst wieder aus diesem Fall herausgenommen hatte, weil dem Alten noch eine wichtige Sitzung bevorstand. Und während sich seine Untergebenen auf den Weg machten, durchquerte Martelli den langen Gang der altehrwürdigen Polizeikaserne. Das unangenehme Neonlicht wurde vom gräulichen Novilonboden reflektiert, sodass alles krank und jämmerlich aussah. Martelli freute sich auf den Bezug des Neubaus, der bald anstand. Endlich lichtdurchflutete Räume, zeitgemäße Infrastruktur und Platz für sich und sein Team. Die neue Umgebung würde sich sicher auch auf die Arbeitsmoral der Beamten niederschlagen, war er sich sicher. Und während er eine gläserne Schwenktüre durchschritt, wie sie auch in alten Spitälern zu finden war, fiel ihm ein, dass Trümpi seit Jahrzehnten in diesem Gebäude seinen Dienst absolvierte. Und plötzlich empfand er es nachvollziehbar, dass man griesgrämig und abgelöscht wurde.
Umso überraschter war er, als er in Trümpis Büro trat. Mehrere wild wuchernde Gummibäume sorgten für ein dschungelhaftes Ambiente und mittendrin saß der Alte. Er blickte zwar überrascht, aber nicht unfreundlich auf, als sein Chef eintrat.
»Salut Jean-Jacques, wie liefs?«
»Danke der Nachfrage«, meinte der Angesprochene und staunte, dass sich der Chef für seine Pensionierung interessierte. »Der Berater für eine sorgenfreie Pensionierung hat mir geraten, mir ein Hobby zu suchen, um nicht an Langeweile einzugehen.«
»Und hast du Hobbys?«
»Hast du welche?«, fragte er zurück.
Martelli lachte kurz auf. »Verstehe. Modelleisenbahnbauen und Briefmarken sammeln sind wohl nicht dein Ding.«
»Im Jahr 1977 tötete ein Mann im Affekt seine Ehefrau wegen einer Modelleisenbahn. Der Grund war, dass die Partnerin mit dem Staubsauger die wartenden Figürchen beim Bahnhof eliminiert hatte. Das war mir eine Lehre!«
Martelli musste lachen. Er mochte Menschen mit trockenem Humor.
»Sag, Jean-Jacques, kannst du dich an einen atomaren Unfall in einer Versuchsanstalt in der Schweiz erinnern? Irgendwann Ende der 60er-Jahre.«
Trümpi dachte kurz nach. Als würde sein Gedächtnis irgendwo zwischen Fenster und Decke hängen, blickte er in die Höhe und suchte in seinem geräumigen Erinnerungsschatz nach Fakten.
»Ja, da war mal was. Wenn ichs noch recht weiß, kam es Ende der 60er-Jahre zu einem Atomunfall. Wieso willst du das wissen?«
»Unser Fall Hungerbühler könnte mit diesem Unfall irgendwie zusammenhängen.«
»Du meinst wegen dieser Gerüchte rund um diese radioaktiven Fässer, von denen die Dörfler gesprochen haben?«
»Es waren wohl nicht nur Gerüchte. Ich habe Fotos gesehen.« Martelli erzählte vom Gespräch mit dem Engel-Wirt. Trümpi hörte aufmerksam zu und nickte. »Wenn du willst, kann ich mal versuchen, mehr über die Geschichte herauszufinden.«
Martelli lächelte. »Mach das. Besonders interessiert uns, wie sehr unser Toter und seine Baufirma in den 60er-Jahren in die Entsorgung dieses Reaktors involviert gewesen waren. Woran arbeitest du im Moment?«
»Ich muss noch in zwei Fällen rund um Nötigung im Nachbarschaftsbereich Papierkram erledigen. Beides Resultate meines letztwöchigen Fronteinsatzes.«
»Gut, das hat Zeit. Ab sofort arbeitest du im neuen Fall. Alle Infos, die wir bislang zusammengetragen haben, findest du auf unserem Server.«
»Und wie heißt das Passwort?« Trümpi wusste, dass sein Chef die Angewohnheit besaß, wichtige Informationen nur seinen eingeschworenen Leuten zugänglich zu machen. Und dass jeder, der das Passwort erhielt, zum engeren Kreis gehörte.
Entgegen seiner Erwartung zögerte Martelli keine Sekunde und nannte ihm den Zugangscode. »Wäre hilfreich, wenn du bis morgen zu unserer 9-Uhr-Sitzung einige Hintergrundinfos zusammengestellt hättest und sie dem Team vortragen könntest! «
Als der Chef das Büro verlassen hatte, widmete sich Trümpi seinem Computer und sah, dass er seinem Gedächtnis trauen konnte. Tatsächlich war es am 21. Januar 1969 in einem unterirdischen Versuchsreaktor zu einer partiellen Kernschmelze gekommen. Während man in der Schweiz lange Zeit nur von einem Zwischenfall sprechen wollte, rangiert der Unfall in der Fachwelt unter den zwanzig größten Atompannen weltweit. So richtig spannend wurde es für den Beamten jedoch, als er auf einen Artikel aus dem Jahr 1979 stieß, der von den fragwürdigen Ergebnissen des parlamentarischen Untersuchungsberichtes handelte. Den Namen des Autors kannte er nur zu gut, und bereits wenige Augenblicke später war die Handynummer gewählt und es läutete.
»Vontobel?«, nahm eine warme Stimme ab.
»Salut Nico, da ist der Jean, wie geht’s?«
»Jean, das freut mich! Danke der Nachfrage, mir geht es gut, bin grad am Holzhacken. Hoffentlich zum letzten Mal, denn ich habe den Winter langsam satt. Wegen Hanni bin ich dieses Jahr nicht in die Cinque Terre gefahren, sondern da geblieben. Aber das Wetter ist eine Tortur …«
»Ja, was macht man nicht alles für die Liebe!« Trümpis Lachen schallte durch den Hörer, doch der Polizist wurde umgehend wieder sachlich.
»Bin eben auf ein Frühwerk von dir gestoßen. Aus dem Jahr 79. Du hast damals für den Tagesanzeiger einen Artikel über das Reaktorunglück in Lucens geschrieben und den Untersuchungsbericht in der Luft zerrissen.«
»1979? Oh, ja, allerdings ein Frühwerk! Ich kann mich noch erinnern: Dieser parlamentarische Untersuchungsbericht war das Papier nicht wert, auf dem er gedruckt worden war. Da wurde mehr vertuscht als aufgedeckt. Eine Riesenschweinerei. Die Schweiz war damals schlimmer als die DDR!«
Trümpi musste grinsen. Auch wenn er nie ein Linker gewesen war und als Beamter auf der Seite des Staates agiert hatte, ging es ihm manchmal selber zu weit, wie sehr sich die Behörden ins Private eingemischt, herumgeschnüffelt und umfangreiche Datensammlungen angelegt hatten. Als dann in den 80er-Jahren der sogenannte Fichenskandal06 groß aufgekocht wurde, war er fast froh, dass er nicht mehr nach intimen Informationen fahnden musste, nur weil ein Mann und eine Frau in einer WG zusammenwohnten und ein Che Guevara-Bild aufgehängt hatten.
»Was genau wurde denn da vertuscht?«
»Gut«, antwortete Nico in einem Tonfall, der Erwartungen dämpfen sollte, »das sind bald vierzig Jahre her, und ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr alle Details. Aber eines weiß ich noch bestens: Der Bericht beschrieb, dass 250 Fässer mit leicht und mittelschwer kontaminiertem Material angefallen waren, die man in Würenlingen zwischengelagert hatte. Aber das konnte nie und nimmer stimmen! Denn die Kaverne war so groß wie eine Fabrikhalle und da fand eine partielle Kernschmelze statt. Da fiel mit Sicherheit auch hochverseuchtes Material an! Wir recherchierten wie die Wilden, aber bissen auf Granit. Niemand wollte Zeuge gewesen sein, niemand kannte Details. Und die offiziellen Stellen wiegelten ohnehin ab. Alles unter dem Deckmantel ›streng geheim‹. Als uns der Chefredaktor von der Geschichte abzog, waren wir alle stinksauer und frustriert, aber wir steckten fest. Aber sag, was interessiert dich diese alte Kamelle?«
Trümpi zögerte kurz, weil er nichts über die Ermittlungen sagen durfte:
»Wir stecken da in einem Fall, der eventuell in diese Zeit zurückführt, aber sind noch völlig am Anfang …«
»Komm, komm«, Nicos Stimme wurde lebhaft, »kein Wischiwaschi! Vielleicht kann ich dir mehr helfen, wenn du mir auf die Sprünge hilfst!«
»Du weißt, dass ich zu Ermittlungen nichts sagen darf. Und schon gar nicht am Telefon. Können wir uns treffen?«
»Oh, jetzt werde ich aber erst recht neugierig, wenn es so geheim ist.« Nico lachte in den Hörer und fügte an: »Ich bin zurzeit in meinem Häuschen in Engstringen. Wo sollen wir abmachen?«
»Ich komme zu dir. Bin in einer Dreiviertelstunde da.«
»Gut, das gibt mir die Gelegenheit, noch eine Flasche Wein kühl zu stellen …«
05 Secondos werden die in der Schweiz geborenen Kinder ausländischer Eltern genannt.
06 Ende der 1980er Jahre wurde bekannt, dass die schweizerische Bundesanwaltschaft während Jahren über Tausende Bürger eine Unmenge von Dateneinträgen, Fichen genannt, gesammelt und ein umfangreiches Archiv angelegt hatte. Fast jeder zehnte Einwohner wurde damals bespitzelt und beobachtet.
Kapitel 5
Als der Polizist die steile Treppe zu Nicos Häuschen erklommen hatte, musste er mehr schnaufen, als es ihm lieb war. Ich sollte doch wieder etwas mehr Sport treiben, dachte Trümpi, als er das freundliche Gesicht des Gastgebers erblickte. Nico war eben aus einem hölzernen Anbau seines Häuschens getreten und trug mehrere faustdicke Holzscheite im Arm.
»Scheiß Winter«, meinte er lachend und bat seinen Gast herein. Drinnen war es schön warm, was am munter brennenden Feuer im Schwedenofen lag. Die Männer setzten sich an den Holztisch und Nico öffnete eine Flasche Wein.
»Einer von Weiningen?«, fragte Trümpi und Nico nickte.
»Ja, ein Sauvignon blanc, für mich ein idealer Spätnachmittagswein, da er zum Denken und Reden animiert und gleichzeitig wegen seiner leichten Säure auch dem Hunger nicht abträglich ist. Genau der Wein, den ich gerne selber machen würde.«
»Höre ich da neue Pläne?«
»Ja«, schmunzelte Nico, »gut möglich, dass ich demnächst ein Rebfeld pachte.«
Die beiden Männer prosteten sich zu und nahmen einen Schluck des frischen Weißweins.
»Übrigens«, Nico änderte abrupt das Thema, »ist es doch fast beängstigend, dass wir uns am Tag, an dem das Schweizer Parlament der Atomlobby auf den Leim gekrochen ist, mit einem Atomunglück beschäftigen müssen! Findest du nicht?«
Nico klang verärgert, und in seinem Gesicht blitzte eine Kampfeslust auf, die Trümpi erstaunte.
»Hat demnach auch der Ständerat den atomaren Turnaround vollzogen?«, fragte der Polizist, der noch keine Nachrichten gehört hatte.
»Ja, heute Morgen ist auch die kleine Kammer zu der erstaunlichen Erkenntnis gekommen, dass es vorderhand keine Alternativen zur Atomenergie gäbe. Wie auch, wenn man ihnen keine Chance gibt? Was ich aber am Schlimmsten finde, ist die Tatsache, dass keiner dieser selbst ernannten Volksvertreter auch nur ein Wort über die akute Abfallfrage verloren hat! Das sind doch alles traurige Wendehälse! Ist wohl ein Zeichen vom Himmel, dass ich die Akten zum Fall Lucens noch aufgehoben habe.«
»Du hast noch Unterlagen? Von einem Artikel, der bald vierzig Jahre alt ist?«, wunderte sich Trümpi.
»Ja, eine dumme Angewohnheit von mir. Meine Frau nannte mich deswegen Messie. Aber ich kann mich nur schlecht von altem Zeug trennen. Das war auch das Schwierigste, als ich aus meiner alten Wohnung ausgezogen und hierher gekommen bin. Ich musste mich von unzähligen Aktenordnern und Archivschachteln trennen, die sich angesammelt hatten. Aber diese Geschichte da,« – Nico stand auf und holte eine etwas zerfledderte Kartonkiste hervor – »habe ich auch deshalb behalten, weil ich mit ihr ja noch eine offene Rechnung habe.« Der Journalist lächelte in sich hinein, als er den Deckel der Schachtel weghob und ein alter Presseausweis zum Vorschein kam. Redaktor der Redaktion Tagesanzeiger, stand darauf und die Nummer 0276.
»Wie lange hast du für den Tagi gearbeitet?«
»Ich hab schon während des Studiums als freier Journalist angefangen, bin 1978 dann eingestellt worden, nachdem mir die gesamte Redaktion das Vertrauen ausgesprochen hatte. Waren lustige Zeiten damals. Die Macht der Redaktion war damals wohl am größten, was mitunter zu Vollversammlungen und stundenlangen Grundsatzdiskussionen führte, nur weil das Management die Marke der Radiergummis wechseln wollte. Aus heutiger Sicht ein unhaltbarer Zustand!« Nico rollte mit den Augen und wühlte in den Unterlagen.
»Da, sieh, dies war der Untersuchungsbericht!«
Der Beamte öffnete das dürre Dossier, das von einer simplen Heft-Klammer zusammengehalten war und brüchig wirkte. Im Innern des Berichts waren Unmengen von Kommentaren angebracht, Zeilen unterstrichen, große Fragezeichen aufgemalt und Ausrufezeichen gesetzt worden. Speziell ein mit roter Farbe Aufgetragenes war offensichtlich der Angelpunkt der Recherche gewesen. Es betraf die erstaunlich tiefe Zahl von entsorgten Fässern.
»Wieso glaubst du, dass 250 Behälter zu wenig waren?«, wollte Trümpi wissen. Nico blickte ihn nur kurz an und suchte einen Stapel Papiere durch, nahm ein Blatt mit einer technischen Zeichnung hervor und hielt es ihm unter die Nase.
»So hat die Versuchsanstalt ausgesehen. Nur schon der Reaktorraum besaß die Dimensionen einer mittelgroßen Fabrikhalle. Wie Bilder und die Ereignisse zeigen, war das Ausmaß der Katastrophe weit größer, als dass die Reste davon in ein paar Fässern hätten beseitigt werden können! Schließlich war nicht nur die Reaktorkaverne verstrahlt worden, sondern auch die Maschinenkaverne.«
»Aber in 250 Containern hat doch schon Einiges Platz und die Kaverne wurde ja versiegelt«, wagte der Polizist einzuwenden, weil er sehr wohl durchschaute, dass Nico wieder Feuer gefangen hatte. Diese Geschichte hatte während der letzten Jahrzehnte in dessen Kopf nur geschlummert. Doch nun war die Flasche geöffnet worden und der Geist ausgebüxt.
»Die Anzahl Fässer ist ja nur das eine. Ebenso brisant ist die Frage, wie viel Radioaktivität ausgetreten ist und wie sicher die Aufräumarbeiten durchgeführt worden waren. Einer der damals involvierten Physiker hat zu Protokoll gegeben, dass im Schmelzsumpf unter dem Reaktor die vierhundert Mal stärkere Strahlung pro Stunde geherrscht habe, als ein Mensch im Laufe eines Jahres aufnehmen dürfe. Ergo stellt sich die Frage, welches arme Schwein da rein musste, um mit dem Schneidbrenner den kontaminierten Reaktor zu zerlegen?«
Trümpi verstand, worauf Nico hinauswollte, und letztlich kamen sie dem springenden Punkt näher, der auch mit dem toten Hungerbühler zu tun haben könnte.
»Hattet ihr denn einen Verdacht, wer den Abbau organisierte?«, fragte der Beamte.
Nico runzelte die Stirn und verteilte weitere Notizblätter, Artikel und Papiere auf dem Tisch. »So weit ich noch weiß«, meinte er dann, »war das eines der Fragezeichen, welches wir nie auflösen konnten, obschon gleich mehrere meiner Kollegen dazu recherchierten. Eine heiße Spur führte zum EMD07, also zum damaligen Militärdepartement. Obschon es beteuerte, mit dem privatwirtschaftlichen Reaktorprojekt nichts zu tun gehabt zu haben, liegt es auf der Hand, dass Spezialisten des Militärs die Hände im Spiel hatten. Wer sonst hätte die Logistik, die man hierzu benötigte?«
»Vielleicht ausländische Firmen?«, schlug Trümpi vor.
»Ich bezweifle, dass sich die offizielle Schweiz nach dem Scheitern ihres ehrgeizigen Atomprogramms auch noch die Demütigung über sich ergehen lassen wollte, fremde Hilfe beim Aufräumen zu benötigen. Ich denke, das wurde intern gelöst.«
»Könnten auch private Firmen involviert gewesen sein?«, fragte Trümpi.
Nico durchschaute die Frage des Beamten und erwiderte grinsend: »Wenn es so gewesen wäre, kämen wir dann bei deinem Fall an?«
Trümpi nahm einen Schluck Wein und lächelte: »Vielleicht.«
»Okay, dann lass uns laut nachdenken!«, schlug der Journalist vor, »das Militär baute in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg Hunderte Tunnels, Festungen und Kavernen. Selbst wenn die eigenen Bautruppen miteinbezogen wurden, wären die paar RS08- und WK-Soldaten nie und nimmer imstande gewesen, dieses üppige Bauvolumen zu realisieren. Ergo gab es stets Beziehungen und Verflechtungen mit der Privatwirtschaft. Allerdings, so würde ich es erwarten, entsprangen die privaten Unternehmer sicher auch dem Kader des Militärs, mussten mindestens Oberleutnant gewesen sein, in ihrem Denken und Handeln patriotisch gesinnt, antikommunistisch und verschwiegen.«
»Aber loyale Bauunternehmer zu haben, reichte ja nicht aus. Es mussten auch Arbeiter rekrutiert werden, die letztlich den Job erledigten.«
»Genau. Und hier begann wohl auch das Problem der Geheimhaltung. Welches Baugeschäft verfügte über Personal, das über Jahr und Tag konstant blieb und selbst vom EMD anerkannt wurde?«
»Wohl nur Firmen mit ausgezeichnet beleumundeten Männern, die ebenfalls im Militär tätig gewesen waren.«
Nico nickte und nippte an seinem Glas. Die beiden Männer waren so in ihr Gespräch vertieft, dass sie gar nicht bemerkten, dass sich eine Person dem Häuschen näherte. Kein Wunder erschraken sie, als die Tür aufsprang.
Hanni Pulver, Nicos Lebensgefährtin, kam mit einer Supermarkttüte herein und erblickte zu ihrem Erstaunen den Polizisten, den sie zusammen mit Nico vor einigen Monaten hier zum ersten Mal angetroffen hatte und mit dem sie, seit den aufwühlenden Erlebnissen rund um die letzten Parlamentswahlen, sporadisch zu Abend gegessen hatte.
Trümpi sprang sofort von seinem Stuhl auf, um Hanni die Tüte abzunehmen.
»Hallo Hanni, schön dich zu sehen!«
»Salut Jean, wie geht’s?«
Nachdem sie auch Nico einen Kuss auf die Backe gesetzt hatte, senkte sie ihren Blick auf den Tisch und betrachtete die ausgelegten Unterlagen.
»Um was für ein papierenes Thema geht es bei euch denn jetzt schon wieder?« Ihre Worte waren launig gehalten und wollten munter wirken, aber konnten eine gewisse Beunruhigung nicht verheimlichen.
»Keine Angst«, beeilte sich Nico deshalb zu erklären, »wir haben nur eine alte Geschichte betrachtet, mit der ich vor Jahren zu tun hatte und die nun wieder bei Jean aufgetaucht ist.«
»Eine alte Geschichte rund um«, sie las den Titel eines der Papiere, »… einen atomaren Versuchsreaktor?«
»Ja, der Reaktor von Lucens, der 1969 explodiert ist.«
»Und die Leiche dazu findet man erst heute?«
»Nein«, erwiderte Jean-Jacques Trümpi treuherzig, »natürlich nicht. Aber wir haben einen Toten im Wehntal gefunden, der möglicherweise mit dem Versuchsreaktor zu tun hatte.«
»Oh, diesen Link hast du mir aber vorenthalten«, platzte es aus Nico heraus, der leicht säuerlich zur Kenntnis nehmen musste, dass Frauen beim Recherchieren nicht selten weiterkamen als Männer. Und das ohne Anstrengung.
Nun grinste auch Jean. »Dir durfte ich das ja auch nicht sagen. Ermittlungsgeheimnis.«
»Schönes Geheimnis«, nahm Hanni den Faden wieder auf, zückte ihr Handy, drückte ein paar Tasten und fügte lässig an: »Dass man einen Toten gefunden hat, steht ja in jedem Onlineportal. Hungerbühler hieß er, war Baulöwe in Niederwenigen und soll, so munkelt man, beim Bau von geheimen Militärprojekten involviert gewesen sein!«
»Und das alles steht in deinem Handy?«, Nicos Stimme klang leicht spöttisch.
»Ja, und außerdem steht da, dass ich Hunger habe und ihr den Tisch decken könnt. Du bleibst doch Jean?«
»Ich will keine Umstände machen.«
»Erwartet dich deine Frau zum Abendessen?«
»Nein, sie besucht irgendeine Veranstaltung.«
»Also, passt doch prima. Nico machst du noch eine Flasche auf?«
07 EMD: Eidgenössisches Militärdepartement, der Vorgänger des heutigen VBS (Eidgenössisches Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport).
08 RS: Rekrutenschule; WK: Wiederholungskurs, den die Soldaten nach absolvierter RS besuchen mussten.
Kapitel 6
»Ich bin’s«, sagte die Stimme am Telefon und fuhr gleich weiter fort. »Du glaubst nicht, was das Schweizer Parlament eben beschlossen hat!«
Der Mann am anderen Ende der Telefonleitung schwieg, weil er wusste, dass der Meister sogleich weitersprechen würde. Er hörte es an seiner aufgebrachten Stimme. Wenn er mal in Rage geriet, war er kaum mehr zu bremsen, würde am liebsten alles kurz und klein schlagen. Und tatsächlich fuhr er fast schreiend vor Wut fort:
»Die haben doch tatsächlich den Ausstieg aus dem Atomausstieg beschlossen. Diese traurigen Wendehälse! War schon ihr erstes Ausstiegsszenario ein Hohn gegenüber unserer Mutter Erde, so verarschen sie nun auch noch alle folgenden Generationen! Nach uns die Sintflut, sagen sich diese aufgeblasenen Wichtsäcke! Und weil die Atomlobby von Anfang an wusste, dass sie die Mehrheit im Parlament bekommen würde, richtet sie nun ein rauschendes Fest aus! Für sich und ihre Getreuen, die es ihr gestatten, viele weitere Millionen mit altersschwachen Atommeilern zu verdienen! Und natürlich feiern sie nicht irgendwo und irgendwie. Nein! Sie haben bereits vor Wochen am schönsten Ort von Zürich einen exklusiven Standort gebucht, den sonst kein Mensch für eine private Party bekommen würde! Und da bauen sie einen Pavillon der Sinnlichkeiten auf und feiern mit exquisiten Speisen und auserlesenen Weinen ihre stumpfsinnige Politik. Doch ihnen wird das Lachen vergehen!«
»Höre ich da einen Plan heraus?«
»Ja, mein Lieber! Wir werden ihnen einen Denkzettel verpassen, der ihnen schwer im Magen liegen wird!«
Der Meister lachte in den Hörer und fuhr fast trunken vor Vorfreude weiter: »Denn ich hab es!«
Der andere verstand nicht gleich: »Was hast du?«
»Na, unser Mineralwasser, das berühmte Aqua gravis! Im richtigen Maß verdünnt, reicht es für mehrere Hundert Liter.«
»Hätte ich nicht gedacht, dass dieser Hurensohn einwilligt.«
»Es verlief auch nicht ganz reibungslos. Aber nun haben wir’s!«, sagte der Meister launig.
»Folglich sollten wir besorgt sein, dass es auch unter die Leute kommt.«
»Du triffst den Nagel auf den Kopf. Ich werde dich so bald als möglich mit allen Details beliefern. Die Battle09 lässt du wie immer Shogi organisieren, natürlich soll er die Operation auch leiten! Kleine Brötchen backen ist passé, nun gilt die Regel: Wer nicht hören will, muss fühlen!«
»Und wenn Shogi die Battle vergeigt? Ist ja eine ziemlich große Nummer für ihn!«
»Warum sollte er?«
»Man weiß ja nie.«
»Ach, MC10, komm endlich weg von dieser albernen Eifersucht. Du bist immer noch meine Nummer zwei, meine rechte Hand. Shogi ist nur der Planungsminister. Du hast deine Talente, er seine. Und er ist der richtige Mann, um diesen charakterlosen Schweinen das Handwerk zu legen! Dich brauche ich für den inneren Zusammenhalt, für die geistige wie die körperliche Fitness der ganzen Truppe. Du bist unersetzlich für mich!«
MC schwieg kurz, das Lob tat ihm gut. »Okay«, sagte er deshalb geschmeichelt und fuhr gleich weiter: »Wenn wir uns auf diese Aktion konzentrieren, sollen wir die geplanten Battles für morgen und kommende Woche vertagen?«
»Wo denkst du hin? Nie und nimmer! Jetzt erst recht. Wir schlagen nun an allen Fronten zu. Wenn die Jungs und Mädels so richtig in Fahrt gekommen sind, dann bewältigen sie auch die Sonderaktion besser. Je regelmäßiger die Maschine läuft, desto weniger Verschleiß gibt es.«
»Sagt einer, der selber dafür sorgt, dass die gute alte Mechanik bald ausgerottet ist und alles digitalisiert wird.«
»Vermisch keine Dinge«, mahnte der Meister mit Schalk in der Stimme, »wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Übrigens am Plan, dass ich zur Tag-und-Nacht-Gleiche vorbeikomme, ändert sich nichts. Allerdings schaffe ich es nicht auf den 21.3., ich komme am nächsten Donnerstag!«
»Dann werden wir am Freitag, mit anderen Worten, an deinem fünfzigsten Geburtstag, die Bacchanalien feiern! Das wird den Kindern noch besser gefallen! Großartig!«
»Somit wird ihnen auch einleuchten, warum ich nicht zum eigentlichen Frühlingsanfang kommen kann. Du musst es ihnen nur plausibel erzählen, dann sind alle happy.«
Dann hängte der Meister auf. MC blickte noch einen Moment auf sein altes Handy, das er nur im Notfall benutzte. Er war dezidiert kein Anhänger dieser neuen Moden, welche dem Menschen vorgaukelten, dass sie ohne Computer, Tablets und Handys verloren seien. Und er verstand auch den Meister nicht ganz, wie er einerseits der größte Kämpfer für die Natur sein wollte und gleichzeitig mit seiner international tätigen Software-Firma für viele absolut unmoralische Großfirmen Applikationen entwickelte, die letztlich das Rad des Kommerzes am Laufen hielten. Natürlich floss dadurch viel Geld in ihre ökologische Sache, was der Meister stets als Legitimation benutzte. Dennoch ging für MC die Rechnung nicht auf. Wer mit dem Feind kollaborierte, auch wenn er dadurch den Widerstand finanzierte, war doch ein Teil des Feindes. So sah er das, doch das konnte er dem Meister nicht begreiflich machen. Irgendwann würde deshalb der Tag kommen, an dem er ihn vor die Wahl stellen musste: entweder für Gaia, also für Mutter Erde, oder dagegen. Beides ging dann nicht mehr. Und dieser Tag war nicht mehr so fern. Außerdem war es höchste Zeit, dafür zu sorgen, dass dieser Shogi, dieses selbstgerechte Berliner Großmaul, von der Bildfläche verschwand.
09 Battle: eigentlich Schlacht, hier als Aktion oder Manifest benutzt.
10 MC: stammt vom Begriff Master of Ceremonies und wird englisch ausgesprochen.
Kapitel 7
Als Trümpi seinen kurzen Vortrag über die Geschehnisse von Lucens beendet hatte, blickten ihn Martelli und das Team respektvoll an. Was er binnen weniger Stunden zusammengetragen hatte – nicht zuletzt dank Nicos Archiv – war beeindruckend und warf interessante Schlaglichter auf den Fall Hungerbühler. Wenn dessen Baufirma tatsächlich an der Beseitigung des Reaktors beteiligt gewesen war, dann würden sich einige Fragen aufdrängen. Martelli wandte sich an Zuppinger und Rütimann:
»Was habt ihr bei Titus Hungerbühler und der Firma herausgefunden?«
Die Angesprochenen zuckten zusammen, und Zuppinger meinte zögerlich: »Nicht viel. Die Unterlagen sind sehr spärlich. Ein Firmenarchiv würde es erst seit zwei Jahren geben, da sein Vater nie etwas aufbewahrt habe, behauptet der junge Hungerbühler. Und von einer Krebserkrankung seines Vaters wisse er nichts, was aber nicht verwundere, weil sie nur selten Kontakt …«
»Ja, das wissen wir bereits«, unterbrach Martelli ungeduldig, »das stinkt doch zum Himmel! Habt ihr ihm nicht ein wenig Dampf gemacht? Ihn unter Druck gesetzt?«
»Womit denn?«, versuchte sich Rütimann zu verteidigen.
»Gut, wir müssen gröberes Geschütz auffahren. Ich werde die Staatsanwältin bitten, einen Durchsuchungsbefehl auszustellen und dann drehen wir in dieser Bude jeden Stein um! Aber so, wie die Dinge liegen, wird das wohl nicht vor Montag sein. Nachdem uns aber der Hungerbühler kaum davonläuft, ist das nicht so schlimm. Mit anderen Worten gebe ich euch – vorausgesetzt es passiert nichts Unvorhergesehenes – frei!«
Die Anwesenden im kleinen Sitzungsraum trauten ihren Ohren nicht. Seit dem Chef in einem Kaderkurs neuer Führungsstil beigebracht wurde, war er eine Wundertüte geworden. Dennoch durchschauten die alten Hasen, dass er mit seinen unkonventionellen Maßnahmen letztlich nur auslotete, ob sein Team auch ohne Druck das Maximum an Leistung erbrachte.
Natürlich unterließen es die Mitarbeitenden diesem Umstand allzu lange nachzuforschen, sie freuten sich über ein freies Wochenende. Einzig der bullige Zuppinger, der für den Basisdienst eingeteilt worden war, musste die Stellung halten, was ihm sichtlich missfiel.
Kapitel 8
Der Pic St. Loup, ein Ausläufer der Cevennen Richtung Mittelmeer, war von der spätwinterlichen Morgensonne regelrecht entflammt worden. Die Reflektion des weißen Felsens, der sich wie eine beinah brechende Welle auf 658 Meter auftürmte, schmerzte in den Augen derer, die sich im beachtlichen Morgenverkehr Richtung Montpellier stauten und ihm kurz einen Blick gönnten. Unweit der D17, einer der sternförmig auf die Stadt zulaufenden Überlandstraßen, lag das Château Nôtreterre. Aus einem großen Saal, der sich im Erdgeschoss des ehemaligen Stalltrakts befand, drangen ungewöhnliche Laute in das Buschland hinaus. Stampfende Schritte, begleitet von einem rabiaten »Ah!« oder »Uh!« erklangen, dann schlugen Stöcke in einem irren Stakkato aufeinander. Sogleich herrschte Stille, ehe wenige Augenblicke später eine ähnliche Abfolge von Lauten und Schreien ertönte.
Die rund dreißig jungen Leute, die in engen Sporthosen und dunkel gehaltenen T-Shirts steckten und trotz der Kühle schwitzten, gingen äußerst konzentriert zur Sache. Stets traten zwei gegen zwei an, wobei das Geschlecht augenscheinlich keine Rolle spielte. Einer griff an, der andere verteidigte sich. Es ging zumeist blitzschnell und der Schrei des Siegers beendete jeweils den Durchlauf.
MC, wie man den Zeremonienmeister und Kampflehrer in Anlehnung an die Hip-Hop-Szene respektvoll nannte, blickte in die Runde. Er war mit Abstand der Älteste im Raum, aber gehörte noch lange nicht zum alten Eisen. Er war agil, sportlich und trug eine schnittige Kurzhaarfrisur. Außerdem wirkte er, wie er selber fand, weit jünger als 45 und konnte sich dank seines durchtrainierten Körpers durchaus sehen lassen. Sicher waren seine stechend blauen Augen das größte Kapital, um bei den Frauen zu punkten, doch er schrieb seine Wirkung seiner gesamten Erscheinung zu und war sehr zufrieden mit sich und der Welt.
Erst recht, als er die schön geformten Körper seiner Schülerinnen und Schüler betrachtete, die mit Hingabe die Übungen erledigten. Ja, er war stolz, was für eine schlagkräftige Gruppe er aus diesem heterogenen Haufen teilweise unsportlicher Leute geschmiedet hatte.
Natürlich waren noch nicht alle auf dem gleichen Stand, das musste er auch seinem Meister dann und wann in Erinnerung rufen, weil der gleich das volle Programm von ihnen verlangte. Dennoch sah er die Fortschritte, lobte und tadelte gleichermaßen. Und in den Gesichtern der jungen Menschen sah er, dass sie wussten, wofür sie lebten, wofür sie kämpften, was wichtig und was nebensächlich war. Und sie würden alles für die ökologische Bewegung und für ihr großes Idol tun, das wusste er.
MC schlug einen Gong und sogleich veränderte sich das Bild im Saal. Die jungen Leute legten die Schlagstöcke zur Seite und holten sich grüne Schaumstoffmatten. Aus der Stereoanlage ertönte eine indische Chillout-Musik und MC machte die Übungen vor. Er brauchte gar nichts mehr zu sagen, schon gar nicht zu dirigieren. Alle folgten ihm automatisch. Übung für Übung. Die jungen Körper dehnten und verrenkten sich, drehten sich um ihre eigene Achse und formten am Schluss eine Kerze oder machten gleich den Kopfstand. Nach einer Dreiviertelstunde waren die Morgenexerzitien vorbei. Weil es nach wie vor kühl war, zogen sich die jungen Männer und Frauen graue Baumwollpullis über. Sie wirkten nun wie eine uniformierte Truppe. Munter schwatzend begaben sie sich ins Freie, überquerten den Innenhof und betraten den sogenannten Speisesaal, der sich im ehemaligen Heuschober befand. Der Raum war schlicht und nur einer dürftigen Renovation unterzogen worden, ganz so, als hätte man größere Pläne vertagt. Das einzige Prunkstück bildete ein zwanzig Meter langer, dunkelbraun lackierter Holztisch, der von Kerben, Kratzern und Zeichen übersät war. Er verlieh dem frugalen Ambiente einen speziellen Glanz.
Die jungen Leute setzten sich an die Tafel, nachdem sie sich von einem Buffet Tee, Brot und ein Müsli mit Früchten und Nüssen geholt hatten. Es herrschte eine muntere und fröhliche Atmosphäre, obschon alle wussten, dass sie auch den restlichen Tag über hart arbeiten würden und all ihre adoleszente Kraft in den Dienst ihrer Sache stellten.