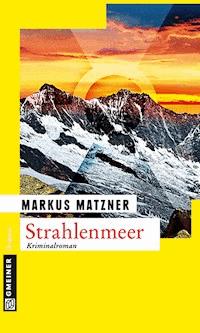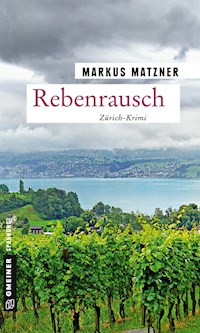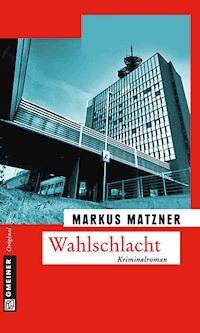
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: TV-Journalisten Vontobel und Ettlin
- Sprache: Deutsch
Kurz vor der großen Wahlsendung für die nationalen Parlamentswahlen werden auf dem Areal des Deutschschweizer Fernsehens zwei Leichen gefunden. Als einige Tage später die TV-Journalisten Mario Ettlin und Nico Vontobel entführt werden und ein Polizist spurlos verschwindet, verdichten sich die Anzeichen, dass hier kein Einzeltäter am Werk ist. Als dem Einsatzleiter der Zürcher Kripo klar wird, dass im Fernsehstudio eine Bombe tickt und die Livesendung bedroht, gerät die Lage endgültig außer Kontrolle …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 351
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
markus Matzner
Wahlschlacht
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2013 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75/20 95-0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung: Julia Franze
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
Personen und Handlung sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt. Der Autor hat sich die Freiheit genommen, Orte zu erfinden oder abzuändern und fernsehtechnische Abläufe zu vereinfachen. Ebenso wollen die im Buch geschilderten polizeilichen Ermittlungsarbeiten nicht den Anschein erwecken, mit der realen Polizeiarbeit identisch zu sein.
Kapitel 1
Ein merkwürdiger Geruch hing über dem Leutschenbach-Quartier.
Das Flüsschen konnte es nicht sein. Seit man es vor bald zehn Jahren renaturiert hatte, galt es als städteplanerisches Vorzeigeobjekt und stank nur noch in Ausnahmefällen. Auf seinem kurzen oberirdischen Stück floss es, von üppiger Vegetation begleitet, zwischen dem Gebäude des Deutschschweizer Fernsehens und dem World Trade Center in nordöstlicher Richtung, um nach eineinhalb Kilometern in die Glatt zu münden. Woher dieser unappetitliche Geruch stammte, ließ sich nicht so leicht eruieren. An der Leiche, die auf einer der Betonterrassen über dem Gewässer lag und vielleicht als letztes Andenken an diese Welt das muntere Plätschern des Leutschenbachs mitbekommen hatte, konnte es nicht liegen. Dieser Mensch war erst vor Kurzem gestorben.
Wohl eher kam der süßliche Duft von der Kehrichtverbrennung, die je nach Windrichtung grüßen ließ. Oder er stammte von der Kantine des Fernsehens und erinnerte daran, dass die Köche bereits um diese Morgenstunde damit begonnen hatten, die Bratensoße für das Mittagessen aufzuwärmen.
Wie auch immer, dachte Jean-Jacques Trümpi, als er den Toten betrachtete, bei dem Gestank könnte man kotzen. Wieso traf es immer ihn, fragte sich der Kriminalpolizist ärgerlich.
Neben ihm stand der diensthabende Nachtwächter, der auf seiner morgendlichen Tour rund ums Fernseh-Areal den Toten gefunden und die Polizei alarmiert hatte.
Ja, diesen Mann würde er schon kennen, antwortete der Polizist auf die Frage des Nachtwächters, der gehofft hatte, einen Wissensvorsprung zu haben. Doch Trümpi machte ihm einen Strich durch die Rechnung und fügte an: »Wer kennt den nicht? War ein stadtbekanntes Original!«
Und wahrlich, der Beamte hätte viel erzählen können, war dem langhaarigen Mann schon vor Jahren auf Streife begegnet, wusste, dass er vor über 25 Jahren aus Berlin in die Schweiz gekommen war, zu Platzspitzzeiten[1], wie viele andere auch. Er hatte einzig aus dem Grund überlebt, weil er dank der Hilfe eines Obdachlosenpfarrers in ein Methadon-Programm aufgenommen wurde. Doch Trümpi war es nicht ums Reden, besonders bei diesem aufdringlichen Typen, der gleichsam von Kollege zu Kollege mit ihm redete, als wäre da kein himmelweiter Unterschied zwischen einem Nachtwächter und einem Kriminalen. Doch das schien der beflissene Mann mit dem schwarzen Béret und seiner blauen Uniform, an dessen Ledergurt anstelle einer Pistole eine phallische Taschenlampe samt sackartigem Schlüsselbund baumelte, nicht zu bemerken. Der war heiß darauf, seine Informationen weiterzugeben:
»Hab ihn heute um 7.37 Uhr gefunden. War natürlich sofort klar, dass da ein Verbrechen vorgefallen sein muss – bei der Delle am Kopf und diesen Blutflecken!«
»War der Luzius häufig hier?«
Der Sicherheitsmann stutzte. Er hatte nicht gewusst, dass der Tote Luzius hieß. Kleinlaut meinte er: »Ich habe diesen Luzius schon ein paarmal hier gesehen. Häufig hielt er sich im Andreaspark oder am See vorn auf. Nicht selten übernachtete er unter der Leutschenbach-Brücke. Wir haben ihn einige Male vertrieben, doch er kam immer wieder. Irgendwann haben wir ihn in Ruhe gelassen. War ja ein netter Kerl. Ab und zu haben wir ihm einen Kaffee gegeben, denn immer draußen zu pennen, das geht doch an die Nieren …«
»Ja«, sagte Trümpi, »verstehe.«
Nachdem er mit der Zentrale Kontakt aufgenommen und die Kollegen der Spurensicherung und das restliche Rösslispiel[2] angefordert hatte, wandte er sich wieder dem Nachtwächter zu und fragte ihn, ob er heute Morgen noch andere Obdachlose gesehen habe. Oder sonst etwas Auffälliges?
»Nein, nur die üblichen Verdächtigen!« Der Uniformierte lachte, als wäre es angebracht, angesichts einer Leiche einen dummen Spruch zu machen.
»Seit wann sind Sie heute im Dienst?«, fragte Trümpi ohne erkennbare Gefühlsregung.
»Erst seit sechs Uhr. Wir haben immer eine Woche Nachtdienst und dann wieder zwei Wochen Tagschichten. Fast wie bei euch, nicht?«
Der Polizist nickte, weil er keine Lust auf Erklärungen hatte. Dann meinte er beiläufig: »Wie viele Leute kommen zwischen sechs und acht zum Arbeiten?«
»Oh, das sind vor allem die Putzequipen, dann die Leute von der Kantine, externe Handwerker, einige von den technischen Abteilungen, aber kaum Journalisten oder Kader. Die kommen«, die Stimme des Sicherheitsmannes wurde verschwörerisch, »in der Regel nicht vor halb neun oder noch später!«
Trümpi nickte erneut. Er hatte auch nichts anderes erwartet und blickte sich um. Noch gut konnte er sich erinnern, als hier draußen in der Agglo[3] kaum ein Haus stand. Das Fernsehstudio Leutschenbach, Anfang der siebziger Jahre gebaut, war jahrelang das einzige Hochhaus weit und breit. Heute wucherten unzählige Bürokomplexe in den Himmel, und die gläsernen Fassaden standen in einem reziproken Verhältnis zur Arbeit, die dahinter erledigt wurde: je mehr Glas, desto intransparenter das Geschäft!
Trümpi drehte seinen Kopf wieder zurück und betrachtete den Eingangsbereich des Senders. Ein großes DSF[4] prangte links von der Glasschiebetür, die zum Empfang führte. Daneben befand sich die mit Schranken bewehrte Zufahrt. Noch weiter links erblickte er den Eingang zu den technischen Bereichen. Allein hier zählte Trümpi drei Videokameras, die das Areal filmten.
»Habt ihr überall Videoüberwachung?«
»Ja, alle großen Eingänge werden überwacht!«, antwortete der Sicherheitsmann mit professionellem Stolz in der Stimme. »Man könnte diese auswerten. Aber Sie glauben doch nicht, dass es einer vom Fernsehen war?«
»Ich glaube gar nichts«, sagte Trümpi schroff, »in einer Viertelstunde sind die Kollegen da, denen können Sie dann die Aufzeichnungen zeigen.«
Der Polizist realisierte, dass mehrere Passanten oberhalb der Terrasse auf dem Weg entlang des Baches stehen geblieben waren und mit unterschiedlichen Mienen zur Leiche herunterblickten. Er animierte sie weiterzugehen, was nur wenig nützte. Immer mehr Menschen glotzten auf den armen Luzius herab und wähnten sich in einem Kriminalfilm, als wenige Minuten später Sirenen durchs Quartier hallten. Fortan wimmelte es von Polizeibeamten, die routiniert ihrer Arbeit nachgingen und den Fundort mit einem weißen Plastikzelt vor neugierigen Blicken schützten.
Trümpi rapportierte seinem Chef seine Erkenntnisse. Severin Martelli, der Einsatzleiter der kantonalen Kriminalpolizei, Abteilung Zürich Nord, wirkte nicht sonderlich interessiert und kehrte ihm den Rücken zu. Wie Trümpi schon zuvor gewusst hatte, konnte er nun gehen. Tötungen und Verbrechen an Leib und Leben krallte sich Martelli. Ihm blieben nur noch die Krumen polizeitechnischer Abklärungen und – immerhin – das Dossier ›Extremismus‹, auf das er sich seit einigen Jahren eingeschossen hatte und das Martelli nicht interessierte. Trümpi war froh, dass er diesen Ort verlassen konnte. Die Nacht war lang, dachte er, als er in seinen aschgrauen BMW stieg und sich auf den Feierabendkaffee freute. Im Rückspiegel seines Autos sah er, wie die Leiche des Luzius Schröder weggetragen wurde, um sie im forensischen Institut untersuchen zu lassen.
»Kann man sagen, wann’s passiert ist?«, fragte Martelli.
»War wohl schon vor einiger Zeit. Würde sagen, vor etwa neun bis zehn Stunden«, meinte der Gerichtsmediziner, der hinter den Bestattern die Treppe zur Straße hochstapfte.
Martelli blickte auf seine Uhr. »Also circa um 23.00 Uhr.«
»So etwa in der Zeit. Eher früher …«
Martelli kannte die Angewohnheit der Gerichtsmediziner, die sich nie auf die Äste hinaus lassen wollten und machte sich dennoch einen Sport daraus, sie wie eine widerspenstige Zitrone auszupressen: »Kann man schon sagen, womit er erschlagen wurde?«
Der Forensiker seufzte, aber er blieb stehen und drehte sich um. Widerwillig fügte er an: »Nein, noch nicht sicher. War wohl kein Stein, eher ein Hammer oder etwas in der Art …«
»Also aus Metall?«
»Ja, natürlich Metall.«
Martelli nickte und ließ den Mediziner gehen, dann blickte er zurück zum Ort, wo die Leiche gelegen hatte. »Wer bringt einen alten Obdachlosen um?«, dachte er und richtete sich an seine Leute, die in den Gebüschen und unten beim Bach nach Spuren oder Gegenständen suchten: »Das Tatwerkzeug könnte so etwas wie ein Hammer gewesen sein. Irgendwas Schweres aus Metall!«
Kapitel 2
Die morgendliche Sonne wärmte das dunkle Holz des kleinen Häuschens und wirkte wie ein Heizstrahler. Nicolas Vontobel lehnte am Türrahmen, nippte an seinem Tee und genoss die spätsommerliche Stimmung. Er blickte in den weitläufigen Garten hinunter, der sich vor ihm gegen Süden erstreckte und von niederstämmigen Obstbäumen umgrenzt war. Bereits hatten einzelne Blätter begonnen, sich zu verfärben, doch die Wiesen und Rebfelder, die sich gegen Westen ausdehnten, stemmten sich mit ihrem kräftigen Grün gegen den nahenden Herbst.
Wie ich diese Jahreszeit liebe, dachte Nicolas und erfreute sich an den Reizen. Rechts vom Eingang beobachtete er minutenlang eine Spinne. Ihr Netz zierten kleine Tautropfen, die sie nicht ungenutzt verdunsten lassen wollte und sich einverleibte. Dann erblickte er in der Ferne einen Eichelhäher, der sich auf die Wiese plumpsen ließ und mit seinem Schnabel nach einem Frühstück suchte.
Noch keine zwei Jahre war es her, dachte Nico, da hätte er um diese Zeit mindestens drei Zigaretten geraucht gehabt, ein halbes Dutzend Tageszeitungen durchforstet und mehrere Tassen Kaffee getrunken. Mit übersäuertem Magen hätte er seinen Computer gestartet, die Mails gecheckt, das Agentursystem auf Geschichten abgeklopft und die Newslage auf CNN, Bloomberg und anderen Kanälen überblickt gehabt, sodass er für die erste Redaktionssitzung des Tages gerüstet gewesen wäre. In einer Art konditioniertem Reflex hätte er sich dann kurz aus dem Großraumbüro verabschiedet, wäre mit dem Lift ins Parterre gefahren, vor die Tür getreten und hätte sich einen weiteren Glimmstängel in den Mund gesteckt. Meistens war er da auf andere Kollegen gestoßen, die sich ebenfalls aufgrund des allgemeinen Rauchverbots in den Gebäuden vor die Tür gestellt hatten. Man sprach über dies und das, nicht selten über die gestrige Sendung oder erörterte die Weltlage. Fünf Minuten später fuhr er wieder in den dritten Stock hoch, um das tägliche Abenteuer mitzuschreiben, das ›Tagesschau machen‹ hieß.
Nico nippte an seinem nicht mehr ganz so heißen Tee. Wie hatte er es nur all die Jahre beim Fernsehen ausgehalten? Wie konnte er nur 30 Jahre lang sein ganzes Handeln, Denken und Fühlen in den Dienst dieser Institution legen, obschon die Arbeit ungesund gewesen war, und man ihm nicht nur einmal Steine in den Weg gelegt hatte? Das letzte Mal war gar nicht so lang her. Vielleicht fünf Jahre, als er eigentlich aufgrund seines Leistungsausweises Nachrichtenchef hätte werden müssen, man ihm aber stattdessen einen Jüngeren vor die Nase gesetzt hatte.
Seine Kolleginnen und Kollegen hatten gestaunt, als er vor zwei Jahren, es war im November gewesen, das Angebot der Frühpensionierung von Seiten seines Arbeitgebers angenommen hatte. Alle prophezeiten ihm, dass er vor Langeweile vergehen und schon bald wieder reumütig zurückkehren würde. Und selbst bei seinem Abschiedsfest versprach ihm der Chefredakteur nochmals vor der ganzen, versammelten Schar, dass er jederzeit zurückkommen könne.
Noch vor vier Jahren hatte er nicht im Traum daran gedacht, freiwillig kürzerzutreten. Dabei hatte Alice damals mit dem Krebs gekämpft, der eigentlich ihn hätte treffen müssen. Denn sie hatte nicht halb so ungesund wie er gelebt. Und als sie ihn im Spital für immer verlassen hatte, da war er schon am folgenden Tag wieder im Büro erschienen.
Nun war er 64 Jahre alt und erfolgreicher Frührentner. Seit eineinhalb Jahren lebte er hier und nahm jeden Tag wie ein junger Hund: Er aß, wenn er hungrig war, trank, wenn er Durst hatte, und tat das, wonach ihm der Sinn stand. Erstaunlicherweise begann sich sein Leben aber dahin gehend zu ordnen, dass er nicht nur auf der faulen Haut lag und die Stunden zählte. Aus einem für ihn noch nicht ganz durchschaubaren Antrieb heraus, begann er so zu leben, wie es manche der alten Philosophen seit Jahrhunderten vorschlugen. Er lebte im Hier und Jetzt und nahm die Aufgaben des Tages mit Freude an, sodass er selbst da lustvolle Momente erlebte, wo ihm früher nur Unbehagen begegnet war.
Im Garten arbeitete er genau so viel, wie er musste, damit die Früchte nicht überreif von den Ästen fielen, das Gras nicht alles überwucherte und die Schnecken seinen Gemüsegarten nicht ratzekahl abfraßen. Jeden Morgen blätterte er anstatt in der Tageszeitung in einem der vielen Bücher, die er seit Jahren besaß, aber nie zu Ende gelesen hatte.
Und er war zufrieden wie seit Langem nicht mehr. So konnte er sich sogar vom Schlag, den Alices Tod bedeutet hatte, erholen und wieder optimistisch in die Zukunft blicken.
Nico musste unwillkürlich schmunzeln: Optimistisch, ja, dieses Wort gehörte wieder zu seinem Wortschatz! Selbst nach 30 Jahren Newsjournalismus, der sich nur durch Krisen, Kriege und Katastrophen definierte.
Er betrachtete sein Stück Land, das so nah an der Großstadt lag und doch so erstaunlich weltentrückt schien. Selbst der Lärm der wenige Kilometer entfernten Autobahn, die Zürich mit Bern verbindet, drang nur noch als leises Rauschen hierher und hätte genauso gut Meeresrauschen sein können.
Nico fühlte sich so frei wie noch nie. Nicht mal die sanfte Vorankündigung des unaufhaltsam näher rückenden Winters bereitete ihm Sorgen. Es war Mitte September, und es galt, aus den Früchten dieser Jahreszeit haltbare Produkte zu machen, die ihm auch nächstes Jahr Freude bereiten würden. Darüber hinaus gab es auch noch jede Menge Pilze im Gubrister Wald, der sich hinter seinem Häuschen zwischen Zürich und Weiningen erstreckte. Und weil er bereits ein paar ertragreiche Plätze gefunden hatte, versprach er sich auch da einiges.
Ja, Nico war sehr zufrieden mit seinem Leben und den damit verbundenen Perspektiven.
Dann erblickte er eine Gestalt, die vom Sträßchen unterhalb des Gartens zu ihm hochkam. Erst als der Mann fast vor ihm stand, traute Nico seinen Augen:
»Ja, Gopfriedstutz[5], bist das wirklich du, Pavel?«
Pavel Bilek, der angesichts des steilen Geländes merklich schnaufte, schaute hoch und setzte sein typisches Lächeln auf, auch wenn es nicht ganz so entspannt wirkte wie damals, als sich die beiden häufig auf einem der Schnittplätze, in der Cafeteria oder auf einer der Raucherinseln begegnet waren.
»Hallo, Nico, wie geht’s? Dachte, ich komm’ mal vorbei und bringe ein paar Gipfeli[6] mit!«
»Das ist eine ganz schlechte Idee! Frische Gipfeli sind eine große Kalorienbombe!«, sagte Nico schroff.
Pavel blickte ihn etwas entgeistert an, bis er das Grinsen in seinem Gesicht richtig deutete und selber zu lachen begann.
»Immer noch der Alte, immer einen Spruch auf den Lippen …«
Nico machte einen Schritt auf den anderen zu, packte ihn und klopfte ihm freundschaftlich auf den Rücken.
»Verdammt lang her, dass wir uns das letzte Mal gesehen haben!«
»Ja, ziemlich genau eineinhalb Jahre, damals bei deinem Abschied«, meinte Pavel und wand sich aus der innigen Umarmung, »hab gedacht, dass ich es früher schaffen würde, mal vorbeizukommen. Aber du weißt ja, wie es ist. Die Zeit rast einfach weiter. Dabei hätte es mich schon lang interessiert zu sehen, wie es einem Frührentner so geht. Schließlich spiele auch ich mit dem Gedanken …«
»Was, du und Frührentner? Du bist ein paar Jahre jünger als ich und hast doch Kinder mit deiner Ex!«
»Reiß keine Wunden auf! Immerhin muss ich keine Alimente mehr bezahlen. Endlich sind beide groß genug, um auf eigenen Beinen zu stehen. Dir ist viel erspart geblieben!«
»Na, so hat jeder seine Bürde zu tragen! Aber komm, lass uns einen Tee trinken und die Gipfeli essen. Ich glaub, ich hab auch noch ein bisschen Butter, und dazu gibt’s meine selbst gemachte Konfi[7].«
Pavel blickte sich um und ließ die Umgebung auf sich wirken. »Schön hast du’s hier! Verdammt, was habe ich dich beneidet, als ich hörte, dass du den Ausstieg aus der Tretmühle wirklich geschafft hast.«
»Wolltest drum nicht zu früh vorbeikommen, was?«
»Ja, ich hätt’ mich hintersonnen, dass ich fast die Hälfte meines Lohnes meiner Ex überweisen musste und kaum genügend Geld hatte, um mir zwei Wochen Ferien am Meer zu leisten. Aber jetzt ist es anders. Jetzt sieht die Welt besser aus. Muss nur noch …«
Weiter kam Pavel nicht, weil ihm Nico verschiedene Teepackungen entgegenhielt:
»Kaffee hab ich keinen, nur Tee, dafür Dutzende Sorten. Welchen willst du?«
»Du säufst Tee? Meine Herren, am Ende rauchst du auch nicht mehr und trinkst nix!«
»Das Rauchen hab ich mir schon nach Alices Tod abgewöhnt. Ich brauch’s wirklich nicht mehr. Eigentlich erstaunlich, wie leicht das geht, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Was den Alkohol betrifft, so will ich wenigstens ein Laster behalten. Bei so vielen Rebstöcken als Nachbarn wäre Abstinenz eine Gotteslästerung!«
»Fürwahr«, staunte Pavel, und Nico nahm in seinem Blick ein kleines Körnchen Neid wahr. »Und das hier rundherum gehört alles dir?«
»Nein, mir gehört nur dieser Streifen bis runter zum Sträßchen. Rechts bis zu den Obstbäumen und links bis zu den Nussbäumen. Das Rebfeld neben mir gehört einem Winzer aus dem Nachbardorf, und der Wald hinter dem Haus, der gehört der Gemeinde.«
»Und wie findet man ein solches Paradies?«
»Das war – einmal mehr – purer Zufall. Vor fast zwei Jahren kam ich beim Spazierengehen mit einer alten Frau ins Gespräch. Sie saß drüben in Weiningen auf einem Bänklein am Waldrand und sah erschöpft aus. Sie trug zwei schwere Papiertaschen voll mit Gemüse, und ich hab ihr angeboten, ihr zu helfen. Auf dem Weg ins Dorf hinunter hat sie mir erzählt, dass sie verwitwet sei und ein Stück Land besitze, dessen Bewirtschaftung ihr immer mehr Mühe bereite. Da hat ein Wort das andere gegeben, und irgendwann keimte bei mir die Idee, dass ich meine Stadtwohnung verkaufen und dafür dieses Land samt Häuschen übernehmen könnte. Die alte Frau und ich waren uns schnell einig, und so wurde ich quasi über Nacht Bauer, Jäger und Sammler.«
»Beneidenswert, wenn ich bedenke, dass ich immer noch acht Stunden am Tag damit verbringe, irgendwelche Scheißbilder aus irgendwelchen Krisengebieten zusammenzuhacken oder blödsinnige Interviews von Politikern zu kürzen.«
»Könntest du denn nicht wieder längere Filme schneiden oder für Magazine arbeiten?«
»Machst du Witze? Seit wir das neue Schnittsystem haben, das im ganzen Haus nur noch virtuelle Daten hin- und herschickt und unfassbar umständlich ist, setzt die Chefetage ausschließlich auf junge Cutter, die virtuos, schnell und nervenstark sind. Ich gehöre zusammen mit einigen anderen zur Gattung der alten Säcke: unbelehrbar, nicht mehr so agil und zu teuer! Ich hatte gehofft, dass es mit der Fusionierung von Radio und Fernsehen und den in die Wege geleiteten Reformen wieder besser würde, aber weit gefehlt. Wegen der vielen Kader-Wechsel in den letzten vier Jahren herrscht ein epochaler Machtkampf um Pfründen und Gelder!«
Es erstaunte Nico, wie wenig es ihn interessierte, was an seinem ehemaligen Arbeitsort passierte. Zwar hatte er noch selber mitbekommen, wie sich die beiden Welten Radio und Fernsehen vor bald fünf Jahren angenähert hatten und zusammengeschmolzen waren, doch der Prozess war mühsam und glich einer Zwangsehe. Von Liebe konnte nie die Rede sein. Da regierte höchstens Vernunft – und allzu oft auch die nicht.
»Und wie ist der neue Direktor?«, wollte Nico wissen, während Pavel seinen Kräutertee betrachtete und ob des sonderbaren Geruchs ein wenig irritiert wirkte.
»Der Zahner? Der schert sich noch weniger um die Arbeitsqualität als seine Vorgänger. Weil die Onlinewerbung auf unseren Seiten nach wie vor stark eingeschränkt wird, muss jeder Franken zusammengekratzt werden. Eine Sendung, die keine Sponsorengelder generieren kann oder zu wenige Downloads aufweist, gilt als ökonomisch verdächtig, selbst wenn sie gute Quoten macht. Ergo diskutiert man nicht mehr über Inhalte, sondern nur noch über den Marktwert. Die Folge liegt auf der Hand: Immer mehr Sendungen müssen sich den Sponsoren anpassen, um auch im nächsten Jahr noch Geld zu bekommen. Das hat fatale Konsequenzen, und nicht selten bleibt der kritische Journalismus auf der Strecke.«
»War dieser Zahner nicht mal Abteilungswirtschafter beim Sport?«
»Nein, er hat den Einkauf der Übertragungsrechte im Sport gemanaged.«
»Ja, jetzt fällt’s mir wieder ein! Er kam damals in den neunziger Jahren ins Gerede, weil er den News-Sendungen die Champions-League-Bilder erst nach der Sportsendung geben wollte. Das gab ein ziemliches Gewitter in der Chefredaktion!«
»Genau. Und jetzt ist er unser aller Chef. So geht das eben!« Pavel biss in eines seiner mitgebrachten Gipfeli und blickte gedankenverloren in die Ferne.
Während die beiden Männer Erinnerungen und Neuigkeiten austauschten, verstrich die Zeit beiläufig und ohne Hektik. Das ist wohl das Geheimnis dieses Ortes, mutmaßte Nico, denn er bemerkte es an sich selber wie auch an seinen Besuchern: Hier wich der Zeitdruck einer entspannten Lebensqualität.
Umso erschrockener fuhr Pavel plötzlich hoch, als er auf seine Uhr blickte. Eine dunkle Erinnerung verdüsterte sein Gesicht: »Oh, es ist ja gleich 12 Uhr. In weniger als einer Stunde muss ich ins Bergwerk und davor sollte ich noch einiges erledigen! Ach, sag, könntest du mir einen Schraubenschlüssel und einen Hammer leihen, bei meiner alten Vespa ist wieder mal die Zündung am Arsch.«
»Fährst du noch immer mit diesem benzinfressenden Möbel herum?«
»Ja, kann mich nicht trennen, ist ja schon bald ein Oldtimer. Aber du hast recht, die Tankkosten sind mittlerweile enorm. Früher konnte man fast ein Auto für dieses Geld betanken.«
Die beiden gingen zum Schopf[8], wo Nico das Werkzeug aufbewahrte. Während sich der Cutter bediente, meinte der Hausherr: »Komm doch mal an einem Abend vorbei, dann können wir bei einem Glas Wein gemütlicher zusammensitzen!«
»Klar, mach ich! Wie wär’s mit … morgen?«
Nico staunte über Pavel. Jahrelang kam er nie, dann konnte er nicht genug kriegen. Mit einem Lächeln antwortete er: »Ja, dann bis morgen!«
»Brauchst du das Werkzeug heute noch, oder kann ich’s dir später zurückgeben? Ich glaube nämlich, dass mir meine alte Vespa noch mehr Streiche spielen wird.«
»Kein Problem. Außerdem habe ich noch irgendwo einen zweiten Hammer. Im Übrigen werde ich heute im Wald Pilze sammeln gehen, da genügt ein Messer.«
»Wahrlich, bist ein Glückspilz, kannst nur hoffen, dass die Strähne nicht plötzlich abreißt!«
»Da habe ich keine Angst mehr, denn es kommt ohnehin, wie es kommen muss.«
Pavel blickte den anderen etwas irritiert an, verabschiedete sich dann mit einem flüchtigen Gruß und stapfte mit schwerem Schritt den Weg zum Sträßchen hinab. Nico blickte seinem alten Kumpel hinterher. Der gefällt mir irgendwie nicht, dachte er, er wirkt so gedankenverloren und einsam.
Und während er aus der Ferne metallene Schläge vernahm, die allem Anschein nach von Pavels Vespa stammten, tauchten bei Nico Bilder auf.
Jahrelang hatten sie zusammengearbeitet, viele hundert Stunden nebeneinander an irgendeinem Schnittplatz gesessen und vielbeachtete Filme zustande gebracht. Zum Beispiel, als sie eine Affäre um dubiose Machenschaften einer großen Schweizer Privatbank während der Zeit der Apartheid aufdeckten oder in einem Report aufzeigten, wie nationalistisch gesinnte Politiker heimliche Zahlungen an Rechtsextreme leisteten, um sie zu Übergriffen auf farbige Ausländer zu animieren und Asylbewerber einzuschüchtern. Stets war Pavel an Nicos Seite gewesen, hatte dem Bilderchaos eine Ordnung gegeben und ein brauchbares Endergebnis hergestellt. Ja, ohne Pavel wäre Nico wohl nie so weit gekommen. Umso schöner, dass das Band zwischen ihnen noch nicht gerissen war, sondern sich erneuern ließ. Als Nico in der Ferne den aufheulenden Motor eines Rollers vernahm, ging er ins Haus, nahm den Korb und das Messer und machte sich auf den Weg, um im Wald oberhalb seines Häuschens nach Steinpilzen zu suchen.
Kapitel 3
Die junge Frau war kaum zu beruhigen. Sie japste und keuchte, dazwischen fiel sie wieder in einen Weinkrampf, schniefte herzerweichend und klammerte sich an die Kollegin, die sie stützte. Als die Polizisten die Kiste mit der Leiche vorbei trugen, begann sie erneut zu schluchzen. Sie atmete ruckartig ein, doch die Luft schien nicht bis zu den Lungenflügeln durchzudringen. Sie blickte aus ihren verquollenen Augen heraus ins Leere. Ihr Körper zitterte. Endlich wandte sich der Notfallmediziner an sie und wollte ihr ein Beruhigungsmittel spritzen. Doch die junge Frau wehrte sich verzweifelt dagegen. Erst als ihre Kollegin ruhig auf sie einredete, gab sie nach, und der Arzt konnte die Injektion setzen, wissend, dass kein Mittel dieser Welt etwas gegen dieses Bild ausrichten konnte, das sich im Hirn der bleichen Frau für alle Zeiten eingebrannt hatte. Ein Bild wie aus einem Horrorfilm, mit dem Unterschied, dass es nicht von einer begabten Maskenbildnerin entworfen worden, sondern grauenvolle Realität war! Die Tote war merkwürdig verdreht zwischen Waschbecken und Wand in einem blutverschmierten Toilettenabteil gelegen. Ihr Kopf war zertrümmert worden, die offenen Augen starrten ins Leere.
Auch der abgebrühte Kriminalist Martelli hatte noch nicht viele derart zugerichtete Leichen gesehen. Es machte den Anschein, als wäre das Opfer, als es sich die Hände waschen wollte, komplett überrascht worden. Alles musste sehr schnell gegangen sein.
Durch Martellis Kopf wanderten Bilder. Es gehörte zu seinem Job, sich den Tathergang plastisch vorzustellen, und er war ein Meister darin. Doch bisweilen verfluchte er diese Gabe, weil ihn die Bilder bis in den Schlaf verfolgten.
Er sah die junge Frau förmlich vor sich, panisch vor Angst, als plötzlich die Tür aufsprang, ein Wahnsinniger auf sie losging und wild wütend auf ihren Kopf eindrosch.
Was war das für ein Mensch? Wer bringt eine wehrlose Frau um?
Martelli erinnerte sich, dass er heute früh beim Anblick des toten Obdachlosen bereits ähnliche Gedanken gehabt hatte. Nun war also ein zweiter Mord geschehen, und alle Anzeichen deuteten darauf hin, dass es der gleiche Täter war. Somit stand fest, dass er die Spur zu ihm in den Gebäuden des Deutschschweizer Fernsehens suchen musste. Das war ja wenigstens mal ein Anfang. Und was hatte die Tote, eine 37-jährige Aufnahmeleiterin, die eben zur Chefin ihrer Abteilung ernannt worden war, mit einem 49-jährigen Obdachlosen zu tun? Martelli schüttelte den Kopf. Er brauchte frische Luft.
Die Kunde über den Mord an Branka Samirovic verbreitete sich wie ein vom Föhn angefachtes Feuer. Als wäre es undenkbar, dass ein Medienhaus, welches seit seinem Bestehen über Verbrechen und menschliche Abscheulichkeiten berichtete, je selber Ort einer derartigen Handlung werden könnte, machte sich lähmende Fassungslosigkeit breit. Nicht wenige und teilweise auch gestandene Journalistinnen und Journalisten, die schon so manche menschliche Tragödie hautnah mitbekommen hatten, ließen ihren Gefühlen und ihrem Unvermögen, das Grauen als real zu erfassen, freien Lauf. Die Kantine, zur Mittagszeit bis auf den letzten Platz gefüllt, war von dieser Geschichte wie überschwemmt worden. So plastisch sie auch erzählt wurde, den Appetit der Medienleute schien sie nicht zu hemmen. Jeder, der irgendetwas Neues wusste, und war es nur die Farbe des Leichenwagens, wurde sogleich von Dutzenden Leuten umringt, und sein Wissen wurde Allgemeingut. Alle wussten genau, wo sich die Toiletten befanden, die Schauplatz dieser unerklärlichen Tat geworden waren. Und alle spürten, dass sie an diesem Ort nie mehr würden vorbeigehen können, ohne an den Mord zu denken.
Aufgrund der herrschenden Stimmung und der Unmöglichkeit, einfach zum Alltag zurückzukehren, sah sich der Fernsehdirektor genötigt, zusammen mit dem Polizisten, der vor einer halben Stunde zu ihm ins Büro gekommen war, vor die versammelten Mitarbeiter zu treten und kundzutun, was eigentlich schon alle wussten.
Das Studio, das Zahner kurzerhand für die Ansprache rekrutierte, war bis in die hinterste Ecke gefüllt. Die Menschen standen zwischen den Kulissenelementen einer Unterhaltungssendung, die noch vor Kurzem die heile Welt vorgegaukelt hatte.
Sichtlich bleich und zum ersten Mal mit einer Situation konfrontiert, bei der marktwirtschaftliche Zusammenhänge komplett nebensächlich waren, suchte der Direktor nach Worten des Mitgefühls. Dank eines Mikrofons waren sie bis in den letzten Winkel zu hören.
»Liebe Kolleginnen und Kollegen«, begann Rolf Zahner vorsichtig und abtastend, »ihr habt es wohl schon gehört. Es ist etwas unfassbar Schlimmes und Tragisches geschehen, was einem die Worte raubt! Zwei Menschen wurden nur unweit von hier Opfer einer absolut unmenschlichen und verabscheuungswürdigen Tat. Wer hierfür verantwortlich ist, kann freilich im Moment noch nicht gesagt werden. Vom Täter – und ich gehe jetzt mal einfach davon aus, dass es ein und derselbe Täter war – fehlt jede Spur. Wie auch immer, eines sage ich mit aller Klarheit: Wir werden alles daran setzen, dass diese Tat aufgeklärt wird! Es kann nicht sein, dass so etwas ohne Konsequenzen bleibt, und ich bitte euch alle, habt Vertrauen in die Arbeit unserer Polizei, deren Vertreter ich euch hiermit vorstellen möchte: Es handelt sich um den Abteilungsleiter der Kripo Zürich Nord, Severin Martelli.«
Die Menschenmenge wartete gespannt auf die Worte des Polizisten, der noch nie vor einer derart großen Menge hatte reden müssen. Martelli räusperte sich und begann etwas umständlich zu erklären, dass es im Moment überhaupt keine Anhaltspunkte gebe, wer diese Tat zu verantworten habe. Sicher sei indes, dass sich das Verbrechen bereits am Vorabend zwischen 22.00 und 23.00 Uhr ereignet habe. Alle, die über diesen Zeitraum etwas Erwähnenswertes zu berichten wüssten, sollten dies bitte umgehend tun. Hierfür werde im 12. Stock des Hochhauses ein Büro eingerichtet. Ebenso würde ein Care-Team der Kantonspolizei zur Verfügung stehen, um Betroffene zu betreuen und ihnen zu helfen. Außerdem ersuchte er, alles zu unterlassen, was die Gerüchteküche anheizte. Er wisse, dass er sich in einem Medienhaus befinde, wo die Wände sprichwörtlich Ohren hätten, aber er appelliere an ihre eigene Betroffenheit und an ihr Mitgefühl.
Eine fast schon beunruhigende Stille breitete sich aus, als Martelli seine Rede beendet hatte. Unzählige Augenpaare waren weiterhin auf ihn und Zahner gerichtet, und es machte nicht den Anschein, als wollte sich die Menge gleich wieder auflösen. In diese Stille drangen plötzlich die Worte einer jungen Journalistin: »Viele von uns haben heute Nachtschicht. Was werden Sie unternehmen, dass uns nicht Ähnliches passiert?«
Als hätten diese Worte die Masse geweckt, begann sofort eine aufgeregte Diskussion. Viele teilten die Bedenken der jungen Frau. Andere fanden, dass man eine Sondersendung im Sinne von Aktenzeichen XY machen müsse, um den Mörder schnellstmöglich zu finden. Einer aus der Abteilung Kultur forderte, den Bildschirm zur vollen Stunde eine Minute lang schwarz zu lassen und Mozarts Requiem zu spielen.
Auf diese Ideen schien Direktor Zahner vorbereitet zu sein, denn er erhob mahnend seine Arme und meinte mit hörbar eindringlicherer Stimme: »Liebe Kolleginnen und Kollegen! Was auch immer wir empfinden, und wie sehr uns diese Situation betroffen macht, eines ist klar: Wir müssen erstens unseren Sendeauftrag erfüllen und zweitens haben wir leider jeden Tag mit ähnlichen Verbrechen zu tun und berichten ebenfalls darüber. Es würde also bei unserem Publikum sehr bigott ankommen, wenn wir – erstmals selber von einer unsäglichen Gewalttat betroffen – die Berichterstattung einstellten. Nein, wir können und wollen nicht zulassen, dass die verabscheuungswürdige Tat eines Einzelnen uns auch noch unserer Handlungsfreiheit beraubt und uns das weitere Vorgehen diktiert!«
Natürlich werde die Sicherheit gewährleistet, meinte er mit funkelnden Augen. Hierfür würden einige abgestellte Beamte der Polizei sorgen, außerdem werde das Kontingent an Nachtwächtern von bisher einem auf vier aufgestockt. Um jede Diskussion im Keim zu ersticken, fuhr er gleich weiter:
»Die Koordination unserer Berichterstattung auf den drei Vektoren TV, Radio und Internet und das Wording über diesen Vorfall werde ich sogleich mit den Abteilungs- und Bereichsleitern definieren. Aber sicher ist, dass sich das DSF nie und nimmer von der irren Tat eines Verbrechers unterkriegen lässt!«
Wieder ging ein Raunen durchs Publikum, doch erneut ließ Zahner keinen Raum für eine Diskussion. Mit klarer Stimme sprach er weiter: Im Übrigen gelte bei Unklarheiten der Dienstweg. Anfragen oder Kontaktnahmen von auswärtigen Medien seien ohne Ausnahme an die zuständigen Pressesprecher weiterzuleiten. Dies gelte umso mehr, als noch in dieser Woche die größte Sendung in der Geschichte der SMG[9] über die verschiedenen Sender verbreitet werde: die National- und Ständeratswahlen 2015.
Zahner wirkte wie ein Politiker an einer Wahlveranstaltung. Die uneingeschränkte Aufmerksamkeit seiner Untergebenen schien ihm Auftrieb zu geben. Abschließend beschwor er die Zuhörer: »Ich bitte euch trotz Betroffenheit, zurück an eure Arbeit zu gehen. Wer eine Betreuung oder ein Gespräch benötigt, kann sich selbstverständlich an das Care-Team wenden, das sich bis auf Weiteres in den Sitzungsräumlichkeiten im 12. Stock einrichten wird. Sobald wir mehr sagen können, werden wir euch informieren. Das verspreche ich! Vielen Dank!«
Kapitel 4
Martelli stand vor dem Büro der Aufnahmeleiter, das sich im ersten Stock des Studiotraktes in einem düsteren Seitengang befand. Aufgrund der verwirrenden Architektur und den sich ähnelnden, endlosen Bürofluchten, die sich hier auf allen Stöcken ausbreiteten, brauchte er einen Moment, um zu verstehen, dass er sich genau einen Stock über dem Ort des Verbrechens befand und dass es auch hier eine Toilettenanlage gab. Dann trat er ins Büro ein.
Mehrere Männer und Frauen blickten ihn stumm an, und Sandro Rizzo, der 40-jährige Studiochef, der dem Polizisten zur Seite gestellt worden war, begann die Personen vorzustellen. Insgesamt vier Männer und fünf Frauen. Martelli ließ sich erklären, was die Aufnahmeleiter zu tun hatten, und erfuhr, dass sie im Studio der verlängerte Arm der Regie waren. Sie mussten den Moderatoren das Zeichen für ihren Einsatz geben, ihnen die richtige Kamera zuweisen. Außerdem hatten sie dafür zu sorgen, dass die Gesprächspartner auf dem richtigen Platz saßen und rechtzeitig wieder verschwunden waren. Last, but not least waren sie verantwortlich dafür, dass das Publikum zum richtigen Zeitpunkt herzhaft applaudierte. Martelli musste innerlich grinsen und begriff, dass es offenbar nur selten spontane Handlungen in Livesendungen gab. Da war jedes Element bis ins Letzte geplant und geprobt.
Als er auf das Opfer zu sprechen kam, bemerkte er, wie sich die anfängliche Anspannung in den Gesichtern der Aufnahmeleiter etwas löste. Es tat ihnen augenscheinlich gut, über ihre ehemalige Kollegin sprechen zu können. Martelli erfuhr, dass sie ein warmherziger und motivierter Mensch gewesen sein musste. Sie arbeitete gestern Abend bei einer Medizinsendung, die von 21.05 bis 21.42 Uhr dauerte, wie Rizzo zu berichten wusste. Danach habe Branka – wie üblich – kurz vor zehn Uhr das Studio verlassen und sei zurück in ihr Büro gegangen.
Ihr Schreibtisch, den sich Martelli zeigen ließ, war aufgeräumt, und der Computer war ausgeschaltet. Nichts deutete darauf hin, dass es hier zu einer folgenschweren Begegnung gekommen wäre. Viel eher sah es so aus, als hätte Branka das Büro verlassen, um die Toilette zu benutzen, bevor sie nach Hause gehen wollte.
»Ist es denkbar«, fragte Martelli in die Runde, »dass Frau Samirovic Feinde oder Neider hatte?«
Die Antwort war eindeutig. Nein, gegen einen Menschen wie Branka schienen keine Ressentiments zu existieren. Selbst dass sie zur neuen Chefin bestimmt worden war, schien bei ihren Kolleginnen und Kollegen nur auf einhellige Zustimmung gestoßen zu sein. Von Neid keine Spur. Martelli stutzte ein wenig über diese Einhelligkeit und spürte, dass hier ein möglicher Schlüssel zum Einstieg in den Fall liegen könnte. Denn irgendwer musste sehr wohl feindlich gestimmt gewesen sein – allenfalls auch als Resultat einer Abfuhr.
»War Frau Samirovic verheiratet oder in einer festen Beziehung?«
Keiner wollte antworten, und alle blickten auf Rizzo, der sich räusperte und dann meinte: »Branka war nur mit ihrem Job verheiratet. Sie war Single …«
Mehr wollte Rizzo anscheinend vor versammelter Mannschaft nicht sagen, doch Martelli ahnte, dass da noch mehr im Busch war. Er verabschiedete sich deshalb von den Aufnahmeleitern mit dem Wunsch, sie möchten ihn umgehend informieren, wenn sie noch irgendetwas zur Aufklärung des Falles beitragen könnten. Während sich zwei weitere Beamte Brankas Schreibtisches annahmen, schob Martelli den verdutzt blickenden Rizzo auf den Gang hinaus und schloss die Bürotür: »Also heraus mit der Sprache, was war Frau Samirovic für ein Mensch, und wie war Ihre Beziehung zu ihr?«
Rizzo lief rot an und stockte kurz, als suche er nach einem Pfad auf unwegsamem Gelände:
»Branka war kein Kind von Traurigkeit, wenn Sie verstehen. Sie war ein eingefleischter Single, was allerdings nicht heißt, dass sie nicht verschiedene Beziehungen hatte.«
»Das hab ich mir fast zusammengereimt …«, brummte Martelli, »auch mit Ihnen?«
Wieder erschrak Rizzo ob der Direktheit der gestellten Frage, um dann wie ein ertappter Junge anzufügen: »Wir hatten mal ein kurzes Verhältnis, aber das ist schon einige Monate her. Sie müssen wissen, ich bin verheiratet, und es ist einfach passiert … seitdem habe ich mit Branka nicht mehr so viel gesprochen. Aber man hat das eine oder andere gehört …«
»Zum Beispiel?« Martelli wurde langsam ungeduldig. Er mochte es nicht, wenn man jemandem die Würmer aus der Nase ziehen musste.
»Naja, sie ging häufig nach der Arbeit aus, traf sich mit Journalisten, Moderatoren und Technikern. Wie schon gesagt, sie nahm das Leben von der leichten Seite und sah ja auch super aus.«
»Haben Sie eine Ahnung, was sie gestern nach der Sendung machen wollte?«
»Nein, aber …«, wieder stockte Rizzo.
»Was?«
»Naja, jeder wusste, dass der Moderator der Medizinsendung ein Auge auf sie geworfen hatte. Nicht selten lud er sie noch zu einem Glas Champagner in irgendeine edle Lounge in der Stadt ein.«
»Und wie heißt der Moderator?«
»Max Bertschi.«
»Ah der? Ja, ich glaub, seine Sendung habe ich auch schon gesehen. Übrigens«, Martellis Augen wanderten durch den halbdunklen Gang, »sind diese Toiletten da defekt?«
»Nicht dass ich wüsste«, gab Rizzo überrascht Antwort.
»Okay«, brummte der Beamte und kniff die Augen zusammen. »Dann werde ich jetzt zu diesem Bertschi gehen. Wo finde ich den?«
Keine fünf Minuten später fuhr Martelli mit dem Lift in den 5.Stock des Hochhauses. Von Rizzo hatte er sich verabschiedet, er brauchte kein Kindermädchen. Als er ins Sekretariat eintrat, blickte er in die rehbraunen Augen einer etwa 50-jährigen Frau, die ihn begrüßte, als würde sie ihn seit Langem kennen.
»Ah, Herr Martelli, hab Sie schon erwartet! Mein Name ist Pulver, Hannelore Pulver, ich bin die Produktionsassistentin der Sendung ›Operation Gesundheit‹.«
Sie streckte ihre feingliedrige Hand aus und schüttelte Martellis Pranke.
»Ist das nicht schrecklich, das mit Branka? Dann noch der Mord an diesem Obdachlosen! Ich verstehe das nicht, dabei war Branka ein so goldiger Mensch, mit so viel Charme und Einsatzwillen. Alle liebten sie!«
»Tja, vielleicht war das gerade ihr Verhängnis, dass sie zu vielen Menschen gefiel …«
Martellis Worte vermieden jede Sentimentalität. Zu seinem Jobprofil gehörte Mitgefühl augenscheinlich nicht, wie die Sekretärin registrierte. Dennoch meinte sie nach kurzem Nachdenken: »Vielleicht haben Sie damit einen wunden Punkt getroffen. Daran habe ich noch gar nicht gedacht!«
»Sagen Sie, Frau Pulver, wer war in die gestrige Sendung involviert?«
»Naja, da waren zum einen zwei Redakteure, dann ich und natürlich unser Moderator, Max Bertschi, der auch gleichzeitig der Chef der Sendung ist.«
»Bertschi ist Arzt, nicht?«
»Nein, er hat nur ein paar Semester Medizin studiert, aber das Studium nie abgeschlossen, kam stattdessen zum Journalismus. Der übliche Werdegang im Fernsehen.« Pulver lächelte vieldeutig.
»Verstehe. Und wo finde ich Herrn Bertschi?«
»Er ist in seinem Büro, aber ich weiß nicht, ob er gestört werden möchte …«
»Das lässt sich leider nicht vermeiden!«
Martellis Worte waren unmissverständlich, dennoch zögerte Hannelore Pulver, bevor sie zum Telefonhörer griff, eine vierstellige Nummer wählte und wartete, bis am anderen Ende der Leitung abgenommen wurde.
»Bitte entschuldige, aber da ist der Herr von der Polizei …«
Martelli verstand die Antwort nicht, aber konnte sich die Worte zusammenreimen, zumal Frau Pulver deutlich machen musste, dass es unumgänglich sei. Plötzlich sprang eine Tür auf, und Martelli blickte in die graublauen Augen von Max Bertschi, der mit seiner ganzen Größe von fast zwei Metern in der Tür stand. Sein grau meliertes Haar, seine buschigen Augenbrauen und seine mediterrane Bräune, die ihn um einige Jahre jünger machte, ließen Martelli unwillkürlich klein und ungepflegt erscheinen. Dabei war auch er weit über1,80 und sicher einige Jahre jünger als der Fernsehdoktor.
Bertschi hieß den Polizisten Platz zu nehmen und setzte sich ihm gegenüber. Zwischen ihnen war ein großer Schreibtisch, dessen schwarze Tischplatte glänzte. Auf dem riesigen Tisch stand nur der Computer samt Tastatur, daneben lag das neueste multifunktionale Handy der Marke ›Mandarin‹, das nebst den üblichen Fähigkeiten auch über eine virtuelle, laserprojizierte Tastatur verfügte. So konnte man auf jeder geraden Fläche bequem schreiben. Martelli hatte schon viel darüber gelesen und wusste, dass es erst in China offiziell erhältlich und sündhaft teuer war.
»Funktioniert das wirklich – das mit der virtuellen Tastatur?«
»Ja, vorausgesetzt, man vertippt sich nicht«, schmunzelte Bertschi und freute sich, dass er mit dem neuen Teil Eindruck schinden konnte. »Aber ich gehe wohl recht in der Annahme, dass Sie nicht wegen des ›Mandarins‹ gekommen sind?«
»Nein, natürlich nicht«, antwortete Martelli und bemerkte, dass dieses Büro absolut papierfrei war. Überhaupt erschien der Raum karg und einfach eingerichtet. Ein verschlossener Bücherschrank und das berühmte Bild von Edward Hopper, das eine hell erleuchtete Bar in dunkler Umgebung zeigte, waren alles.
»Wie kann ich Ihnen helfen?«, fragte der Moderator in einem Ton, als wäre sein Gast ein Patient, was Martelli ärgerte. Er spürte förmlich die Aura, mit der sich Bertschi als selbst ernannter Halbgott in Weiß von anderen Menschen distanzierte. Der Polizist musste sich zwingen, seine Fragen ebenso direkt zu stellen wie bei allen anderen.
»Sie haben vom Tod von Branka Samirovic gehört?«
»Ja, unfassbar. Ich bin tief betrübt. Sie war ein echter Sonnenschein!«
Martelli suchte im Gesicht von Bertschi nach Indizien, die das Gesagte irgendwo spiegelten. Aber von Empathie sah er nichts.
»Wie standen Sie zur Toten?«
Bertschi blickte dem Polizisten unverhohlen in die Augen und meinte dann aufreizend lässig: »Ist das ein Verhör, oder anders gefragt: Werde ich verdächtigt?«
Nun gefiel es Martelli. Der Moderator hatte – einer Schachpartie nicht unähnlich – die Eröffnung verpatzt, und so konnte der Polizist schön einen Zug um den anderen machen und angreifen.
»Gäbe es denn Grund für Verdächtigungen?«
So einfach schien es allerdings doch nicht zu werden. Dafür war Bertschi zu gerissen. Er lachte plötzlich auf: »Gut, lassen wir das Versteckspielen. Wie Ihnen zu Ohren gekommen sein dürfte, habe ich Frau Samirovic – wie einige andere Männer auch – ein wenig besser gekannt. Nicht selten habe ich sie nach der Sendung zu einem Glas Champagner eingeladen. Doch gestern hatte ich leider keine Zeit und verließ das Areal kurz nach der Sendung, weil meine Frau Geburtstag hatte.«
»Ihre Frau?«
»Ja, tun Sie nicht so scheinheilig. Meine Frau ist sehr tolerant. Außerdem unterrichte ich sie nicht über Details. Das wäre unfein!«
»Verstehe. Wo waren Sie mit Ihrer Frau zwischen 22.00 Uhr und Mitternacht?«
»Zu Hause. Zusammen mit meiner Tochter feierten wir ihren Geburtstag und haben darauf angestoßen. Wir sind nicht mehr weggegangen.«
»Können Sie sich einen Grund vorstellen, wieso jemand Branka Samirovic umgebracht hat?«
»Nein«, sagte Bertschi, und zum ersten Mal schien er seine eingeübte Selbstbeherrschung zur Seite zu legen und erlaubte seinem Gesicht Emotionen, »es ist mir absolut unverständlich, wie jemand eine solche Tat verüben konnte. Gut, es gab wohl einige Männer, die bei ihr abgeblitzt sind. Aber das ist doch kein Grund, sie umzubringen!«
»Frau Samirovic war gestern Abend Ihre Aufnahmeleiterin. War sie anders als sonst? Vielleicht unkonzentrierter?«
»Nein, nein, sie war wie immer: hoch professionell und ein Sonnenschein. Wenn sie in der Nähe war, dann fühlte sich jeder Moderator sicher. Es konnte nichts passieren, wenn Sie verstehen, was ich meine.«
Martelli nickte und wartete mit der nächsten Frage, weil Bertschi zu überlegen schien.
»Das Einzige, das mir auffiel, war, dass Branka sehr bald nach der Sendung das Studio verließ. Augenscheinlich hatte sie keine Lust mehr, mit der Crew ein Glas trinken zu gehen. Das war unüblich. Gut, sie wusste, dass ich keine Zeit hatte, aber das war ab und zu der Fall. Und sie schien mir, wenn ich mir das noch mal so richtig überlege, etwas gehetzt.«
Als Martelli einige Minuten später in den 12. Stock hochfuhr, um sich bei seinen Mitarbeitern über den Stand der Ermittlungen zu informieren und mit den Betreuern des Care Teams zu sprechen, staunte er nicht schlecht, dass derart viele Menschen – vornehmlich Frauen – im schmalen Gang standen und angeregt diskutierten. Auch wenn ihre Gespräche kurzzeitig verstummten, als der Beamte vorbeiging, durchschaute Martelli sogleich, dass sich die hier anwesenden TV-Leute auch erhofften, zu weiteren Informationen zu gelangen. Sie wollten verständlicherweise die beiden Morde in eine Relation setzen und sich einen Reim darauf machen können. Martelli erklärte sich dies mit dem Umstand, dass Medienschaffende in der Recherche und im Verständnis der Zusammenhänge auch eine Art Trost fanden.
Noch in diese Gedanken versunken, trat er in eines der Büros ein. Sogleich kam Lukas Rütimann, ein Beamter seines Teams, auf ihn zu, um ihm den Stand der Ermittlungen zu rapportieren. Er kannte seinen Chef schon geraume Zeit, sodass er wusste, welche Erkenntnisse ihn am meisten interessierten: »Die Gerichtsmedizin hat angerufen: Es ist so gut wie sicher, dass beide mit demselben Gegenstand getötet worden sind. Es dürfte sich um einen Zimmermannshammer handeln, also einen mit einem lang gezogenen, schnabelartigen Ende. Bei einem ordentlichen Schlag mit einem solchen Gerät würde jeder Schädel zertrümmert, sagte der Mediziner.
Außerdem haben wir die technische Crew der gestrigen Medizinsendung zusammengerufen und alle befragt. Unisono sagen sie aus, dass Branka Samirovic das Studio allein verlassen hat. Eine Kamerafrau fügte an, sie habe aufgeschnappt, dass sie schnell nach Hause wollte, weil sie über Kopfweh klagte.«
Martelli musste unwillkürlich an den Hammer denken, der eben diesen Kopf zerstört hatte. Manchmal hasste er seinen Beruf, nicht selten hasste er auch die Menschen.
»Gibt es irgendwelche Hinweise, wen Samirovic nach der Sendung noch gesehen haben könnte?«
»Nein, leider nicht. Sie schien allein in ihr Büro gegangen zu sein, während die anderen entweder noch im Studio zu tun hatten oder nach Hause aufbrachen.«
»Ergab die Videoauswertung der Ausgänge schon etwas?«
»Leider nein«, sagte Rütimann. »Laut einem der Sicherheitsleute war es gestern ungewöhnlich ruhig. Außer den Leuten von der Medizinsendung waren nur noch die Crews der Nachrichtensendungen im Haus, deren Studios aber in einem anderen Gebäude untergebracht sind. Allerdings werden nicht alle Eingänge mit Video überwacht, sondern nur die Haupteingänge. Mit anderen Worten kann jeder, der sich im Areal auskennt, ungefilmt rein und raus!«
»Scheiße«, sagte Martelli unwillkürlich, »dann haben wir noch nicht sehr viel!«
Martelli blickte gerade zu den Fernsehleuten hinüber, als sich die Lifttür öffnete und ein groß gewachsener Mann mit dunklen Haaren heraustrat.
»Chef«, rief Enzo Baldini aufgeregt und drosselte seine Stimme gleich wieder, als er bemerkte, dass sich sofort mehrere Augenpaare auf ihn richteten. Martelli winkte ihn in ein leeres Sitzungszimmer, wo der Beamte dann lossprudelte: »Wir haben wahrscheinlich die Tatwaffe gefunden! Einen Hammer mit einer schnabelartigen Verlängerung!«
»Wo?«
»Er lag eingepackt in einen Plastiksack auf dem Gepäckträger einer alten Vespa, die unten bei den Fahrradständern abgestellt ist. Und wenn wir uns nicht täuschen, hat es noch Blut drauf!«
»Wem gehört die Vespa?«
»Zuppinger ist daran, dies rauszufinden!«
»Sehr gut, gehen wir.«
Martelli und Baldini fuhren mit dem Lift ins Parterre, verließen durch einen Hintereingang das Hochhaus und steuerten auf den Fahrradständer zu. Als Zuppinger seinen Chef erblickte, hob er den in einem durchsichtigen Plastiksack steckenden Hammer triumphierend in die Höhe. Als sie näher kamen, meinte er: »Da ist definitiv Blut am Hammer, auch hier an der Vespa!«
Martelli nickte, erfreut über die Fortschritte der Ermittlungen.
»Und wem gehört diese Vespa?«
»Einem Pavel Bilek aus Zürich Seebach, 58 Jahre alt, von Beruf Videoeditor.«
»Gut, den gehen wir jetzt besuchen.«