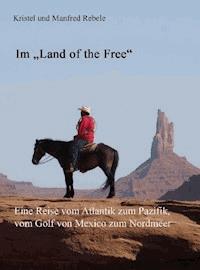Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Die Erfahrung des Fremden beim Reisen: auf den ersten Blick unverständliche alte Kulturen, für deren Verständnis wissenschaftliche Quellen herangezogen werden. Das traurige Schicksal indigener Völker. Reiseerfahrungen an den Enden der Welt: exotische Landschaften. Geologische Zeitreisen ins Archaikum. Fremde Sitten im Vergleich mit deutscher "Ordnung". Folklore.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 119
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Fremd ist der Fremde nur in der Fremde
(Karl Valentin)
Strange!
Vom Reiz des Fremden
In Patagonien
Finis Terrae.Feuerland
Subjektivität am Ende der Welt
Feuerlandindianer oder: Christliche Fernstenliebe am Ende der Welt
Die Alacaluf-Madonna
Die Jesuiten-Reduktionen
Präkolumbianische Kulturen Südamerikas
Die Inka
Die Kosmologie der Inka
Choquequirao
Die Chimu
Die Moche
Die Chavin-Kultur
Die Gegenwart der Ahnen
Die Indianer Nordamerikas
Lost in Capitalism: Australiens Aborigines
Eine australische Zeitreise
Vulkanlandschaften
Reisen in der Mongolei
Indiens Dreck
Verkehr
Moralisches Wertgesetz
Folklore
Vorwort
Als ich mit Rucksack über Teneriffa wanderte, im Freien schlafend, mit karg bemessenem Budget in einfachen Dorfkneipen oder aus meinem Blechnapf essend, sah ich beim Abstieg aus den Bergen im Norden ein isoliert dort am Meer liegendes Hotel. Eine ältere deutsche Dame, Hotelgast, mit der ich auf dem Camino ins Gespräch kam, ermöglichte mir– aus Solidarität der Allgäuerin zu einem Allgäuer, aus Mitleid mit dem Clochard und aus Ärger über das Hotel, das Katzen vergiftete, eine Teilnahme am Frühstücksbuffet, das für mich ein bleibendes Erlebnis wurde. So sehr ich es genoss, nach langer Zeit wieder deutsche Wurst und deutsches Müsli zu schmecken, so irreal kam mir das Hotel vor: ein nach Teneriffa verlängertes Deutschland mit Sonnengarantie und Palmen, eine künstliche Insel. Seitdem ist mir dieses Hotel ein Sinnbild für eine Art des Reisens, die ohne Neugier auf das fremde Land sich von der Andersartigkeit nicht groß beunruhigen lassen will. Und bis heute steht für mich fest, dass man auf diese Weise etwas verpasst.
Das Fremde, Exotische, Ausgefallene, Unvertraute kennenzulernen und zu erleben, auch dies kann durchaus den Reiz des Reisens ausmachen, und davon handelt dieses Buch. In der Form eines Mosaiks werden Reiseerlebnisse, -beobachtungen und -reflexionen ausgebreitet, auch wissenschaftliche Erklärungen für das auf den ersten Blick so Fremdartige. Natürlich sind es vor allem andere Kulturen, die auf einen Europäer fremdartig wirken; aber auch Landschaften können dieses Gefühle erzeugen.
Die Faszination des Fremden, dem dieses Buch gewidmet ist, ist freilich nur die eine Seite der Medaille. Nicht verschwiegen werden soll die andere, manchmal unangenehme, manchmal nervende, manchmal beängstigende Seite. Von der Aufdringlichkeit selbsternannter Führern in Marokko weiß fast jeder Reisende zu berichten. Am Ende ist er so weit, jede Kontaktaufnahme eines Marokkaners als Anbahnung eines Geschäfts zu beargwöhnen ( meist zu Recht) und sich abweisend zu verhalten. Man bedauert auf der einen Seite, dass ein unbefangenes Miteinander-ins- Gespräch-kommen so nicht möglich ist; auf der anderen Seite sieht man auch nicht ein, dass jede Freundlichkeit als „do ut des“ zu verstehen und mit einem Preiszettel versehen ist. Andere Länder, andere Sitten – aber man muss nicht alle gut finden. Zu Hause, beim Betrachten der Reisebilder, sind die unangenehmen Seiten des Fremden schnell vergessen und der Reiz des Exotischen setzt sich als überwiegender Eindruck fest. Unter den eher unangenehmen Erlebnissen gibt es welche, auf die man gleichwohl nicht verzichten möchte, weil sie so eindrücklich und charakteristisch für das bereiste Land sind; aber auch Situationen, auf die man gerne verzichtet hätte. Dazu zählen etwa die Erfahrungen mit Hafenbehörden in Südamerika, wo man sich fühlt wie in einem Roman Kafkas: eine Behörde entscheidet nach völlig undurchsichtigen Regeln, man wartet vor Türen, wird von Pontius nach Pilatus geschickt und wieder zurück, fühlt sich irgendwie ausgeliefert.
Und trotzdem macht man sich dann wieder auf in die Ferne und Fremde: VIAJAR ES VIVIR – REISEN IST LEBEN.
In Patagonien
Beruhige dich, mein Herz, du kannst ja doch nichts anderes machen als warten. Der Freund ist weggetrampt, um Mechanikerhilfe zu holen. Er wird wiederkommen, also beruhige dich. Einen Tag hatten wir gewartet, gewartet in der Einsamkeit, bis ein Auto kam. Stunde um Stunde schauten wir das lange Band der Schotterpiste entlang in die Unendlichkeit und dann, nach einem halben Tag, einer Nacht schlechten Schlafs und einem weiteren halben Tag ungeduldigen Ausschauhaltens zeigte sich weit in der Ferne eine Staubfahne, die waagerecht vom Wind weggetragen wurde, immer größer wurde, ein Auto entließ, das schließlich bei uns hielt und den Freund entführte nach Perito Moreno, mich zurücklassend bei unserem Wagen, der hier auf der Ruta 40 zusammengebrochen war. Nun fährt er die Strecke zurück durch die Halbwüste der grau-grünen Sträucher und der Büschel aus Pampagras, zurück in jenes Kaff nahe dem Lago Argentino, in dem die Farmer der weiteren Umgebung einkaufen. Dort hatten wir Proviant gebunkert für unsere Expedition. Wie hatten wir gemosert über das dürftige und wenig frische Angebot! Ach – nun, da ich hier gestrandet sitze, am Straßenrand im Irgendwo der endlosen Ebenen erscheint mir jenes staubige Kaff mit seinen kümmerlichen Bäumchen entlang der Hauptsstraße wie ein Leuchtturm der Zivilisation.
Dorthin eilt er nun zurück, über laut aufschreiende Viehgitter, wo die Straße die Weidezäune durchstößt. Die Füchse, die hier an Autoreifen gekreuzigt sind, rufen ihm ein schauriges „Memento mori!“ hinterher. Vorbei an Bergrücken, in deren Mulden sich eine Hazienda duckt – man sieht sie nicht, denn sie hat sich hinter einem Schutzwall von Pappeln verkrochen, die die schlimmsten Schläge des patagonischen Sturms auf sich nehmen.
Mich aber – ausgesetzt in der Ebene- packt er. Seit Tagen heult er ums Auto, rüttelt an ihm, lässt es zittern, schwanken. Tag und Nacht ist dieses Brausen in der Luft, die Ohren sehnen sich nach einem Moment der Stille – und werden nicht erhört. Noch in den Schlaf verfolgt mich das Geheul der Erynnien.
Das Auge sieht von alledem nichts. kein Baum biegt sich mit fahrigen Ästen. Knorrige Sträucher mit Hartlaub stehen still, als ob sie das Toben der Luft nichts anginge, nur einige Blättchen zittern etwas. Nicht anders das Pampagras, das hier in sehr kurzen Büscheln wächst, gekämmt hingeduckt; kleine Bewegungen der überaus zähen Halme sind ihr einziges Zugeständnis an die Macht des Windes. Die Sinne sind verwirrt: Die erdrückende Gegenwärtigkeit des Windes, für den die gemarterten Ohren zeugen, erscheint den Augen als Trug. Aber nur solange, wie man den Wind im Auto, abgeschirmt, aus der Distanz, sozusagen theoretisch betrachtet. Außerhalb der Wagenburg prügelt er auf alle Sinne gleichzeitig ein: die Augen werden trocken, die Haut kalt, Haare und Hose flattern.
Bruce Chatwin berichtet, er sei hier im patagonischen Sturm gewandert. Gewöhnt man sich so eher an die Elemente?
Woher hatte er sein Wasser? Es gibt keine Bäche, nur ganz wenige Flüsse, die das milchig-grüne Wasser der Gletscherseen zum Atlantik führen. Es regnet kaum. Der Fallwind, der die Anden herabfegt, bringt Wolken mit, die mit tief hängenden grau-blauen Schleiern über das Land jagen. Bevor sie dem durstigen Boden mehr als ein paar Tropfen gönnen, haben sie sich auch schon aufgelöst.
Und wie hat er die Unendlichkeit der Straße ertragen? Mit dem Auto fuhren wir Ewigkeiten immer geradeaus auf einen langgezogenen Bergrücken zu, Ewigkeiten an ihm entlang, der nur langsam seine Gestalt änderte. Wer hier entlang wanderte, dem räumte die leere Unendlichkeit die Seele aus – und doch verhinderte diese Halbwüste jede meditative Versenkung, die anderswo Religionsstifter hervorgebracht haben soll; denn hier fehlt: die Stille. Hier zu gehen, zu stehen, einfach nur zu sein erfordert eine ständige Anstrengung der Selbstbehauptung gegen den unablässig angreifenden Wind.
Wer hier wanderte, der könnte vielleicht sogar begreifen, wie man in diesem wüsten, menschenfeindlichen Land leben kann – weit entfernt von anderen Menschen, mit seinen Schafen und einem Wetter widerstehend, das tiefe Furchen in den Gesichtern hinterlässt.
Wer hier wanderte, käme am Ende zu einer Tankstelle mitten im Irgendwo, der ein kleiner Laden angeschlossen ist, wo es nicht viel zu kaufen gibt, nur das Nötigste: Konservendosen und Pferdesättel. Er sähe mich dort einen Mate trinken – und träumen.
Finis Terrae
nannten die Seefahrer zunächst das Kap im Nordosten Spaniens. Mit den immer weiter ausgreifenden Entdeckungsfahrten schob sich dieses Ende immer weiter von Europa weg. Zunächst lag es an der Westküste Afrikas. Die portugiesischen Seefahrer des Mittelalters mussten all ihren Mut zusammennehmen, um diesen magischen Punkt zu überschreiten, der das äußerste Ende der bekannten Welt bezeichnete; jenseits von ihm konnten Schiffe über die Kante der Welt hinabstürzen, konnten aus Alpträumen entsprungene Ungeheuer aus dem Meer steigen und das Schiff verschlingen.
Am Ende der Entdeckungsfahrten lag das Ende der Welt - Fin del mundo- im südlichsten Teil des amerikanischen Kontinents: in Patagonien - weit weg von Europa, ein blasser Punkt in der Weite der immer weiter werdenden Welt. Aber immer noch hat das Wort "Ende der Welt" einen mittelalterlichen Geschmack auf der Zunge: Hier endet die bekannte Welt, das Vertraute; dort, jenseits das Unbekannte, wo alles möglich ist.
In unserer modernen Welt, in der der ganze Globus vermessen ist, ist die terra incognita verschwunden, gibt es keine weißen Flecken mehr, als deren Entdecker man sich ins Buch der Geschichte eintragen könnte. Das Jenseitige, der Ort, wo alles möglich ist, das sich die Phantasie in bunten Bildern ausmalt, es ist kein geographischer Ort mehr.
Aber geblieben ist das Bild der Grenze, der absoluten Grenze. Grenzen gibt es viele, Staatsgrenzen allemal, aber auch Flüsse und Berge bilden Grenzen. Meistens sieht es "drüben" kaum anders aus, die Sitten mögen ein wenig verschieden sein, doch solange die Menschen diesseits und jenseits der Grenze nicht nationalistisch aufgehetzt sind, wissen sie darum, dass ihre Gemeinsamkeiten zahlreicher sind als ihre Unterschiede: auch da drüben leben Menschen, und selbst wenn deren Kultur sehr fremdartig sein sollte, es ist eine Form der Kultur, wovon die eigene eine andere. Am Fin del mundo erwartet uns dagegen jenseits der Grenze keine andere Kultur, sondern - deren Ausbleiben. Das Ende der Welt ist das Ende der Zivilisation.
Also ist das Ende der Welt an vielen Orten, überall dort, wo menschliche Zivilisation sich ausdünnt und die Wüste beginnt? Aber hinter jeder Wüste ist irgendwo wieder bewohntes Land, hinter dem Ende der Welt jedoch: nichts.
Und wo liegt er nun, dieser magische Ort? Wir alle wissen, dass die Erde eine Kugel ist, dass man also auf jedem Kreis, den man um sie beschreibt, irgendwo auf bewohntes Land stoßen muss. Aber dieses Wissen ist seltsam abstrakt; denn wenn wir am Meer stehen, vor dieser Unendlichkeit des Wassers, sagen uns Anschauung und Gefühl: da hinten ist nichts mehr, und nur unser geographisches Wissen korrigiert unsere Vorstellung, die hier der mittelalterlichen recht nahe ist. Nirgendwo aber erscheint dies Gefühl naheliegender als in Patagonien und Feuerland: hinter dir liegt die endlose Weite der Steppe, so gut wie menschenleer, die Zivilisation dünn gesät, du stehst auf dem südlichsten Fleck der amerikanischen Landmasse, die hier in den sturmgepeitschten antarktischen Ozean ragt, vor dir eine lebensbedrohende Wasserwüste, hinter der keine freundlichen Gestade dich erwarten sondern eine lebensfeindliche Eiswüste, von einem Sturmgürtel umschlossen. Du stehst an einem Punkt der Erde, wo du froh bist, einem bescheidenen Stück Zivilisation zu begegnen , und der nächste Schritt darüber hinaus führt dich in deren vollständige Negation.
Man vermutet diesen Punkt zunächst in Ushuaia, der südlichsten Stadt der Welt. Sie hat 50.000 Einwohner und ist Zentrum des Feuerlandtourismus; hinzu kommt seine Funktion als Ausrüstungsstützpunkt für die zunehmenden Kreuzfahrten in die Antarktis. Als Bruce Chatwin sie besuchte, hatte er noch den Eindruck eines verschlafenen, unfreundlichen Kaffs am Ende der Welt, in dem "man nicht begraben sein möchte"; in der heutigen Geschäftigkeit kann dieser Eindruck nicht mehr aufkommen. Ushuaia ist ein "Muss" für jeden Südamerika-Individualreisenden, sei er per Fahrrad, Motorrad, Wohnmobil, Reisebus unterwegs: da kommt einiges zusammen. Und alle folgen dem Ruf "fin del mundo", der Idee vom Ende der Welt, die Ushuaia so genial als Markenzeichen für sich entwickelt hat, dass am Ende vom Abenteuer einer Reise ans Ende der Zivilisation nichts mehr übrig bleibt.
Auch an den großen Touristenmagneten Patagoniens, den Torres del Paine und am Fitzroymassiv hat man nicht das Gefühl, schon halb außerhalb der Welt zu sein. Aber wie immer ist solch ein Gefühl relativ. Wer von Europa einfliegt und sich dann von der Kleinstadt Puerto Natales im Süden über Schotterpisten aufmacht zu den Torres, für den sieht das grandios modellierte Granitmassiv, wenn es sich wie die Burg vom heiligen Gral aus der patagonischen Ebene erhebt, in all seiner Naturerhabenheit, Entrücktheit in der Weite der Pampa, unschwer aus wie ein Ausrufezeichen am südlichen Ende Amerikas . Wer sich jedoch nach einer tagelangen Reise durch Patagonien von Norden her diesen Granittürmen nähert, der genießt dort die touristische Infrastruktur, liest die in den Wanderhütten zurückgelassenen deutschen Zeitschriften und kommt sich nach der langen Zeit, die er unerreichbar und abgeschnitten von Informationen über das Weltgeschehen verbracht hat, vor wie nach Europa zurückgekehrt.
Wir suchten – und fanden- unser fin del mundo in Feuerland.
Feuerland
Blickt man von der flachen patagonischen Pampa über die Magellanstraße hinüber nach Feuerland, so zeigt sich das Land dort zunächst als eine ebensolche leicht gewellte Ebene. Im Ende 19. Jahrhundert/Anfang 20. Jh. gehörte dieses Gebiet einer einzigen Gesellschaft, der "Sociedad Explotadora de Tierra de Fuego", die hier Schafzucht in großem Stil betrieb (und zuvor einen Genozid an den Indianern). Cameron wurde 1904 von der Sociedad Exploradora, deren Besitz sich über einen ganzen Breitengrad erstreckte, als die Hauptestancia einer 300.000 ha großen Schafweide gegründet, welches wieder in Unterestancias "secciones" unterteilt war mit entsprechenden Verwaltern. Diese wiederum hatten "puestos", die von je einem Schafhirten besetzt waren, der mit Hunden und Pferden sich um die Schafe kümmerte. In Cameron stehen noch die Häuser der damaligen Estancia, aus blauem, rosa, grünem, mittlerweile verblichenem Wellblech mit Veranden, weißen Holzsäulen und Holzgittern. Diese Estancia war wie ein kleines Dorf: es gab Verwaltungsgebäude, Vorratshäuser, ein Gebäude für die zentrale Schafschur, el plantel de reproductores (Tierzucht?), maestranza (Werkstatt). Wir reiben uns die Augen und fühlen uns im Traum 90 Jahre zurückversetzt. Zurückversetzt aber in einen Geisterort: der "Supermarkt" in einem der einfachen Wellblechhäuser ist mit Vorhängeschloss verrammelt, wahrscheinlich längst aufgegeben, Klopfen und Rufen vergebens. Ende der Welt eben.
Aber noch nicht genug. Der abgelegenste Ort auf Feuerland scheint uns der Seno Almirantazgo zu sein, ein langer, schmaler Seitenarm der Magellanstraße, da zieht es uns hin.
Zunächst geht es durch klassisches leicht gewelltes Estancia-Land, und was an Gebäuden neben der Straße auftaucht, sieht neu und proper aus, in großem Stil, ein hier offenbar immer noch lohnendes Geschäft. Die Ebenen sind windturchtost: die Flechtenbärte der wenigen Bäume stehen waagerecht im Wind. Unter den Lengabäumen liegen gelbe kugelartige Früchte, walnussgroß mit einer wabenförmigen Oberfläche. Es handelt sich um einen parasitischen Pilz, der auf und um Äste und Zweige der Buchen wächst. Sein hiesiger Name: Pan de Indio. Darwin schreibt, dass dieser Pilz von den Indianern gesammelt und als einzige pflanzliche Nahrung gegessen wurde, und zwar roh. "Er hat einen schleimigen, unbedeutend süßen Geschmack, mit einem leichten Pilzgeruch."