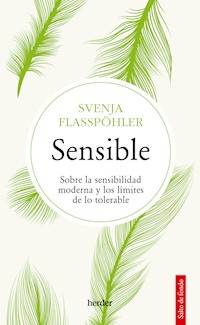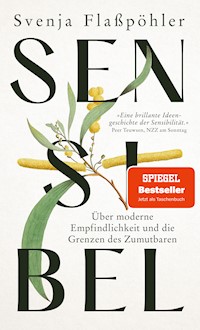Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Hanser Berlin LEBEN
- Sprache: Deutsch
Wie geht Streiten heute? Svenja Flaßpöhler, eine unserer streitbarsten Denkerinnen, appelliert persönlich, philosophisch und pointiert für mehr richtigen Streit
„Warum also streite ich? Davon und von der Frage, was Streiten heißt, handelt dieses Buch.“ Svenja Flaßpöhler gilt als streitlustig, als jemand, der gerne angreifbare Positionen vertritt. Doch in ihr wohnt eine ganz andere Erfahrung: die eines Trennungskinds, das mit der Angst vor Streit und Eskalation aufgewachsen ist. In ihrem persönlich-philosophischen Essay zeigt sie, dass über das Streiten nachzudenken vor allem heißt, sich von Illusionen zu befreien. Ein Streit ist kein herrschaftsfreier Diskurs, sondern es geht um Macht: Der Abgrund der Vernichtung ist immer als Möglichkeit präsent. Gleichzeitig ist es gerade der Streit in seiner Unversöhnlichkeit, der uns vorantreibt und Veränderung bewirkt. Ein flammendes Plädoyer für Lebendigkeit, Mut und den Eros des Ringens.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 126
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Ähnliche
Über das Buch
Wie geht Streiten heute? Svenja Flaßpöhler, eine unserer streitbarsten Denkerinnen, appelliert persönlich, philosophisch und pointiert für mehr richtigen Streit»Warum also streite ich? Davon und von der Frage, was Streiten heißt, handelt dieses Buch.« Svenja Flaßpöhler gilt als streitlustig, als jemand, der gerne angreifbare Positionen vertritt. Doch in ihr wohnt eine ganz andere Erfahrung: die eines Trennungskinds, das mit der Angst vor Streit und Eskalation aufgewachsen ist. In ihrem persönlich-philosophischen Essay zeigt sie, dass über das Streiten nachzudenken vor allem heißt, sich von Illusionen zu befreien. Ein Streit ist kein herrschaftsfreier Diskurs, sondern es geht um Macht: Der Abgrund der Vernichtung ist immer als Möglichkeit präsent. Gleichzeitig ist es gerade der Streit in seiner Unversöhnlichkeit, der uns vorantreibt und Veränderung bewirkt. Ein flammendes Plädoyer für Lebendigkeit, Mut und den Eros des Ringens.
Svenja Flaßpöhler
Streiten
Hanser Berlin
Für Elisabeth
Übersicht
Cover
Über das Buch
Titel
Über Svenja Flaßpöhler
Impressum
Inhalt
Prolog
Streit ist kein Diskurs
Trennlinien
Bindungskräfte und Thanatos-Tendenzen
Du — überhaupt
Die Sprungfeder des Muts
Grenzen der Vernunft
Macht des Allgemeinen
Umstritten sein
Messen und Morden
Selbstverteidigung
Strategie und Feigheit
Mit Habermas ins Pluriversum
Epilog
Dank
Anmerkungen und Verweise
Verwendete Literatur
Prolog
In den Augen vieler Menschen bin ich eine Frau, die sich gerne streitet und mit einer gewissen Lust angreifbare Positionen vertritt. In der Tat reizen mich bestimmte gesellschaftliche Tendenzen zum Widerspruch. Manche begrüßen das und nehmen mich wahr als »streitbare Philosophin«, die sich dem »Mainstream« entgegenstellt. Andere wiederum nennen mich »Schwurblerin« und meinen, ich sei unsolidarisch, aufmerksamkeitssüchtig und rede über Dinge, von denen ich keine Ahnung habe. Über eine Sache aber sind sich vermutlich alle einig: dass ich streitlustig bin. Als sei Streit für mich etwas Lustiges. Doch in mir wohnt eine andere Erfahrung.
Bei dem Wort Streit denke ich an eine sehr frühe Angst, an innere Erstarrung. Ich denke an die Trennung meiner Eltern, als ich noch keine zwei Jahre alt war, an den Auszug meines Vaters, an ein starkes, namenloses Vermissen. Ich denke an eine zerrissene Welt, die von Anfang an da war und die ich nie akzeptieren wollte, im Grunde bis heute nicht. Ich denke an die vielen durchwachten Nächte, später, in der zweiten, ebenfalls krisengeschüttelten Ehe meiner Mutter, weil ich fürchtete, dass im Eifer des Gefechts jemand sterben könnte, wenn es niemanden gibt, der aufpasst. Ich denke an Geschrei, an zerbrechendes Geschirr, an umfallende Regale im Handgemenge. Und an meine Mutter, die eines Tages geht und sich auch nach uns Kindern nicht mehr umdreht.
Warum also streite ich? Davon und von der Frage, was Streiten heißt, handelt dieses Buch.
Streit ist kein Diskurs
Zunächst einmal gilt zu klären, worüber wir reden, wenn wir von »Streit« reden. Dies umso mehr, als die Ermahnung, wir müssten wieder lernen zu streiten, dieser Tage so oft zu hören ist, dass sie in meinen Ohren schon wieder fast ein wenig wohlfeil klingt. Streit, da schwingt so herrlich mit, was uns doch allen lieb und teuer ist. Wer streiten kann, setzt sich mit Andersdenkenden auseinander, hält die Meinungsfreiheit hoch. Wie sagte Helmut Schmidt: »Eine Demokratie, in der nicht gestritten wird, ist keine.« Ein Satz, den sich eine große Wochenzeitung zu eigen gemacht hat, um ihre Rubrik »Streit« zu bewerben, die vor einigen Jahren ins Leben gerufen wurde. Streiten, so scheint es, ist etwas Gutes, zumindest dann, wenn bestimmte Benimmregeln berücksichtigt werden. Das ist alles nicht falsch und verfehlt doch das Spezifische des Phänomens.
Über das Streiten nachzudenken heißt, sich von Illusionen zu befreien. Ein Streit ist nie harmlos. Der Abgrund der Vernichtung ist immer da. Bereits die Begriffsgeschichte weist eindrücklich auf die Gewalt dieses Tuns hin, und zwar wohlgemerkt: eine physische Gewalt. So wurde »strît«, heißt es im Grimmschen Wörterbuch, schon im Althochdeutschen »als bezeichnung des waffenkampfes neben anderen wörtern« verwendet. Im Mittelhochdeutschen hat sich »strît« gar in »massenhaft anschwellendem gebrauch als allgemeine bezeichnung des physischen kampfes« durchgesetzt. Nicht umsonst hießen »Schlachtrösser«, also Pferde, die bis ins 16. Jahrhundert hinein im Kampf eingesetzt wurden, auch »Streitrösser«. Und noch Luther verwendete »strît« regelmäßig im Sinne von Kampf, Schlacht, Krieg. Wer stritt, stach zu, schlachtete ab, löschte Leben aus. Bis zum Ende des 18. Jahrhunderts war diese Bedeutung von »Streit« vorherrschend.1
Vor gut zwei Jahrhunderten hieß streiten also noch vornehmlich: kämpfen. Und zwar buchstäblich bis aufs Blut. In unserer Zeit weisen Ausdrücke und Redewendungen wie »Schlagabtausch« oder »Wortgefecht« noch auf diese körperliche Dimension hin, die als Möglichkeit immer lauert. Wer »einen Streit vom Zaun bricht«, lässt einen Streit so heftig und plötzlich eskalieren, »wie man eine Latte (als Waffe) von der nächsten Umzäunung bricht«2. Ob unter Nachbarn, in der Familie, im Straßenverkehr, bei Protesten, gar im Parlament: Ein Streit hat immer das Potenzial, in reale, physische Gewalt umzuschlagen. Dass und inwiefern sich diese Dynamik gerade in unseren Tagen zeigt, davon wird noch die Rede sein.
Eingedenk dieser Eskalationspotenz zeugt der heutige Wortgebrauch von »Streiten« dennoch von einer zunehmenden Pazifizierung moderner Gesellschaften. Genauer: von einem Prozess zivilisatorischer Sensibilisierung, der körperliche Gewalt einzudämmen und sprachliche Aushandlungen an ihre Stelle zu setzen versucht. Wenn wir von »Streiten« sprechen, meinen wir keinen Waffenkampf um Leben und Tod mehr. Wer »streitet«, kämpft nicht physisch, sondern verbal, und zwar (hier kommen die Benimmregeln ins Spiel) am besten fair, sachlich und lösungsorientiert, getragen von gegenseitigem Verstehen, der Fähigkeit zum Perspektivwechsel.
Womit wir allerdings sogleich bei der problematischen Aufweichung des Begriffs — und zwar im doppelten Sinne — angelangt wären. Wer nämlich meint, es sei möglich, sich emphatisch und verständnisvoll zu streiten, hat noch nicht erfasst, was Streit ist. Streiten hat mit einem Perspektivwechsel, einem Aus-sich-Heraustreten, zunächst einmal nichts zu tun. Ein Mensch, der anfängt, den Gegenstand des Streits mit den Augen des anderen zu sehen, streitet schon nicht mehr, sondern befindet sich bereits auf dem Weg der Verständigung. Genauer: Ein Mensch, der die Sicht wechselt und sich auf diese Weise verstehend auf einen Konsens zubewegt, führt keinen Streit, sondern nimmt an einem Diskurs teil.
Eine phänomenologische Annäherung mag genauer illustrieren, worin die Differenz besteht. Stellen wir uns zwei Menschen vor, die streiten. Was zeigt das geistige Auge: Menschen, die ruhig einander zuhören, sachlich Argumente austauschen und zwischendurch immer wieder verständnisvoll nicken, wenn der andere redet? Menschen also, die sich, um es mit Jürgen Habermas zu sagen, zur »wechselseitigen Perspektivübernahme« und zur »gemeinsamen Überwindung ihres Egoismus«3 nötigen lassen, um konsensorientiert dem »eigentümlich zwanglosen Zwang des besseren Argumentes«4 zu folgen? Wohl kaum. Das Wort Streit evoziert ein anderes Vorstellungsbild, in dem Affekte klar zutage treten und sich die gesamte Atmosphäre völlig anders gestaltet. Wer in einen Streit verwickelt ist, erhebt die Stimme, um ihr Geltung zu verschaffen. Die Gemütslage ist erhitzt, die Gesichtsmuskeln sind angespannt. Die Hände liegen nicht ruhig auf dem Tisch, sondern sind Teil des Gefechts, verleihen den emotional vorgebrachten Worten zusätzlich Kraft. Kurzum: Ein Streit ist nie frei von Herrschaft. Hier geht es um Macht, weil Menschen, die wirklich und wahrhaft streiten, einander gerade nicht verstehen. Hier prallen grundverschiedene Seinsweisen, gar Weltbilder aufeinander.
Habermas geht davon aus, dass wir, wenn die idealen Bedingungen eines herrschaftsfreien Diskurses gegeben sind, qua Vernunft erkennen, dass wir bestimmte Normen und Werte teilen und so zu einem Konsens finden. Doch wie sich an gegenwärtigen Großkrisen zeigt, ist das längst nicht immer der Fall. Sind Corona-Impfgegner unsolidarisch oder einfach nur selbstbestimmt? Ist es moralisch und politisch legitim, Waffenlieferungen an die Ukraine zu kritisieren? Migration zu begrenzen? Lassen sich die historischen Hintergründe des Terrorangriffs der Hamas in Israel beleuchten, ohne in sträfliche Relativierung abzugleiten? An solchen Fragen scheiden sich die Geister, spalten sich Familien, scheitern Freundschaften. Der Grund ist: Man begreift schlicht nicht, wie der andere so denken kann, wie er denkt. Und man hält dieses andere Denken für derart falsch und fatal, dass es so »nicht stehen bleiben kann«. Ergo muss es, auch wenn es hart klingt, zu Fall gebracht werden.
Natürlich kann es sein, dass nach einem ersten heftigen Streit doch noch der Weg des Diskurses beschritten wird. Doch es ist ebenso möglich, dass die Positionen unversöhnt bleiben, sich der Streit also nicht durch »kommunikative Rationalität« (Habermas) auflöst.
Zu streiten heißt somit im Kern dies: dass ich meine Perspektive gegen eine andere stelle. Voraussetzung dafür ist, dass ich meine Sichtweise für richtig und die andere für falsch oder mindestens für fatal unterkomplex halte und das unmissverständlich zum Ausdruck bringe. Um zu streiten, muss ich also jemandem ins Gesicht sagen können: Ich habe recht und du nicht. Ohne diese Entgegensetzung gäbe es schlicht keinen Streit, sondern vielmehr ein suchendes Gespräch, einen »discursus«, was übersetzt »Umherlaufen« bedeutet. Der Diskurs ist ein besonnenes, wandelndes Denken, das sich durch die Fähigkeit auszeichnet, die eigene Position zu verlassen oder eine solche gar nicht erst zu besitzen.
Die Sokratischen Dialoge sind für die Dynamik des Diskurses paradigmatisch. Sokrates hat mit den Athener Bürgern, die er in lange Gespräche über Tugend, Krieg oder Pädagogik verwickelte, nicht im eigentlichen Sinn gestritten. Er hat mit ihnen gemeinsam ein Für und Wider erörtert und auf diese Weise falsche Gewissheiten erschüttert. Die Grundhaltung des Sokrates lautete: Ich weiß, dass ich nicht weiß. Wer das Nichtwissen zum Prinzip erhebt, kann hervorragend dialektisch denken, aber nicht wirklich streiten (wobei Sokrates in den überlieferten Dialogen weitaus besserwisserischer ist, als sein eigener Grundsatz vermuten lässt).
Wer streitet, darf nicht von vornherein an sich beziehungsweise der eigenen Sichtweise zweifeln, nicht etwaige Gegeneinwände immer schon mitbedenken, nicht insgeheim glauben, dass der andere vielleicht doch im Recht sein könnte. Vielmehr ist die notwendige Voraussetzung eines Streits eine affektive Unmittelbarkeit, die Zweifel überhaupt nicht aufkommen lässt. Der Affekt ist es, der mich in die Lage versetzt, meine Gewissheit in einem bestimmten Augenblick gegen eine andere entschieden in Stellung zu bringen. Anders gesagt: Was ich brauche, um zu streiten, ist die nötige aggressive Energie — verstanden in dem Sinne, wie die Psychoanalyse sie deutet: Nämlich als eine affektive Kraft, die zunächst einmal weder gut noch schlecht ist, sondern gebraucht wird, um sich zu behaupten. Ohne Aggression gäbe es keine Streitbereitschaft und auch kein Durchsetzungsvermögen. Ohne Aggression würde ich den Sprung in die harte Auseinandersetzung scheuen wie ein Kind den Sprung vom 5-Meter-Turm. Ohne Aggression lässt sich schlicht nicht streiten. Ganz im Gegenteil: Nur durch sie kann ein Streit überhaupt entstehen. Nur durch sie komme ich in die Lage, in einer bestimmten, möglicherweise noch so heiklen Situation zu sagen »Das sehe ich anders!«, um sodann mit argumentativer Schärfe meiner Sicht Macht zu verleihen. Hierbei kommen auch rhetorische Mittel wie die Polemik (griechisch für ›Streit‹, ›Krieg‹) zum Einsatz, um durch Überspitzungen gezielt die Schwachstellen der gegnerischen Argumentation herauszustellen, ja regelrecht aufzuspießen. Auf diese Weise gebe ich dem Affekt eine Form: Ich verwandle ihn in eine argumentative Waffe, die dazu dient, den Kampf zu gewinnen.
Im letzten Kapitel dieses Buches werden wir sehen, dass sich genau hier, in der Transformation des Affekts in Argumente, Streit und Diskurs berühren. Und wir werden auch sehen, dass der Diskursethiker Habermas in seiner Rolle als öffentlicher Intellektueller das Schlachtfeld des Streits immer wieder ganz gezielt aufsuchte und dabei durchaus über »eine ausgeprägte Feindwahrnehmung« verfügte.5 In einer idealen Welt mögen Diskurse herrschaftsfrei sein. In der Realität aber lassen sich Aggressionen nicht einfach zum Verschwinden bringen.6 Sie zu balancieren ist die Kunst.
Trennlinien
In meiner Kindheit habe ich erlebt, wohin Streit führt, wenn der Affekt als reine Zerstörung agiert: zur Auflösung aller Bindungen. Vor allem denke ich dabei an meine Mutter, die viel zu verstrickt in ihre eigene Geschichte war, um in ihren Liebesbeziehungen frei zu sein. Der Streit war ihr Schwert, mit dem sie sich durchs Leben und durch ihre Ehen kämpfte. In den Augen meiner Mutter diente dieses Schwert dem Selbstschutz und zielte doch auf Vernichtung.
Zum Zeitpunkt meiner Geburt war sie 20 Jahre alt. Stärker als ihre Liebe zu meinem Vater, ihrem ersten Ehemann, war der Hass auf ihren Vater, dessen tyrannischer Macht sie durch die Gründung einer eigenen Familie endgültig zu entfliehen hoffte. Und so geschah im Grunde schon meine Zeugung wie auch weite Teile ihres späteren Lebens auch aus einer Rebellion heraus, aus einem großen Nein gegen ihren Vater, der aber, da alles Handeln meiner Mutter in Wahrheit auf ihn bezogen blieb, seine Macht nie verlieren sollte. Diese väterliche Allmacht durchwirkte die Beziehungen zu ihren Männern, und so blieb das Nein meiner Mutter stärker als das Ja. Ihre Ehen zerfielen — sosehr sie sich auch bemühte.
An das Streiten zwischen ihr und meinem Vater kann ich mich, da ich noch zu klein war, nicht mehr bewusst erinnern, dafür aber sehr genau an die Eskalationsstufen im Streit mit meinem Stiefvater, die sich von einem zu laut auf den Teller gelegten Löffel über knallende Türen bis hin zu Handgreiflichkeiten hochschrauben konnten.
Vor allem spätabends oder nachts kam es oft zu schweren Auseinandersetzungen. Wenn ich wach in meinem Bett lag, wusste ich manchmal nicht, was ich mehr befürchten sollte: dass das Geschrei und Geschepper ein Stockwerk tiefer noch stundenlang weitergeht; oder dass es plötzlich aufhört, weil jemand tot ist. Ich — oder genauer gesagt mein Leib — weiß noch sehr genau, wie es sich anfühlt, einen solchen Streit zu erleben. Der Atem stockt. Im Magen liegt ein Stein, der immer größer wird. Es ist, als würde man selbst ein wenig sterben.
Mein Stiefvater verstand nicht, woher die hohe Reizbarkeit meiner Mutter in Wahrheit rührte (er führte sie meist auf den Alkohol zurück, der in der Tat oft im Spiel war), weshalb sie so schnell die Sachebene verließ und persönlich wurde, warum sie in nahezu allem patriarchale Unterdrückung wähnte. Im Gegenteil, mein Stiefvater fand seinerseits im Freiheitsdrang meiner Mutter immer wieder willkommenen Anlass zum Furor. So verkeilten sie sich ineinander und waren gleichzeitig hilflos wie zwei Schiffbrüchige, die in höchster Seenot den rettenden Ring nicht sehen. Stattdessen rissen sie sich gegenseitig in die Tiefe, versanken im Strudel des Zorns. Die Affekte waren durch nichts gebunden, weil niemand sie durchschaute, und so konnten sie nach und nach alles zerstören, worauf Beziehungen gründen: Vertrauen, Achtung, Liebe. Nach einem solchen Streit ist es unmöglich, so zu tun, als sei nichts geschehen. Das Davor ist unwiederbringlich verstellt.