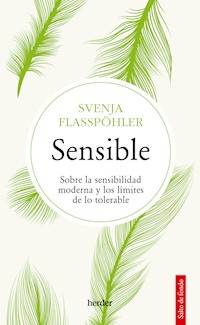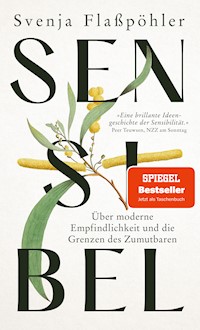11,99 €
Mehr erfahren.
Von der Kunst loszulassen
Verzeihen heißt dem Wort nach: Verzicht auf Vergeltung. Wer verzeiht, bezichtigt nicht länger andere für das eigene Leid, sinnt nicht auf Rache oder juristische Genugtuung, sondern lässt es gut sein. Aber wie ist ein derartiges Loslassen möglich, das weder gerecht noch ökonomisch noch logisch ist? Lässt sich das Böse verzeihen? Führt das Verzeihen zu Heilung, gar Versöhnung – oder ereignet es sich jenseits allen Zwecks? Ausgehend von eigenen Erfahrungen ergründet die Philosophin Svenja Flaßpöhler, unter welchen Bedingungen ein Schuldenschnitt im moralischen Sinne gelingen kann. Sie spricht mit Menschen, denen sich angesichts schwerster Schuld die Frage des Verzeihens in aller Dringlichkeit stellt, und sucht nach Antworten in der Philosophie.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 187
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Verzeihen heißt dem Wort nach: Verzicht auf Vergeltung. Wer verzeiht, bezichtigt nicht länger andere für das eigene Leid, sinnt nicht auf Rache oder juristische Genugtuung, sondern lässt es gut sein. Aber wie ist ein derartiges Loslassen möglich, das weder gerecht noch ökonomisch noch logisch ist? Lässt sich das Böse verzeihen? Führt das Verzeihen zu Heilung, gar Versöhnung – oder ereignet es sich jenseits allen Zwecks? Ausgehend von eigenen Erfahrungen ergründet die Philosophin Svenja Flaßpöhler, unter welchen Bedingungen ein Schuldenschnitt im moralischen Sinne gelingen kann. Sie spricht mit Menschen, denen sich angesichts schwerster Schuld die Frage des Verzeihens in aller Dringlichkeit stellt, und sucht nach Antworten in der Philosophie.
Svenja Flaßpöhler ist promovierte Philosophin und stellvertretende Chefredakteurin des Philosophie Magazin. Seit 2013 ist sie außerdem Literaturkritikerin in der Fernsehsendung »Buchzeit« (3sat) und Mitglied der Programmleitung des Philosophiefestivals phil. COLOGNE. Ihr Buch Mein Wille geschehe. Sterben in Zeiten der Freitodhilfe (2007) wurde mit dem Arthur-Koestler-Preis ausgezeichnet. Zuletzt erschien Wir Genussarbeiter. Über Freiheit und Zwang in der Leistungsgesellschaft (2011). Svenja Flaßpöhler lebt mit ihrem Mann und den beiden gemeinsamen Kindern in Berlin.
Svenja
Flaßpöhler
Verzeihen
Vom Umgang
mit Schuld
Deutsche Verlags-Anstalt
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Copyright © 2016 Deutsche Verlags-Anstalt, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Büro Jorge Schmidt, München
Umschlagmotiv: © Getty Images
Typografie und Satz: DVA/Andrea Mogwitz
Gesetzt aus der Palatino Nova
ISBN 978-3-641-12519-6V001
www.dva.de
Für meine Mutter
Inhalt
Prolog: Blick in den Rückspiegel
Einleitung: Die Herausforderung des Verzeihens
Heißt verzeihen verstehen?
»Das kann man nicht verstehen!« Über extreme Lebensentscheidungen
Wille und Wahn: Die Grenzen der Schuld
Die Nora-Problematik: Das Tabu weiblicher Selbstermächtigung
Das Böse verstehen: Ein Exkurs in die Philosophiegeschichte
Der rätselhafte Andere und die Kraft der Güte
»Er wusste nicht, was er tat«: Wie eine Mutter versucht, dem Mörder ihrer Tochter zu verzeihen
Heißt verzeihen lieben?
Der liebende Blick
Emotionaler Kredit: Verzeihen als Vertrauensvorschuss
Zeig deine Reue! Zur Logik der Gegengabe
Bedingungsloser Schuldenschnitt: Die »Andere Ökonomie«
Der göttliche Ruf von oben
Unproduktive Verausgabung: Die Verrücktheit des Verzeihens
Geschenktes Leben: Was schulden Kinder ihren Eltern?
Schuld und Liebe: Besuch im Bibelkreis der JVA Tegel
Heißt verzeihen vergessen?
Aktives Vergessen
Was mich nicht umbringt, macht mich stärker?
Absinken in die Bedeutungslosigkeit: Vergessen durch Erinnern
Ist Schuld vererbbar?
Allen Nazis sei vergeben: Die Selbstheilung der Eva Mozes Kor
Frieden stiften durch »Nicht-Erinnern«: Die Amnestie
Christliche Rhetorik auf falschem Feld? Zur Politik der Vergebung
Auf ewig unverzeihbar: Über metaphysische Schuld
Wenn Wunden nicht heilen: Ein Gespräch mit zwei Überlebenden der Shoah
Epilog: Das offene Tor
Dank
Anmerkungen
Literatur
Prolog: Blick in den Rückspiegel
Äußerlich alles wie immer. Der Tisch mit der Wachstuchdecke, braun-weiß gemustert, fünf Stühle, die gelb gestrichenen Wände, auf dem Herd der lila Aufkleber mit der Frauenpowerfaust. Ich stehe in der Küche, lausche. Meine Schwestern haben sich ins Obergeschoss zurückgezogen, mein Stiefvater in sein Arbeitszimmer, zu hören ist nur das Klappern von Kleiderbügeln an der Garderobe. Das Gepäck meiner Mutter ist schon im Auto, ihr sonstiges Hab und Gut längst in ihr neues Heim verfrachtet, jetzt fehlt nur noch sie selbst. Für den bevorstehenden Abschied gibt es kein Ritual, keine eingeübte Kulturtechnik, kein Skript, und so geht sie an mir vorbei, wortlos. Ein Luftzug, der vertraute Geruch, dem ich automatisch quer durch die Küche folge. Ich trete in den Garten, sehe meine Mutter, wie sie die Abkürzung über den Rasen nimmt. Ich folge ihr nicht, bleibe unter dem Vordach unseres Hauses stehen, beobachte aus der Ferne, wie sie in ihren Wagen steigt. Ein blauer Datsun, seltsamerweise weiß ich die Marke noch heute. Der Motor springt an. Das Gartentor ist offen, die Straße frei. Der Blick meiner Mutter geht in den Rückspiegel.
*
Ich war 14, als meine Mutter ging. Der Mann, Anlass ihres Weggangs, wurde wenig später ihr dritter Ehemann. Zur Hochzeit eingeladen wurden wir Kinder nicht. Die anfänglichen Versuche, uns zu besuchen, endeten immer im Streit (meine Mutter, wie sie mit dem Zeigefinger über die verstaubte Küchenlampe fährt, wie sie meinem Stiefvater vorwirft, sich nicht zu kümmern etc.) und hörten bald auf. Hin und wieder fuhr ich zu ihr, sah ihr neues Leben: Das Haus, den Mann, das Baby, dem bald ein zweites folgen sollte. Später, sehr viel später, ich lebte schon in Berlin, schrieb ich eine Geschichte, in der meine sechs Jahre jüngere Halbschwester und ich nachts in das neue Haus meiner Mutter eindringen. Anfänglich wirkt es, als wollten wir die ganze Familie, zumindest aber unsere Mutter töten, doch stattdessen hängen wir uns beide im Dachstuhl auf.
Ich habe meine Mutter nie offensiv zur Rede gestellt, sie nie offen gehasst. Dennoch gab es, geboren aus meiner Ohnmacht ihr gegenüber, den tiefen Wunsch, dass sie irgendwann bestraft wird. Dass sich, wenn schon nicht ich, wenigstens der Weltgeist an ihr rächt.
Manchmal vergingen Jahre, ohne dass ich sie gesehen oder mit ihr gesprochen habe. Wenn überhaupt geschahen die Treffen unfreiwillig auf Familienfesten. Der stille Wunsch aber, von ihr eine Erklärung zu bekommen, gar ein Wort des Bedauerns zu hören, lebte fort, überdauerte mein gesamtes Studium in Münster, der Stadt, in der ich geboren wurde und aus der ich, als ich mein Examen erhalten hatte, regelrecht floh.
Erst in Berlin habe ich die Hoffnung auf ein an meine Mutter geknüpftes Heil irgendwann, wie es so schön heißt, fahren gelassen. Anstatt mich weiter auf sie zu fixieren, radelte ich drei Mal die Woche quer durch Berlin zu Frau F., legte mich auf ihre lederne Couch, fünf Jahre lang. Der graue Schleier, der für mich bis dahin unauflöslich zur Welt gehört hatte, lichtete sich; die Nächte, in denen ich auf Selbstzerstörungskurs allein durch die Stadt zog, wurden seltener. Meinen Mann lernte ich kennen, als die Analyse gerade begonnen hatte. Als sie auf ihr Ende zuging, wurde ich schwanger.
Ich weiß nicht mehr, wie meine Mutter von meiner Schwangerschaft erfuhr: Von ihrer Mutter, meiner Großmutter, oder von mir selbst. Sicher ist, dass mein Wunsch, mich meiner Mutter mitzuteilen, größer wurde, je stärker ich das Baby in mir spürte. Die kleinen Schmetterlingsschläge, später dann die deutlichen Tritte hatte auch sie gefühlt, als sie mit mir schwanger war. Ich tauschte mich mit ihr am Telefon aus. Dann wurde unsere Tochter geboren. Tage und Wochen verflogen. Meine Mutter kam nicht. Monate vergingen. Meine Mutter kam nicht. Irgendwann telefonierten wir auch nicht mehr. Zum ersten Mal gesehen hat sie ihre Enkelin, zu diesem Zeitpunkt fast ein Jahr alt, auf der Beerdigung meines Großvaters. Ein Blick in den Kinderwagen; mehr gab die Situation nicht her.
Die Abwesenheit meiner Mutter war jedoch nur äußerlich. Denn: Es gibt kaum ein Ereignis, das einen Menschen so unwiederbringlich auf seine Herkunft zurückwirft wie die Geburt eines eigenen Kindes. Als ich selbst Mutter wurde, fühlte ich meine Mutter in mir wie einen Geist, den ich doch längst in seine Flasche zurückgesperrt zu haben glaubte. Wenn ich mit meiner Tochter sprach, erklang aus mir ihre Stimme. Wenn ich sie wickelte, sah ich ihre Hände an meinen Armen. Die plötzliche und notgedrungene Identifikation rief verstörende Fragen in mir wach: Werde ich meine Vergangenheit jemals los? Ist eine solche Befreiung überhaupt je möglich, und wenn ja, bis zu welchem Grade? Kann ich mich tatsächlich von meiner Mutter lossagen? Die Herkunft hinter mir lassen wie einen beschwerlichen Sandsack? Wie kann ich verhindern, dass ich mein Leid auf mein Kind übertrage? Ja, und dies ist ein Gedanke, den ich gar nicht denken will, den ich sogleich erschrocken von mir weise, wenn er mir kommt: Könnte es sein, dass ich – trotz oder vielleicht sogar wegen meines unbedingten Wunsches, nie dieselben Fehler zu wiederholen – eines Tages ähnlich agiere wie meine Mutter? Diese Angst ist nicht grundlos. Immerhin zeigt sich allenthalben, in individuellen Biographien genauso wie im großen Lauf der Geschichte, wie insistierend schmerzhafte Erfahrungen sein können. In Form der Rache, eines diffusen Schuldgefühls oder der Depression schreibt sich der Schmerz ein Leben lang fort und in die Körper der Nachgeborenen ein; ja, bisweilen entsteht sogar der Eindruck, als akkumulierte sich das Leid nachgerade, ähnlich einem Schuldenberg, der von Generation zu Generation immer größer wird.
Vier Jahre vergingen. Jahre, in denen ich andere Mütter mit ihren Müttern auf Spielplätzen sah, Großmütter, die ihre Enkel mit leuchtenden Augen anschaukelten, ihnen beim Rutschen zuschauten, die Schuhe banden. Jahre, in denen ich erkannte, wie schlechterdings unmöglich es ist, sich aus der Genealogie, dem eigenen Gewordensein herauszunehmen wie aus einem schlechten Film. Im Sommer 2012, meine Mutter und ihr dritter Mann hatten sich inzwischen getrennt, nahm ich den Kontakt – fast beiläufig, wie mir rückblickend scheint – wieder auf. Dass ich beruflich in ihrer Nähe zu tun hätte, schrieb ich ihr in einer E-Mail. Ob wir uns nicht treffen könnten? Am vereinbarten Tag erwartete ich sie auf einem Parkplatz unweit des Kölner Doms. Als ich meine Mutter von Ferne aus dem Auto steigen sah, schlug mir das Herz bis zum Hals. Sie ging auf mich zu, dann drehte sie abrupt um: Sie hatte vergessen, Geld in den Parkautomaten zu werfen. Noch im selben Augenblick entschuldigte ich innerlich ihr Verhalten: Dass sie nicht als Erstes auf mich zulief, mich umarmte, war keine Böswilligkeit, noch nicht einmal Gedankenlosigkeit, sondern ihr mir nur allzu bekanntes Pflichtbewusstsein, die andere Seite ihrer Explosivität. Bis der Schein ordnungsgemäß hinter der Windschutzscheibe platziert war, dauerte es ein paar Minuten, in denen ich nicht wusste, wohin mit mir.
Ich habe sie seitdem nicht oft gesehen. Wenn ich sie treffe, sehe ich eine Frau um die sechzig, die unbezweifelbar meine Mutter ist. Ich sehe ihr Gesicht, ihre Lippen, ihre Hände, ich sehe unsere Ähnlichkeit. Wir sprechen, wenn wir uns treffen, nie über das Gewesene. Stattdessen reden wir über unsere Arbeit, über Politik, die Welt. Meine Mutter ist eine lebendige, wache Gesprächspartnerin. Das war sie schon immer. Wenn ich mit ihr spreche, vergesse ich die Zeit.
*
Meine Halbschwester fragt mich oft, warum ich unsere Mutter eigentlich sehen will. Ich sage dann: Weil sie irgendwann sterben wird. Weil sie unsere Mutter ist. Weil ich mir nach ihrem Tod nicht vorwerfen möchte, die Zeit, die mir noch mit ihr geblieben wäre, nicht genutzt zu haben.
Also erwartest du noch etwas von ihr?, fragt meine Schwester.
Nein, antworte ich. Sie kann mich nicht mehr verletzen. Ich erwarte nichts. Weder eine Erklärung noch eine Entschuldigung.
Du hast ihr also verziehen? Meine Schwester bemüht sich, die Frage lässig und beiläufig klingen zu lassen.
Ich weiß nicht, was ich sagen soll.
Verzeihen. Ein großes Wort.
Einleitung: Die Herausforderung des Verzeihens
Dieses Buch ist der Versuch, das Verzeihen zu verstehen und auszuloten bis an seine Grenzen. Wer verzeiht, handelt weder gerecht noch ökonomisch, noch logisch. Verzeihen bedeutet dem Wort nach: Verzicht auf Vergeltung. Verzicht auf Wiedergutmachung. Der Verzeihende fordert nicht, was ihm eigentlich zusteht. Er lässt ab, entsagt, hört auf zu »zeihen«, das heißt zu benennen, bekannt zu machen.1 Das ewige Zeigen auf die Wunde, das Bezichtigen eines Anderen, findet mit dem Verzeihen ein Ende. Damit vollzieht sich das Verzeihen jenseits des Gesetzes, das unser Leben fundamental bestimmt. Dieses Gesetz lautet: Wer Schuld hat, muss zahlen. Je höher die Schuld ist, desto höher auch der Betrag. Das Fatale an der moralischen Schuld ist, dass sie nicht auf dieselbe Weise abgeleistet werden kann wie rechtliche Schuld oder ökonomische Schulden. Ja, je schwerer die moralische Schuld wiegt, desto weniger scheint sie vom Schuldigen beglichen werden zu können. Sie währt weiter, klebt gleichsam an ihm.
Das Christentum hat für dieses Problem das Ritual der Beichte erfunden: Durch die Absolution, so besagt das lateinische Wort absolvere, löst sich der Täter von der Schuld. Aber auf welche Weise vermögen Menschen einander zu ent-schuldigen, wenn sie das Gegenüber nicht von Schuld freisprechen können wie Priester einen Sünder im Beichtstuhl? Menschen können Schuld nicht wie von Zauberhand abnehmen, sie können sich nur zu ihr verhalten. Der Begriff des Verzeihens trägt dieser Einschränkung Rechnung: Die Schuld des Täters bleibt bestehen; verzichtet wird lediglich auf ihre Begleichung.
Verzicht oder Gabe?
Diese passive Dimension des Verzichts, des Nichttuns, des Lassenkönnens ist für das Verzeihen wesentlich. In dieser Hinsicht steht es in einem eigentümlichen Gegensatz zum religiös konnotierten Begriff des ›Vergebens‹. Obschon beide Wörter zumeist synonym verwendet werden – auch und gerade in Übersetzungen, denn etwa im Französischen und Englischen existiert für ›Verzeihen‹ und ›Vergeben‹ jeweils nur ein Begriff –, ist es hilfreich, sich den Unterschied zu vergegenwärtigen. Das wesentliche Moment des ›Vergebens‹ ist nicht der Verzicht, sondern die Gabe. Auch im französischen pardon und im englischen forgive ist sie enthalten: Dem Vergeben, meint der französische Philosoph Paul Ricœur, wohnt ein Überschuss inne, der diesen Akt klar vom kalkulierten Tauschgeschäft unterscheidet: Wer vergibt, schielt nicht auf eine exakt bemessene Gegengabe. Vielmehr ist das Vergeben ein Akt des Schenkens, der, wenn er gelingen soll, auf die Tugend der Bescheidenheit auf Seiten des Beschenkten genauso angewiesen ist wie auf die Tugend des Großmuts auf Seiten des Schenkenden. Opfer und Täter kommen zusammen in einem extraordinären, feierlichen, man möchte fast sagen göttlichen Akt, den die Theologin Beate Weingardt als einen genuin »schöpferischen Vorgang« beschreibt. »Im Wort Vergebung«, so Weingardt, werde »das Negative des Verzichts«, das dem Verzeihen innewohnt, »in das Positive des Gebens gewendet« – für Weingardt ein entscheidender Grund für das »höhere moralische Gewicht« des Vergebens.2
In der Tat klingt das Wort »Verzeihen« im Gegensatz zum »Vergeben« auffällig alltäglich. Schließlich bitten wir nicht nur in existenziellen Situationen, sondern bei allen möglichen Gelegenheiten (Zuspätkommen, kleinen Kränkungen etc.) um Verzeihung – aber um Vergebung? Wenn ein Mensch zum anderen sagte »Vergib mir«: Verliehe er ihm damit nicht automatisch eine nachgerade göttliche Macht?
Und doch ist das Verzeihen, nur weil es weltlich ist und bisweilen floskelhaft verwendet wird, keineswegs notwendigerweise von niederem moralischen Wert – im Gegenteil. Um Verzeihung bitten wir einen anderen Menschen, um Vergebung hingegen vor allem religiöse Würdenträger oder Gott selbst. Anstatt den Begriff des Verzeihens also für philosophisch irrelevant zu erklären, geht es vielmehr darum, das Wort freizuschälen vom floskelhaften Gebrauch – und herauszuarbeiten, inwiefern nicht nur die Gabe, sondern auch der Verzicht eine Geste der Transzendenz sein kann. Tatsächlich besteht ja die außerordentliche Leistung des Verzeihenden darin, sich eines Impulses, eines Affektes, eines emotionalen Automatismus zu erwehren: Anstatt sich dem Rachedurst oder dem verbitterten Wunsch nach Wiedergutmachung hinzugeben, übt er sich in Zurückhaltung. Anders formuliert: Der Verzicht auf die Lust, erfahrenes Leid heimzuzahlen beziehungsweise in Rechnung zu stellen, ist sein Geschenk, seine Gabe.
Genau an diesem Punkt berühren sich die Begriffe des Vergebens und des Verzeihens: Der Nicht-Akt des Verzichts geht über in den Akt des Gebens; und auch umgekehrt ist das (göttliche) Vergeben vom Verzicht nie ganz zu trennen. Der so genannte ›Ab-Lass‹ etwa offenbart diese Untrennbarkeit ganz buchstäblich: »Bis in die Neuzeit hinein wurde die Sündenvergebung als Ablaß gedacht: als Tugend der Passivität, die einem gleichwohl strengen und gerechten Gott zugeschrieben werden durfte«, so der Kulturhistoriker Thomas Macho. »Die Gottheit verzeiht, indem sie von einer Verfolgung der Missetaten abläßt.«3 Das Verzeihen vom Vergeben dogmatisch abzugrenzen wäre folglich verfehlt; ganz abgesehen von dem Fakt, dass in anderen Sprachen nicht zwischen Vergeben und Verzeihen unterschieden wird, was zu unlösbaren Übersetzungsschwierigkeiten führt. Und so lässt es sich auch nicht vermeiden, dass in der vorliegenden Abhandlung beide Begriffe Verwendung finden; wenn etwa Hannah Arendt vornehmlich von »Vergebung« spricht, werde ich mich, wenn ich mich auf Arendt beziehe, ihren Gebrauch übernehmen. Dass ich für den Titel meines Buches jedoch den Begriff des Verzeihens gewählt habe, findet seinen Grund in seiner benannten Weltlichkeit: Mir geht es um Entschuldungsprozesse zwischen Menschen, um dezidiert diesseitige Akte des Schulderlasses, die gleichwohl, wie wir sehen werden, immer wieder ins Transzendente, Übermenschliche ausgreifen.
Der Ruf des Unverzeihbaren
Das profane Verzeihen vollziehen wir jeden Tag ohne groß darüber nachzudenken: »Verzeihung«, sagt der höfliche Mensch in der U-Bahn, wenn er aus Versehen jemanden anrempelt oder ihm auf den Fuß tritt. So gering ist die Schuld desjenigen, der um Verzeihung bittet, dass es im Grunde gar nichts zu verzeihen gibt. Das wahre, das wahrhaftige Verzeihen, auf das es ankommt und das hier im Mittelpunkt steht, stellt sich nur angesichts großer, ja größter Schuld. »Man muß, so scheint mir, von der Tatsache ausgehen, dass es, nun ja, Unverzeihbares gibt«, so der französische Philosoph Jacques Derrida. »Ist es nicht eigentlich das einzige, was es zu verzeihen gibt? Das einzige, was nach Verzeihung ruft?«4
ENDE DER LESEPROBE