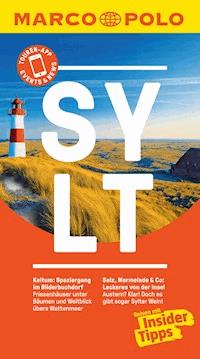19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Dörlemann eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Als Sönnich Petersen stirbt, ist niemand im Dorf am Watt traurig, am wenigsten seine Tochter Helma. Er war ein liebevoller Vater, der Krieg hatte ihn hart gemacht. Sein Tod fällt in eine Zeit, in der der aufkommende Tourismus neue Menschen und Gebräuche mit sich bringt. Immer mehr Inselbewohner wollen am Wohlstand teilhaben, auch Helma vermietet bald an Badegäste. Doch da ist noch etwas, was sie beschäftigt: Über ihre früh verstorbene Mutter wurde immer eisern geschwiegen. Auch um die Mutter ihres Kindheitsfreundes Rudi gibt es ein Geheimnis, sie wurde während des Krieges abgeholt und kam nie zurück. Wie konnten die Frauen einfach so verschwinden? Warum fragte niemand nach ihnen? Die Suche nach Klarheit führt Helma und Rudi in die dunkelsten Kapitel der Geschichte ihrer Insel.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 452
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Silke von Bremen
Stumme Zeit
Roman
Dörlemann
Die Personen und Ereignisse dieses Romans sind fiktiv. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen wären zufällig. 2. Auflage 2024 Alle Rechte vorbehalten © 2024 Dörlemann Verlag AG, Zürich Umschlaggestaltung: Mike Bierwolf Gemälde auf dem Umschlag: Julia Küchmeister, St. Severin mit Kornfeld Keitum Sylt, 30 × 60 cm, Öl. Satz und eBook-Umsetzung: Dörlemann Satz, Lemförde ISBN 978-3-03820-896-9www.doerlemann.ch
Inhalt
Dieses Buch ist meinen Müttern gewidmet:
Gisela
Elke
Meta
Hanna
History is not the past, it is the present.
We carry our history with us.
We are history.
James Baldwin
Der Himmel hatte seit Tagen das undefinierbare Grau eines alten Feudels. Aber am Morgen frischte der Wind auf, zerriss den himmlischen Putzlappen und jagte bald darauf große, kompakte Wolken über die Insel.
Helma lebte lange genug in ihrem Elternhaus, um zu wissen, dass es gleich wieder losgehen würde. Diesem jaulenden Pfeifton, der zuverlässig immer dann durch ihr altes Haus zog, kurz bevor der Wind auf Nordwest umschlug, war einfach nicht beizukommen.
Er ging ihr durch Mark und Bein. Das Schlimmste daran war, dass dieses unerträgliche Geräusch von ihr selbst Besitz ergriff. Reflexartig wurde ihre eigene Atmung flacher, der Ton schlug ihr auf die Lunge, und sie wusste, es war das Klügste, wenn sie das Weite suchte. Vielleicht war es auch das Haus selbst, das aus dem letzten Loch pfiff. Wie ein Asthmakranker schien es nach Luft zu ringen, während draußen der Wind an den Türen und Fenstern rüttelte.
Das Beste war, einfach selbst rauszugehen, sich dem Wind zu stellen. Sie hätte dieses Gefühl, das ihr den Brustkorb zuschnürte, nicht einmal schildern können. Und unerfreulicherweise ging es jedes Mal einher mit der Stimme ihres verstorbenen Vaters, den sie sagen hörte: »Riet di tosamen.« Reiß dich zusammen.
Dieser Stimme war ebenfalls kaum beizukommen, sie saß in ihrem Innersten und kommentierte ungefragt all ihr Tun und Handeln. Wenn es dafür einen Knopf gegeben hätte, hätte Helma ihn lieber gestern als heute auf »Aus« gedreht.
Sie zog sich ihren Wollmantel an. Er hatte schon bessere Zeiten gesehen. Das Garn hatte am Bund und an den Unterarmen kleine Knötchen gebildet. Die meisten Knöpfe saßen locker, hingen wie gesenkte Köpfe nach unten und zeigten damit offenherzig die verschiedensten Fäden, mit denen sie immer wieder angenäht worden waren. Der Kragen des Mantels war, obwohl sie keine Cremes oder Make-up benutzte, speckig, was auch die braune Farbe des Wollstoffs nicht mehr kaschieren konnte.
So ganz passten sie nicht mehr zusammen, sie und ihr Mantel, der sie seit vielen Jahren begleitete. In dem sie sich aber so wohlfühlte, dass sie ihn eher bewohnte, als ihn zu tragen. Doch sie war dünner geworden, der Stoff umspielte ihre schlanke Figur nicht mehr, sondern schlotterte um ihren Körper. Sie sollte sich angewöhnen, sagte sie sich, einen dicken Pullover unter dem Mantel zu tragen.
Helma knotete sich den grauen Strickschal um ihren schlanken Hals und trat aus der hinteren Klöntür, um auf der windabgewandten Seite nach draußen zu kommen. Wenn sie zurückkehrte, würde sich ihr Elternhaus, das seit über zweihundert Jahren die härtesten Stürme abwetterte, von der Atemnot erholt haben.
Die großen Bäume, die noch Teile ihres Laubes trugen, wurden vom Wind kräftig geschüttelt. Er wollte wie jedes Jahr nackte Äste schaffen. Die Blätter flogen durch den Garten, um wirbelnd im Windschatten zwischen Haus und Stall ein paar Kreise zu ziehen und dann auf dem mit kleinen Feldsteinen gepflasterten Boden liegen zu bleiben. Missmutig schaute Helma auf die vor ihre liegende Arbeit, bevor sie auf die schmale Straße trat.
Noch vor einigen Jahren war es ein einfacher Sandweg gewesen, der direkt an ihrem Wall vorbeiführte. Lediglich dieser alte Steinwall und ein Stück Garten standen zwischen dem Weg, der vom Dorf zur Kirche führte, und ihrem Haus, dessen schmale Westseite zur Straße zeigte. Vor der langen Südwand, hinter deren Fenster sich seit eh und je die Wohnräume befanden und auch der Haupteingang ihres Hauses, lag ein einfaches Rasenstück, bestanden mit zwei großen Ulmen. Die alte Hauswand war mit Backsteinen und Muschelkalk aufgemauert. Wenn die Sonne auf die Wand schien, leuchteten die Steine in den verschiedensten Rottönen und wurden nur unterbrochen von regelmäßig gesetzten Kopfsteinen, die einen eigenwilligen dunklen Grünschimmer besaßen, wie man es bei anderen Häusern im Dorf nur selten fand. An ihrem Haus fanden sich links und rechts des Eingangs sogar Rautenmuster aus diesen Steinen, die sich im Giebel über der Tür noch einmal wiederholten. Was immer sich der frühere Baumeister dabei gedacht hatte, Helma gefiel es, dass sich ihr Haus dadurch von den anderen abhob. Der Wind schob sie förmlich vor sich her. Den Weg zur Kirche, der leicht anstieg, hätte sie blind zurücklegen können, er war ihr ein fast tägliches Ritual geworden. Um diese Tageszeit konnte sie damit rechnen, niemandem mehr zu begegnen. Die Saison war zu Ende, das Dorf hatte sich geleert und die Einheimischen hatten wenig Grund, bei aufkommendem Sturm vor die Haustür zu gehen. Es sei denn, man lebte in einem Haus, das offensichtlich Asthma hatte.
Die Kirchenpforte schwang im Wind hin und her und gab dabei einen leicht wimmernden Ton von sich. Helma musste sie nur anstoßen, um auf den Friedhof zu treten.
Familienbesuche nannte sie diese Spaziergänge. Ihre Familie schien auf die Welt gekommen zu sein, um diesen Friedhof zu bevölkern. Aber auch hier war die alte Ordnung durcheinandergeraten. Als Gunther Straubing, ein Zugezogener, auf den Friedhof ziehen musste, bekam er einen Platz direkt neben dem Eingang der Kirche.
Das war Helma wie ein Menetekel vorgekommen. Jahrhundertelang war es Sitte gewesen, dass um die Kirche herum die alten Familien des Dorfes lagen. Brodersen, Petersen, Johannsen, Nielsen, Janssen, Erken, Friedrichsen, Paulsen.
Die Wischkowskis, Tscherwonkas, Krokowiaks, Gniffkes, Zuntrums, Kruschkes, Milkereits und Straubings hatten am äußeren Rand zu liegen. Dort hätte er hingehört. Aber der neue Pastor wusste nichts von den alten Traditionen. Sie hatte auch keine Lust, ihm das zu verklaren. Er würde sowieso bald weiterziehen. Sollte er hier überraschend sterben, würde er in die äußere Reihe gehören. Aber was sich gehörte, wussten nur noch wenige.
Eine Haarsträhne hatte sich aus ihrem kräftigen, dunkelblonden Dutt im Nacken gelöst und tanzte vor ihrer Nase herum. Die Taschen ihres alten Mantels waren glücklicherweise ein Quell an Schätzen und Fundstücken, die sich im Laufe der Zeit dort angesammelt hatten. Das Klemmchen war zwar schon verbogen, aber es war eines mit Rillen, das hielt viel besser. Während sie mit der einen Hand die Strähne stramm nach hinten zog, um sie zu bändigen, und mit der anderen Hand die Haarnadel unter ihre gerade gewachsenen Vorderzähne schob, um diese aufzubiegen, erinnerte sie sich daran, wie sie es letzten Winter neben einer Bank gefunden hatte. Irgendwann konnte man alles brauchen. Bei ihr kam jedenfalls nichts weg. Was manche Menschen alles so wegwarfen und liegenließen, konnte sie nicht verstehen.
Sie wechselte gerne die Wege zwischen den Friedhofsreihen, um zur Grabstelle ihrer Eltern zu kommen. Meine Güte, sah das schluderig aus. Kopfschüttelnd registrierte sie, dass Böteführs Tochter gar keine Ordnung hielt. Die Topfpflanzen waren vertrocknet, und die Grabvase war trotz Erdspieß umgefallen. So waren die Schnittblumen längst verdurstet und lagen braun und welk vor dem Grabstein. Kein Wunder, denn seit die Tochter auf dem Festland wohnte, kam sie kaum noch auf die Insel. Aber auf dem Friedhof nicht für Ordnung zu sorgen, nein, das gehörte sich in Helmas Augen nicht.
Sie selbst hatte letztes Mal Herbstastern eingepflanzt. Die waren nun auch braun geworden, aber für Tannenzweige und Weihnachtsgestecke war es noch viel zu früh.
Die große Grabplatte ihrer Familie war aus hellem Sandstein und so hoch, dass man sie trotz Hecken und Büschen schon aus der Ferne sehen konnte. Aufgestellt vom Erbauer ihres Hauses, der sicher auch für die Inschrift verantwortlich war: »Mit Gott fang du die Arbeit an, mit Gott sie auch vollende, wer seine Pflicht hat treu getan, der freue sich am Ende.« Warum er sich gerade für diesen Spruch entschieden hatte, wusste keiner mehr. Aber er schien für ihre Familie wie gemacht zu sein, Pflichterfüllung war keine Option, sondern Gesetz im Hause Petersen.
Als der alte Grabstein auch auf der Rückseite keinen neuen Namen mehr fassen konnte, hatte ihr Vater einen neuen Stein aufstellen lassen. Helma hatte keinerlei Erinnerung an ihre Mutter Karen, die hier seit knapp vierzig Jahren lag, weil sie die Geburt ihrer Tochter nicht überlebt hatte.
Oma Gondel war der zweite Name auf dem neuen Stein. Und ihr Vater ließ damals, wenn man schon mal dabei war, auch gleich den Namen seines Bruders Uwe, an den Helma sich kaum erinnerte, in den Stein schlagen.
Oma Gondel hatte die Vermisstenmeldung offenbar bis zum Schluss als Versprechen genommen, ihr Zweitgeborener würde irgendwann aus diesem letzten Krieg wieder heimkehren. Mit dieser Hoffnung hatte sie bis an ihr eigenes Ende gelebt, und Helma hoffte, dass sie ihren Uwe oben im Himmel wiedergefunden hatte.
Karen Petersen geb. Peters
7. 4. 1904 – 7. 3. 1936
Uwe Petersen
25. 5. 1906 – seit 1944
vermisst in Frankreich
Gondel Petersen geb. Nissen
6. 6. 1883 – 26. 2. 1955
Sönnich Petersen
22. 8. 1903 – 9. 12. 1970
Der Familiengrabstein musste nur noch für ihren Namen reichen. Danach kam niemand mehr.
Wenn sie nicht den Fehler gemacht hätte, Frank Godbersen zu heiraten, hätte dort später einmal ihr eigentlicher Name gestanden: Helma Petersen. Frank Godbersen war Schnee von gestern, zum Glück hatte sie noch die Kurve gekriegt. Aber der Ärger über diesen Ausrutscher in ihrem Leben blieb. Am besten gar nicht dran denken.
»Helma Sönnichsen« hatte der alte Nachbar sie immer gerufen. Das hatte ihr gefallen. Aber die Zeiten, in denen die Kinder als Nachnamen den Vornamen des Vaters erhielten, waren so lange vorbei, wie ihr Haus alt war.
Jedes Mal, wenn sie am Grab ihres Vaters stand, musste sie an Willy Brandt denken, dessen uneheliche Geburt allein schon Grund genug für Sönnich Petersen gewesen war, alles abzulehnen, was der Bundeskanzler von sich gab. Im Hause Petersen hieß er weiterhin Herbert Frahm, wenn man über den feigen Sozi redete, der sich den Namen Brandt erst in Norwegen zugelegt hatte, wohin er sich abgesetzt hatte, statt wie jeder anständige Deutsche für das Vaterland zu kämpfen.
Die Frage, ob ihr Vater wohl länger gelebt hätte ohne ihr Geschenk, den Fernseher, stellte sie sich nach fünf Jahren nicht mehr, aber ein paar Zweifel waren geblieben. Ihr Entschluss, er solle die nächste Fußballweltmeisterschaft in Mexiko nicht mehr nur im Radio verfolgen, war doch gut gemeint gewesen.
Aber danach war Sönnich Petersens Leben nicht mehr das alte. Er verbrachte jeden Abend vor dem neuen Guckkasten, wie man die Fernseher im Dorf damals nannte. Es sei denn, er spielte mit seinem alten Kameraden Willi Krüger, ihrem ehemaligen Turnlehrer, in der Dorfkneipe »Tante Gerda« Skat.
Er war nun dabei, als Thor Heyerdahl glücklich mit seiner Ra II auf der anderen Seite des Atlantiks landete, betrauerte den Tod von Grethe Weiser, kommentierte fachkundig den Vietnamkrieg und erlebte im November die erste Ausstrahlung einer Krimiserie, die Tatort hieß. Und dann begann die Adventszeit. Helma hatte Tannengrün geschnitten und aus dem alten Strohkranz, der dafür jedes Jahr vom Boden geholt wurde, einen Adventskranz gebastelt. Im Dorfladen hatte es sogar noch passende rote Kerzen gegeben, von denen an jenem Abend zwei brannten.
Sie hatte es sich auf dem alten, durchgesessenen Sofa gemütlich gemacht, auf dem jede Menge Kissen lagen, damit man nicht direkt auf den Sprungfedern saß. Neben ihr stand der ausklappbare Nähkasten mit den Stopfsachen. Ausbessern war nicht ihre Stärke, aber außer ihr gab es niemanden mehr im Haus, der sich um dünn gewordene Handtücher oder Kopfkissen kümmerte. Sie war von den vielen Frauen, die einst im Haus lebten, als Einzige übriggeblieben. Und es gab nur wenige Momente, in denen es ihr seltsam vorkam, dass über ihre Mutter, Großmütter und Urgroßmütter selten geredet wurde. Sie hatten ihren Platz in der Familie, aber niemand holte sie durch Erzählungen und Austausch von Erinnerungen in die Welt der noch Lebenden. Ihr Vater sprach nicht über seine Mutter Gondel und schon gar nicht über ihre Mutter Karen. Mit deren Beerdigungen war scheinbar gleich alles mit vergraben worden.
Dass der Abend eine theaterreife Wendung nehmen würde, war durch nichts vorherzusehen gewesen. Als die Tagesschau begann, hatte sie gerade den Faden durch die Nadel gezogen. An diesem Abend des 7. Dezembers wurde gleich im ersten Beitrag von Willy Brandts Reise nach Warschau berichtet. Als die Bilder seines Kniefalls über den Schirm flackerten, brauchte es nur Sekunden, um in Petersens Pesel den längst verlorenen Zweiten Weltkrieg erneut ausbrechen zu lassen.
Das erste Geschoss war das Holzbrett, auf dem noch Schwarzbrot belegt mit Mettwurst vom Abendbrot lag. Ihr Vater wischte alles mit einer einzigen, kräftigen Bewegung vom Tisch, so dass es bis zum Fenster flog. Dann griff er sich die halbvolle Bierflasche und schleuderte sie, schneller als Helma gucken konnte, mit voller Wucht an die Wand. Dem dumpfen Knall und fliegenden Splittern folgte der eklige Geruch von ausgelaufenem Bier. Gleichzeitig brüllte Sönnich Petersen in rasender Wut alles in Richtung Fernseher, was er an Schimpfwörtern auf Lager hatte. Eine Palette an Flüchen, Beleidigungen und verbalen Entgleisungen, die einen ganzen Wehrmachtstornister hätte füllen können.
Helma hatte instinktiv den Adventskranz an sich gerissen, um ihn aus der Gefahrenzone zu bringen, während Sönnich Petersen unvermittelt vom Sessel aufsprang. Sie registrierte sprachlos, wie ihr Vater, der sich sonst nur noch schwerfällig bewegen konnte, wie eine jüngere Ausgabe seiner selbst auf den Fernseher zustürzte, um ihn mit seinen Fäusten zu bearbeiten. Dabei bespuckte er gleichzeitig die Mattscheibe, auf der mittlerweile aber nur noch der Sprecher Lothar Dombrowski zu sehen war, der nun wirklich gar nichts mit all dem zu tun hatte, was ihren Vater um seine Fassung brachte.
»Dieser Drecksack verrät alles, wofür wir gekämpft haben. Wir haben in Warschau aufgeräumt, und dieser Bankert, dieser Bastard Frahm kriecht den Polacken in den Arsch.«
Sönnich Petersen war ein schweres Gewitter auf zwei Beinen, das sich in einer gewaltigen Explosion entlud. Und dann zusammenbrach. Ihr Vater lag plötzlich am Boden und rang nach Luft. Helma, die sich nicht zu helfen wusste, wollte Hilfe holen. Doch sie hatte die Situation unterschätzt, seine Kraft reichte noch aus, sie anzubrüllen, sie solle sich gefälligst zusammenreißen, es wäre ja noch schöner, wenn dieser Hurensohn ihn auch noch Geld kosten würde. Er verbat sich einen Arzt, Krankenwagen, die Feuerwehr oder wen man sonst in so einem Fall rufen würde.
Helma hatte es irgendwie geschafft, ihn wieder in den Sessel zu hieven, und sich anschließend in die Küche verzogen, um aus seinem Blickfeld zu kommen. Später hörte sie ihn ins Bett poltern. Erst danach traute sie sich wieder in die Stube, um Ordnung zu machen. Zum Glück hatte die neue Mode, Tapeten über die Fliesen zu kleben, vor den Wänden des alten Pesels Halt gemacht. Von der glasierten Oberfläche konnte sie die klebrigen Bierreste leicht abwischen. Das meiste war sowieso durch die Ritzen der Holzbohlen versickert, unter denen Gott sei Dank nur gebrannter Sand lag. Sie schüttete Essig hinterher, in der Hoffnung, dass es am nächsten Morgen nicht wie in einer Kneipe riechen würde.
Was für ein Abend! Wenn ihr Vater ausrastete, das hatte Helma in den letzten Jahrzehnten gelernt, musste man sich in Sicherheit bringen. Alles andere war verlorene Liebesmüh. Seine Wutanfälle waren legendär, und es gab wohl niemanden im näheren Umfeld, der mit ihnen noch keine Bekanntschaft gemacht hatte.
Nachdem alles aufgeräumt war, der Adventskranz wieder auf dem Tisch stand und der Pesel so aussah, als wenn Brandt in Bonn geblieben wäre, war sie ins Bett gegangen, ohne dem Vorfall noch irgendeine Bedeutung beizumessen.
Der nächste Morgen startete mit einer Überraschung. Sönnich Petersen, der fast jeden Tag gnadderig durchs Leben zog, war ungewöhnlich freundlich mit ihr. Er hatte sich bei ihr sogar für das Mittagessen bedankt, was in Helmas Erinnerung noch nie vorgekommen war. Genießen konnte sie das alles jedoch nicht, ihr war das Verhalten ihres Vaters im höchsten Maße suspekt. Sie traute diesem trügerischen Frieden nicht über den Weg und erwartete jeden Moment, dass er wieder einen Rappel bekam.
Sätze wie »Helma, ich weiß ja, dass ich mich auf dich verlassen kann«, kamen ihr einfach nur seltsam vor. Kurz kam ihr der Gedanke, ihr Vater hätte wohl doch größeren Schaden genommen und sein Gehirn wäre beim Sturz vielleicht in Mitleidenschaft gezogen worden.
Nachmittags, bevor es dunkel wurde, ging er noch einmal zur Kirche hoch und durch das Dorf. Danach verschwand er im Badezimmer, das sie erst vor zwei Jahren eingebaut hatten, und legte sich in die Badewanne. Und ohne dass er den Fernseher noch einmal anschaltete, wünschte er ihr eine gute Nacht und zog sich ins Schlafzimmer zurück. Am nächsten Morgen hörte Helma ihren Vater früh rumoren, als es aber wieder still wurde, war sie sich sicher, dass er sich wieder hingelegt hatte.
Als er um sieben Uhr nicht am Frühstückstisch saß, wusste Helma sofort, dass etwas passiert war. Aber auf das, was in seinem Schlafzimmer auf sie wartete, war sie nicht vorbereitet.
Auf ihr vorsichtiges Klopfen gab es keine Reaktion. Daraufhin öffnete sie die Tür einen Spalt breit. Das Licht vom Flur fiel in sein Zimmer, und was sie dann im Halbdunkel sah, verstand sie zunächst nicht.
Sönnich Petersen lag auf seinem Bett und trug eine grün-grau schimmernde Uniform, an die Helma sich nur noch vage erinnerte.
Sie stieß die Tür weiter auf und sah im selben Moment die ganze Bescherung.
Es musste ihn viel Kraft gekostet haben, sich in die Montur aus dem Krieg zu zwängen, aus der sein alter Körper herausgewachsen war. Er hatte versucht, die Jacke mit dem Gürtel zusammenzuhalten, und Helma berührte es unangenehm, wie sein Bauch aus der offenen Hose quoll. Seine Füße und die unteren Hosenbeine steckten in schweren Stiefeln, die offensichtlich frisch gewichst worden waren.
Helma tastete nach dem Lichtschalter neben der Tür.
Die Schlafzimmerlampe warf ein funzeliges Licht auf Sönnich Petersen. Das eckige Koppelschloss und ein kleiner Totenkopf nebst Hoheitsadler reflektierten die matte Beleuchtung.
Die Schirmmütze war nach vorn in sein Gesicht gerutscht und auf der Nase liegen geblieben. So konnte sie von seinem Kopf, der auf die linke Seite gekippt war, nur das rasierte Kinn und den leicht geöffneten Mund sehen.
Das Rot der Hakenkreuzbinde am linken Arm leuchtete und war der einzige Farbtupfer in diesem seltsamen Arrangement. Der Arm hing über die Bettkante nach unten. Sie konnte erkennen, dass aus seiner Hand ein Buch auf den Boden gerutscht war. Der rechte Arm lag ausgestreckt auf dem Ehebett, und die Hand umklammerte seinen Ehrendolch der SS, den er früher gerne mal gezeigt hatte. Helma erinnerte sich plötzlich daran, wie er einmal die Waffe hervorgeholt hatte, als sie mit Rudi und Dietrich gespielt hatte. Am nächsten Tag hatte Rudis Vater, Heinrich, in der Küche gestanden und war so aufgeregt gewesen, dass ihm teilweise die Stimme weggeblieben war.
»Dass du es wagst … ohne dich könnte Lena noch leben …« Mehr hatte Helma nicht mitbekommen, weil Oma Gondel sie aus der Küche geschoben hatte. Aber sie hatte ihren Vater wieder mal toben hören. Danach war Rudis Vater nie wieder in ihr Haus gekommen.
Helma war ein wenig näher ans Bett getreten. Als sie vor dem Fußende des schweren Holzbettes stand, hatte sich ihr Vater noch immer nicht bewegt. Zaghaft tippte sie an eine der Stiefelspitzen. Keine Reaktion.
Sie räusperte sich vernehmlich. Immer noch Stille. Dann erst kam langsam der Moment, in dem ihr klar wurde, dass Sönnich Petersen die Entscheidung über sein Leben selbst in die Hand genommen hatte und niemals wieder toben würde.
Sie ließ sich auf den geflochtenen Wäschepuff fallen, der noch zur Aussteuer ihrer Mutter gehört hatte, und versuchte tief durchzuatmen. Aber im selben Moment brach ein Lachkrampf aus ihr hervor, der einfach nicht enden wollte. Über diesen Reflex hatte sie später lange gegrübelt, ohne eine Antwort zu finden, sie war nur froh, dass niemand Zeuge dieser überspannten Reaktion gewesen war.
Mit Bauchschmerzen von dem unpassenden Gelächter und Tränen in den Augen kam sie erst Minuten später wieder zu sich. Ihr Vater hatte sich keinen Millimeter gerührt. Er war definitiv mausetot, daran bestand jetzt wirklich kein Zweifel mehr.
Sie brauchte noch einen Moment, dann stand sie auf, strich ihren Rock glatt und beschloss, sich erst einmal einen kräftigen Kaffee zu kochen.
Was hatte ihr Vater sich dabei gedacht? Auf keinen Fall durfte irgendjemand erfahren, was Sönnich Petersen sich für seinen letzten Auftritt ausgedacht hatte. Aber ihr war auch klar, dass sie allein nicht in der Lage war, ihren Vater zu entkleiden und in eine unverfängliche Position zu bringen.
Ihr fiel nur ein einziger Mensch ein, der ihr helfen könnte.
Sollte Rudi sich über den frühen Telefonanruf gewundert haben, ließ er es sich nicht anmerken.
Der Tag war noch nicht hell, da stand er in ihrem Flur. Dass er keine großen Fragen stellte und später nie wieder über diesen Schlamassel sprach, rechnete sie ihm hoch an.
Gemeinsam versuchten sie, das Koppelschloss zu öffnen. »Meine Ehre heißt Treue«, las Helma, bevor sie den Gürtel in die alte Seekiste warf, die, seit sie denken konnte, neben dem Ehebett stand, aber immer verschlossen gewesen war. Dorthin wanderte alles wieder zurück, was offensichtlich die letzten fünfundzwanzig Jahre dort aufbewahrt worden war. Dazu gehörte auch das Liederbuch, das aufgeschlagen auf Seite neun am Boden gelegen hatte.
»Wenn alle untreu werden, so bleiben wir doch treu:
Daß immer noch auf Erden für euch ein Fähnlein sey,
Ihr Lehrer teutscher Jugend, ihr Bilder bessrer Zeit,
Ihr uns zu Männertugend, zum Liebestod geweiht.«
Helma musste nicht weiterlesen. Sie kannte das Lied zur Genüge. Wenn Sönnich Petersen guter Stimmung und Willi Krüger zu Besuch war, dauerte es keine zwei Biere und die beiden schmetterten das Lied durchs Haus. Und wenn Krüger endlich ging, sang Sönnich Petersen seinem Kameraden hinterher:
»Die Straße frei den braunen Bataillonen
Die Straße frei dem Sturmabteilungsmann!
Es schaun aufs Hakenkreuz voll Hoffnung schon Millionen
Der Tag der Freiheit und für Brot bricht an.«
Als Kind war sie sicher, dass der Sturmabteilungsmann zuständig für die Herbststürme war, die oft das Meer bis vor ihre Haustür trieb, und dass ein Allmächtiger einen Haken schlagen könne, damit das Kreuz der Sturmflut an ihnen vorüberzog.
Wann hatte sie eigentlich kapiert, was das Lied wirklich bedeutete? Helma konnte sich nicht mehr erinnern. Ihre Kindheit war voll mit Rätseln und Irrtümern, deren Auflösung erst viel später und oft zufällig geschah. Durchhalten bis zur Vergasung, der Popel in der Nase war ganz selbstverständlich ein Jude, der Furz in der Hose ein Brite, die Quäcke im Garten nichts anderes als Franzosenkraut, wenn sie sich beeilen sollte, hieß es nur Gewehr bei Fuß. Wenn es mit jemandem Schwierigkeiten gab, war die Antwort auf die Frage, was machen wir bloß, lapidar: »Ab nach Madagaskar mit ihm.« Sie hatte das alles kritiklos hingenommen. Nichts von dem begriffen, was hinter diesen Worten stand, die zu ihrer Kinderzeit wie warme Milch, Schläge, Brot und kalte Zimmer im Winter gehört hatten. Und nie ernsthaft über die mit Sicherheitsnadeln hochgesteckten leeren Hosenbeine nachgedacht, die quietschenden Prothesen, die umgeschlagenen Jackenärmel, die an Krücken humpelnden Männer, die man in allen Dörfern traf.
Die dunkle Verpackung aus Pappe, in der Sönnich Petersen die Blausäurekapsel aufbewahrt hatte, warf sie in den Ofen. Die Splitter der Glasampulle, auf die ihr Vater gebissen hatte, wischte sie, so gut es ging, mit einem Waschlappen von seinen Lippen.
Dietrich, der vor ein paar Monaten die ehemalige Praxis von Dr. Bote übernommen hatte, ließ sich nichts anmerken. Helma hatte ihm schon am Telefon erklärt, dass sie ihren Vater bereits gewaschen und fertig gemacht hatte. Sie hätte ihm sogar die Blutgruppe ihres Vaters mitteilen können, die bizarrerweise in der Innenseite seines linken Oberarms zu finden war, aber diese eintätowierte Information aus Kriegszeiten brauchte jetzt wirklich niemand mehr. Sie entschuldigte sich vorsorglich bei ihm, dass ihr erst später der Gedanke gekommen sei, ihn vorher anrufen zu müssen. Aber der Tod ihres Vaters war ja eindeutig gewesen, und so hätten sie es schon immer in diesem Haus gehalten.
Bei ihren Urgroßeltern wurde noch das Stroh verbrannt, auf dem sie in der Todesstunde gelegen hatten, um die bösen Geister zu vertreiben. Und Helma hatte kurzfristig überlegt, ob sie diesen alten Brauch vorsichtshalber wieder aufleben lassen sollte, aber im Hause Petersen waren längst Matratzen eingezogen. Man könnte sie allenfalls in drei Monaten zur Biike bringen.
Dietrich hatte nur der Form halber kurz seine Finger an Sönnich Petersens Hals gelegt und sich dann zu Helma in die Küche gesetzt. Sein Blick verriet ihr, dass sie ihm kein X für ein U vormachen konnte. Aber er spielte das Spiel mit. Wie früher. Als er neben Rudi zu ihren engsten Vertrauten gehört hatte.
»Was willst du nun machen?«, hatte er gefragt. Als sie in seine großen braunen Augen schaute, spürte sie sich an diesem Morgen erstmals wieder. Und ihr wurde schlagartig klar, warum sie Dietrich in den letzten Monaten ausgewichen war, nachdem das ganze Dorf davon sprach, dass er auf die Insel zurückgekehrt war. Sein Blick ging direkt in ihr Herz, und sie wusste, dass die unendliche Trauer, die sie überkam, nichts, aber auch rein gar nichts mit ihrem Vater zu tun hatte.
Auf einmal war ihr tatsächlich zum Heulen zumute, und Dietrich, der »Barackenjohnny« aus Kindertagen, ahnte vermutlich nicht ansatzweise, warum ihre Augen schwammen und sie ihren Kopf wegdrehen musste. Sie hielt seinen Blick, der so viele Erinnerungen heraufbeschwor, kaum aus. Was für eine vergeudete Zeit lag hinter ihr. Was hätte sie darum gegeben, wenn er sich getraut hätte, sie in den Arm zu nehmen.
Aber Dietrich machte sich nur die nötigen Notizen auf seiner Karteikarte. Und fragte auch nicht noch einmal nach. Sie hätte auch keine Antwort auf die Frage gehabt. Erst einmal musste ihr Vater unter die Erde.
Sönnich Petersen, der Bauer, dessen Familie seit Generationen in diesem Dorf lebte, war, wie man auf der Insel sagte, eine große Leiche. Der Bestatter hatte die letzte Reise für ihren Vater aufwendig vorbereitet.
Wie es üblich war, hatte Helma sich als eine der Ersten zur Kirche begeben und saß in der vordersten Reihe. Aber sie konnte spüren, wie sich das Gotteshaus langsam füllte. Sie hörte es hinter sich hüsteln, murmeln, räuspern und tuscheln. Ein Gesangbuch fiel zu Boden, Füße schrammten über den Holzfußboden zwischen den Bänken und langsam erreichte sie der mottige Geruch der dunklen Kleider, deren Bestimmung es war, die überwiegende Zeit im Schrank zu hängen.
Die Trauerpredigt, von der sie nicht viel mitbekam, war offenbar ein Fiasko. Der alte Pastor verwechselte Namen und Daten, was sie ihm verzieh, denn ihm war wenige Tage zuvor das Haus über dem Kopf abgebrannt. Das alte Pastorat nur noch ein Haufen Schutt und Asche. Er hatte ihr ganzes Mitgefühl. Das Haus zu verlieren, den schützenden Raum, dessen Wände alles umschlossen, was an Erinnerung und Eigentum zu einem gehörte, wäre für sie ein einziger Albtraum.
Neben ihr hatte Oma Martin gesessen. Eine Oma des Zufalls, die sie dem Krieg und der Vertreibung zu verdanken hatte. Oma Martin war mit Sicherheit nicht ihres Vaters wegen in die Kirche gekommen. Helma wusste, dass Alwine Martin von Sönnich Petersen nichts gehalten hatte.
Seltsamerweise war ihr von der Beerdigung praktisch nur die eigenwillige Interpretation des Vaterunser in Erinnerung geblieben, die Oma Martin gesprochen hatte: »Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. Und führe uns nicht nach Sibirien, sondern erlöse uns …« Ihr war schlagartig klar geworden, wie wenig sie von Oma Martins Leben wusste.
Nach der Predigt hoben die Träger den Sarg an, um ihn durch den schmalen Gang der Kirche nach draußen zu tragen. Helma folgte ihrem Vater zum letzten Mal. Sie ging unter den alten Messingkronleuchtern hindurch, von denen der große mit den geschwungenen Armen vor langer Zeit von einem ihrer Vorfahren gestiftet worden war. Sie sah, dass die Kirche bis auf den letzten Platz besetzt war. Und registrierte erstaunt, dass Willi Krüger, vermutlich als Einzigem, die Tränen in den Augen standen.
Beim Beerdigungskaffee setzte er sich zu ihr. Von dem forschen Auftreten aus der Zeit, als er noch ihr Turnlehrer gewesen war, war nicht mehr viel übrig. »Helma, hab ich dir überhaupt mal erzählt, wie viel ich deinem Vater zu verdanken habe?« Ehe Helma es sich versah, war sie an der Ostfront und im Krieg. Krüger hatte einen echten Überraschungsangriff auf sie gestartet.
»Wir waren ja schon auf dem Rückzug, und auf einmal hörten wir ein schweres Brummen in der Luft, das immer lauter wurde und näherkam. Dann sahen wir einen Verband von mehr als zwanzig Schlachtfliegern. Sie kamen direkt auf uns zu, und wir hatten keine Zeit mehr, in den Wald zu rennen. Die Mistkerle sahen uns, und wir hörten, wie sie hinter den Tannen beibogen und zurückkamen. Ihre Schnauzen auf uns gerichtet, gingen sie auf Tiefe und schossen aus diesem gottlosen Himmel auf uns herab. Aus den Bordkanonen der Tragflächen ging ein unvorstellbares Blitzgewitter auf uns nieder und dann der brüllende Maschinenschwarm. Du kannst dir das nicht vorstellen.« Krüger schluckte kurz.
»Sie warfen Bündel von Sprengbomben ab, und als sie an uns vorbei sind, kamen zum Abschied noch dicke Zeitzünderbomben mit Pressluftabschuss von hinten. Es war ein Inferno, von jetzt auf nun waren wir in der Hölle und hatten keine Chance. Dieses Sausen und Zischen, wenn die Bomben fallen, geht einem durch Mark und Bein. Hat Sönnich dir mal erzählt, dass man diesem sich zuspitzenden Sausen anhören kann, ob die Bomben auf einen zufallen oder nicht?« Krüger vergewisserte sich, dass Helma ihm zuhörte. »Man muss die Dinger im Blick behalten, Helma.« Er erklärte es ihr so ernsthaft, als wenn für ihn klar war, dass Helma dieses Wissen mit Sicherheit einmal brauchen würde.
»Wenn die erste Bombe so dreihundert Meter vor dir einschlägt, dann krachen die nächsten im Abstand von vierzig bis fünfzig Metern in der Schussfolge auf die Erde. Ich bin gleich von Splittern erwischt worden. Wenn Sönnich nicht gewesen wäre, wäre ich kurz darauf tot gewesen, ich lag genau in der Schussreihe. Er hat mir damals das Leben gerettet, Helma. Ich weiß nicht, woher er die Kraft genommen hat, aber er zog mich in einen Bombenkrater. In den frischen Kratern konnte man nämlich ziemlich sicher sein, nicht noch mal getroffen zu werden, das wäre sowas wie zehn Richtige im Lotto gewesen.« Willi Krüger grinste schief.
»Als die Flieger abgezogen waren, hat Sönnich immer wieder nach den Sanitätern gerufen, gebrüllt hat er, sich die Seele aus dem Leib geschrien, aber die kamen nicht, weil sie selbst getroffen worden waren. Dann hat er mich bis zur Marschstraße geschleppt und eine Zugmaschine angehalten, damit sie mich beim nächsten HVP abladen. Also Hauptverbandsplatz. Sonst wäre ich da draußen verreckt.« Er musste Luft schnappen, saß nun nicht mehr mit Helma an einer schön gedeckten Kaffeetafel, sondern um ihn herum brüllten und schrien die Kameraden. Seine Augen waren weit aufgerissen und Helma hatte keine Idee, wie sie ihn zurückholen konnte.
»Deinen Vater hat es nur zwei Tage später erwischt. Tapferkeit oder Tatkraft, Helma, sind mitten im Sperrfeuer keine Überlebensvorteile. Wir wurden ausgelost. Heute Verwundung, morgen Abschuss. Alles zufällig verteilt, von wem auch immer.« Willi Krüger machte eine Pause und schien sich wieder zu beruhigen.
»Unsere Verletzungen haben uns das Leben gerettet, so verrückt das auch klingt. Wir wären da draußen sonst wie die Karnickel abgeschossen worden.« Er nahm noch einen Schluck aus der Tasse, deren Blümchenmuster so wenig zu seinen Erinnerungen passte wie ein Hochzeitskleid zu einer Beerdigung.
»Sie haben es geschafft, unseren Lazarettzug aus der Hölle rauszubringen. Dein Vater, Helma, war der beste Kamerad, den man sich denken konnte.« Der letzte Satz ging im Zittern seiner Stimme fast unter.
Bis zu diesem Tag hatte sie nicht geahnt, dass sie mit Willi Krüger Mitleid haben konnte. Und als er nicht einmal zwölf Monate später seinem Kameraden auf den Friedhof folgte, hatte Helma im Namen ihres Vaters ein großes Gesteck beim Gärtner bestellt. Und sie hatte ihm halbwegs verziehen, dass er Dietrich nur Barackenjohnny gerufen hatte und auch die anderen Flüchtlingskinder regelmäßig schikanierte oder sie der Lächerlichkeit preisgab, wenn ihnen ein Fehler unterlief, sie mit geflickten Kleidern im Klassenzimmer saßen oder ihnen die hochdeutsche Sprache schwerfiel.
Ein kleiner Zaunkönig schreckte sie aus ihren Erinnerungen mit seinem schimpfenden Zerr-Zerr auf. Sie sammelte die braunen Blätter von der geharkten Fläche des Grabes und warf sie auf den Weg. Der Wind würde sich schon um das alte Laub kümmern.
Als sie hochblickte, sah sie, dass sie doch nicht allein auf dem Friedhof war. Aber Hauke Henningsen wollte sie mit Sicherheit nicht über den Weg laufen. Sie wusste, dass er sowieso bald wieder an ihrer Haustür stehen und versuchen würde, ihr irgendetwas abzuschnacken. Henningsen war in ihren Augen ein Luftikus. Er hatte überhaupt keine Ahnung von den Dingen. Wenn sie ihm erzählen würde, dass sie die Fliesen im Pesel schon allein deshalb nicht verkaufen konnte, weil es noch den Brief aus Harlingen gab, in dem der Kapitän seiner Frau im Sommer 1785 von den Schwierigkeiten der Fliesenbestellung berichtete, würde er sie mit Sicherheit für verrückt erklären.
Letztes Mal hatte er auf die alte kleine Heckfigur gezeigt, die auf der Innenseite der Gartentür saß: »Frau Godbersen, was wollen Sie denn damit? Da platzt doch schon die Farbe ab und schön ist das Gesicht doch nun wirklich nicht.« Sie hätte ihm eigentlich gerne erklärt, dass von dem verloren gegangenen Schiff, dessen ganze Mannschaft ertrunken war, dies das einzige Stück war, das jemals von der Flut angetrieben wurde. Und dass man diese Dinge nicht verkaufte, um damit irgendetwas zu dekorieren. Aber sie wusste, bei Hauke Henningsen war diesbezüglich Hopfen und Malz verloren. Er hätte auch seine eigene Großmutter verkauft, wenn sie genug Geld einbringen würde.
Sie bog hinter der Kirche ab, um ungesehen den Heimweg antreten zu können. Der Wind hatte mittlerweile tatsächlich gedreht. Wer sie nicht kannte, hätte aus der Ferne meinen können, eine Vogelscheuche habe sich vom Acker gemacht. Mit ihren dünnen Beinen, die in halbhohen Stiefeln steckten, schritt sie weit aus. Der Mantel flatterte im Wind und das Klemmchen hatte doch seinen Dienst versagt, gleich mehrere Strähnen, die ihr immer eine Nasenlänge voraus waren, hatten sich gelöst.
Die Blätter auf dem Hof lagen nun friedlich aneinandergeweht an der Stallwand, und auch wenn sie keine Lust dazu hatte, holte sie sich die Harke aus der alten Waschküche, um sie zusammenzufegen. »Wer seine Pflicht hat treu getan, der freue sich am Ende« – ohne dass es ihr klar war, hatte sich dieser Leitsatz, die Inschrift auf der Grabtafel der Familie Petersen, in jede ihrer Zellen eingenistet und forderte täglich seinen Tribut.
Wir brauchen einen Mann auf dem Hof, sieh zu, dass du mit einem wiederkommst, der was taugt.«
Die Stimme von Sönnich Petersen ließ keinen Widerspruch zu und war schneidend wie der Ostwind im Februar. Er hatte Besseres zu tun, als zum Bahnhof zu fahren, wo laut Bürgermeister die nächsten Flüchtlinge verteilt wurden. »Sönnich, beim nächsten Trupp musst du auch welche nehmen. Bleickens haben schon zwei Familien, wir müssen jetzt alle zusammenstehen. Wird ja hoffentlich nicht lange dauern.«
Gondel Petersen hatte schon lange keine Lust mehr, mit ihrem Sohn zu streiten. Krieg war nun schon lange genug, und wie man 1945 freiwillig in den eigenen vier Wänden weiter Krieg spielen konnte, konnte sie nicht begreifen.
Sie zog ihren Mantel vom Haken der alten Flurgarderobe, verließ das Haus durch den gleich danebenliegenden Hintereingang und stand in der kalten Luft eines sich neigenden Märztages.
Ihr Erstgeborener weigerte sich beharrlich, das schwindsüchtige Kriegsglück zur Kenntnis zu nehmen. Dabei müsste er es eigentlich besser wissen. Auch wenn er nicht viel von der Zeit an der Ostfront erzählte, verriet doch seine ganze Wut, dass er sich um den Endsieg betrogen fühlte.
Gondel musste sich zu Fuß auf den Weg zum Bahnhof machen. Dass sie keinerlei Verantwortung für Verlorengegangenes hatte, schien Sönnich nicht in den Sinn zu kommen. Sein Zorn richtete sich gegen alles und jeden, der ihm querkam, und deshalb blieb der alte Einspänner im Schuppen.
Gondel kamen auf ihrem Weg nach kurzer Zeit schon die ersten Fuhrwerke und Pritschenwagen entgegen, beladen mit fremden Gesichtern, erschöpften Blicken, habseligen Koffern und Kisten. Die Schlaglöcher schüttelten alles durch, was oben saß. Die größeren Kinder liefen neben den Pferden her, in abgetragenen Kleidern, die von einer langen Reise erzählten. Die Kleinen saßen auf den Schößen ihrer Mütter und reckten wie junge Vögel ihre mageren Hälse. Und Gondel stellte erschüttert fest, dass aus den kleinen Mäntelchen alte Gesichter mit müden Augen ragten, die die neue Umgebung kaum wahrzunehmen schienen. Ohne zu grüßen, ließ Gondel die Gefährte passieren.
Sie beschleunigte ihre Schritte, sie war nun über sechzig, die Knie schmerzten, wenn sie längere Strecken zu Fuß laufen musste. Sie lief die Bahnhofsstraße entlang, querte den großen Weg, um an den Dorfrand im Süden zu kommen, wo man vor achtzehn Jahren den Bahnhof eingeweiht hatte. Damals war alles auf den Beinen gewesen, was laufen konnte. Mit dem Zug des Reichspräsidenten wurde die neue Strecke eröffnet und in der Stadt hatte man dieses Ereignis mit einem großen Festumzug gefeiert. Das schien ihr Jahrhunderte her zu sein.
Und nun Einquartierung. Als wenn sie nicht schon genug Not hätten. Dabei hatte zuerst alles so gut angefangen. Die Wirtschaftskrise Ende der zwanziger Jahre hatte ihnen fast das Genick gebrochen, aber dann kam die Zeit, in der den Bauern erstmals feste Preise garantiert wurden. Die Jahre nach der Machtergreifung waren eine unverhofft goldene Zeit für den Reichsnährstand, zu dem sie nun ungefragt gehörten. Sie wussten auf einmal, wie wichtig sie für Deutschland waren.
Und die Ortschaften auf der Insel blühten auf, weil an jeder Ecke das Militär mit seinen Bauprojekten die Wirtschaft ankurbelte. Tausende von Arbeitern bauten Kasernen, Bunker, Flakstellungen, Straßen. Der Inhalt ihrer wöchentlichen Lohntüten blieb überwiegend auf der Insel und in den Gasthäusern. Die Nachfrage nach Bauland stieg, alle hatten genug. Verständlich, dass viele den Krieg anfangs noch lauthals bejubelt hatten, man fühlte sich auf der Insel, die wie eine Festung ausgebaut war, sicher.
Doch es dauerte nicht lange, bis die Heimatzeitung die ersten Todesanzeigen abdruckte: »In harten Kämpfen an der Front gefallen«, andere ließen mitteilen, dass ein »hoffnungsvolles Leben für Führer, Volk und Vaterland hingegeben worden war«, es gab sogar Eltern in »stolzer Trauer«. Auch Geburtsanzeigen hatten sich verändert, »Am Geburtstage des Führers wurde unser Junge geboren«, Gondel hatte in den Aprilmonaten der letzten Jahre immer wieder derartige Zeitungsannoncen lesen dürfen.
Ihr hatte der Krieg einen zweiten Sönnich nach Hause geschickt, der Sohn, der ihr vertraut gewesen war, als er an die Front musste, war irgendwo im Osten verlorengegangen.
Uwe war noch immer in Frankreich vermisst. Nicht zu wissen, wo ihr Jüngster abgeblieben war, zerriss Gondel das Herz. Diese Unsicherheit und Angst schnürten ihr schon morgens nach dem Aufstehen die Luft ab, und nachts konnte sie keinen Schlaf finden. Sie hatte sich um ihren Herrgott nie wirklich gekümmert. Jetzt aber rief sie ihn in ihren Gebeten täglich an, als wenn sie auf einmal beste Freunde wären.
Die Sondermeldungen der Wehrmacht im Juni letzten Jahres, just an ihrem Geburtstag, nagten immer wieder an ihrer Hoffnung. »Die Flotten zweier Weltmächte sind mit Unterstützung großer Luftwaffenverbände in Anmarsch auf die europäische Westküste«, hieß die erste offizielle Meldung. Wie ein Messer bohrte sich dieser Satz in ihre Eingeweide, als sie ihn das erste Mal hörte. Aber die Mitteilung, die ihren unerschütterlichen Optimismus letztlich ins Wanken brachte, lautete: »Die deutschen Vorposten werden die Annäherung der feindlichen Einheiten aufnehmen und die Meldung weitergeben.« Auch ohne militärische Ausbildung war ihr klar, dass man einen zu erwartenden Sieg anders durch die Volksempfänger geschickt hätte. Sie wusste längst, dass die Normandie im Juni 1944 für einen deutschen Soldaten kein guter Platz zum Überleben war.
Mit Uwe, der seinem Vater so ähnlich war, hätten die Verhältnisse auf dem Hof leichter sein können. Und dann die kleine Helma. Ihre Enkelin war wie ein zu früh aus dem Nest gefallenes Küken, das seinen Platz suchte und sie mit ihren gerade mal neun Jahren viel Kraft kostete. Dass Dr. Bote Helmas Mutter nach der Geburt nicht retten konnte, würde Gondel ihm, wie manch anderes, nicht verzeihen. Und nun auch noch Flüchtlinge. Was sollten die hier alle? Es gab doch überhaupt nicht genügend Wohnraum. Bei dem Gedanken daran, wer dort am Bahnhof auf sie warten würde, wurden ihre Schritte automatisch langsamer.
Als Gondel Petersen endlich auf dem Bahnhofsvorplatz ankam, war sie die Letzte. »Gondel, dat is dien Besöök«, hörte sie Fiete, der jetzt Gemeindearbeiter war, weil er mit seinem Armstumpf, den er einer zu spät geworfenen Handgranate zu verdanken hatte, nicht mehr als Zimmermann taugte, spöttisch sagen, »dann sind wir hier durch, schönen Tag noch, die Damen.«
Der Wind strich über den leergefegten Platz, und Gondel hätte sie auch in der schwärzesten Nacht wahrgenommen. So rochen ungezählte Tage ohne Seife, so rochen Hunger und Elend.
Vor ihr stand eine ältere Frau, deren schwarzes Kopftuch tief in die Stirn gezogen war, und unter dem Rock aus grob gewebtem Wollstoff schauten klobige Lederstiefel hervor, wie sie die Soldaten trugen. Sollte das denn nie enden? So geschlagen sahen auch die Männer und Söhne aus, die der Krieg mehr tot als lebendig ausgespuckt hatte, wenn sie wieder zu Hause in der Tür standen. Als die gebeugte Gestalt sich mit »Alwine Martin« vorstellte, musste sie nicht mehr sagen, um zu verraten, dass sie aus Ostpreußen kam.
»Dann kommen Sie mal mit.« Gondel hatte es nicht eilig, nach Hause zu kommen und auf Sönnich zu treffen. Sie ging langsam voran. Nach wenigen Schritten merkte sie jedoch, dass selbst das zu schnell war. Sie hoffte, Alwine Martin, die nur schlurfend gehen konnte, würde verstehen, dass sie den Rucksack, der ihr schwer von der Schulter hing, allein tragen musste, als sie durchs Dorf gingen. Es war unmöglich, dass die Inselbäuerin Gondel Petersen dieses Gepäck übernahm. Man war ja wer.
Bei den überfüllten Baracken zog gerade eine weitere Flüchtlingsfamilie ein. Vor wenigen Wochen hatte Gondel hier noch die Männer vom Reichsarbeitsdienst gegrüßt, die in verschiedenen Lagern auf der Insel untergebracht worden waren, um Deiche und Straßen zu bauen. Eine junge Frau war gerade dabei, ihr weniges Hab und Gut vom Leiterwagen zu holen. Sie sah die beiden alten Frauen vorbeigehen und rief einem Jungen von vielleicht zehn Jahren zu: »Dietrich, hilf Tantjen Martin mal mit ihrem Rucksack.«
Vor Gondel Petersen tauchte einer der zerrissenen Jungen auf, dessen dunkelbraune Augen sie genau musterten. Alwine Martin schenkte er ein kurzes Lächeln, griff sich ihren Rucksack, der viel zu groß für ihn war, warf ihn sich über den Rücken und trug ihn den Rest des Weges, um ihn dann am Ziel abzustellen und grußlos zu den Baracken zurückzueilen.
Nur noch an drei Gehöften vorbei, dann hatte der Spießrutenlauf endlich ein Ende. Auch wenn sie selbst niemanden sehen konnte, Gondel wusste, dass alle sie sahen. Hinter den Scheiben saßen ihre Nachbarn und registrierten aufmerksam, dass Sönnich sie allein zu Fuß zum Bahnhof geschickt hatte und sie nun auch Einquartierung hatten.
»Das ist Ihre Kammer, der Eimer steht hinten im Stall und die Waschküche ist daneben. Um fünf Uhr essen wir Abendbrot.«
Mit diesen Worten ließ Gondel Petersen das Elend allein, ging über die Hintertür hinaus und ließ sich auf die windgeschützt stehende Bank an der Südwand des Hauses fallen. Im Holunderbusch neben ihr saß eine Amsel, die nach kurzer Zeit so fröhlich zu zwitschern begann, als wenn die letzten Kriegsjahre nicht gewesen wären.
Wie sollte es bloß weitergehen? Gondel ahnte, dass Alwine Martin nicht mehr weiterziehen konnte. Irgendwann musste jede Reise ihr Ende haben. Aber so schwer hatte sie sich das sich abzeichnende Kriegsende nicht vorgestellt. Was Hitler wohl gerade machte?
Männer und der ewige Kampf, sie hatte das noch nie verstanden. Das Wenige, was sie von der Geschichte ihrer Insel wusste, war meist mit Krieg verbunden. Solange die Menschen hier denken konnten, war man im Grenzgebiet immer Spielball von Königen und Herzögen gewesen, denen es offenbar völlig egal war, wie viele Opfer ihre Untertanen bringen mussten, wenn sie untereinander in Streit gerieten.
Und ihr kam ihr alter Nachbar Desche in den Sinn, der letzten Sommer, just als der große Angriff an der französischen Küste startete, friedlich in den Himmel geflohen war. Seine Generation hatte einen Krieg nach dem nächsten erlebt. Als kleines Kind musste er miterleben, wie sein Vater auf die Schlachtfelder geschickt wurde, um 1864 Dänemark zu besiegen, das Land, zu dem man hier seit Menschengedenken gehörte. Um nur zwei Jahre später erneut ins Gefecht ziehen zu müssen, weil die Preußen sich auf einmal nicht mehr mit ihren Verbündeten, den Österreichern, verstanden. Und als wenn das an Schlachten nicht gereicht hätte, kam schon bald der nächste Feldzug, weil Frankreich den Preußen 1870 den Krieg erklärte.
Da machte dann nicht mehr sein Vater mit, sondern Desche selbst, den man zum Kämpfen ins Franzosenland abkommandiert hatte. Er brachte aus diesem Krieg immerhin ein paar Brocken Französisch mit und konnte mit »Bonjour Mademoiselle« oder »ma Chéri« den Frauen im Dorf imponieren. Aber ansonsten blieb ihm nur die Gewissheit, dass er niemals mehr eine große Reise machen wollte. Ihm war es herzlich egal gewesen, dass man nach diesem Krieg zum frisch gegründeten, großen Deutschen Reich gehörte. Und als Kaiser Wilhelm II. später mit einem weiteren großen Krieg alles aufs Spiel setzte, verlor Desche seinen Ältesten und der Kaiser sein Reich. In seinem fünften Krieg, der für ihn schon vor 1939 begonnen hatte, weil er von den Nazis nicht viel hielt, lief er orakelnd durch das Dorf und redete von der Strafe Gottes. Bis dieser ihn endlich zu sich holte.
Was musste passieren, damit die Männer endlich klug wurden? Gondel Petersen hatte keine Antwort auf diese Frage. Genauso wenig wie darauf, wie sie den bevorstehenden Tobsuchtsanfall ihres Sohnes bändigen sollte, denn die Flüchtlingsfrau war mit Sicherheit nicht die Hilfe, die er sich für den Hof erhofft hatte.
Alwine Martin erschrak sichtlich, als sie in die Küche kam, wo die Familie schon am Tisch saß. Der Hausherr Sönnich Petersen thronte am Kopfende des Küchentisches und seine eng stehenden Augen schauten sie zornig an. Sein Gesicht schien ihr wie eine missglückte Zeichnung, die von zwei harten Linien bestimmt wurde. Auf dem bis über die Ohren rasierten Schädel thronten streichholzkurze, aschblonde Haare, die ein akkurat gezogener Scheitel trennte. Die zweite Linie zerteilte die linke Gesichtshälfte. Der Granatsplitter war knapp unter dem Auge eingedrungen und hatte die Wange sauber tranchiert, bevor er im Kiefer steckengeblieben war. Sönnich Petersen hatte noch Glück gehabt, Oberarzt Kessel war im früheren Leben Chirurg gewesen und hatte sich Mühe gegeben, die durchtrennte Gesichtshälfte nicht nur zu flicken, sondern fachkundig zu vernähen. Das Resultat war nichtsdestotrotz ein schiefes Lächeln, aber Sönnich Petersen hielt sowieso nicht viel von Freundlichkeit.
Viel schlimmer war, dass ein größerer Splitter seine linke Schulter zertrümmert hatte. Er konnte den Arm seitdem nur unter Schmerzen bewegen. Schlechte Voraussetzung für gute Stimmung. Er begrüßte die Flüchtlingsfrau gar nicht erst und tat so, als wenn sie Luft für ihn wäre, und sprach auch in die Luft.
»Da schicken sie uns nun also das ganze Kroppzeug.«
Helma, die nicht wusste, was Kroppzeug war, war aufgestanden und hatte einen Knicks gemacht, als sie Alwine Martin die Hand gab.
»Knicks nur bei anständigen Leuten, die keine Fahnenflucht begangen haben, mien Deern.«
Helma, die auch nicht wusste, was Fahnenflucht war, sagte keinen Mucks mehr, und Gondel versuchte gar nicht erst, gute Miene zum bösen Spiel zu machen.
Alwine Martin hatte sich an das untere Ende des Tisches gesetzt und zaghaft den Teller mit Bratkartoffeln aufgegessen und den Becher mit Milch ausgetrunken, der danebengestanden hatte. Am Tisch herrschte die ganze Zeit über absolute Stille, nur unterbrochen vom Klappern des Bestecks auf den Tellern. Ohne noch vom Brot und den anderen Köstlichkeiten nachzunehmen, die sie seit Wochen weder gesehen, geschweige denn gegessen hatte, verabschiedete sie sich eilig in ihre Kammer.
Gondel beschloss, Alwine Martin den Teller zukünftig neben die Kammer zu stellen, das wäre sicher für alle das Einfachste. Bevor sie den Tisch abräumte, brachte sie ihre Enkelin zu Bett. In dem niedrigen Zimmer über dem kleinen Kriechkeller lag Helma bereits in dem alten Wandbett, das in diesem Haus schon immer den Kindern vorbehalten gewesen war. Hier hatten auch ihre beiden Jungs Sönnich und Uwe gelegen. Die Innenwände waren mit alten Geldscheinen ausgekleidet, die Helmas Vorfahren, die zur See gefahren waren, aus fernen Ländern mitgebracht hatten. Die ganze Welt war bei Helma im Bett, nur gab es niemanden, der ihr erklärt hätte, was die seltsamen Zeichen und Bilder zu bedeuten hatten.
»So, Füße hoch.« Solange es draußen noch frisch war, wärmte Gondel für Helma immer einen Stein am Ofen. Sie schob ihn ans untere Ende des Bettes, damit die Füße nicht kalt wurden. »Und Arme unter die Bettdecke.« Sie wickelte Helma fest ins Federbett ein, damit die karge Wärme im Bett blieb.
Ihr gemeinsames Ritual, bevor sie sich von ihrer Enkelin mit einem Streicheln über die Stirn verabschiedete, war ein altes Wiegenlied, dessen erste beiden Strophen sie gemeinsam sangen:
»Schlaf, Helma schlaf,
Am Himmel ziehn die Schaf,
die Sternlein sind die Lämmerlein,
der Mond, der ist das Schäferlein,
schlaf, Helma schlaf.«
Sönnich, der ihr immer wieder vorwarf, sie würde das Kind verzärteln, hätte sich mit Sicherheit für eine andere Strophe entschieden. »Schrei nicht wie ein Schaf, sonst kommt des Schäfers Hündelein und beißt mein böses Kindelein« war mehr nach seinem Geschmack, wenn Helma sich in den Schlaf weinte. Glücklicherweise tat sie das nur noch selten. Gondel machte sowas immer ratlos, es war viel einfacher gewesen, zwei Jungs großzuziehen.
Sie wusste längst, dass ihre Enkelin sich wieder frei strampelte, wenn sie das Zimmer verlassen hatte. Helma holte sich ihre Puppe ins Bett, die nach Anweisung von Sönnich abends in den Puppenwagen gehörte. Die Wand des Alkovens zum Nachbarzimmer, in dem ihr eigenes Bett stand, war dünn, und so konnte sie manches Mal wenigstens ein paar Geschichten hören, die Helma ihrer besten Freundin erzählte. Und sie erfuhr bruchstückhaft von den kleinen Sorgen und Nöten, die ihre Enkelin hatte. Wenn sie Helma morgens weckte, lag die Puppe meist schon wieder an dem ihr zugewiesenen Platz.
Bis sie heute Abend mit der Hausarbeit fertig war, brauchte es Zeit. Erst zwei Stunden später fiel Gondel erschlagen ins Bett. »Müde bin ich, geh zur Ruh, schließe meine Augen zu. Lass mich morgen tapfer sein und lass mich bitte nicht allein. Amen.« Gondel Petersen war im Gegensatz zu ihrer Enkelin rechtschaffen müde und fürchtete trotzdem eine schlaflose Nacht.
Zur selben Zeit lag Alwine Martin in ihrer Kammer und dankte dem lieben Gott, dass sie ein Dach über dem Kopf hatte und endlich kein Schluchzen und keine Schreie in der Nacht mehr hören musste. Sie fürchtete sich vor gar nichts mehr. Schlimmer als das, was hinter ihr lag, konnte es nicht werden.
Sie versuchte, die Bilder der Flucht aus ihrem Kopf zu verbannen. Sie wollte nie mehr erfrorene Leichen am Wegesrand sehen, Ratten, die sich über Kadaver hermachten, und Kinder, die wimmernd ihre Mütter riefen. Sie dachte an das letzte große Familienfest, als sie noch alle sorglos getanzt hatten und sie so beschwipst gewesen war, dass sie über jeden Satz kichern musste, den Peter ihr ins Ohr geflüstert und dabei hin und wieder vorsichtig an ihrem Ohrläppchen geknabbert hatte. Jung und dumm waren sie gewesen und hatten nicht gewusst, in was für seligen Zeiten sie lebten.
Als das Jahr 1946 anbrach, folgten in einer zweiten Welle den Flüchtlingen die Vertriebenen, und der Wohnraum auf der Insel wurde noch knapper. Und so wie sich diese Fremden darüber wunderten, dass die Insulaner sich untereinander nicht grün waren, so wunderten sich die Insulaner darüber, dass sich diese beiden Gruppen nicht vertrugen, obwohl sie doch beide ihre Heimat verloren hatten.
Auf dem Grundstück von Sönnich Petersen war ein neuer Alltag eingekehrt. Man sah im Frühjahr zwei Frauen gemeinsam die Beete bestellen, die geschützt auf der Südostseite des Hauses lagen. Ein hoher Wall umfriedete den Garten, der am äußeren Rand mit Rhabarber und Johannisbeeren bestanden war. Die Obstbäume, die im herben Inselklima nur halb so groß wurden wie die Geschwister auf dem Festland, hatten dieses Jahr nur wenig Zeit zum Blühen gehabt.
Als wenn der Wettergott sich entschuldigen wollte, schickte er nach dem Eiswinter, in dem der Tod unter den Kindern und Alten der schlecht versorgten Flüchtlinge, Vertriebenen und einstigen Zwangsarbeitern reichlich Ernte gehalten hatte, zu den Eisheiligen hochsommerliche Temperaturen. Der Wind nahm den kargen Böden das letzte Wasser, und jeden Morgen zogen Alwine und Gondel mit Gießkannen durch die Reihen, um Bohnen, Sellerie, Möhren und Zwiebeln zu retten, die sie frisch eingesät hatten.
Gondel hatte sich daran gewöhnt, dass Alwine Martin ihren eigenen Kopf haben konnte. Und sie überließ ihr vieles im Garten, selbst wenn ihr manches seltsam vorkam. Beim Saateinbringen hatte ihr Flüchtling immer ein Korn des Samens im Mund und redete in dieser Zeit kein Wort. Ob das nun helfen würde? Und wenn es mittags ausnahmsweise Salzkartoffeln gegeben hatte, üblicherweise aßen sie Pellkartoffeln, um nichts zu verschwenden, griff sich Alwine Martin die dünn geschälten Schalen und grub sie abends an verschiedenen Plätzen im Garten ein, weil mit Glück selbst aus Kartoffelschalen neue Früchte wachsen konnten. Gondel war gespannt, ob ostpreußische Sitten auch an der Nordsee fruchten würden. Sie war mittlerweile froh über die Gesellschaft und Sönnich hatte glücklicherweise einen Knecht gefunden, der ihm draußen half.
Alwine Martin hingegen war es in den letzten Monaten gelungen, sich an die neuen Umstände zu gewöhnen. Sie haderte nicht mehr damit, dass sie auf einer Insel gelandet war, das war einfach Schicksal. Ihre kleine Kammer wusste sie zu schätzen. Andere, die in ehemaligen Kasernen oder Barackenlagern einquartiert worden waren, hatten es erheblich schlechter getroffen.
Mit Sönnich Petersen jedoch konnte und wollte sie sich nicht arrangieren. Von dieser Sorte Deiwel hatte sie genügend erlebt. Als Herrenmenschen hatten sie sich aufgespielt, die Leute in Angst und Schrecken versetzt, und nun ließ er seine Familie antreten, kommandierte sie wie auf dem Kasernenhof herum und lamentierte, wie schön es hätte werden können, wenn sich alle mehr zusammengerissen hätten, um den Krieg doch noch zu gewinnen. Manchmal waren die Falschen zurückgekommen.
Und genau wie Gondel Petersen wartete sie auf Nachricht. Von ihrem Sohn, der vermutlich in russischer Kriegsgefangenschaft war, und ihrer Tochter und Enkelin, die sie in der Heimat zurückgelassen hatte. Mit Gondel Petersen konnte man sich verstehen, aber sie verstand nicht, wie sie ihrem Sohn alles durchgehen lassen konnte. Mutter hin oder her. Sie musste doch sehen, dass ihre Enkelin ein schweres Kreuz an diesem Vater zu tragen hatte.
»Oma Martin, Oma Martin!« Helma stürzte schluchzend durch die Gartenpforte und segelte in ihre weit geöffneten Arme.