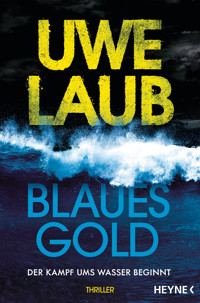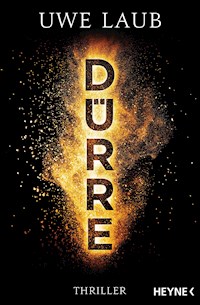7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 17,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Zwei packende Thriller von Bestsellerautor Uwe Laub in einem Band
STURM
Weltweit häufen sich scheinbar unerklärliche Wetterphänomene. Australien: Extreme Wasserverdampfung bringt Ökosysteme zum Einsturz. Sibirien: Nach einem signifikanten Temperaturanstieg taut der Permafrostboden. Gebäude sacken zusammen, Straßen und Städte werden zerstört. Deutschland: Das Olympiastadion in Berlin wird von einem Tornado verwüstet, in weiten Teilen Hannovers wüten Hagelstürme. Zahllose Tote und Verletzte werden geborgen, die Nation ist im Schockzustand. Es beginnt der Kampf gegen einen Feind, der uns alle umgibt …
LEBEN
Antilopenherden in Südafrika und Fledermauskolonien auf der Schwäbischen Alb: Weltweit verenden innerhalb kürzester Zeit große Tierpopulationen, ganze Arten sterben in erschreckendem Tempo aus. Experten schlagen Alarm, denn das mysteriöse Massensterben scheint vor keiner Spezies Halt zu machen. Der junge Pharmareferent Fabian Nowack stößt auf Hinweise, dass selbst der Fortbestand der Menschheit unmittelbar bedroht ist. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt, an dessen Ende unsere Erde nie wieder so sein wird wie zuvor.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 924
Veröffentlichungsjahr: 2021
Sammlungen
Ähnliche
UWE LAUB
STURM
LEBEN
Zwei Thriller in einem Band
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright© 2018 / 2020 by Uwe Laub
Copyright © 2021 dieser Ausgabe
by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Heiko Arntz
Printed in Germany
Umschlaggestaltung: DAS ILLUSTRAT, München,
unter Verwendung eines Motivs von Umberto Nocentini/Shutterstock (STURM)
sowie von Motiven von Inked Pixels / Shutterstock; Chones / Shutterstock und xpixel / Shutterstock (LEBEN)
Satz: Leingärtner, Nabburg
ISBN 978-3-641-29059-7V002
www.heyne.de
Das Buch
Weltweit häufen sich scheinbar unerklärliche Wetterphänomene. Australien: Extreme Wasserverdampfung bringt Ökosysteme zum Einsturz. Sibirien: Nach einem signifikanten Temperaturanstieg taut der Permafrostboden. Gebäude sacken zusammen, Straßen und Städte werden zerstört. Deutschland: Das Olympiastadion in Berlin wird von einem Tornado verwüstet, in weiten Teilen Hannovers wüten Hagelstürme. Zahllose Tote und Verletzte werden geborgen, die Nation ist im Schockzustand. Es beginnt der Kampf gegen einen Feind, der uns alle umgibt …
Der Autor
Uwe Laub wurde 1971 in Rumänien geboren. Er war zwei Jahre alt, als seine Eltern mit ihm nach Deutschland zurückkehrten. Laub arbeitete mehrere Jahre im Pharma-Außendienst, seit 2010 führt er das Unternehmen eigenständig. Seine Liebe gilt dem Schreiben. Für den Wissenschafts-Thriller »Sturm« hat Uwe Laub jahrelang recherchiert.
UWELAUB
STURM
THRILLER
WILHELMHEYNEVERLAG
MÜNCHEN
Für meinen Vater
Danke für alles
»Sollen sich alle schämen, die gedankenlos sich
der Wunder der Wissenschaft und Technik bedienen,
und nicht mehr davon geistig erfasst haben als die Kuh von
der Botanik der Pflanzen, die sie mit Wohlbehagen frisst.«
ALBERT EINSTEIN
1
BERLIN
Daniel Bender schloss die Augen und wünschte sich weit weg. Bis vor einer halben Stunde war er noch in absoluter Hochstimmung gewesen, voller Energie, bereit, es mit der ganzen Welt aufzunehmen. Dieser Samstagnachmittag entwickelte sich jedoch zu einem echten Albtraum, und das lag keinesfalls nur am Wetter, das sich beständig verschlechterte. Mit einem Auge beobachtete Daniel die rasch aufquellenden Gewitterwolken über dem Berliner Olympiastadion, aber das wahre Grauen spielte sich auf dem Spielfeld ab. Der FC Bayern hatte gerade das 3:0 erzielt, dabei war noch nicht einmal Halbzeit. Daniel warf Ben einen Blick zu, der neben ihm stand und seinen Hertha-BSC-Schal um Augen und Ohren gewickelt hatte. Sein Kumpel litt wie ein Hund. Daniel klopfte ihm aufmunternd auf die Schulter. »Noch ist nichts verloren.«
Ben zog den Schal herunter. »Heb dir solche Sprüche für deine Zuschauer auf.« Er sah Daniel vorwurfsvoll an und blickte dann flehend gen Himmel.
Daniel erwiderte nichts. Nach dem Spiel, bei einem kühlen Bier, würde Ben sich schon wieder beruhigen. Daniel zupfte an seinem Trikot. Es klebte am Körper. Die für diese Jahreszeit ungewöhnlich schwülwarme Luft machte ihm zu schaffen. Seit Tagen ging das schon so. Die Boulevardpresse sprach bereits von einer »Hitzewelle«. Die übliche Übertreibung. Daniel betrachtete die Sache etwas nüchterner. Er wusste, dass für die momentane Hochdrucklage eine Blocking-Situation verantwortlich war, wie Meteorologen dieses Phänomen nannten. Dabei lenkten stabile Hochdruckgebiete in der oberen Troposphäre Tiefdruckgebiete links und rechts von sich ab und sorgten somit für »Schönwetterinseln«, die sich mit Durchmessern von über zweitausend Kilometern über große Teile Europas erstrecken konnten. Eigentlich eine tolle Sache. Wie so viele Menschen sehnte sich Daniel jedoch allmählich etwas Abkühlung herbei. Er folgte Bens Beispiel und blickte nach oben.
Die Wolkenmasse hatte sich zu einer imposanten Säule in den Himmel erhoben. Daniel zog eine Grimasse. Eine Cumulonimbuswolke mit ausgeprägter Amboss-Form verhieß nichts Gutes. Tatsächlich erklang jetzt ein dumpfes, lang gezogenes Donnergrollen und schwoll mit einer solchen Intensität an, dass es sogar die Fan-Gesänge auf den Tribünen übertönte.
Daniel blickte entlang des Stadionovals durch die Öffnung über dem Marathontor, in Richtung des Glockenturms. Dieser befand sich etwa zweihundert Meter vom Stadion entfernt, am Ende einer weitläufigen Rasenfläche, dem Maifeld. Von seinem Platz in der Ostkurve aus konnte Daniel den oberen Teil des Turms gut erkennen. Mit offenem Mund starrte er auf die schwarze Wolkenwand, die sich urplötzlich von der Unterseite der Gewitterwolken im Westen absenkte, bis sie so knapp über dem Boden hing, dass sie fast an der Spitze des siebenundsiebzig Meter hohen Turms kratzte.
Eine Wallcloud, dachte er. Aber das ist unmöglich.
Ein greller Blitz zuckte vom Himmel, unmittelbar gefolgt von einem krachenden Donnerschlag. Die gesamte Tribüne erzitterte.
»Wow«, kommentierte Ben.
Keiner achtete mehr auf das Spiel. Alle starrten nach oben. Viele zeigten mit ausgestreckten Fingern auf die tief hängende Wolkenwand über dem Glockenturm, andere filmten das Geschehen mit ihren Handys. Auch Daniel zückte jetzt sein Handy. Gut möglich, dass er sich hier in den nächsten Minuten interessantes Bildmaterial für seine nächste Show sichern konnte.
Es begann zu schütten. Blitze erhellten den Himmel, einer greller als der andere. Donnerschläge krachten durch die Luft, laut wie der Knall von Düsenjägern beim Durchbrechen der Schallmauer. Ein Blitz schlug in die Spitze des Glockenturms ein, wo sich die über vier Tonnen schwere Olympiaglocke befand. Daniel meinte zu sehen, wie sie vor dem pechschwarzen Hintergrund für einen Augenblick rot aufglühte.
Wind kam auf. Mit zunehmender Sorge beobachtete Daniel, wie die Wolken über ihnen anfingen zu rotieren. Rasch kristallisierte sich die rundliche Struktur einer Gewitterzelle heraus, deren Ausmaße so riesig waren, dass sie ganz Charlottenburg bedecken musste. Die Rotation nahm Fahrt auf. Täuschte sich Daniel, oder hing plötzlich ein chlorähnlicher Geruch in der Luft? Ozon, schoss es ihm durch den Kopf.
Noch lief das Spiel weiter, aber es würde garantiert jeden Moment abgepfiffen werden. Während Daniel überlegte, ob es allmählich Zeit wurde, die Tribüne zu verlassen, schlug ein greller Blitz mit ohrenbetäubendem Knall in die im Runddach des Stadions integrierte Flutlichtanlage über der Westkurve ein. Funken sprühten, Metall- und Glassplitter regneten auf die Menge herab. Menschen schrien auf. Die Flutlichtanlage fiel aus, und mit einem Schlag wurde es dunkel im Oval. Die Spieler flüchteten in die Kabinen. Daniels Hauptaugenmerk aber galt der Westkurve, wo jetzt Panik einsetzte.
Tausende Menschen schienen mit einem Mal nur noch von einem einzigen Gedanken erfüllt: Nichts wie raus hier! Die Menge strebte auf die Ausgänge zu. Die ersten Zuschauer, die das trügerische Glück hatten, nahe bei den Ausgängen zu sitzen, es aber nicht schnell genug durch die Absperrungen schafften, wurden bereits von der stetig nachrückenden Menge gegen die Absperrungen gequetscht. Gellende Schreie waren zu hören, die das allgemeine Gebrüll übertönten. Mit erschreckender Klarheit begriff Daniel, dass heute, hier und jetzt, Menschen sterben würden. Er stoppte die laufende Videoaufnahme und steckte das Handy in seine Hosentasche.
»Das gibt’s doch nicht!«, rief Ben aus. Er boxte Daniel mit dem Ellbogen in die Rippen und deutete in Richtung Glockenturm.
Daniel musste sich zwingen, den Blick von der wogenden Menschenmasse in der Westkurve abzuwenden, aber kaum hatte er den Grund für Bens Aufregung erblickt, kam ihm alles andere belanglos vor.
»Heilige Madonna«, flüsterte er. Er stand wie hypnotisiert da, unfähig, sich zu bewegen, und beobachtete das Geschehen, das sich rund um den Glockenturm abspielte.
Die tief hängende Wolkenwand veränderte ihre Struktur und formte sich zu einem gigantischen Trichter. Das schmale Ende der Trichterwolke verlängerte sich und glich bald einem Rüssel, der sich unaufhaltsam dem Erdboden näherte. Daniel schnappte nach Luft. Nicht einmal während seines Auslandssemesters an der School of Meteorology in Oklahoma hatte er die Geburt eines Tornados aus so geringer Distanz mitangesehen. Unfassbar, dies mitten in Deutschland zu erleben.
Unaufhörlich näherte sich der Rüssel dem Maifeld. Schließlich kam es zum Kontakt. Touchdown. Gras, Erde und alles, was auf dem Rasen herumlag, wurde aufgewirbelt und gnadenlos in die Höhe gerissen. Wild zuckend begann der Tornado mit lautem Brausen eine zerstörerische Schneise in das Maifeld zu schlagen.
Zunächst schien es, als würde er sich in einem rechten Winkel zum Olympiastadion entfernen. Sekunden später jedoch änderte er seine Zugbahn und rotierte auf den Glockenturm zu. Der schmale Turm hatte der Urgewalt des Tornados nichts entgegenzusetzen. Unter dem Einfluss der mächtigen Winde zerbarst er in tausend Stücke. Beton, Ziegel und Mauerreste stoben in alle Richtungen davon. Die größeren Trümmer fielen zu Boden, die kleineren, leichteren Bruchstücke wurden von den Aufwinden in die Höhe gerissen, nur um kurz darauf wie Geschosse ausgespuckt zu werden. Die mächtige Glocke stürzte in die Tiefe und durchbrach das Dach der direkt darunter befindlichen Langemarckhalle. Daniel blieb keine Zeit, um darüber nachzudenken, ob die Glocke Menschen unter sich zerquetscht haben mochte, denn der Tornado näherte sich dem Stadion.
Die meisten Zuschauer waren bislang auf den Tribünen geblieben, doch jetzt änderte sich die Situation. Allen wurde schlagartig bewusst, dass sie sich in akuter Lebensgefahr befanden. Innerhalb weniger Sekunden waren sämtliche Ausgänge verstopft. Nichts ging mehr.
Inzwischen war es dunkel, als wäre schlagartig die Nacht hereingebrochen. Starkregen durchmischt mit Hagel prasselte auf die Menschen nieder. Daniel riss schützend seine Arme nach oben. Alles in ihm schrie nach Flucht, aber ein Blick zu den verstopften Ausgängen verriet ihm, dass jeder Versuch rauszukommen aussichtslos war. Ihm wurde klar: Wenn der Tornado seine Zugbahn beibehielt, würde es ihn und Ben erwischen.
Überall versuchten sich die Leute rücksichtslos in Sicherheit zu bringen. Auf dem Weg in die vermeintlich sicheren Katakomben stießen Männer Frauen und Kinder beiseite, nur um kurz darauf festzustellen, dass sie gegen eine Wand von Hunderten Menschen chancenlos waren. Der Tornado erreichte das Stadion und streifte dabei die linke Säule des Marathontors. Sie zerbröselte, als wäre sie aus Sand gebaut. Beton und Mörtel spritzten in alle Richtungen. Zuschauer sanken zu Boden, getroffen von scharfkantigen Splittern. Doch das wahre Grauen setzte jetzt erst ein. Der Tornado erfasste die ersten Menschen. Sie wurden eingesaugt, schreiend in die Luft gewirbelt und wieder ausgespuckt. Aus mehreren Metern Höhe stürzten sie zu Boden, wo sie reglos liegen blieben.
Das Brausen des Tornados steigerte sich zu einem infernalischen Kreischen. Es erinnerte Daniel an einen Güterzug, der mit angezogenen Bremsen an ihm vorbeiraste. Er ging in die Hocke und krümmte sich zusammen, die Hände zum Schutz gegen den Hagel weiterhin über den Kopf haltend.
Daniel wusste nicht, wie lange er so dagehockt hatte, aber endlich zog das Monstrum fort von der Tribüne, auf das inzwischen verwaiste Spielfeld. Dort zerlegten die mörderischen Winde ein Tor in seine Einzelteile, als bestünde es aus Mikado-Stäbchen. Der hin und her zuckende Rüssel schien nach neuen Opfern zu suchen. Regen und Hagel trommelten auf Daniel ein, doch nahm er dies kaum mehr wahr. Wie ein geblendetes Reh konnte er seine Augen nicht vor seinem grausigen Schicksal abwenden.
In Höhe der Mittellinie wirkte der Tornado für einen Moment unentschlossen, in welche Richtung er weiterziehen solle. Dann beschrieb er einen Neunzig-Grad-Winkel und steuerte direkt auf die Haupttribüne zu. Die verglasten VIP-Logen boten keinerlei Schutz. Die deckenhohen Frontscheiben explodierten förmlich. Ein Splitterregen ergoss sich auf die darunter befindliche Haupttribüne, gefolgt von Stühlen, Tischen und sonstigem Mobiliar, das der Tornado aus den Logen riss. Obwohl die VIPs eigentlich Zeit genug zur Flucht gehabt hatten, waren zu Daniels Überraschung viele geblieben. Hatten sie tatsächlich gedacht, in ihren goldenen Käfigen würde ihnen nichts geschehen? Ein fataler Trugschluss, den viele nun mit dem Leben bezahlten.
Wenige Sekunden später durchbrach der Tornado die Außenwand des Stadions und zog endlich davon. Zitternd verfolgte Daniel, wie sich der obere Teil der Trichterwolke entfernte. Das Brausen wurde schwächer. Wind, Regen und Hagel hörten so abrupt auf, wie sie eingesetzt hatten. Das Gelände rund um das Marathontor sah aus wie nach einem Bombenangriff. Die Westkurve, die blaue Tartanbahn sowie das Spielfeld waren mit Leichen und abgerissenen Gliedmaßen bedeckt.
Daniel sah nach oben, und seine Augen füllten sich mit Tränen. Selbst in den Streben der Dachkonstruktion und der Flutlichtanlage entdeckte er Leichen. Vom Tornado nach oben gerissen, hatten die Körper sich zwischen Eisen- und Stahlträgern verfangen. Daniel zog Ben an sich, umarmte ihn, so fest er konnte, und gemeinsam weinten sie, wie sie noch nie geweint hatten.
2
JAKUTSK, RUSSISCHER FÖDERATIONSKREIS FERNOST
Schon seit der Mittagspause machten Gerüchte die Runde, dass an der Oberfläche etwas Seltsames vor sich ging. Doch was genau dort oben los war, das wusste keiner genau zu sagen. Jewgeni Sorokin sah in die Gesichter seiner Kumpel, in denen er dieselbe Ratlosigkeit fand, die auch in ihm herrschte. Vor einer halben Stunde war das vorzeitige Ende der Schicht bekannt gegeben worden. In den siebzehn Jahren, in denen Jewgeni nun schon tief unten in den Stollen der ALROSA-Minen unter lebensgefährlichen Bedingungen Diamanten förderte, hatte es so etwas noch nie gegeben. Nun, was immer an der Oberfläche vor sich gehen mochte, in wenigen Minuten würde er es erfahren.
Er öffnete seinen Spind, verstaute Arbeits- und Handschuhe und nahm im Gegenzug seine Stiefel, Handschuhe, Fellmütze und die Gesichtsmaske heraus, die er vor Schichtbeginn dort deponiert hatte. In seine traditionellen untys, die wärmsten Stiefel der Welt, schlüpfte er sofort, die anderen Kleidungsstücke behielt er in der Hand. Er zog sie grundsätzlich erst unmittelbar vor der Fahrt nach oben an. Auch wenn der Winter noch ein paar Wochen auf sich warten ließ, betrugen die Temperaturen an der Oberfläche bereits jetzt durchschnittlich minus dreißig Grad. Wirklich zu schaffen machte dies Jewgeni nicht. Wie alle Jakuten kannte er es nicht anders. Er war in der kältesten Großstadt der Welt geboren und aufgewachsen und hatte von Kindesbeinen an gelernt, im Winter mit Temperaturen um die minus fünfzig Grad umzugehen.
Jewgeni betrat den Aufzug. Rumpelnd setzte sich die Eisengitterkabine in Bewegung, und gemeinsam mit weiteren Minenarbeitern fuhr Jewgeni der Oberfläche entgegen. Es herrschte eine angespannte Stimmung. Das Rattern und Knirschen des Aufzugs war Jewgeni noch nie so laut vorgekommen wie heute.
»Das hat sicher etwas mit dem grünen Licht zu tun«, ließ sich ein älterer, bärtiger Kumpel vernehmen.
»Was für ein Licht?«, fragte Jewgeni.
»Mein Schwager Alexej hat es letzte Nacht gesehen. Er konnte nicht schlafen und hat aus dem Fenster geschaut. Da hat er es gesehen.«
»Was hat er gesehen?«
»Alexej schwört, dass der Himmel grün geleuchtet hat.«
»Polarlichter?«
Der Bärtige schüttelte den Kopf. »Alexej meint, es hat wie ein grüner, pulsierender Ball ausgesehen.«
Jewgeni betrachtete den Bärtigen skeptisch. Geschichten wie diese kursierten regelmäßig unter den älteren, häufig abergläubischen Einheimischen. Er wollte dazu gerade eine Bemerkung fallen lassen, als er eine sonderbare Veränderung bemerkte. Irritiert sah er an sich herab. Es fühlte sich an, als würde sich eine Schicht dicker, zähflüssiger Luft wie ein Kokon um seinen Körper legen und ihm den Brustkorb zudrücken. Die verängstigten Gesichter seiner Kumpel verrieten, dass sie es ebenfalls spürten.
Mit jedem Meter, den sie sich der Oberfläche näherten, wurde Jewgeni unruhiger. Das Atmen fiel ihm zunehmend schwerer. Mit dem Handrücken wischte er sich einen Schweißfilm von der Stirn. Er sah nach oben, wo ein heller Streifen Tageslicht den Ausstieg markierte. Roch es nicht auch ganz anders als sonst? Und woher kam diese Wärme? Erneut wischte er sich über die feuchte Stirn.
Der Aufzug stoppte, die Türen öffneten sich. Gleißendes Licht blendete Jewgeni. Er kniff die Augen zusammen, beschirmte sie mit der Hand und versuchte vergeblich, etwas zu erkennen. Ein milder Windhauch strich über sein verschwitztes Gesicht. Verdammt, wieso war es hier oben so warm? Es sollte eigentlich eiskalt sein.
Eine Stimme befahl ihnen auszusteigen. Jewgeni gehorchte zögernd und trat hinaus in eine Welt, die nicht mehr dieselbe war wie wenige Stunden zuvor.
Intensive Sonnenstrahlen durchdrangen Jewgenis Kleidung und heizten seinen Körper auf. Blinzelnd entfernte er sich einige Schritte vom Aufzug. Der Boden unter seinen Füßen war weich und gab unter seinem Gewicht nach. Jewgeni trat in eine Pfütze, stutzte, ging weiter und trat erneut in eine Wasserlache. Er betrachtete die öligen Schlieren und fragte sich, wieso das Wasser nicht gefroren war? Allmählich gewöhnten sich seine Augen an die Helligkeit, und er sah sich um. Überall standen die Menschen einzeln oder in Gruppen beisammen und beobachteten das Unbegreifliche: Der Boden, der in ganz Jakutien von September bis April ohne Ausnahme durchgehend gefroren war, taute in einem atemberaubenden Tempo auf.
Auf dem gesamten Gelände hatten sich riesige Pfützen gebildet, der Boden glich krümeligem Sand. Unweit von Jewgeni stand ein Lkw, dessen Reifen auf der Fahrerseite noch auf festem Boden ruhten, diejenigen auf der Beifahrerseite jedoch steckten bis zu den Radnaben im Wasser. Zwei Arbeiter entluden in großer Eile Kartons, die auf der schrägen Ladefläche zu verrutschen drohten. Ein paar Meter daneben neigte sich ein hoher Mast, an dessen Spitze starke Scheinwerfer angebracht waren, ebenfalls gefährlich zur Seite.
Vor neun Stunden hatte Jewgeni sein Haus wie üblich vor dem Morgengrauen verlassen, um zur Arbeit zu fahren. Da hatte das Thermometer noch minus zweiundvierzig Grad angezeigt. Normalität für Jewgeni, der sein ganzes Leben lang nie aus Jakutsk herausgekommen war. Inzwischen brannte die Sonne mit einer Intensität vom Himmel, die er nie für möglich gehalten hätte. Schon jetzt, nach kaum fünf Minuten, juckte die Haut auf seinem Gesicht und seinen Handrücken. Ratlos betrachtete er seine Jacke, Fellmütze, Handschuhe und die Gesichtsmaske, die er noch immer in der Hand hielt. Die Temperaturen lagen gewiss weit im zweistelligen Bereich. Im zweistelligen Plus-Bereich! Wie war das möglich?
Ein ohrenbetäubender Lärm riss Jewgeni aus seinen Gedanken. Der Mast mit den Scheinwerfern war umgefallen. Mit einem Mal wurde Jewgeni die Tragweite dessen bewusst, was hier geschah. Taute der Boden an der Oberfläche auf, verwandelte er sich in krümeligen Sand, in dem Jewgenis Untys jetzt schon bis zu den Knöcheln steckten. In den meisten Ländern versuchte man gar nicht erst auf diesem schwierigen Untergrund zu bauen. In Jakutsk gab es keine Wahl. Alle Gebäude standen auf Pfählen. Für jeden einzelnen Pfahl musste man ein Loch tief in den steinharten Boden bohren. Im Sommer taute der Boden maximal bis in eine Tiefe von vier Metern auf. Wie sich anhand des umgestürzten Mastes zeigte, galt diese Regel offenbar nicht mehr. Bei diesem Gedanken wurde ihm flau. Wenn dieser Auftauprozess in diesem Tempo weiterging, drohte ganzen Wohngebieten der Untergang – denn Jakutsk war schließlich sprichwörtlich auf Sand gebaut.
O bosche moi! –Mein Gott! Jewgeni dachte an sein eigenes kleines Häuschen. Und an Irina, seine Frau, und Dimitrij, seinen Sohn, die darin auf ihn warteten, vermutlich ebenso verängstigt und ratlos wie er selbst. Er musste sofort zu ihnen.
Bevor er das umzäunte und alarmgesicherte Gelände verlassen konnte, musste er sich den üblichen Kontrollen unterziehen, auf die der Konzern selbst an diesem so außergewöhnlichen Tag nicht verzichtete. Um zu verhindern, dass Diamanten aus der Mine geschmuggelt wurden, führte man Jewgeni zunächst in einen unmöblierten Raum, in dem er sich bis auf die Unterhose ausziehen musste. Ein Angestellter mit gepuderten Latexhandschuhen winkte ihn heran und unterzog ihn einer umfassenden Leibesvisitation, die keine Körperöffnung aussparte. Jewgeni schloss die Augen. Diesen Teil der täglichen Routine hasste er. Danach musste er sämtliche Kleidungsstücke anziehen, die er bei sich trug, bevor er vor das Röntgengerät trat. Ungeduldig rieb er sich über die Bartstoppeln. Die Prozedur kam ihm heute entsetzlich langwierig vor. Noch während er durch die Schleuse nach draußen entlassen wurde, zog er sich Jacke und Pullover wieder aus. Die Hitze war unerträglich.
Er ging zur Bushaltestelle vor dem Haupteingang, einem rostigen Unterstand mit löchrigem Wellblechdach. An einem normalen Arbeitstag fuhren die Busse bei Schichtwechsel im Minutentakt. Aber heute war nichts normal.
»Da kommt kein Bus mehr«, sagte ein Kumpel, der offenbar zu Fuß zur Arbeit kam. Wie Jewgeni hielt er Pullover und Jacke in den Händen. Sein Gesicht war gerötet und verschwitzt.
»Sie kommen nicht durch?«, fragte Jewgeni. »Ist es so schlimm?«
Der Kumpel setzte zu einer Antwort an, schüttelte dann nur den Kopf und ging wortlos weiter. Jewgeni zögerte keine Sekunde und machte sich zu Fuß auf den acht Kilometer langen Heimweg.
Er ging die schlammige Straße entlang, auf der vor Tagesanbruch die Räder der Pkws und Busse noch auf dem Eis durchgedreht hatten. Es stank nach faulen Eiern. Jewgeni wusste, dass im Permafrostboden Methan sowie weitere Faulgase gebunden waren, die nun freigesetzt wurden. Die Sonne brannte wie Feuer auf seiner Haut. Um sein Gesicht zu schützen, zog er seine Fellmütze über den Kopf und klappte den Schirm nach unten. Rasch wurde es unter der Mütze brütend heiß, doch der Schutz vor der stechenden Sonne war wichtiger. Sein Unterhemd klebte ihm an Brust und Rücken. In den dicken, mit Rentierfell gefütterten Untys schienen seine Füße zu kochen.
Nach einer halben Stunde erreichte Jewgeni eine lang gezogene Kurve, die in eine Senke führte, und er erkannte die Ursache, weshalb die Busse nicht zu den Minen durchkamen. Wo die Straße in die Senke hinab- und auf der anderen Seite wieder hinaufführte, versank sie auf einem etwa dreißig Meter breiten Teilstück in einem tiefen Tümpel. Offenbar sammelte sich hier das Tauwasser der näheren Umgebung. In der Mitte stand ein Bus bis zu den Fenstern im Wasser. Auf der anderen Seite parkten drei weitere Busse mit laufenden Motoren. Ihre Fahrer standen beisammen, rauchten und debattierten. Sie wirkten ratlos.
Jewgeni kniete sich am Rand des Tümpels nieder. Mit beiden Händen schöpfte er Wasser, klatschte es sich ins Gesicht. Es war die reinste Wohltat. Er nahm seine Mütze ab und strich sich mit nassen Hände die Haare nach hinten. Dann folgte er dem Beispiel einiger Kumpel, die den kleinen Teich auf dessen rechter Seite über eine Anhöhe umgingen.
Auf diese Weise erreichte er schließlich Jakutsk.
Was er sah, übertraf seine schlimmsten Befürchtungen. Fast alle der Häuser am Stadtrand versanken in braunem Schlamm, einige wiesen bereits Schräglage auf. Auf den Straßen herrschte Hektik. Männer diskutierten lautstark und wild gestikulierend miteinander, andere räumten fluchtartig ihre Wohnungen. Frauen, jung wie alt, sahen ihnen zu und jammerten oder beteten. Ein Gebäude brannte. Flammen schlugen aus dem Erdgeschoss. Immerhin war die Feuerwehr vor Ort und begann in diesem Augenblick mit den Löscharbeiten. Vermutlich war durch das einsinkende Gebäude eine Gasleitung beschädigt worden. Falls dies zutraf, drohte diese Gefahr Hunderten weiteren Häusern. Jakutsk würde sich in eine Flammenhölle verwandeln, falls dieser verdammte Auftauprozess nicht bald aufhörte.
Jewgeni bekreuzigte sich. Er dachte an sein Häuschen am östlichen Stadtrand, direkt neben dem Fluss Lena. Ein entsetzlicher Gedanke kam ihm. War es denkbar, dass sich der Flusslauf änderte, wenn sich bestimmte Uferregionen senkten? Was, wenn die Lena über ihre Ufer trat und das ganze Wohnviertel überflutete? Der mächtige Strom würde alles mit sich reißen – Autos, Häuser, Menschen. Irina und Dimitrij schwebten womöglich in Lebensgefahr. Jewgeni beschleunigte seine Schritte.
Er kam am Markt vorbei, an dessen Ständen gestern noch steif gefrorene Fische in den Eimern der Händler aufrecht gestanden hatten und die gefrorene Milch scheibenweise angeboten worden war. Jetzt ließen die Fische die Köpfe hängen, und weiße Flecken auf dem Boden verrieten das Schicksal der Milch. Ein altes Marktweib packte ihn jammernd am Arm und faselte irgendetwas von verdorbenen Waren und dass sie ruiniert sei. Jewgeni stieß sie beiseite. Er verabscheute sich dafür, aber ihm lief die Zeit davon. Er musste zu seiner Familie. Irgendwo aus Richtung Stadtmitte hörte er eine dumpfe Explosion und kurz darauf Sirenengeheul. Eine weitere Gasleitung? So gut es ging, versuchte er die Panik und den Lärm um ihn herum auszublenden. Jakutsk hatte knapp zweihundertsiebzigtausend Einwohner, und sie schienen heute alle auf den Beinen zu sein.
Wenig später erreichte er sein Wohnviertel. Wie die großen Mehrfamilienhäuser steckten auch die kleinen Häuschen bis über die Türschwellen im Schlamm. Lag es doch am Fluss? Hatte die Lena das Erdreich unterspült? Jewgenis Magen krampfte sich zusammen, als er sah, dass auch sein Haus betroffen war. Wässriger Schlamm bahnte sich gurgelnd seinen Weg durch die Spalte in der Eingangstür.
Jewgeni riss die Haustür auf. »Irina! Dimitrij!«
Niemand antwortete.
O bosche moi!, dachte er, als er den Gasgeruch im Haus bemerkte.
3
BREDENSTEDT BEI HANNOVER
Der dritte Sonntag im September war ein traumhafter Tag. Die Sonne brannte vom Himmel und trieb die Temperaturen vermutlich zum letzten Mal in diesem Jahr an die Dreißig-Grad-Marke. Ein besseres Wetter hätten sich die Planer des jährlichen Stadtfestes nicht wünschen können. Laura Wagner saß auf dem Rand des runden Brunnens auf dem Rathausplatz und betrachtete das Treiben durch ihre Sonnenbrille. Sie trug eine cremeweiße Bluse und türkisfarbene Shorts, ihre mittellangen braunen Haare hatte sie auf einer Seite zurückgekämmt und mit einer Spange befestigt. In der Mitte des Brunnens sprudelte eine Fontäne. Glitzernde Wasserspritzer flogen durch die Luft und prickelten angenehm auf Lauras nackten Beinen. Sie tauchte ihre Hand ins Wasser und benetzte ihren Nacken mit dem kühlen Nass. Eine Wohltat. Kurzerhand streifte sie ihre Riemchensandalen ab, tauchte ihre Füße in den Brunnen und wackelte mit den Zehen. Ein verliebtes Pärchen schlenderte händchenhaltend vorbei. Laura sah ihnen hinterher, bis sie in der Menge verschwanden, seufzte verträumt und wandte ihre Aufmerksamkeit wieder den anderen Menschen zu.
Wie jedes Jahr an diesem Tag war die Altstadt für den Verkehr gesperrt. Vor den Geschäften hingen Luftballons, es fand ein Flohmarkt statt. Zig Buden und Imbisswagen sorgten für die Verpflegung, in der Luft hing der Geruch von Grillwürsten und Zuckerwatte. Am Rande des Rathausplatzes stand ein kleines Festzelt, in dem der städtische Musikverein aufspielte. Noch war vom Umzug nichts zu sehen. Laura reckte ihr Gesicht der Sonne entgegen. Ihre Sommersprossen würden wieder voll zur Geltung kommen. Es war ihr egal. Als Teenager hatte sie versucht, die hellbraunen Flecken mit Make-up zu überdecken. Irgendwann hatte sie eingesehen, dass die Sommersprossen zu ihrem Gesicht einfach dazugehörten. Außerdem gab es in ihrem Leben aktuell niemanden, den das möglicherweise interessiert hätte. Ihre Welt drehte sich seit vielen Jahren einzig um Robin, ihren elfjährigen Sohn. Sie konnte es kaum erwarten, ihn endlich in seinem Kostüm zu sehen.
Die Sonne verschwand hinter einer Wolke. Laura nahm ihre Sonnenbrille ab und ließ ihre Blicke schweifen. Das gesamte Wochenende über hielten Konzerte, Ausstellungen und andere Veranstaltungen die Einwohner Bredenstedts auf Trab. Den Höhepunkt stellte ohne Zweifel der Festumzug dar, an dem alle Schulen, Kindergärten und Vereine mitwirkten. Von weit her drang jetzt Musik an Lauras Ohren. Zunächst gedämpft, dann zunehmend lauter und klarer. In die Zuschauer kam Bewegung. Schnell bildeten sie eine Gasse quer über den Rathausplatz. Laura stellte sich auf den Rand des Brunnens, von wo aus sie über alle Köpfe hinweg sah. Etwas jedoch irritierte sie. Sie legte ihren Kopf in den Nacken und blickte in den Himmel.
Die vereinzelte, einsame Wolke, die sich vor die Sonne geschoben hatte, erschien Laura irgendwie sonderbar. Obwohl sich kaum ein Hauch regte, war die Wolke in Bewegung, veränderte sich. Laura konnte dabei zusehen, wie sie aufquoll. Jetzt glich sie einem gigantischen Blumenkohl mit immer neuen Ausbuchtungen. Weitere Wolken bildeten sich wie von Zauberhand, scheinbar aus dem Nichts. Stück für Stück zog sich der Himmel zu. Die Geschwindigkeit, mit der das Wetter umschlug, war atemberaubend. Bitte jetzt keinen Regenschauer, dachte sie.
Endlich rollte der erste Umzugswagen auf den Rathausplatz, ein grüner Traktor, mit Blumen dekoriert, der schwarze Abgaswolken in die Luft jagte. Hinter dem Wagen folgte sogleich die erste Musikkapelle. Die Zuschauer am Wegesrand fingen an, im Takt mitzuklatschen. Noch war Robins Klasse nicht zu sehen, dafür fiel Laura etwas Sonderbares auf: Die Tauben, die den Rathausplatz für gewöhnlich in Scharen bevölkerten, waren nirgendwo zu sehen. Nicht ein einziges Tier. Wohin waren sie verschwunden? Und weshalb?
Wenige Minuten später verkündete ein erneuter Blick nach oben nichts Gutes. Eine tief liegende, schmutzig gelb leuchtende Wolkenwalze näherte sich von Osten. Die Luftfeuchtigkeit war mit einem Mal erdrückend. Lauras Bluse klebte an ihrem Körper. Nun deutete tatsächlich alles auf ein Gewitter hin. Laura verzog das Gesicht. Der Umzug kam nur langsam voran. Immer wieder geriet er ins Stocken. Dann, endlich, kamen die Kinder.
Und mit ihnen kam der Sturm.
Die bedrohliche Wolkenfront erreichte das Stadtzentrum. Wie aus dem Nichts fegten kräftige Böen über den Rathausplatz. Laura ruderte mit den Armen, um auf dem Rand des Brunnens nicht das Gleichgewicht zu verlieren. Ihre Haarspange löste sich, und ihre Haare wirbelten durcheinander. Irgendwo fiel etwas mit einem lauten Klirren zu Boden. Laura zog ein Haargummi aus der Hosentasche und band sich einen Pferdeschwanz. Überall kämpften die Leute mit dem Wind. Pappteller und Servietten stoben durch die Gegend. Eine Jacke wehte über den Rathausplatz, verfolgt von ihrem fluchenden Besitzer.
Zunächst konnte Laura Robin in der Menge der Kinder nirgendwo entdecken. Die Ritter und Burgfräuleins sahen sich auf die Entfernung allesamt ziemlich ähnlich. Erst als sie näher kamen, entdeckte sie ihren Sohn. Er lieferte sich mit seinem Freund Samuel ein spielerisches Gefecht mit seinem Holzschwert. Den Kindern schien der aufkommende Sturm vollkommen egal zu sein. Sie gingen in ihren Rollen auf und vergaßen dabei die Welt um sich herum. Laura beneidete die beiden um ihre Sorglosigkeit. Sie rief Robins Namen und winkte ihm zu. Natürlich hörte und sah er sie nicht.
Regen setzte ein. Erste dicke Tropfen platschten vom Himmel. Binnen Sekunden entwickelte sich ein Platzregen, gleichzeitig sank die Temperatur spürbar. Es dauerte nicht lange, bis Lauras Kleider durch und durch nass waren. Sie begann zu zittern, überlegte, ob sie sich irgendwo unterstellen sollte, doch irgendetwas hielt sie davon ab. Laura glaubte an den Mutterinstinkt. Wenn sie gegenüber Andrea und Katrin davon sprach, lachten ihre Freundinnen sie immer aus, doch Laura wusste es besser. Es gab diesen Instinkt, und hier und jetzt, während sie durchnässt und frierend inmitten eines Platzregens auf dem Rand eines Brunnens stand, meldete er sich eindringlich.
Die Tauben fielen ihr ein. Man sagte, Tiere besäßen einen sechsten Sinn. Warum hatte Laura nicht früher daran gedacht? Einmal mehr blickte sie ängstlich hinauf zu der tief hängenden, inzwischen pechschwarzen Wolkendecke. Über dem Stadtrand zuckten Blitze. Plötzlich verspürte Laura den dringenden Wunsch, Robin auf der Stelle in Sicherheit zu bringen. Sie sprang vom Brunnen und lief auf ihren Sohn zu, der sich etwa vierzig Meter Luftlinie entfernt von ihr noch immer mit Samuel im Schwertkampf übte.
»Entschuldigung«, rief sie, während sie sich ihren Weg durch diejenigen Zuschauer bahnte, die in einer Jetzt-erst-recht-Einstellung Regen und Sturm trotzten.
Kurz darauf fand sie sich inmitten der Kinder wieder. Sie entdeckte Robin und war mit zwei schnellen Schritten bei ihm. »Robin!«
»Mama? Was machst du hier?« Auch er triefte vor Nässe. Sein Helm und sein Schild aus Pappmaché wellten sich bereits und waren kurz davor, sich aufzulösen.
»Wir gehen«, sagte Laura.
»Wohin?«
»Nach Hause.«
»Jetzt schon? Wieso?«
»Komm bitte.« Sie packte ihn am Arm.
»Nein.« Er riss sich los. »Die anderen dürfen auch mitlaufen.«
»Das ist mir egal.«
Sie bemerkte, dass sie Aufmerksamkeit erregte. Leute grinsten, hielten sie wohl für überängstlich. Nun, sollten sie. Entschlossen zog sie Robin mit sich. »Komm jetzt!«
»Hat Robin etwas ausgefressen?«, fragte Samuel, der plötzlich vor ihnen stand. Sein Papphelm hing ihm in Fetzen vom Kopf.
»Nein«, antwortete Laura. »Es ist nur …«
Über ihren Köpfen donnerte es. Noch während Laura angespannt den Atem anhielt, schlug direkt vor ihren Füßen ein dicker Eisbrocken auf das Kopfsteinpflaster. Der Aufprall sprengte ihn in Dutzende kleinere Stücke. Erschrocken sprang Laura zur Seite. Weitere Eisklumpen folgten. Die Kinder stießen überraschte Schreie aus. Laura traute ihren Augen nicht. Das, was da vom Himmel auf sie niederging, war Hagel. Aber diese Hagelkörner waren faustgroß.
Auf dem Platz brach Panik aus. Direkt vor Laura wurde ein Mann am Kopf getroffen und ging zu Boden. Verängstigte Kinder schrien und rannten wild durcheinander. Verzweifelt versuchten sich die Menschen in Sicherheit zu bringen. Rasch waren die wenigen verfügbaren Unterstände an Grillbuden und vor den Cafés belegt. Aber wirklich Schutz bot hier nichts.
Ein heftiger Schlag gegen Lauras Schulter jagte ihr einen stechenden Schmerz über den Rücken. Ein Hagelbrocken hatte sie getroffen. Praktisch im selben Moment hörte sie Robin aufschreien. Er drückte beide Hände auf seinen Kopf und begann zu weinen. Ein dünner Blutfaden sickerte zwischen seinen Fingern hervor. Lauras Herz setzte einen Schlag aus. Als glich dieser Treffer einem Weckruf, löste sie sich aus ihrer Starre. Sie blickte sich hektisch um. An den Unterständen der Grillbuden, sowie den wenigen überdachten Verkaufsständen reichte der Platz längst nicht mehr für die vielen Menschen aus. Auch vor den umliegenden Cafés drängte sich die Menge vor verstopften Türen.
Laura packte mit der einen Hand Robin und mit der anderen Samuel und rannte mit den beiden auf einen Traktor zu, der wenige Meter entfernt mit laufendem Motor mitten auf dem Platz stand. Die Frontscheibe war eingeschlagen, der Fahrer hielt sich mit beiden Händen das blutende Gesicht. Vermutlich hatten ihn Glassplitter verletzt.
»Unter den Anhänger!«, brüllte Laura und drückte die beiden Kinder nach unten. Robin und Samuel verstanden und krochen auf allen vieren unter die Ladefläche. Dann ging auch Laura auf die Knie und robbte unter den Anhänger. Mehrere Erwachsene und Kinder folgten ihrem Beispiel bis es keinen Platz mehr gab. Hoffentlich kam der Fahrer nicht auf die Idee, plötzlich loszufahren. Er schien schwer verletzt zu sein. Wer konnte schon sagen, was in diesem Augenblick in ihm vorging? Ihnen blieb nichts anderes übrig, als das Risiko einzugehen. Die Alternative war gefährlicher.
Während der Hagel unablässig über ihnen auf die Ladefläche hämmerte, untersuchte Laura Robins Wunde. Behutsam tastete sie seinen Kopf ab, was er mit einem Aufschrei quittierte.
»Schon gut«, sagte sie beruhigend, »ich bin vorsichtig.« Sie teilte seine Haare an der Stelle, an der sie die Wunde vermutete, doch es war zu dunkel, um viel zu erkennen.
»Mein Kopf tut weh«, jammerte Robin.
»Ich weiß, Schatz. Wenn wir zu Hause sind, verarzten wir dich sofort.« Sie drückte ihm einen Kuss auf die Wange und hoffte, er würde ihre eigene Unruhe nicht bemerken. Sobald der Hagel vorbei war, würde sie ihn ins Krankenhaus bringen müssen. Doch bis dahin waren sie zum Warten verdammt. Frierend und zitternd beobachteten sie die schrecklichen Szenen, die sich auf dem Rathausplatz abspielten.
Männer, Frauen und Kinder wurden von Hagelbrocken getroffen und stürzten, viele mit blutenden Platzwunden. Sie hielten die Unterarme schützend über die Köpfe und rollten sich zusammen, um den herabstürzenden Eisklumpen so wenig Angriffsfläche wie möglich zu bieten. Kinder irrten über den Platz und riefen nach ihren Eltern, die wer weiß wo sein mochten. Gleichzeitig rannten Eltern umher, die verzweifelt nach ihren Kindern suchten. Ein älterer Mann stolperte in gebückter Haltung über den Platz. Ein schweres Hagelgeschoss traf ihn im Nacken. Er sackte zusammen und blieb reglos liegen. Zwei kleine Mädchen, keine sechs Jahre alt, kamen in Lauras Sichtfeld. Sie trugen rosa Kleidchen, hielten sich an den Händen und weinten erbärmlich. Wo zum Teufel waren ihre Eltern? Laura brach der Anblick der verstörten Mädchen das Herz. Sie konnte die beiden unmöglich ihrem Schicksal überlassen.
Sie wollte gerade unter dem Anhänger hervorkriechen, da fasste Robin sie angsterfüllt an der Schulter. »Wo willst du hin, Mama?«
»Ich bin gleich wieder da.«
»Nein«, rief er mit aufgerissenen Augen, die rechte Gesichtshälfte blutverschmiert. »Du sollst nicht weggehen.«
»Siehst du diese Mädchen? Ich bringe sie nur schnell zu uns in Sicherheit.«
»Nein! Lass mich nicht allein.« In seinen Augen standen Tränen.
»Sie sollten auf Ihren Sohn hören«, mischte sich ein Mann ein, der neben ihr hockte. »Sie bringen sich nur selbst in Gefahr.«
»Einer muss diesen Mädchen helfen.« Laura ließ sich nicht beirren. »Und Sie denken ja offensichtlich nicht daran.«
Der Mann sah skeptisch unter dem Anhänger hervor. »Von welchen Mädchen reden Sie überhaupt?«, fragte er unwirsch.
Sie wollte ihn schon fragen, ob er eigentlich blind sei, als ihr auffiel, dass die Mädchen verschwunden waren.
Der Hagelsturm wütete weiter. Er zerstörte Fenster, Jalousien, Autoscheiben und durchschlug Dachziegel. Er zerfetzte Balkonpflanzen, Dekorationen an Häusern und Umzugswagen sowie die Sonnenschirme vor den Cafés. Auf dem Kopfsteinpflaster bildete sich bereits eine weiße Schicht. Das Schlimmste jedoch waren die Menschen, die über den Platz stolperten und Schutz suchten, wo es keinen gab. Laura schloss die Augen. Sie konnte das alles nicht mehr mitansehen.
Und dann war der Spuk plötzlich vorbei. Das Prasseln auf der Ladefläche des Anhängers ebbte ab. Für einen Augenblick herrschte eine gespenstische Stille. Der Hagelschauer mochte insgesamt nur wenige Minuten gedauert haben. Diese Zeitspanne jedoch hatte gereicht, um Bredenstedt ins Chaos zu stürzen.
Allmählich kehrten die Geräusche zurück, die der Hagel zuvor übertönt hatte. Das Weinen, Schluchzen und Rufen. Laura gab Robin und Samuel ein Zeichen, und gemeinsam krochen sie unter dem Anhänger hervor.
Der Rathausplatz war nicht wiederzuerkennen. Alles war unter einer nun schmelzenden Eisschicht verborgen. Dampfschwaden waberten über den Platz. Unzählige Körper krümmten sich auf dem Boden. Eltern hockten vor ihren Kindern, versorgten notdürftig ihre Wunden.
»Mir ist übel, Mama.« Robin war kreidebleich. Noch immer sickerte Blut aus seiner Wunde am Kopf.
Laura ging vor ihm in die Hocke und umarmte ihn. Sie wollte etwas Beruhigendes zu ihm sagen, doch noch bevor sie den Mund aufmachen konnte, verlor er das Bewusstsein und erschlaffte in ihren Armen.
4
LAKE ALEXANDRIA, SÜDAUSTRALIEN
Obwohl ihnen seit vielen Meilen kein Fahrzeug begegnet war, setzte Riley Dohaney vorschriftsmäßig den Blinker, kurz bevor er die Abzweigung erreichte, die von der Poltalloch Road auf die staubige Zufahrtsstraße zum Leuchtturm führte. Auf der unebenen Piste wurden Riley und sein Beifahrer Steve Jenkins ordentlich durchgeschüttelt. Die Kette mit dem Anhänger des gekreuzigten Heilands, die Riley um den Rückspiegel gelegt hatte, flog von einer Seite zur anderen. Riley verringerte die Geschwindigkeit auf zehn Meilen pro Stunde. Auf ein paar Minuten kam es nicht an. Seit er aus gesundheitlichen Gründen frühzeitig in Pension gegangen war, hatte er jede Menge Zeit. Und jeder neue Tag war für ihn ein Gottesgeschenk. Er bekreuzigte sich. Neben ihm verdrehte Steve genervt die Augen. Riley bemerkte es, sagte jedoch nichts. Auch Steve würde eines Tages erkennen, dass der Sinn des Lebens im Glauben bestand und nicht darin, stundenlang vor dem Fernseher zu hocken, Football anzuschauen und dabei Donuts zu verdrücken.
Sie erreichten ihr Ziel. Der sieben Meter hohe Point-Malcolm-Leuchtturm stand seit 1878 an dem kleinen Kanal, der den Lake Alexandria mit dem Lake Albert verband. Sein Erhalt war dem Denkmalschutzverein »Poltalloch Homestead Heritage« zu verdanken, in deren Auftrag Riley zweimal pro Woche ehrenamtlich vor Ort nach dem Rechten sah. Er stellte den Motor ab, und sie stiegen aus. Sofort umwehte sie ein warmer Wind. Eine Libelle flog heran, schwirrte einen Moment lang vor Rileys Kopf herum und klammerte sich dann an die Antenne des Jeeps.
»Hätt’ nicht gedacht, dass es heute so heiß wird«, stöhnte Steve. Er liebte es, sich zu beklagen.
»Ziemlich warm, in der Tat.« Nachdenklich setzte Riley seinen breitkrempigen Lederhut auf und zog zur Sicherheit die Schnüre unter dem Kinn fest. Der Wind war stark genug, um den Hut über die Klippen in den See zu wehen.
»Dauert’s lang?« Steve kam um den Jeep gewatschelt und rückte seine Baseballkappe der Adelaide Crows zurecht.
»Wir sind schneller wieder fort, als ein Schaf geschoren ist.« Riley ließ seine Blicke über das Gelände wandern. Neben dem grellweiß angestrichenen Leuchtturm stand das ehemalige Wärterhäuschen. Ein solider Backsteinbau, der dank regelmäßiger Renovierungsarbeiten gut in Schuss war. Ansonsten gab es außer vertrocknetem Gras, einigen kniehohen Büschen und einem einsamen abgestorbenen Baum nicht viel zu sehen. Die karge Landschaft besaß einen herben Charme. Riley schritt das Gelände ab. Mit dem Leuchtturm und dem Wärterhäuschen war alles in Ordnung. Wie üblich. Doch etwas irritierte Riley. Irgendwie wirkte der Ort verändert.
Ein Kreischen hoch oben am Himmel erregte Rileys Aufmerksamkeit. Ein Adler drehte seine Kreise und stieß kurze, spitze Schreie aus. Unter ihm, deutlich tiefer, segelten vier Brillenpelikane über den See, den Riley von seinem Standpunkt aus jedoch nicht sehen konnte. Dazu stand er zu weit vom Rand der Klippe entfernt. Der Adler kreischte erneut.
»Was ist nun?«, fragte Steve. »Wenn man bei Doc Flanner nicht pünktlich ist, untersucht der einen nicht.«
»Du wirst deinen Termin schon nicht verpassen.« Allmählich bereute Riley es, Steve angeboten zu haben, ihn heute in die Stadt mitzunehmen.
Er drehte sich um und ging zurück zum Jeep. Auf der Kühlerhaube bemerkte er eine Libelle. Sie lag rücklings da und bewegte sich nicht. Zu seinem Erstaunen sah er jetzt weitere tote Libellen auf dem Boden. Er schob seinen Hut in den Nacken und suchte die nähere Umgebung ab. Dutzende tote Libellen lagen rund um den Wagen verteilt im Staub.
»Heilige Scheiße«, hörte er in diesem Moment Steve ausrufen, »das hier musst du dir ansehen!«
Riley fuhr herum. »Wie oft habe ich dir gesagt, dass du nicht fluchen sollst.«
Steve stand am Rand der Klippen und starrte hinunter. »Das musst du dir ansehn, Mann«, wiederholte er nur.
Riley trat neben ihn.
Lake Alexandria war ein seichter See, gespeist von mehreren Flüssen, die allesamt den Osthängen der südlichen Mount Lofty Ranges entsprangen. Bei Goolwa, einige Meilen südwestlich von Point Malcolm, verband die Murray-Mündung den See mit dem Ozean. Bei geringer Wasserführung der Flüsse war diese Mündung in der Vergangenheit häufig von einer Sandbank verschlossen gewesen. Dann hatten Flut und Südweststürme Meerwasser in großen Mengen in den See gedrückt. Um dies zu vermeiden, hatte man eine Reihe von Flutwehren zwischen den Inseln gebaut. Seitdem blieb der Wasserpegel ebenso wie der Süßwassergehalt des Sees konstant. Ein Umstand, der für die Fischpopulation, die größtenteils aus Karpfen bestand, außerordentlich wichtig war. Doch jetzt traute Riley seinen Augen nicht. Der Wasserpegel des Sees war über Nacht um mindestens fünfzehn Meter abgesunken.
»Der See verschwindet«, raunte Steve.
Riley trat einen Schritt näher an die Klippen, um das Ufer direkt unter ihnen betrachten zu können.
»Das ist doch nicht möglich.« Mit seinen Augen fuhr Riley die dunkle, rund um den See verlaufende Linie ab, die, wie er vermutete, die ursprüngliche Uferbegrenzung markierte. Durch den geringen Wasserstand hatte sich der See in Form und Ausdehnung verändert. Wie konnte so etwas über Nacht geschehen?
»Warum glitzert das Wasser so komisch?«, fragte Steve.
»Was meinst du?« Riley sah genauer hin. Jetzt erst bemerkte er, dass die Oberfläche des Sees außergewöhnlich silbern in der Morgensonne glänzte. Je nach Sonnenstand schimmerte das Wasser üblicherweise in einem hellen Türkis oder tiefdunklen Blau. Aber geglitzert hatte es bisher nie. Als hätte jemand geriffelte Alufolie vor ihnen ausgebreitet.
Die Erkenntnis traf Riley wie ein Hieb in die Magengrube. Irgendwo weit über ihm kreischte wieder der Adler. Riley nahm kaum Notiz davon. Er starrte auf den See und bekreuzigte sich. »Du meine Güte.«
Er hastete zum Jeep, kramte sein Fernglas aus dem Kofferraum und lief zu den Klippen zurück. Er hob das Fernglas an seine Augen. Und dann sah er es. Seine Schultern sackten nach unten.
»Mann, was ist los mit dir?«, fragte Steve.
Mit starrem Blick reichte Riley ihm das Fernglas.
Kurz darauf stieß Steve keuchend Luft aus. »Heilige Scheiße! Das sind ja alles Fische. Alle krepiert.«
Diesmal maßregelte Riley ihn nicht für seine derbe Wortwahl. Der Anblick des Sees, der nicht nur vor seinen Augen zu verschwinden schien, sondern dessen Oberfläche zudem von zigtausenden toten Fischen bedeckt war, die mit dem Bauch nach oben im Wasser trieben, lähmte ihn. O Herr, welche Sünden haben wir begangen, dass du uns so bitter bestrafst?
»Muldjewangk«, flüsterte Steve.
»Wie bitte?«
»Mann, die Geschichte von den Aborigines. Sie sagen, Lake Alexandria wird von einem Monster bewohnt. Von Muldjewangk. Und Muldjewangk taucht von Zeit zu Zeit auf und fordert seine Opfer.«
»Unsinn«, kommentierte Riley. »Komm, wir müssen das sofort melden.«
Hinter ihnen prallte etwas mit voller Wucht auf den Boden, als hätte jemand aus großer Höhe eine Bowlingkugel fallen gelassen. Riley und Steve wirbelten herum. Wenige Schritte vom Jeep entfernt lag der Adler, der vor wenigen Minuten noch seine Kreise am Himmel gezogen hatte. Eine Staubwolke hüllte ihn ein, sein Hals war bogenförmig verdreht. Um ihn herum wirbelten Federn durch die Luft, die vom Wind fortgetragen wurden.
Riley Dohaney glaubte nicht an die alten Aborigines-Mythen. Er glaubte an die Macht des Herrn. Für ihn stand fest, dass Gott der Herr hier seine Hand im Spiel haben musste.
Entweder Er oder der Teufel.
5
Laura drückte das Gaspedal ihres Polos bis zum Bodenblech durch und holte aus der alten Mühle heraus, was aus ihr herauszuholen war. Die Bäume am Rand der Landstraße flogen an ihr vorbei. Robin lag bewusstlos auf der Rückbank. Samuel saß neben ihm, verstört und ängstlich. Laura hatte ihn kurz entschlossen mitgenommen. Sie würde ihn später zu Hause abliefern. Jetzt war ihr Ziel das Siloah-Klinikum in Hannover.
Sie fuhr wie eine Verrückte, und als sie für einen Augenblick im Rückspiegel ihr eigenes Gesicht erblickte, fand sie, dass sie mit den herabhängenden nassen Haaren und dem verlaufenen Mascara auch exakt so aussah. Auf der Gegenfahrbahn kamen ihr Krankenwagen mit eingeschalteten Blaulichtern entgegen. Bredenstedt befand sich im Ausnahmezustand und benötigte jede verfügbare Hilfe. Laura hupte wild, scheuchte einen Mercedes zur Seite und überholte ihn an einer unübersichtlichen Stelle. Die Sorge um Robin trieb sie an. Im Rückspiegel warf sie ihm einen sorgenvollen Blick zu. Sein Zustand schien sich zunehmend zu verschlechtern. Der Druckverband, den sie ihm mit einer Mullbinde aus dem Verbandskasten notdürftig angelegt hatte, war bereits rot verfärbt. Laura presste die Lippen aufeinander und kämpfte mit den Tränen.
Endlich erreichten sie das Krankenhaus. Laura bog auf die Zufahrt ab und bremste scharf. Auf die Idee, die nächstgelegene Klinik anzufahren, war offenbar halb Bredenstedt gekommen. Vor dem überdachten Haupteingang standen kreuz und quer Autos. Männer eilten mit Kindern auf den Armen in die Notaufnahme, Erwachsene stützten sich gegenseitig auf dem Weg in das Gebäude. Krankenwagen fuhren vor, luden im Eiltempo Verletzte ab, bevor sie wieder davonbrausten. Sirenen heulten. Ununterbrochen wurde gehupt. Laura sah sich um. Was sollte sie tun? Das Auto gleich hier abstellen und Robin bis zum Eingang tragen? Und Samuel so lange allein lassen?
Sie traf eine Entscheidung und fuhr im Slalom an Autos und Menschen vorbei bis direkt vor den Haupteingang. Sie parkte halb auf der Zufahrt, halb in einem Blumenbeet, damit die Krankenwagen durchkamen. Dann sprang sie aus dem Wagen.
»He! Sie können da nicht stehen bleiben.« Ein Pfleger kam wild gestikulierend angerannt. »Fahren Sie sofort weiter!«
»Helfen Sie mir. Bitte.« Sie öffnete die hintere Tür, deutete auf Robin.
Der Pfleger sah das Kind, seufzte, dann zog er Robin von der Rückbank und hob ihn vorsichtig hoch. »Wie heißt er?«
»Robin Wagner. Ich bin seine …«
»Ich kümmere mich um ihn. Und Sie fahren jetzt auf der Stelle die Kiste da weg.«
Laura nickte und sah ihm hinterher, wie er mit ihrem bewusstlosen Sohn auf dem Arm in der Notaufnahme verschwand. Als sich die Tür hinter den beiden schloss, begann sich alles um Laura herum zu drehen. Sie stützte sich mit beiden Händen gegen die Karosserie ihres Wagens und atmete tief ein und aus. Der Schwindelanfall verflog. Sie warf Samuel einen Blick zu, setzte sich hinters Steuer und fuhr langsam auf den Klinikparkplatz.
Die Wartezeit zog sich endlos hin. Samuel war längst von seiner Mutter abgeholt worden, die sich überschwänglich bei Laura dafür bedankt hatte, dass sie sich um ihn gekümmert hatte. Jetzt stand Laura vor Robins Krankenbett und sah auf ihre Armbanduhr. Seit über zwei Stunden wartete sie nun schon auf einen Arzt, der ihr etwas über Robins Zustand sagen konnte. Er lag in einem Vierbettzimmer, womit er es besser erwischt hatte als viele andere, die wegen Überbelegung die Nacht auf den Gängen verbringen mussten. In den anderen Betten lagen ausnahmslos Männer, von denen einer schrecklich röchelte. Der Geruch nach Desinfektionsmitteln reizte Lauras Nase. Robin schlief tief und fest. Ein weißer Turban aus Mullbinden umhüllte seinen Kopf. Er war an Überwachungsgeräte angeschlossen, die Puls und Herzfrequenz anzeigten und gelegentlich piepsten. Laura streichelte Robins Hand und betrachtete den Überwachungssensor, den man über seinen Zeigefinger gestülpt hatte.
»Frau Wagner?«
Sie schreckte hoch. Vor ihr stand ein Mann in einem weißen Arztkittel. Ein Stethoskop hing aus einer Seitentasche. Er war höchstens Ende dreißig, obwohl seine Haare bereits vollständig ergraut waren. Irgendwie kam er Laura bekannt vor.
»Ich bin Dr. Fund. Ich habe Ihren Sohn untersucht und den Riss genäht.«
»Wie schlimm ist es?«
»Ich musste mit fünf Stichen nähen, aber das ist nicht das Problem.«
»Sondern?«
»Vielleicht zuerst die gute Nachricht. Wir haben den Schädel Ihres Sohnes geröntgt. Es ist nichts gebrochen. Die Calvaria, das Schädeldach, ist intakt. Auch die Lamina externa und interna sind unverletzt, was sehr gut ist.«
»Aber?«
Dr. Fund legte ihr väterlich eine Hand auf den Unterarm. »Entschuldigung. Ich habe Sie beunruhigt. Das war nicht meine Absicht.« Er musterte sie. »Sagen Sie, Frau Wagner, erinnern Sie sich nicht mehr an mich? Denken Sie ein paar Jahre zurück. Damals waren meine Haare noch schwarz.« Er lächelte.
Laura schlug sich mit der flachen Hand gegen die Stirn. »Dr. Fund. Natürlich … Bitte entschuldigen Sie. Ich bin etwas durch den Wind.«
»Das ist verständlich. Außerdem sind die Jahre nicht spurlos an mir vorbeigezogen.« Er strich sich durch die Haare.
»Es ist mir trotzdem unangenehm. Schließlich haben Sie Robin damals das Leben gerettet«, und etwas leiser fügte sie hinzu, »und mir vermutlich ebenso.«
»Jetzt übertreiben Sie. Auch wenn ich zugeben muss, dass die Umstände wirklich außergewöhnlich waren.«
Laura erwiderte nichts.
»Die Medien haben die Sache ziemlich aufgebauscht, wenn ich mich recht erinnere«, sagte er nachdenklich. »Wissen Sie, als der Notruf eintraf, kam ich praktisch frisch von der Universität und …«
»Ich bin Ihnen wirklich sehr dankbar für alles«, unterbrach Laura ihn, »aber ich habe damit abgeschlossen.«
»Natürlich.« Er nickte verständig.
»Was ist mit meinem Sohn? Sie sagten, es gebe auch eine schlechte Nachricht?«
»Robin hat vermutlich eine mittelschwere Gehirnerschütterung erlitten. Genaueres kann ich erst sagen, wenn wir weitere Untersuchungen vorgenommen haben. Darum möchte ich ihn gerne für ein paar Tage zur Beobachtung hierbehalten. Sind Sie damit einverstanden?«
»Habe ich denn eine Wahl?«
»Er ist bei uns in guten Händen. Gehen Sie nach Hause, und schlafen Sie sich aus. Wir sehen uns morgen.« Er schenkte ihr zum Abschied ein Lächeln und verschwand mit schnellen Schritten.
Sie sah ihm nach. Er hatte gut reden. Wie sollte sie nach dem heutigen Tag an Schlaf denken? Zu der Sorge um Robin gesellten sich nun zudem längst verdrängte Erinnerungen, wachgerufen durch einen Arzt, der nur freundlich sein wollte, aber nicht ahnte, was seine Worte in ihrem Inneren auslösten. Die Angst drohte zurückzukehren.
Der röchelnde Mann im Bett gegenüber bekam einen Hustenanfall. Das rasselnde Geräusch seiner Lungen holte Laura in die Gegenwart zurück. Sie zog einen Plastikstuhl heran, setzte sich neben Robins Bett, umschloss seine Hand und wartete darauf, dass die Vergangenheit wieder verblasste. Das tat sie immer. Früher oder später.
6
GAKONA, ALASKA
Brad Ellison staunte nicht schlecht. Touristen verirrten sich nur selten in diese schneebedeckte Einöde. Zwei oder drei Wohnmobile in den Sommermonaten, dazu ein paar einheimische Jäger und Fallensteller während der Jagdsaison. Mehr gab es kaum zu sehen. Ellison machte ein Eselsohr in sein Buch, erhob sich von seinem Stuhl und drückte seine Nase an das beschlagene Fenster des Wachhäuschens, um einen besseren Sichtwinkel zu bekommen.
Das Wohnmobil holperte über die verschmutzte Zufahrtsstraße. Staubwolken wirbelten hinter dem Fahrzeug auf. Es erreichte die Zufahrt der Anlage, wo es stoppte. Wie ein Aufkleber an der Fronseite verriet, stammte der Wagen von »Fraserway RV«, einem der größten Wohnmobilvermieter des Landes. Hinter dem Lenkrad saß ein Mann, neben ihm auf dem Beifahrersitz eine Frau. Trotz der verdreckten Scheiben konnte Ellison erkennen, dass sie kupferrotes Haar hatte. Er fragte sich, warum der Fahrer die Scheibenwischer nicht benutzte? Vielleicht waren die Spritzwasserdüsen eingefroren, was bei diesen älteren Modellen häufig vorkam. Aber warum hielten sie hier? Vermutlich hatten sie die Anlage mit dem Campingplatz verwechselt, der sich rund sieben Meilen weiter den Glenn-Highway hinunter befand. Ellison seufzte.
Er zog seinen Parka über, rückte Gürtel und Pistolenhalfter zurecht, trat aus dem Wachhäuschen und postierte sich am Tor. Es war bereits hell, obwohl sich die Morgensonne hinter einer geschlossenen Wolkendecke versteckte. Bis auf einen brummenden Dieselgenerator, der hinter dem Wachhäuschen für Strom sorgte, war es totenstill. Ellison blickte durch die Eisenstäbe des Tors und wartete. Eine geschlagene Minute tat sich gar nichts. Dann öffnete sich die Fahrertür, und der Mann stieg aus. Er war grauhaarig, hatte einen Vollbart und trug eine dicke, dunkelblaue Daunenjacke. In einer Hand hielt er eine halb entfaltete Landkarte. Er blickte abwechselnd auf die Karte und die Straße und diskutierte dabei mit seiner Frau. Immer wieder deutete er die Straße entlang.
Ellison musste grinsen. Die beiden hatten sich tatsächlich verfahren, und vermutlich warf sie ihm vor, dass er die zusätzlichen acht Dollar pro Tag für ein Navigationsgerät hatte sparen wollen. Weshalb die beiden allerdings den Glenn-Highway überhaupt verlassen hatten, war Ellison unbegreiflich.
Der Mann wurde lauter. Sein Atem kondensierte in der eisigen Luft. Er schien Ellison gar nicht zu bemerken. Inzwischen war Ellison sicher, dass die beiden den Campingplatz suchten. Die auf keiner Touristenkarte verzeichnete, rundum eingezäunte Anlage, vor der sie parkten, verwirrte sie.
Ellison verlor die Geduld. »Hey!«, rief er.
Der Mann hob den Kopf und sah zu ihm herüber.
»Kommen Sie!«, rief Ellison und winkte ihn zu sich.
Der Mann zuckte mit den Schultern und kam auf ihn zu. Sein Gang war trotz seiner klobigen Fellstiefel seltsam federnd.
»Suchen Sie den Campingplatz?«, fragte Ellison.
»Man sieht mir den ahnungslosen Touristen wohl auf einen Kilometer an?« Der Mann lächelte und hielt dabei die Landkarte vor sich.
Ellison grinste, öffnete die Tür im Zaun und trat hinaus. »Tja, könnte man so sagen …«
»Gut«, sagte der Grauhaarige. Nach wie vor lächelnd zog er eine Pistole hinter der Landkarte hervor und richtete sie auf Ellisons Kopf. »Dann habe ich ja alles richtig gemacht.«
Das Grinsen erstarb auf Ellisons Lippen. Ohne dass es einer Aufforderung bedurft hätte, hob er die Hände. Trotz seiner Überraschung identifizierte er die Pistole in Sekundenbruchteilen als eine SIG-Sauer P226, eine der Standardwaffen der Navy Seals. Der Grauhaarige, der nun wahrlich nicht mehr wie ein ahnungsloser Tourist aussah, nahm Ellisons Waffe an sich und steckte sie in eine der Taschen seiner Jacke.
»Was soll das werden?«, fragte Ellison.
»Wonach sieht es denn aus? Du wirst jetzt das Tor öffnen, damit wir das Fahrzeug von der Straße schaffen können.«
Ellison warf einen raschen Blick auf das Wohnmobil. Die Frau schien nicht die Absicht zu haben, ihren Platz im warmen Fahrzeug zu verlassen. »Wisst ihr überhaupt, wo ihr hier seid?«
»In einer der am schlechtesten bewachten militärischen Einrichtungen, die ich kenne. Jetzt öffne das Tor!« Er drückte Ellison die Pistole gegen die Schläfe und schob ihn vor sich her.
Sie betraten das Wachhäuschen. Ellison betätigte den Toröffner. Der Grauhaarige riss ihn an der Schulter herum und stieß ihm die Pistole ins Kreuz. »Raus!«
Ellison wurde zur Beifahrertür des Wohnmobils geführt. Durch die verdreckten Scheiben sah er die Frau. Weshalb rührte sie sich nicht? Ellisons Magen sendete mit einem Mal flaue Signale.
»Aufmachen!«, befahl der Grauhaarige.
Ellison drückte die Türklinke herunter. Kaum hatte er die Tür einen Spalt weit geöffnet, sackte der Körper der Frau zur Seite und stürzte auf ihn zu. Ellison keuchte, spannte seine Muskeln an und fing sie auf. Hinter ihm lachte der Grauhaarige auf.
Verdutzt betrachtete Ellison das Ding in seinen Armen. »Eine Schaufensterpuppe?«
»Die roten Haare sind nicht schlecht, was?«
Ellison betrachtete die Puppe in seinen Händen. »Und jetzt?«
»Wirf sie in den Graben, und dann setz dich ans Steuer.«
Ellison gehorchte. Der Grauhaarige nahm auf dem Beifahrersitz Platz. Sie fuhren bis vor die ehemaligen Wohnhäuser der Anlage. Die flachen Gebäude hatten ihre beste Zeit lange hinter sich, falls sie jemals so etwas wie eine beste Zeit gehabt hatten. Die Farbe an den Wänden war im Laufe vieler strenger Winter verblasst und blätterte großflächig ab. Einige Rollläden waren heruntergelassen, andere hingen auf halber Höhe schief vor den Fenstern. Ein bärensicherer Müllcontainer stand unweit der Eingangstür.
»Aussteigen!« Der Grauhaarige wedelte mit der SIG-Sauer.
»Was wollen Sie hier?«, fragte Ellison, als sie sich vor dem Wohnmobil gegenüberstanden. »Die Anlage ist seit über zwei Jahren stillgelegt. Außer mir ist niemand hier.«
»Ich weiß. Aber wenn die Anlage tatsächlich stillgelegt ist – was machst du dann hier?«
Ellison setzte zu einer Antwort an, merkte aber, dass er darauf keine Antwort wusste.
»Siehst du?«, schnaubte der Grauhaarige. »Du bist nichts weiter als eine Marionette, die Befehle ausführt, ohne sie zu hinterfragen.« Damit griff er in seine Haare und zog sie mit einem Ruck vom Kopf. Unter der Perücke kam eine blank polierte Glatze zum Vorschein. Danach riss er sich den falschen Bart ab.
Der Mann, der da vor ihm stand, war kaum dreißig Jahre alt, schätzte Ellison. Allerdings durchzogen tiefe Furchen sein Gesicht. Jetzt öffnete er eine schmale Tür im hinteren Bereich des Wohnmobils, warf Perücke und Bart hinein und deutete auf fünf backsteingroße Pakete. »Hol die hier heraus, und leg sie auf den Boden.«
Die Konsistenz der ockerfarbenen, knetgummiartigen Pakete kam Ellison vertraut vor. »Ist es das, wofür ich es halte?«
»Diese Anlage wird nie wieder jemand bewachen müssen«, erklärte der Glatzkopf
»Ich nehme an, Sie haben Ihre Gründe, warum Sie ein paar veraltete Computer und ein paar Hundert Antennen in die Luft jagen wollen.«
»Darauf kannst du Gift nehmen.«
»Nun, es ist mir offen gesagt auch egal.« Ellison schluckte. »Lassen Sie mich bitte nur am Leben.«
»Das hängt ganz davon ab, ob du kooperierst.«
Die nächsten Minuten platzierte Ellison auf dem weitläufigen Antennenfeld hinter dem Gebäude mehrere C4-Sprengstoffpakete nach Anweisungen des Glatzkopfs, der unablässig die SIG-Sauer auf ihn gerichtet hielt. Ellison fragte sich, warum er diese Arbeit nicht selbst erledigte. Unter seinen dicken Klamotten schien sich ein durchtrainierter Körper zu verbergen. Und doch wirkten manche seiner Bewegungen seltsam unsicher. Was stimmte mit diesem Kerl nicht?
Nach getaner Arbeit führte der Glatzkopf ihn zum Hauptgebäude, vor dessen Tür ein vollautomatischer 4-4-2-Fingerprintscanner angebracht war. Mit einem Schlag wurde Ellison klar, weshalb er noch am Leben war. Der Scanner war in der Lage, mittels Infrarotsensoren zu unterscheiden, ob ein Finger durch eine lebende Person aufgelegt wurde, oder ob es sich um eine Kopie oder gar um totes Material handelte. Es hätte dem Glatzkopf also nichts genutzt, Ellison zu töten, ihm die Hände abzuhacken und diese auf den Sensor zu legen.
Nach der Anmeldeprozedur entriegelte sich die Tür, und sie traten in einen Gang, von dem alle paar Meter weitere Gänge abzweigten. Das alte Gebäude war unbeheizt. Modriger Geruch nach feuchten Teppichböden und schimmligen Tapeten schlug ihnen entgegen. Auch hier musste Ellison den Sprengstoff in mehreren leer stehenden Räumen platzieren. Einzig im Technikraum standen ein paar alte Computer und Monitore in einem Regal herum. Nachdem Ellison das letzte C4-Paket neben dem ehemaligen Hauptserver deponiert hatte, wurde er nach draußen geführt.
Vor dem Gebäude verengten sich die Augen des Glatzkopfs. »Auf die Knie!«
Ellisons spürte, wie ihm das Blut aus dem Gesicht wich. Alles in ihm verkrampfte sich. »Sir, bitte … Ich …«
»Nenn mich nicht Sir!«, brüllte der Glatzkopf und hieb ihm die SIG-Sauer gegen die Schläfe.
Ellison ging zu Boden. Er spürte die kalte Nässe des schneematschbedeckten Bodens, die sich durch den Stoff seiner Hose fraß. Mühsam richtete er sich auf. Sein Schädel pochte. »Bitte nicht. Ich bin verheiratet.«
»Jeder macht Fehler im Leben.« Der Glatzkopf richtete seine Waffe auf Ellison und drückte ab.
Ein heftiger Schlag gegen die Brust riss Ellisons Oberkörper zurück. Er spürte, wie das abgefeuerte Projektil glühend heiß in sein Herz fuhr und es zerfetzte. Dann kippte er zur Seite.
Brad Ellison war tot, noch bevor er auf dem Boden aufschlug.
7
Am Morgen nach dem Hagelsturm fuhr Laura auf das Firmengelände der Andra AG. Der Konzern – ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Hochfrequenztechnik – hatte seinen Sitz in einem modernen Industriebau, im Gewerbegebiet auf dem Tönniesberg in Bornum, am östlichen Stadtrand von Hannover. Auf dem akkurat gestutzten Grünstreifen vor dem Parkplatz stand ein Fahnenmast mit einer auf halbmast gesetzten Bundesflagge. Nach dem verheerenden Tornado von Berlin befand sich die gesamte Republik im Ausnahmezustand. Die furchtbare Katastrophe beherrschte die Medien. Über den Hagel, der bei Hannover niedergegangen war, redete angesichts dieser Tragödie kaum jemand. Er war nur eine Randnotiz.
Laura parkte ihren Polo, stieg aus und kniff die Augen zusammen. Die Sonne schien an einem wolkenlosen Himmel, als wäre am Wochenende nicht das Geringste vorgefallen. Laura dachte an ihre Sonnenbrille, die sie während des Hagelsturms verloren hatte. Sie hatte in der Nacht kaum geschlafen und hätte sie jetzt gut gebrauchen können. Sie strich den Rock ihres Kostüms glatt und schlug die Autotür zu. Der Lack blätterte von der Türkante ab, und nicht nur dort. Neben all den Dellen, die der Hagel in der Karosserie hinterlassen hatte, fiel es jetzt nicht weiter auf. Laura klopfte zweimal auf das Dach, als würde sie einem alten, verdienten Freund aufmunternd auf die Schulter klopfen. Dann machte sie sich auf den Weg in ihr Büro. Furchtbare Dinge waren an diesem Wochenende geschehen, doch Stillstand war im Leben nicht vorgesehen. Die Erde drehte sich weiter. Es war Montag.