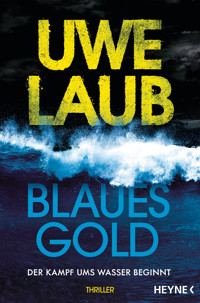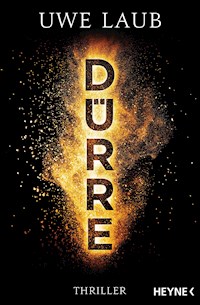
11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Wir dachten, wir hätten noch Zeit. Jetzt bezahlen wir den Preis.
Der Klimawandel beschleunigt sich unaufhaltsam. Dürren und Ernteausfälle nehmen weltweit zu. In ganz Europa herrscht Hungersnot. Um der wachsenden Bedrohung etwas entgegenzusetzen, beschließen die Länder drastische Maßnahmen: Landwirtschaftliche Betriebe werden verstaatlicht, eine App soll den CO2-Fußabdruck eines jeden Bürgers kontrollieren. Als die Geschwister Julian und Leni des CO2-Betrugs angeklagt werden, verlieren sie ihre Existenzgrundlage – und werden erbarmungslos gejagt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 522
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
DASBUCH
Der Klimawandel beschleunigt sich unaufhaltsam. Dürren und Ernteausfälle nehmen weltweit zu. In Europa herrscht Hungersnot. Um der wachsenden Bedrohung etwas entgegenzusetzen, beschließen die Länder drastische Maßnahmen: Landwirtschaftliche Betriebe werden verstaatlicht, eine App soll den CO2-Fußabdruck eines jeden Bürgers kontrollieren. Als die Geschwister Julian und Leni des CO2-Betrugs angeklagt werden, verlieren sie ihre Existenzgrundlage – und werden erbarmungslos gejagt.
DERAUTOR
Uwe Laub wurde 1971 in Rumänien geboren. Er war zwei Jahre alt, als seine Eltern mit ihm nach Deutschland zurückkehrten. Laub arbeitete mehrere Jahre im Pharma-Außendienst, seit 2010 führt er das Unternehmen eigenständig. Seine Liebe gilt dem Schreiben. Für seine Wissenschafts-Thriller recherchiert er jahrelang. Sein Roman »Sturm« wurde zum Bestseller.
www.uwelaub.de
UWE LAUB
DÜRRE
THRILLER
WILHELM HEYNE VERLAG
MÜNCHEN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2021 by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Kerstin von Dobschütz
Umschlaggestaltung: DAS ILLUSTRAT, München,
unter Verwendung eines Motivs von © Shutterstock.com/Vandathai
Satz: Leingärtner, Nabburg
ISBN 978-3-641-26708-7V004
www.heyne.de
Für meine Mutter
Iss doch noch etwas, Bub! Es ist genug da.
1
November 2022
Nicht im Traum hätte Alex Baumgart jemals gedacht, dass ein zerknitterter, nach Bier stinkender Kassenbon einer verrauchten Studentenkneipe in Karlsruhe sein Leben verändern würde. Doch manchmal hielt das Schicksal Überraschungen bereit.
Alex hatte die Kneipe vor wenigen Minuten verlassen und eilte nun aufgekratzt über regennasse Bürgersteige nach Hause. Es war ein eiskalter, windiger Novemberabend, und Alex vergrub seine Hände tief in den Taschen seines gefütterten Anoraks. Nieselregen benetzte sein Gesicht und durchnässte seine schulterlangen Haare. Doch all das nahm Alex kaum wahr. Seine Gedanken kreisten einzig um den Kassenbon in seiner Hand. Seine Finger umklammerten das Thermopapier, als wollten sie es nie wieder freigeben.
Es war erstaunlich. In Podcasts hörte Alex häufig Geschichten erfolgreicher Menschen, die in ihrem Leben Außergewöhnliches geleistet und manchmal sogar ganze Imperien aufgebaut hatten. Befragte man diese Menschen nach dem Ursprung ihres Erfolgs, rangierten harte Arbeit und Durchhaltevermögen meistens auf den vorderen Plätzen. Die Fähigkeit, Rückschläge wegzustecken und unbeirrt an einem Ziel festzuhalten, wurde ebenfalls häufig genannt. Hakte man weiter nach und fragte Visionäre, wie alles begonnen hatte – genauer, an welchem Punkt ihres Lebens sie erkannt hatten, welchen Weg sie einschlagen mussten –, antworteten nicht wenige, alles habe mit einer simplen Idee begonnen. Während Alex im fahlen Licht einer Straßenlaterne eine menschenleere Straße überquerte und auf den gegenüberliegenden Bürgersteig wechselte, dachte er darüber nach, dass er das Potenzial besaß, zu einem dieser Visionäre zu werden. Vorsichtig rieb er die Finger seiner rechten Hand aneinander, nur um den Bon zu spüren. Unbewusst musste er grinsen. Er war an etwas Großem dran. Das stand für Alex Baumgart in diesem Augenblick außer Frage.
Der Bürgersteig endete und mit ihm die Straße. Durch einen offenen Hinterhof, vorbei an mehreren überquellenden Müllcontainern, gelangte Alex in den nördlichen Otto-Dullenkopf-Park. Nach fünf Semestern, die er nun schon am Karlsruher Institut für Technologie Informatik studierte, kannte er so ziemlich jeden Schleichweg in diesem Stadtteil. Der Wind frischte auf, und Alex beschleunigte seine Schritte. Der Weg durch den stockdunklen Park war zwar ein wenig unheimlich, aber er sparte Alex mehrere Minuten Fußmarsch. Und ab sofort war seine Zeit kostbar. Er konnte es kaum erwarten, eine erste Skizze seiner Vision zu Papier zu bringen.
Wenig später betrat er die kleine Studentenbude, die er sich mit seinem besten Freund und Kommilitonen Tom Valcke teilte. Er streifte seine durchnässten Turnschuhe ab und eilte ins Wohnzimmer. Der Fernseher war aus, und die Tür zu Toms Zimmer stand einen Spaltbreit offen. Da kein Licht brannte, schien Tom noch unterwegs zu sein. Sein heutiges Date zog sich offenbar länger als üblich hin. Vermutlich waren die beiden in ihre Bude gegangen. Alex hoffte es, denn das würde ihm eine ruhige Nacht verschaffen, in der er ungestört arbeiten konnte.
Er ging in sein Zimmer, schälte sich aus dem Anorak und warf ihn auf den Wäscheberg, der sich auf einem Stuhl in der Ecke türmte. Er zog auch sein nach Rauch stinkendes T-Shirt aus und rubbelte sich damit die Haare trocken, bevor er es zu den anderen Klamotten auf den Haufen warf. Dann schlüpfte er in ein zerknittertes T-Shirt, das über dem Bettrand hing, schnappte sich seinen Notizblock, einen Kugelschreiber sowie den Laptop, ging ins Wohnzimmer und hockte sich im Schneidersitz auf das Sofa. Vorsichtig platzierte er den Bon neben sich und strich das Thermopapier glatt. Obwohl der Zettel leicht zerknittert war und der Rand eines feuchten Bierglases einen Teil der Beschriftung verwischt hatte, war der Text auf der Rückseite, auf den es Alex ankam, noch bestens zu erkennen. Während draußen der Regen stärker wurde und dicke Tropfen gegen die Fensterscheiben schlugen, nahm er Notizblock und Kuli in die Hand und begann, seine losen Gedankenfetzen in erste Stichworte zu fassen.
»Alter, was machst du da?«
Alex hätte vor Schreck beinahe seinen Kuli fallen lassen. Er sah von dem Notizblock auf, dessen Seiten sich mittlerweile ordentlich gefüllt hatten.
Tom Valcke stand in nassen Socken im Wohnzimmer und sah ihn fragend an. Er trug ein schwarzes Hemd mit aufgekrempelten Ärmeln und durchnässte Bluejeans. Er schwankte leicht, seine Haare klebten klatschnass an seinem Kopf, die Augen waren glasig. Zu allem Überfluss stank er nach kaltem Zigarettenrauch.
»Schon zurück?«, entgegnete Alex wenig erfreut. »Lief es heute nicht so mit deinem Date?«
»Hä?« Tom runzelte die Stirn. »Wie kommst du darauf? Im Gegenteil. Die Kleine ging ab wie ein junges Kätzchen auf Katzenminze.«
»Und warum bist du dann schon wieder zurück? Ehrlich, so früh hab ich nicht mit dir gerechnet.«
»Alter, hast du was geraucht?«
»Nee. Wieso?«
Tom schüttelte den Kopf und trottete in sein Zimmer. Während er sich auszog und sämtliche Klamotten von sich warf, rief er durch die offene Tür: »Ich bin von dir ja einiges gewohnt, aber hast du mal auf die Uhr gesehen?«
Alex stutzte und warf einen Blick auf die Zeitanzeige im Display seines aufgeklappten Laptops, das neben ihm auf dem Sofa lag. 3:47 Uhr. Oha. Verwundert rieb Alex sich über den Nacken. Saß er tatsächlich seit über sechs Stunden hier an seinen Notizen? Es kam ihm vor, als hätte er erst vor wenigen Minuten die Kneipe verlassen. Er hatte vollkommen die Zeit vergessen, während er wie in Trance Seite um Seite des Notizbuchs vollgekritzelt hatte. Der Kassenbon war in eine der Sofaritzen gerutscht, und Alex zog ihn heraus.
»Hey, Tom«, rief er, »ich muss dir was zeigen.«
»Alter, ich hab fünf Bier intus und zwei geile Nummern hinter mir. Ich hau mich ins Bett.«
»Nur kurz. Ich bin da an was dran. Ich will wissen, was du davon hältst.«
Nur in Unterhose erschien Tom in der Tür. »Ich kann dir sagen, was ich jetzt von ’ner ordentlichen Mütze voll Schlaf halte …«
»Geht auch ganz schnell.«
Tom musterte Alex und umgekehrt. Manchmal war Alex ein klein wenig neidisch auf Toms durchtrainierten Körper, der in Kombination mit seinem charismatischen Lächeln bei den Frauen definitiv gut ankam. Toms ständig wechselnde Eroberungen sprachen eine deutliche Sprache. Dann aber führte Alex sich jedes Mal vor Augen, dass Tom sich für diesen Körper mehrmals pro Woche im Fitnessstudio abquälte, und schon war Alex seine eigene hagere Statur vollkommen egal. Überhaupt brauchte man einen perfekt trainierten Körper seiner Auffassung nach nur dann, wenn man sonst nichts hatte oder konnte. Er selbst war einundzwanzig Jahre alt, untergewichtig und blass, und er strebte einen Bachelor in Informatik an, während eine Freundin nicht einmal ansatzweise am Horizont zu erahnen war. Er war kein Adonis, dafür wusste er, wie man Codes schrieb. Und darin war er besser als die meisten seiner Kommilitonen.
»Komm schon, Tom.« Er räumte den Platz neben sich frei und klopfte auf die Sitzfläche. »Nur fünf Minuten. Du wirst Augen machen.«
Tom seufzte. Er schlurfte zurück in sein Zimmer, zog sich ein weißes T-Shirt mit dem Aufdruck Kiss me, I will be rich one day über, und ließ sich dann neben Alex in die Sofakissen plumpsen. »Also?«
»Unsere ehemalige Stammkneipe, das Woodys, hat den verdammten Corona-Lockdown nicht überlebt, wie du weißt«, sagte Alex. »Deswegen hab ich mir heute mal die Kneipen rund um den Alten Schlachthof angesehen. Und in einer davon hab ich den hier bekommen …« Er hielt Tom den Bon vor die Nase.
»Alter, du lässt dir in einer Kneipe eine Rechnung geben und hebst sie auch noch auf?« Tom schüttelte verständnislos den Kopf. »Wegen Typen wie dir nennen sie uns Informatikstudenten Nerds. Ist dir schon klar, oder?«
»Sieh dir einfach an, was draufsteht.«
Tom zuckte mit den Schultern. »Du hattest heute Abend zwei Schöfferhofer Grapefruit Weizenbiere. Na und?«
»Nicht das.« Alex drückte ihm den Zettel in die Hand und deutete auf den Text, der auf der Rückseite in Kursivbuchstaben aufgedruckt war. »Das hier!«
»Für diesen Kassenbon«, las Tom gelangweilt vor, »wurden wertvolle Ressourcen wie Holz, Wasser und Energie verbraucht. Zudem befinden sich bedenkliche Chemikalien in den Farbentwicklern für Thermopapiere. Die geltende Kassenbonpflicht verursacht überflüssige Müllberge, deren Entsorgung wiederum Energie benötigt. Der unnötige CO2-Ausstoß im Zusammenhang mit der unsinnigen Kassenbonpflicht ist unverantwortlich. Jede zusätzliche Tonne in die Luft entlassenes CO2 trägt zur Klimaerwärmung bei und kostet uns somit nicht nur Geld, sondern langfristig auch unsere Zukunft. Diese Zeche zahlen wir alle! Bedanken Sie sich dafür bei Ihrer Regierung.«
Tom sah ihn fragend an. »Ja und? Diese bescheuerte Bonpflicht ist doch nichts Neues. Freu dich lieber, dass die Kneipen wieder geöffnet sind. Was ist an diesem Bon denn so wahnsinnig aufregend?«
»Ich hab mal auf die Schnelle recherchiert«, antwortete Alex. »Bei etwa zwanzig Milliarden Transaktionen pro Jahr im deutschen Handel und einem Kassenbon, der statistisch gesehen durchschnittlich zwanzig Zentimeter lang ist, produzieren wir rund 2,375 Millionen Kilometer oder 5 700 Tonnen zusätzliches Kassenpapier. Damit könnte man dreiundvierzig Fußballfelder bedecken. Hintereinander gelegt käme man auf eine Länge von 2,3 Millionen Kilometern. Damit könnte man den Äquator fünfzigmal umwickeln. Zur Herstellung dieser Papiermassen werden 12 500 Tonnen Holz verbraucht. Das entspricht etwa 8500 Fichten mit einer Höhe von 25 Metern und einem Durchmesser von 0,4 Metern. Um es dir anschaulicher zu machen: Das entspricht einem gefällten Baum pro Stunde! Ist das zu fassen?«
»Alter, natürlich sind diese Bons so was von überflüssig. Wären die Finanzämter nicht auf dem technologischen Stand der vorindustriellen Zeit, könnte man das alles ganz einfach elektronisch regeln. Da müssen wir nicht drüber diskutieren. Ich kapier nur nicht, worauf du hinauswillst? Gehst du jetzt unter die Aktivisten und kettest dich an Bäume?«
Alex nahm den Bon wieder an sich und tippte mit dem Zeigefinger darauf. »Hier steht, die Zeche zahlen wir alle.«
»Is so.« Tom nickte.
»Das sehe ich aber nicht ein.«
»Was?«
»Na, dass ich die Zeche dafür zahlen soll, wenn andere die Umwelt ausbeuten und zerstören und den Klimawandel vorantreiben.« Er sprang vom Sofa auf und begann, vor Tom auf und ab zu tigern. »Weißt du, was ich noch gelesen habe? Jede Stunde werden in Deutschland rund 320 000 Einwegbecher verbraucht, davon alleine 140 000 Becher für Mitnahmegetränke. Pro Jahr sind das fast drei Milliarden Einwegbecher, die im Müll landen. Ich benutze aus Prinzip niemals Einmalbecher. Warum also muss ich für die Entsorgung dieses Müllbergs zahlen? Warum werde ich in Sippenhaft genommen für den CO2-Ausstoß, der bei der Produktion dieser schieren Masse an Einwegbechern und deren Entsorgung anfallen?«
»Das kannst du so doch nicht sehen.«
»Doch kann ich.« Allmählich redete Alex sich in Rage. »Ich kaufe niemals irgendwo Essen zum Mitnehmen, lasse es mir in eine Styroporschachtel packen, dazu noch das passende Plastikbesteck geben, um das Ganze am besten dann noch zusammen mit zehn Papierservietten in eine Plastiktüte zu stecken. Warum muss ich die Zeche dafür zahlen, wenn andere dies tun? Ich besitze kein Auto. Warum muss ich …«
»Alter, ich hab’s ja kapiert«, unterbrach Tom ihn. »Du bist nun mal ein Grüner. Aber wird dieses ganze Plastikzeugs in der EU nicht sowieso bald verboten?«
»Ist es schon zum Teil. Aber mir geht’s hier ums Prinzip.«
»Ich verstehe, dass dich so was nervt. Aber so läuft das nun mal auf dieser Welt. Dagegen kannst du nichts tun.«
»Das denkst du! Ich sage, dass es vielleicht doch eine Möglichkeit gibt, gewisse … Prozesse gerechter aufzuteilen.«
»Alter, es ist spät, und ich bin platt. Ich kann dir nicht folgen.«
Alex ging zu seinem Laptop, drehte das Display in Toms Richtung und spielte eine der beiden kurzen Videosequenzen ab, die er im Laufe der letzten Stunden im Netz gefunden hatte.
Die Aufnahme stammte von November 2019 und zeigte einen Ausschnitt einer flammenden programmatischen Rede der damals designierten EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die sie vor der Konrad-Adenauer-Stiftung in Berlin hielt. Darin teilte sie den Zuhörern mit, dass die neue EU-Kommission in den kommenden zehn Jahren eine Billion Euro für den Klimaschutz in Europa aktivieren würde. Binnen dreißig Jahren, bis zum Jahr 2050, sollte Europa der erste klimaneutrale Kontinent werden. Von der Leyen bereitete ihre Zuhörer darauf vor, dass in den nächsten Jahren beherzte Entscheidungen zum Wohle aller getroffen werden müssten.
»Ich kann diese Tussi nicht ausstehen«, kommentierte Tom, nachdem das Video gestoppt hatte.
Alex verdrehte die Augen. »Darum geht’s doch gar nicht. Es geht darum, was sie zwischen den Zeilen gesagt hat.«
»Aha. Und das wäre?«
»Warte ab.« Alex grinste vielsagend und startete die zweite Videosequenz, die vom September 2020 stammte.
In einer Rede zur Lage der Nation in Brüssel erhöhte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erneut die ohnehin schon ambitionierte Zielvorgabe zur Einsparung von klimaschädlichem CO2. Die Europäische Union wollte nun schon bis 2030 den Ausstoß von Treibhausgasen um mindestens 55 Prozent senken. Mehrere Vorgaben für Energiewirtschaft und Industrie wurden weiter verschärft. Eine neue CO2-Bepreisung wurde eingeführt. Das Emissionshandelssystem ETS, das bisher nur Kraftwerke und Fabriken einschloss, sollte auf Gebäude und Verkehr ausgedehnt werden.
Alex stoppte das Video.
Missmutig sagte Tom: »Wenn ich mir noch so ein Video anschauen muss, gehe ich sofort ins Bett.«
Alex klappte seinen Laptop zu. »Klimaneutralität ist in aller Munde. Selbst China, Russland und Indien fahren ihren CO2-Ausstoß mittlerweile drastisch herunter. Sogar die USA und Brasilien verstehen inzwischen, wie unglaublich wichtig ein moderates Klima für unser langfristiges Überleben ist. Nur gibt es bei allen ehrenwerten Bemühungen auf diesem Feld einen Faktor, den alle übersehen.«
»Und der wäre?«
»Die Menschen. Wir sind dieser Faktor, Tom. Wir alle. Wir sind das Problem oder, besser gesagt, unsere Lebensweise ist es.«
Tom gähnte. »Ist das deine wahnsinnig tolle Erkenntnis des heutigen Abends? Gratuliere, du hast begriffen, was allen anderen längst klar ist.«
Alex ging nicht auf diese Spitze ein. Stattdessen sah er Tom eindringlich an. »Im Augenblick zahlen wir alle die Zeche für alle möglichen Vorgänge in der Welt, auf die wir absolut keinen Einfluss haben. Ob wir das wollen oder nicht. Ich will, dass du über folgende Frage nachdenkst: Was, wenn jeder Einzelne nur seine eigene Zeche zahlen müsste? Was, wenn jeder exakt steuern könnte, welche Zeche er in welcher Höhe zahlen möchte? Ich rede von Eigenverantwortung, die belohnt wird, anstatt kollektiver Mithaftung für die Unvernunft der Massen.«
Tom legte die Stirn in Falten. »Redest du von so etwas wie einem CO2-Preis? Zum Beispiel auf Strom? Den gibt es schon, falls du darauf hinauswillst.«
»Ja und nein. Ich denke größer, Tom. Sehr viel größer. Aequitas geht weit über alles hinaus, was man in diese Richtung bislang auch nur angedacht hat.«
»Aequitas?«
Alex grinste schief. »Der Name für die App, die wir beide programmieren werden. Hab mir den Namen vorhin ausgedacht. Find ich irgendwie cool.«
»Moooment! Wir werden eine App programmieren?«
»O ja.« Alex nickte heftig. »Wir beide. Gemeinsam. Aber die App ist nur ein kleiner Teil des Systems.«
»Ich weiß zwar immer noch nicht, worauf du hinauswillst, aber jetzt bin ich neugierig. Also, worum genau geht’s?«
Alex schlug sein Notizbuch auf und legte los.
Ununterbrochen redete er beinahe eine Stunde lang auf seinen Kommilitonen ein, dann legte er seine Notizen beiseite und sah Tom fragend an. »Na, was denkst du?«
Tom lehnte sich auf dem Sofa zurück und starrte eine ganze Weile nachdenklich an die nackte Decke. Dann verzogen sich seine Mundwinkel zu einem Lächeln. Ohne Vorwarnung sprang er auf und packte Alex bei den Schultern. »Ich hätte ja nie gedacht, dass ich das mal sagen würde, aber … Alter, du bist genial!«
»Echt jetzt?«
»Wenn ich es dir sage.« Toms glasiger Blick war verschwunden, ebenso seine Müdigkeit. Mit leuchtenden Augen sagte er: »Lass uns sofort loslegen.«
2
14 Monate später
Alex Baumgart wartete mutterseelenallein in der dreizehnten Etage des wuchtigen Berlaymont-Gebäudes in Brüssel vor einer geschlossenen Tür und wusste nicht, wohin mit sich. Verunsichert drückte er den Laptop mit beiden Händen gegen seinen Oberkörper. Bereits beim Betreten des imposanten Gebäudes, des Sitzes der Europäischen Kommission, hatte Alex das Gefühl beschlichen, hier vollkommen fehl am Platz zu sein. Mit jeder weiteren Minute, die er hier auf dem Gang verbrachte, wuchs in ihm die Überzeugung, dass er der ganzen Sache nicht gewachsen war. Wo zum Henker blieb Tom? Die Uhr tickte.
Flehentlich starrte Alex auf das Ende des langen Flurs in der Hoffnung, Tom jeden Augenblick um die Ecke kommen zu sehen. Im Gegensatz zum Erdgeschoss, wo es von Menschen nur so gewimmelt hatte, war auf dieser Etage überraschend wenig los. Nur gelegentlich eilten Männer in maßgeschneiderten Anzügen oder Frauen in schicken Kostümen an ihm vorbei. Zwar hatte Alex versucht, sich dem Anlass entsprechend ebenfalls in Schale zu werfen, doch die geringschätzigen Blicke, die an ihm hinabglitten, verrieten, dass ihm dies nicht geglückt war. Das weiße Hemd, das er sich gestern von Tom geliehen hatte, war ihm zwei Nummern zu groß, ebenso wie Toms schwarze Bundfaltenhose, die Alex mit einem Gürtel eng um seine schmalen Hüften gezurrt hatte. Dazu passten seine dunkelblauen Turnschuhe natürlich wie die Faust aufs Auge. Es war nicht so, als wäre ihm dies nicht bewusst gewesen. Er sah es nur nicht ein, Hunderte von Euros für Klamotten auszugeben, die er nach dem heutigen Tag sowieso nie wieder anziehen würde. Außerdem, wen interessierte, was er anhatte? Es ging einzig und allein um Aequitas.
Vierzehn Monate nachdem ein versiffter Kassenzettel aus einer verrauchten Studentenkneipe Alex’ Leben eine neue Richtung gegeben hatte, fand er sich heute in Europas Machtzentrum wieder, um das Resultat seiner Vision zu präsentieren, die ihn damals, an einem kalten, regnerischen Novemberabend, überkommen hatte. Und ausgerechnet heute ließ Tom sich nicht blicken. Das sah ihm gar nicht ähnlich. Sie hatten die Präsentation gemeinsam ausgearbeitet, und Alex wusste, wie sehr Tom seinem Part entgegenfieberte. War ihm auf dem Weg hierher womöglich etwas zugestoßen?
Die Minuten verrannen. Alex war kurz vorm Durchdrehen. Am wichtigsten Tag in seinem bislang wenig ereignisreichen Leben, ließ sein bester Kumpel ihn hängen. Nicht einmal einen kurzen Anruf oder eine Nachricht war ihm die Verspätung wert. Und das, obwohl sie in nur zehn Minuten vor die EU-Kommission treten sollten.
Die Sonne schien durch die Fenster und tauchte den Gang in helles Licht. Trotzdem brannten die Kunststoffleuchten an den Decken. Alex ärgerte sich über dieses Ausmaß an Energieverschwendung. Kein Wunder, dass die EU in Sachen Klimaschutz auf der Stelle trat. Geredet wurde viel, gute Absichten gab es zuhauf, doch die offensichtlichsten Stellschrauben sah man nicht. Deswegen interessierte sich die EU-Kommission so brennend für Aequitas. Aequitas versprach Europa nichts weniger als die Lösung eines scheinbar unlösbaren Problems.
Alex’ Anspannung stieg. Er musste sich im Kopf dringend von dem Druck befreien, der auf ihm lastete. Also trat er an eines der vielen Fenster und sah hinaus. Weit unten rollte der Verkehr der morgendlichen Rushhour über die Rue de la Loi bis hin zum Schuman-Kreisverkehr, wo sich die scheinbar niemals endende Blechlawine in alle Himmelsrichtungen verteilte. Rund um das Rondell reihten sich beeindruckende Bürogebäude aneinander. Sie beheimateten die unterschiedlichsten europäischen Behörden. Die Fensterfassade des siebenstöckigen Triangle Buildings, des Hauptquartiers des Europäischen Auswärtigen Dienstes, glänzte ebenso im Sonnenlicht wie die verspiegelten Fenster des Justus-Lipsius-Gebäudes, des Konferenz- und Pressezentrums des Rates der Europäischen Union. Zwischen diesen beiden Gebäuden erstreckte sich in einiger Entfernung der Jubelpark. Die Aussicht von hier oben war ebenso beeindruckend wie einschüchternd. Nervös nestelte Alex an Toms viel zu großem Hemd. Verdammt, wo blieb der Kerl? Alleine würde Alex die Präsentation garantiert versauen. Zumal Aequitas sowieso noch nicht zu einhundert Prozent rundlief.
Kam die Präsentation womöglich zu früh? Alex fand schon, doch Tom hatte das bis zuletzt nicht hören wollen. Erst gestern hatten sie wieder einmal bis weit nach Mitternacht darüber diskutiert. Im Gegensatz zu seinem Partner hätte Alex gerne mehr Zeit für weitere Testläufe gehabt, doch wie Tom immer zu sagen pflegte: Perfektion ist nur eine Illusion; du erreichst sie sowieso nie.
Alex verstand durchaus, dass sich ihnen eine Chance wie heute vielleicht nie wieder bieten würde, weshalb er schließlich auch eingelenkt hatte. Immerhin hatten sie in den letzten Monaten unzählige Bugs im Programmcode identifiziert und ausgemerzt, darüber hinaus liefen die Simulationen seit über drei Wochen auf zwei Servern nahezu fehlerfrei. Aber was hatte das schon zu bedeuten? Es war nach wie vor denkbar, dass ihnen Aequitas um die Ohren flog. Bei einem System dieser Größenordnung war nichts ausgeschlossen. Dutzende mögliche Fehlerquellen hatten sie vermutlich noch nicht einmal auf dem Schirm. Aus Sicht eines normalen Users war Aequitas nur eine gewöhnliche App, die überaus einfach zu bedienen war. Tatsächlich aber handelte es sich um ein radikal neues, unglaublich komplexes System, dessen flächendeckende Einführung das Leben aller Menschen in Europa von Grund auf verändern würde. Die Frage lautete nur, ob Europa schon so weit war. Würden die EU-Kommissare tatsächlich den Mut aufbringen, eine derartig wegweisende Entscheidung zu treffen?
Sehnsüchtig sah Alex in Richtung der Aufzüge und verfluchte Toms Unzuverlässigkeit. Um sich abzulenken, blickte er wieder durch das Fenster und beobachtete die Autos, die weit unter ihm in den Kreisverkehr hinein- und wieder hinausfuhren.
Er wusste nicht, wie lange er so dagestanden hatte, als ihm jemand auf die Schulter tippte. Erschrocken fuhr er zusammen, drehte sich um und blickte in die leuchtend blauen Augen von Tom.
»Entspann dich«, sagte Tom schmunzelnd. »Hast du etwa gedacht, ich schicke dich ganz allein in die Arena und werfe dich den Raubtieren zum Fraß vor?«
Erstaunt sah Alex an ihm herab. Tom war nicht wiederzuerkennen. Er war beim Friseur gewesen und hatte sich sogar seinen Dreitagebart abrasiert. Außerdem steckte er in einem braunen Anzug, der überhaupt nicht zu ihm passte. Tom wirkte darin altbacken und steif. Am meisten aber überraschte Alex die braune Krawatte, denn Tom hasste Krawatten. Für ihn waren sie der Inbegriff von Spießigkeit und das Symbol einer längst überholten Geschäftswelt. Wie es schien, hatte er sogar Geld in ein neues Paar dunkelbrauner Lederschuhe investiert. Mit einem Mal fühlte sich Alex in seinen geliehenen Klamotten noch unwohler.
»Wie siehst du denn aus?«, fragte Alex.
Tom richtete sich zu voller Größe auf und schloss den obersten Knopf seines Jacketts. »Da staunst du, was? Hab mir den Anzug von meinem Dad ausgeliehen. Der hat nicht schlecht gestaunt, als ich ihn danach gefragt habe, das kann ich dir sagen.«
»Hätte ich mir doch einen Anzug besorgen sollen?«, fragte Alex unsicher.
»Ach was.« Tom deutete mit dem Finger auf die geschlossene Tür vor ihnen. »Du siehst exakt so aus, wie die Bürokraten in diesem Raum sich denjenigen vorstellen, der ihnen heute die technischen Details erklären wird. Du machst Aequitas authentisch. Alter, du bist das Mastermind hinter all dem. Also bleib locker.«
»Dann machst du heute einen auf Geschäftsmann, und ich gebe den Nerd. Ist es das, was du mir damit sagen willst?«
»Alter, du bist ein Nerd. Machen wir uns nichts vor.«
»Du hast das genau so geplant«, stellte Alex fest.
Tom legte ihm eine Hand auf die Schulter und sah ihn eindringlich an. »Heute bietet sich uns eine einmalige Chance. Wir können heute Geschichte schreiben. Vorausgesetzt, wir stellen es richtig an. Alter, so eine Chance erhalten wir nie wieder.«
»Und du denkst, unsere Chancen erhöhen sich, wenn ich den Nerd gebe?«
Tom zog seine Hand zurück. »Sei einfach du selbst.«
»Ich fasse es nicht, dass du mich vorführen willst, nur weil du denkst, dass wir damit punkten.«
Tom seufzte. »Als ich kam, hast du gerade den Kreisverkehr da unten beobachtet, richtig?«
»Ja, aber was hat das mit …?«
»Wie lange hast du da runtergestarrt?«
»Keine Ahnung. Vielleicht fünf Minuten.«
»Okay. Wie viele dunkelblaue Autos sind in diesen fünf Minuten durch den Kreisel gefahren?«
»Vierundzwanzig. Dreizehn Limousinen, neun Kombis und zwei Minivans.«
»Und wie viele schwarze Autos?«
»Neununddreißig. Vierundzwanzig Limousinen, elf Kombis, drei Minivans und eine Stretchlimo.«
»Silberne?«
»Fünfzehn. Elf Limousinen, vier Kombis.«
»Alter«, Tom grinste, »du bist ein Nerd.«
Alex machte den Mund auf, um zu widersprechen, ließ es aber bleiben. Schließlich sagte er halbherzig: »Ich kann mir Prozesse, Zahlen und Codes einfach gut merken. Das ist alles.«
»Und wie du das kannst.« Tom packte ihn mit beiden Händen an den Schultern, als wollte er ihn wach rütteln. »Du bist ein Genie. Ich kenne niemanden außer dir, der dazu fähig wäre, ein System wie Aequitas zu programmieren. Lass dir von niemandem etwas anderes einreden, klar?«
Alex nickte zögerlich.
»Du. Bist. Ein. Genie«, wiederholte Tom. »Merk dir das, wenn wir gleich diesen Raum betreten. Zeig es diesen Typen.«
Alex nickte abermals, und Tom ließ ihn los.
In diesem Augenblick öffnete sich die Tür, und ein weißhaariger Mann in einem gut sitzenden dunklen Anzug und perfekt gebundener Krawatte bat sie einzutreten.
Tom wandte sich ein letztes Mal an Alex. »Denk daran, was wir besprochen haben: Immer cool bleiben. Egal, was da drin passiert.«
»Klar.«
»Alter, ich meine das ernst. Flipp nicht gleich aus, wenn die ersten kritischen Fragen kommen. Wir sind perfekt vorbereitet. Wir rocken das!«
»Klar.«
Tom grinste und schritt selbstbewusst durch die Tür. Alex folgte ihm mit klopfendem Herzen.
Im Berlaymont-Gebäude gab es 47 Aufzüge, 33 Konferenzsäle und 880 Besprechungsräume. Insgesamt arbeiteten rund 50 000 Menschen für die unterschiedlichsten Institutionen der Europäischen Union, davon alleine 32 000 für die EU-Kommission. Deren Chefs, und zwar ausnahmslos alle sechsundzwanzig EU-Kommissarinnen und -Kommissare mitsamt der Präsidentin, musterten in diesem Augenblick die beiden jungen Informatikstudenten aus Karlsruhe, die in den Commission Room geführt wurden. Verstohlen sah Alex sich um. Die Wände waren mit dunklen Holzpaneelen getäfelt. Mehrere hoch oben angebrachte Überwachungskameras und Richtmikrofone erfassten jeden Quadratzentimeter des Raums. In der Mitte befand sich ein ovaler Konferenztisch aus hellem Holz mit integrierten Bildschirmen und Schwanenhalsmikrofonen. Die EU-Kommissare saßen auf schwarzen Ledersesseln mit hohen Rückenlehnen. Präsidentin von der Leyen am Kopfende des Tisches kannte Alex aus dem Fernsehen, von allen anderen Kommissaren hatte er nicht einmal die Namen gehört. Auch die unterschiedlichen Ressorts, denen sie vorstanden, waren ihm unbekannt. Da Alex jedoch niemanden in seinem Freundeskreis kannte, der auch nur annähernd wusste oder gar verstand, wie die EU eigentlich regiert wurde und wie sie funktionierte, machte er sich nichts daraus. Namen waren ihm herzlich egal. Wichtig war nur, dass sich die Kommission für Aequitas interessierte, auch wenn er wusste, dass beileibe nicht alle Anwesenden seiner Vision positiv gegenüberstanden. In Vorbereitung auf ein gnadenloses Verhör war Tom deswegen in mehreren Rollenspielen in die Rolle eines kritischen EU-Kommissars geschlüpft. Als Advocatus Diaboli hatte er ihn mit harscher Kritik konfrontiert und ihn emotional gefordert. Eigentlich hätte Alex die Präsentation heute mit Zuversicht angehen können, dennoch hatte er weiche Knie.
Der weißhaarige Mann zog sich in den Hintergrund zurück und ließ Alex und Tom inmitten des Raums stehen. Präsidentin von der Leyen begrüßte sie mit knappen Worten und gab den Anwesenden einen kurzen Überblick über den Werdegang und das Projekt der beiden jungen Männer. Währenddessen musterten die Kommissare Alex kritisch und teilweise offenkundig missbilligend. Er bemühte sich, trotzdem cool zu bleiben. Warum konnte er nicht einfach loslegen? Als wüsste nicht jeder Einzelne sehr genau, weshalb sie heute hier waren.
Endlich übergab die Präsidentin ihnen das Wort, und Tom bedankte sich für den freundlichen Empfang. Sie hatten vereinbart, dass er beginnen sollte. Er war extrovertierter und erheblich wortgewandter als Alex. Er vermochte es, Menschen in seinen Bann zu ziehen und zu begeistern. Das hatte Alex schon immer an ihm bewundert. Heute würde Tom über sich hinauswachsen müssen, genau wie in wenigen Minuten dann Alex selbst.
»Danke«, begann Tom, »dass wir heute, in diesem besonderen Rahmen, die Möglichkeit erhalten, Ihnen Aequitas vorzustellen. Wir werden bis ins kleinste Detail aufzeigen, wozu Aequitas in der Lage ist. Unser System wird Ihre kühnsten Erwartungen übertreffen. Das kann ich Ihnen schon jetzt versprechen. Danach werden wir alle Ihre Fragen beantworten. Lassen Sie mich zuvor jedoch etwas über die grundsätzliche Idee sagen, die hinter Aequitas steckt, und weshalb unser System die Lösung für Sie ist, um Ihre Ziele im Rahmen des Green Deals zu erreichen.«
Während Tom mit erstaunlicher Selbstsicherheit und vollkommen frei ohne Manuskript in der Hand sprach, sah Alex reihum in die Gesichter der Anwesenden. Anhand ihrer Mimik versuchte er herauszufinden, wer dem Projekt wohlwollend und wer ihm ablehnend gesinnt war. Es war ein sinnloses Unterfangen. Sämtliche Männer und Frauen in diesem Raum waren erfahrene Politiker, die sich unter Kontrolle hatten. Nun, spätestens in der Fragerunde würden sich die Skeptiker zu erkennen geben.
»Sie möchten die EU bis 2050 klimaneutral bekommen«, sagte Tom gerade. »Der Green Deal – eine beinahe unlösbare Aufgabe. Meine Damen und Herren, machen wir uns nichts vor: Mit den bislang gängigen Maßnahmen werden Sie an Ihrem selbst gesteckten Ziel scheitern. Und das wissen Sie sehr genau. Anderenfalls wären mein Partner und ich heute nicht hier.«
In einigen Gesichtern sah Alex jetzt zuckende Mundwinkel und blinzelnde Augenlider. Scheinbar traf Tom mit seiner Rede einen Nerv.
»Die traurige Realität ist«, fuhr er fort, »dass wir von Jahr zu Jahr immer höhere CO2-Emissionen verzeichnen. Und das trotz mehrerer Corona-Lockdowns und trotz aller Bemühungen, den Ausstoß von Treibhausgasen in den Griff zu bekommen. Das Emissionshandelssystem ETS sowie die einzelnen nationalen Handelssysteme dürfen wir getrost als gescheitert betrachten. Ich denke, niemand hier in diesem Raum wird mir da widersprechen. Warum aber will es uns einfach nicht gelingen, Emissionen deutlich und dauerhaft herunterzufahren?« Tom sah in die Runde. »Ich sage Ihnen, warum. Die gegenwärtige Politik ist zu zögerlich. Aus Angst, nicht wiedergewählt zu werden, traut sich kein Politiker, egal aus welchem Land oder welcher Partei, diejenigen Maßnahmen zu ergreifen, die tatsächlich Wirkung zeigen würden. Das, was die Politik bislang auf den Weg bringt, reicht bei Weitem nicht aus. Das ist uns allen hier bewusst. Wenn nicht bald ein radikales Umdenken und ein Wandel in der Gesellschaft stattfinden, wird diese Erde in wenigen Jahrzehnten in weiten Teilen unbewohnbar sein.«
»Wenn es so einfach wäre«, warf ein gebräunter Mittfünfziger mit dicker Brille ein, »und wenn es wirksame Maßnahmen gäbe, so hätten wir diese längst beschlossen. Ich möchte Sie daran erinnern, junger Mann, wo Sie sich hier befinden. Halten Sie uns etwa für Dilettanten?«
»Natürlich nicht«, erwiderte Tom und warf Alex einen raschen Seitenblick zu. Sie hatten diesen Einwand erwartet. »Sehen Sie, leider agieren die meisten Menschen beim Thema Klimawandel vollkommen irrational. Im Grunde wissen wir alle, dass wir nicht einfach so weitermachen können wie bisher, doch wir verschließen davor nur allzu gerne die Augen. Insgeheim hoffen wir, Mutter Erde wird das schon irgendwie selbst in den Griff bekommen. Aber das ist ein Trugschluss. Nichts, rein gar nichts wird sich von alleine regulieren. Physikalische Prozesse sind nicht verhandelbar. Und genau deswegen brauchen wir Aequitas.«
»Möglicherweise greife ich vor«, sagte der gebräunte EU-Kommissar, »aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass Aequitas von den Bürgern akzeptiert werden würde. Und ohne Akzeptanz ist Ihr System vollkommen wertlos, meine Herren.«
»Sie haben doch noch gar nicht gesehen, wie es funktioniert«, brach es aus Alex heraus, ehe er es verhindern konnte. »Vielleicht warten Sie erst mal ab?«
Tom warf ihm einen bösen Blick zu.
»Entschuldigung«, nuschelte Alex kleinlaut.
»Bitte entschuldigen Sie meinen Partner«, sagte Tom. »An seiner Leidenschaft erkennen Sie seine Überzeugung für dieses Projekt.« Er wandte sich an den gebräunten Kritiker. »Auch wenn Sie mit Ihrer Frage tatsächlich ein wenig vorgreifen, so möchte ich Ihnen dennoch eine Antwort geben. Was, denken Sie, haben das FCKW-Verbot, Müllrecycling, Kläranlagen, Katalysator und Partikelfilter gemeinsam?«
»Worauf wollen Sie hinaus?«, wollte der Kommissar wissen.
»Noch vor wenigen Jahrzehnten«, antwortete Tom, »hat man Abfall einfach irgendwo in der Landschaft entsorgt, Atommüll im Meer versenkt, Abwässer ungeklärt in Flüsse und Seen eingeleitet, Abgase ungefiltert durch Kaminschlote oder Auspuffanlagen gejagt. Keine einzige dieser Umweltsünden wurde durch Eigenverantwortung des freien Marktes gelöst. Das alles hat sich nur zum Besseren geändert, weil der Staat eingegriffen und Gesetze eingeführt hat. Immer wenn man auf freiwillige Änderungen durch die Industrie gehofft hat oder auf Verhaltensänderungen der Menschen, wurde man bislang enttäuscht. Menschen brauchen Regeln und Gesetze, an die sie sich zu halten haben. Anders funktioniert es nicht, das hat die Geschichte oft genug bewiesen.«
Endlich sah Alex ein erstes zaghaftes, aber zustimmendes Nicken bei einigen der Anwesenden. Er bewunderte die Eloquenz, die Tom an den Tag legte. Das hatte ihm Alex gar nicht zugetraut.
»Die Menschen«, fuhr Tom mit fester Stimme fort, »haben schon immer aufgeschrien, wenn es ihnen aus Gründen des Umweltschutzes an den Geldbeutel ging. Aber mit der Zeit legt sich die Empörung, und man erkennt die Notwendigkeit einer intakten Umwelt. Ich frage Sie, verehrte Damen und Herren, wer stellt heute noch die Sinnhaftigkeit von Kläranlagen, Luftreinhalte-Verordnungen oder Schadstofftests für Autos infrage? Wir nehmen heute als gegeben hin, was vor ein paar Jahrzehnten noch undenkbar war. Wir sind sogar heilfroh darüber. Der Blick in die Vergangenheit zeigt uns, ohne Anreize oder Zwänge ist in puncto Umweltschutz bislang nur höchst selten etwas passiert. Und jetzt liegt es an Ihnen, meine Damen und Herren, mithilfe von Aequitas die Weichen zu stellen, damit Europa bis 2050 tatsächlich der erste klimaneutrale Kontinent wird.«
Der gebräunte Kommissar lehnte sich süffisant lächelnd in seinem Sitz zurück. »Sie sind also tatsächlich der Meinung, dass Aequitas die Lösung ist?«
»Offen gesagt«, erwiderte Tom im Brustton der Überzeugung, »ist Aequitas in meinen Augen Ihre einzige Option. Wenn Sie es ernst meinen, versteht sich.«
Der Kommissar erwiderte nichts.
Tom deutete auf Alex. »Mein Partner, Alex Baumgart, ist das Mastermind hinter Aequitas. Er hat das System im Wesentlichen programmiert. Daher wird er es Ihnen jetzt bis ins letzte Detail vorstellen.« Er nickte Alex aufmunternd zu.
Alex atmete tief durch. Die Augen aller Anwesenden waren jetzt auf ihn gerichtet.
Du hast das wochenlang geübt, sagte er sich. Du kannst das.
Dann begann er zu reden.
3
Vier Stunden später betraten Alex und Tom die Bar Funky Monkey, nur wenige Gehminuten vom Berlaymont-Gebäude entfernt. Mit dem langen Tresen aus dunkel poliertem Holz sowie den runden Tischen und Stühlen mit geschwungenen Armlehnen erinnerte das Funky Monkey Alex an ein englisches Pub. Durch die verglaste Eingangstür fiel das Licht der Nachmittagssonne und zauberte wirre Schatten auf den Holzfußboden; an der Wand hinter dem Tresen hing ein Fernseher, auf dem ein Fußballspiel lief. Außer Alex und Tom waren nur zwei weitere Gäste im Pub, die im hinteren Bereich saßen.
Sie setzten sich an einen Tisch gleich neben dem Eingang und bestellten jeder ein Leffe Blonde. Beide waren aufgekratzt, ja geradezu euphorisch. Die Präsentation war ein voller Erfolg gewesen. Selbstverständlich hatte die EU-Kommission noch keine offizielle Entscheidung verkündet, doch sofern Aequitas die diversen Gremien und Ausschüsse überstehen und auch alle sonstigen Hürden nehmen sollte, sah der in Aussicht gestellte Zeitplan vor, dass Aequitas schon Anfang nächsten Jahres in einem einjährigen Testbetrieb in Luxemburg starten sollte. Sofern dabei alles nach Plan verlief, sollte Aequitas danach mit einer zweijährigen Übergangsphase in der gesamten EU für alle Mitgliedstaaten und alle Bürger verpflichtend eingeführt werden. Die Namen Alex Baumgart und Tom Valcke würden in die Geschichtsbücher eingehen.
Der Kellner brachte ihre Bestellung, und sie prosteten sich breit grinsend zu. Alex’ Kehle war ausgetrocknet, und er nahm einen großen Schluck. Das Bier schmeckte herrlich.
»Das haben wir uns verdient«, sagte Tom und wischte sich Schaum von der Oberlippe.
»Aber so was von«, stimmte Alex ihm zu. »Ich hab Durst wie ein Fisch. So viel wie heute hab ich noch nie am Stück geredet. Und die trockene Luft von der Klimaanlage war echt übel.« Er nahm einen weiteren großen Schluck.
»Alter, vergiss die Klimaanlage.« Tom grinste bis über beide Ohren. »Vergiss die Strapazen der letzten Monate. Vergiss die durchgearbeiteten Nächte. Wir haben diese Bürokraten überzeugt. Nur darauf kommt es an.«
»Wir sollten nicht zu früh feiern«, mahnte Alex. »Die endgültige Entscheidung fällt erst in einigen Wochen. Die ganzen Gremien und Ausschüsse …«
»Ach was. Die haben sich längst entschieden. Ich sag dir, die hatten sich schon entschieden, bevor sie uns eingeladen haben. Die wollten sich heute nur noch persönlich ein Bild von uns machen.«
»Denkst du echt?«
»Die brauchen Aequitas, und das wissen sie ganz genau.« Tom zeigte mit dem Finger auf ihn. »Du warst heute spitze. Okay, am Anfang warst du ein wenig nervös, aber dann hast du die Sache gerockt.«
»Findest du echt?«
Tom nickte und lehnte sich entspannt in seinem Stuhl zurück. »Ich habe nicht übertrieben, als ich dich als das Mastermind hinter unserem System vorgestellt habe. Obwohl ich natürlich auch meinen Anteil daran habe.«
»Natürlich hast du das.« Alex lächelte matt. Tom tat gerne so, als wären sie beide gleichermaßen an der Entwicklung von Aequitas beteiligt. Doch sie wussten beide, dass das nicht stimmte. Aequitas war Alex’ Vision. Außerdem wäre Tom allein niemals in der Lage gewesen, Aequitas zu programmieren. Er kannte nicht einmal sämtliche Finessen des Systems – ebenso wenig wie die EU-Kommissare. Bis ins letzte Detail, so hatte Tom ihnen versprochen, würde Alex ihnen Aequitas erklären. Doch an dieses Versprechen hatte Alex sich nicht ganz gehalten.
Beim Gedanken an sein kleines Geheimnis, das in den tiefsten Ebenen des Quellcodes von Aequitas schlummerte, musste Alex sich ein triumphales Grinsen verkneifen. Angestrengt starrte er auf sein Bier, um sich nicht durch irgendeine unbedachte Mimik oder Geste zu verraten. Tom hatte sich gegen Ende der Entwicklungsphase viel mehr mit der grafischen Oberfläche der App beschäftigt als mit dem Quellcode. Demzufolge hatte er auch keine Ahnung von der kleinen Hintertür in ihrem System. Alex hatte diesen ganz speziellen Code in nur wenigen Stunden während einer schlaflosen Nacht geschrieben. Niemand außer ihm wusste davon. Er konnte es kaum erwarten ihn ein paar Wochen nach der EU-weiten Einführung von Aequitas zu aktivieren.
Das erste Bier war schnell getrunken, also bestellte Tom per Handzeichen nach.
Alex sah ihn nachdenklich an. »Weißt du, was mich beschäftigt?«
»Ob du lieber ein Grapefruit Hefeweizen anstatt eines Leffe Blonde trinken sollst?«
Alex beugte sich zu ihm vor. »Hast du dich nie gefragt, wieso die Kommission dermaßen radikale Änderungen in so kurzer Zeit durchboxen will? Ich meine, mir soll das ja nur recht sein, aber wir beide wissen, was mit Aequitas auf die Menschen zukommt. Sie werden das nicht einfach so hinnehmen. Der Gegenwind wird enorm sein. Also frage ich dich: Warum hat die Kommission es so eilig?«
»Wieso eilig?«, gab Tom zurück. »Aequitas wird nach und nach stufenweise eingeführt, um die Menschen daran zu gewöhnen. Bis zur letzten Stufe werden mindestens drei Jahre vergehen.«
»Ja schon, aber drei Jahre sind verdammt wenig.«
»Ist doch nicht unser Problem. Wir haben nur dafür zu sorgen, dass Aequitas Anfang nächsten Jahres einsatzbereit ist. Alles andere ist nicht unsere Baustelle.«
»Aber haben die Kommissare auf dich nicht auch irgendwie … verzweifelt gewirkt?«
Tom sah ihn verständnislos an. »Wie kommst du darauf?«
Alex seufzte und überlegte, wie er ihm seine diffusen Gedankengänge verständlich machen konnte. »Schau, wir beide wissen, wie weitreichend Aequitas in das Leben der Menschen eingreifen wird. Ohne Not würde kein Politiker riskieren, der Bevölkerung das aufzuzwingen. Schon gar nicht innerhalb von drei Jahren. Die EU-Kommission muss also einen verdammt guten Grund für diese Entscheidung haben.«
»Aber liegt das nicht auf der Hand? Klimaneutralität bis 2050. Darum dreht sich hier doch alles.«
Alex schüttelte den Kopf. »Das ist eben nicht alles. Ich sage dir, man verschweigt uns etwas. Nämlich den wahren Grund für die Einführung von Aequitas.«
»Ach was. Alter, du siehst Gespenster. Lass uns lieber noch eins trinken.« Er hob zwei Finger in Richtung des Kellners.
Alex ließ es dabei bewenden. Er hatte keine Lust auf Diskussionen. Stattdessen vertraute er lieber seiner Intuition. Er sah keine Gespenster. Die EU-Kommission verfügte über Informationen, die man ihm und Tom vorenthielt. Was war es, das die Kommissare so offenkundig beunruhigte und das selbst die Entwickler von Aequitas nicht erfahren durften? Auf jeden Fall musste es sich um eine bedeutende Sache handeln, so viel war Alex klar.
Der Kellner erschien an ihrem Tisch, und Tom riss ihm die beiden Gläser Leffe Blonde förmlich vom Tablett. Alex grinste. Nun ja, in einem hatte Tom zumindest recht. Dies war kein Tag zum Grübeln sondern zum Feiern. Einen ordentlichen Rausch hatten sie sich heute redlich verdient.
Während sie sich zuprosteten, dachte Alex erneut an sein kleines Geheimnis. Sobald der richtige Zeitpunkt kam, würde er den Code aktivieren. Und dann würde die Party mal so richtig starten.
4
Ein paar Jahre später
Julian Thaler kniete auf dem Dach des Schweinestalls und hantierte mit einem Schraubendreher an der Verkabelung der Solarmodule herum, die das gesamte Dach bedeckten. Aus irgendeinem Grund hatte sich die Halterung des Ladereglers gelockert; vermutlich weil sich das Dach aufgrund der seit Wochen andauernden Hitze leicht verzogen hatte. Obwohl noch früh am Vormittag brannte die Sonne auch heute wieder von einem wolkenlosen Himmel. Schweiß tropfte von Julians Stirn auf die Module. Er legte den Schraubendreher beiseite und rieb sich mit den Ärmeln seines hellblauen UV-Shirts Stirn und Gesicht trocken. Blinzelnd betrachtete er die vertrockneten Felder und verbrannten Wiesen, die sich rund um den Thaler-Hof erstreckten. Dieser Sommer bescherte den Landwirten in großen Teilen Europas die vierte Missernte hintereinander. Getreide, Gräser und Wälder, aber auch Mensch und Tier lechzten nach Wasser. Allerorten wurde Regen herbeigesehnt, doch der war nicht in Sicht. In absehbarer Zeit waren weder Abkühlung noch Rettung für die verkümmerte Saat auf den Feldern zu erwarten. Global betrachtet, sah die Lage nicht viel besser aus. Den Menschen auf der ganzen Welt stand ein weiteres entbehrungsreiches Jahr bevor.
Julian griff nach seiner Trinkflasche, die an seinem Gürtel steckte. Das klare Wasser war eine Wohltat für seine gesprungenen Lippen und seine ausgetrocknete Kehle. Er gönnte sich drei kostbare Schlucke und widmete sich dann wieder seiner Arbeit. Die anhaltende Trockenheit hatte nicht nur die Holzkonstruktion des Dachs beeinträchtigt. Windböen, die immer wieder Staubwolken über die Felder und den Hof trieben, hatten die Module mit der Zeit verdrecken lassen. Der Wirkungsgrad der Tandem-Solarzellen war auf unter sechzig Prozent gefallen, was sich zunehmend negativ bemerkbar machte. Der Solarstromspeicher des Thaler-Hofs lud sich tagsüber nicht mehr vollständig auf. Damit sank der Autarkiegrad des Hofs. Seit einigen Tagen musste Julian sogar wieder teuren Strom zukaufen, um bei diesen Temperaturen die ausreichende Belüftung und Kühlung des Stalls sicherzustellen. Das war unumgänglich, denn ein Ausfall der Umluftanlage würde den sicheren Hitzetod der verbliebenen zwanzig Schweine bedeuten. Leider kostete zugekaufter Strom nicht nur viel Geld, er ging zudem mit einer hohen CO2-Bepreisung einher. Jede einzelne Kilowattstunde belastete Julians Aequitas-Konto mit wertvollen CO2-Credits. Es lag also in seinem eigenen Interesse, die Module gut in Schuss zu halten. Umso mehr, da er seine Credits für diesen Monat schon jetzt beinahe aufgebraucht hatte. Sollte er sein ihm zugeteiltes monatliches CO2-Budget überschreiten, würde er Credits zukaufen müssen, damit sein Aequitas-Konto nicht ins Minus rutschte. Und wie immer reichte das Geld dafür vorne und hinten nicht aus.
Seine Smartwatch am Handgelenk vibrierte. Ein rascher Blick auf das Display verriet ihm, dass soeben acht weitere Credits von seinem Konto abgebucht worden waren. Sie waren bei der gestrigen Lieferung von Saatgut angefallen. Julian seufzte. Es gab Dinge, die waren einfach nicht zu ändern. Die Aequitas-Push-Nachricht verschwand vom Display, das nun wieder Datum und Uhrzeit anzeigte. Julian fuhr es durch Mark und Bein. Verdammt! Heute war ja Samstag, und obendrein war es bereits kurz nach 9:00 Uhr. Wie hatte er das nur vergessen können? Auf dem Marktplatz war garantiert längst die Hölle los. Wenn er und Leni diese Woche nicht leer ausgehen wollten, musste er sich jetzt mächtig sputen.
Er ließ alles stehen und liegen und kletterte hastig die Leiter hinunter, die an der Stallwand lehnte. Dann rannte er quer über den staubigen Hof zum Wohnhaus. Im Flur schnappte er sich einen leeren Rucksack vom Garderobenhaken und eilte in die Küche. Auch wenn die Zeit drängte, so wollte er sich nicht ohne eine gefüllte Trinkflasche auf den Weg machen. Gut möglich, dass er heute mehrere Stunden in der prallen Sonne anstehen musste, weil er so spät dran war.
In der Küche stand Leni mit dem Rücken zur Tür an der Spüle. Sie trug ein violettes Top, ihre knallengen Lieblingsshorts, Flipflops sowie Vaters alten Kopfhörer auf ihren Ohren. Von der Arbeit auf den Feldern war sie ebenso gebräunt wie er selbst. Während sie das Geschirr vom Vortag spülte, tanzte sie vor dem Waschbecken umher und sang dabei lautstark zu einem Lied mit, das Julian nicht hören konnte. Ihre Stimme war hell und klar, doch eine Sängerin würde nie aus ihr werden. Julian lächelte. Seine sechzehnjährige Schwester war so in ihre Arbeit und Musik vertieft, dass sie ihn nicht bemerkte. Obwohl er es eilig hatte, betrachtete er sie einen Moment lang. Es war schön zu sehen, dass Lenis alte Fröhlichkeit und ihre jugendliche Unbekümmertheit allmählich wiederkehrten. Sie hatte in den letzten Jahren viel mitgemacht, doch jetzt wackelte sie mit den Hüften und warf ihren Kopf beim Singen hin und her, als wäre nie etwas vorgefallen. Es sah lustig aus, wie ihre langen hellbraunen Haare von einer Seite zur anderen schwangen. Vollkommen in ihre Musik versunken, strahlte sie eine Unschuld aus, von der Julian sich wünschte, dass Leni sie sich möglichst lange bewahren mochte. Er liebte seine fünf Jahre jüngere Schwester über alles, und er bewunderte sie dafür, wie sie in ihrem Alter mit dieser außerordentlich schwierigen Situation zurechtkam, in der sie sich befanden.
Schließlich gab er sich einen Ruck und ging zu der hölzernen Kommode, auf der ihr Vorrat an gefüllten Wasserflaschen stand. Jetzt bemerkte Leni ihn. Sie hörte auf zu singen und sah ihn fragend an.
»Heute ist Samstag«, sagte Julian. Er griff nach einer Flasche und stopfte sie in den Rucksack. »Ich hab total die Zeit vergessen.«
»Was?«, rief Leni. Sie erinnerte sich an die Kopfhörer auf ihren Ohren und hob eine der dicken Hörermuscheln an. Trällernder K-Pop ertönte.
»Ich sagte, ich bin spät dran.« Er warf sich den Rucksack über und deutete auf den fast leeren Vorratsschrank in einer Nische neben der Kommode.
»Oh.« Sie verzog das Gesicht. »Stimmt, heute ist Samstag …«
»Eben. Hoffen wir, dass noch was übrig ist, bis ich da bin.« Er wirbelte herum und lief durch den Flur zur Haustür.
»Ich mach uns Eistee«, rief sie ihm hinterher.
Neben der Haustür lehnte Julians rostfleckiges Mountainbike an der Wand. Er sprang auf und trat in die Pedale. Kurz darauf flog er förmlich zur Hofausfahrt hinaus.
So schnell er konnte, radelte er über den staubigen Feldweg, zwischen braunen Wiesen und trostlosen Feldern hindurch, der Stadt entgegen. Die Sonne brannte gnadenlos vom Himmel, und bald schon drückte Julian der Schweiß aus allen Poren. Schnell war sein UV-Shirt durchgeschwitzt. Seine Nachlässigkeit ärgerte ihn. Hoffentlich kam er nicht zu spät. Leni und er konnten auf die wöchentliche Lebensmittelration nicht verzichten. Selbst mit den Rationen knurrten ihre Mägen oft genug. Und dann war da ja noch Doktor Schwarz, der Julian zunehmend unter Druck setzte. Aber an den Doc wollte er jetzt nun wirklich keinen Gedanken verschwenden.
Der Anblick der Felder verhieß nichts Gutes. Trockene, aufgebrochene Böden, dünne fahlgrüne Weizenbestände, die den Sommer vermutlich nicht überleben würden, dazu notreife Gerste, deren Grannen nach oben standen und so wenig Ertrag wie nie zuvor versprachen. Die seit Monaten anhaltende Dürre setzte vor allem dem Getreide stark zu. Vor wenigen Jahren noch Statistiken, Modelle, Vorhersagen und Prognosen, die in ferner Zukunft lagen, waren regelmäßig wiederkehrende Dürren, Hagelstürme und Starkregen in Europa längst zur traurigen Realität geworden. Trockene Sommer und verregnete Winter sorgten für massive Ernteausfälle. Missernten häuften sich. Erschwerend kam hinzu, dass aufgrund des fortschreitenden Klimawandels mehr als die Hälfte des verfügbaren Ackerlandes weltweit von Desertifikation bedroht war. Jährlich ging Ackerland in einer Größenordnung von zweiunddreißig Fußballfeldern pro Minute verloren. Das entsprach in etwa der gesamten Ackerfläche Deutschlands. Alleine dadurch fehlten einer wachsenden Weltbevölkerung jedes Jahr weitere zwanzig Millionen Tonnen Getreide. Das war nur einer der Gründe, weshalb die verheerenden Missernten der letzten Jahre zu der aktuell herrschenden weltweiten Hungersnot geführt hatten. Nahrungsmittel waren teuer geworden, und jeden Tag ausreichend Essen auf dem Tisch zu haben war für immer mehr Familien keine Selbstverständlichkeit mehr. Schon jetzt verhungerten mehr Menschen als jemals zuvor, und anders als noch vor wenigen Jahren galt dies inzwischen auch für die Bevölkerung ganz Europas. Landwirte wie Julian konnten wenig bis gar nichts dagegen unternehmen. Den Anbau von Zuckerrüben und Raps hatte Julian schon vor zwei Jahren aufgegeben, da diese Pflanzen weniger hitzetolerant, dafür aber wasserdurstiger als Getreide waren. Stattdessen war er dazu übergegangen, neben genetisch verändertem Mais und Gerste auch Soja anzubauen. Soja war hitzetoleranter, doch selbst diese Pflanze gab nur dann einen halbwegs vernünftigen Bohnenertrag her, wenn während des Reifeprozesses genügend Wasser zur Verfügung stand. Und danach sah es auch dieses Jahr nicht aus. Viele Landwirte hatten längst den Mut verloren und ihre Höfe freiwillig für einen Hungerlohn an die Staatliche Agrarbehörde verkauft. Diejenigen, die wie Julian den beschwerlichen Bedingungen trotzten, fristeten ein entbehrungsreiches Dasein.
Unbeirrt trat Julian weiter in die Pedale, während ihm der umherwirbelnde Staub in den Augen brannte.
Hinter einer Kuppe erschienen die ersten Häuser von Fichting. Auch in den Dörfern und Städten ächzten Mensch und Tier unter den Rekordtemperaturen. Die Wasserpegel von Flüssen und Seen sanken von Woche zu Woche. Rhein, Elbe, Havel und viele andere Flüsse führten so wenig Wasser, dass Sandbänke und Felsen frei lagen und Güterverkehr mit Schiffen unmöglich geworden war. Sogar Trinkwasser wurde in mehr und mehr Regionen knapp, und selbst die rund 5200 Notbrunnen in Deutschland drohten, bald zu versiegen. Längst war sauberes Trinkwasser zum Luxusgut geworden. Da war es auch wenig verwunderlich, dass die Staatliche Agrarbehörde seit Wochen die künstliche Beregnung von Feldern und Äckern nur noch in bestimmten Regionen und nur unter strengen Auflagen erlaubte.
Julian riss den Lenker herum. Beinahe wäre er gedankenverloren in ein Schlagloch gerauscht. Er richtete seine Konzentration wieder auf den Weg, denn jetzt erreichte er den Ortsrand Fichtings. Verwahrloste Vorgärten, heruntergelassene Rollläden, abblätternde Farben und Risse in den Fassaden verrieten, dass die meisten Häuser leer standen. Nur wenige Autos parkten auf den Straßen. Seit der Einführung von Aequitas verschwanden Autos nach und nach von den Straßen. Immer weniger Menschen konnten sich die teuren CO2-Credits dafür noch leisten, vor allem in ländlichen Regionen. Mit seinen knapp zweitausend verbliebenen Einwohnern gehörte Fichting zu den kleineren Gemeinden der Umgebung. Noch vor wenigen Jahren waren es dreimal so viele Einwohner gewesen. Doch Arbeit auf dem Land war knapp geworden, nicht zuletzt durch eine zunehmend digitalisierte Landwirtschaft. Die Menschen flohen in die Städte. Das Überangebot an Wohnraum auf dem Land ließ die Preise entsprechend ins Bodenlose fallen. Es war eine Abwärtsspirale, aus der es kein Entrinnen gab. Gemeinden wie Fichting hatten keine Zukunft. Sie starben langsam, aber sicher aus.
Julian hetzte weiter in Richtung Stadtmitte. Die Hitze setzte ihm zu. Sein Herz hämmerte, seine Lunge gierte nach Sauerstoff, und seine Oberschenkel brannten. Trotzdem behielt er sein Tempo bei. Die Angst, bei der heutigen Verteilung der Lebensmittelrationen leer auszugehen, verlieh ihm ungeahnte Kräfte.
Zwei Straßen weiter kam er an der Bäckerei und der Metzgerei vorbei. Beide Betriebe waren seit einiger Zeit geschlossen, die Rollgitter vor den Eingangstüren heruntergelassen und mit Vorhängeschlössern gesichert. Julian fragte sich, wozu? In beiden Läden gab es schon lange nichts mehr zu holen.
Er fuhr von der Straße ab und nahm eine Abkürzung über den Parkplatz von Fichtings einzigem Supermarkt. Ein einzelnes Auto stand verloren neben zwei Reihen ineinandergeschobener Einkaufswagen. Der Supermarkt hatte noch an drei Tagen die Woche geöffnet. Allerdings herrschte in den meisten Regalen gähnende Leere. Die wichtigsten Grundnahrungsmittel fehlten, viele Obst- und Gemüsesorten gab es nur noch saisonal. Wasserintensive Produkte wie Spargel oder Nüsse fanden sich kaum noch. Und wenn, dann waren sie praktisch unerschwinglich. Dasselbe galt für Nahrungsmittel, die aus fernen Ländern importiert werden mussten wie Reis, Kakao, Kaffee und Avocados. Der CO2-Ausstoß, der beim Transport dieser Produkte entstand, verteuerte sie erheblich. Die Menschen waren kaum noch dazu bereit – oder finanziell in der Lage –, wertvolle CO2-Credits für importierte Luxusgüter zu verschwenden. Dasselbe galt mittlerweile auch für Fleisch. Mit dem Verbot der Massentierhaltung aufgrund des hohen Wasserverbrauchs sowie CO2-Ausstoßes waren die Preise für Fleisch ins Uferlose gestiegen. Echtes Fleisch war für die breite Masse praktisch unerschwinglich geworden. Künstliches Fleisch aus dem Labor ebenso wie Fleischersatz aus getrockneten und pürierten Insekten waren zwar billiger, aber auch sie waren nicht immer und überall verfügbar. Insgesamt war gesunde, naturbelassene Nahrung zum Luxusgut geworden. Billigere synthetische Lebensmittel voller künstlicher Aroma- und Zusatzstoffe machten zwar für einige Stunden satt, dafür aber auf Dauer krank. Das Hauptproblem bestand in der mangelnden Versorgung mit Grundnahrungsmitteln wie Getreide, Kartoffeln, Mais oder Soja. Und genau deshalb war es umso wichtiger, dass Julian den Marktplatz so schnell wie möglich erreichte.
Während er auf Kopfsteinpflaster zwischen alten Fachwerkhäusern hindurchraste, warf er einen Blick auf seine Smartwatch. Mist! Wäre er eine Stunde früher aufgestanden, wäre er rechtzeitig mit den Solarmodulen fertig geworden.
Dann, endlich, hörte er die Menschenmenge.
5
Die Ausgabe der wöchentlichen Lebensmittelrationen war noch in vollem Gange. Inmitten des abgesperrten und von Bundeswehrsoldaten bewachten Marktplatzes drängten sich etwa zweihundert Menschen vor drei Lastwagen. Von deren Ladeflächen aus verteilten Mitarbeiter der Stagrar – wie die Staatliche Agrarbehörde umgangssprachlich genannt wurde – die Essensrationen an die Einwohner Fichtings sowie der umliegenden Gemeinden. Julian war überrascht, dass um diese Uhrzeit noch so viel los war. Aus irgendwelchen Gründen hatte die Verteilung heute offenbar später als üblich begonnen. Das kam Julian natürlich sehr gelegen.
Er rollte bis vor die Absperrung, stieg vom Rad, schloss es an einem Laternenpfahl ab und eilte die Absperrgitter entlang zum Durchgang. Dort wies er sich einem Soldaten gegenüber aus, indem er seine Smartwatch vor einen ID-Scanner hielt. Das war der Moment, vor dem Julian jede Woche aufs Neue graute. Bislang war alles gut gegangen, aber das bedeutete nicht, dass man ihm nicht irgendwann doch auf die Schliche kommen konnte. Sollte sein Schwindel auffliegen, drohte ihm Gefängnis. Doch dieses Risiko musste er eingehen. Zu viel hing davon ab.
Der Sensor registrierte Julians persönliche Bürgernummer und gab grünes Licht, woraufhin der Soldat ihn durchwinkte. Innerlich atmete er auf.
Auf dem sonnenüberfluteten Platz herrschte ein reges Kommen und Gehen. Während Julian sich durch den Menschenstrom hindurch auf die Enden der Schlangen zubewegte, die sich hinter den Ladeflächen der Lastwagen gebildet hatten, fiel ihm auf, wie dünn und ausgemergelt die Leute geworden waren. Nicht wenige trugen Kleidung, die ihnen eine oder zwei Nummern zu groß geworden war. Die Menschen waren angespannt, der Ton rau. Diejenigen, die wie Julian spät dran waren, befürchteten, leer auszugehen. Andere, die ihre Rationen bereits erhalten hatten, pressten die Päckchen auf dem Heimweg fest an ihre Körper. Ein Mann rempelte Julian von hinten an und eilte, ohne sich zu entschuldigen, an ihm vorbei, nur um sich vor ihm ans Ende der Warteschlange stellen zu können. Julian nahm es ihm nicht wirklich übel. Der Fokus der Menschen hatte sich radikal verändert, seitdem Nahrungsmittel mehr Geld verschlangen als Wohnraum oder Mobilität. In Großstädten war der Diebstahl von Lebensmitteln an der Tagesordnung, aber selbst in Orten wie Fichting musste man auf der Hut sein. Der Hunger trieb Menschen ins Verbrechen, und mit jeder weiteren Missernte wurde es schlimmer. Bewaffnete Überfälle auf die bewachten Lebensmitteldepots der Staatlichen Agrarbehörde nahmen zu. Immer wieder kam es dabei auch zu Todesfällen, doch der Hunger war häufig stärker als die Sorge ums eigene Leben. Als kleiner Junge hatte Julians Opa Anton ihm stets eingetrichtert, niemals in der Öffentlichkeit den Geldbeutel zu öffnen. Das zöge nur die falschen Leute an, hatte Opa Anton immer gemeint. Wäre er noch am Leben, würde er Julian heute vermutlich raten, niemals für alle sichtbare Lebensmittel bei sich zu tragen.
In der Warteschlange ging es nur langsam vorwärts. Julian nutzte die Zeit und gönnte sich mehrere Schlucke Wasser aus seiner Trinkflasche. Aktuell war für jeden Bürger pro Woche eine Lebensmittelration vorgesehen, unabhängig von Geschlecht oder Alter. Einzig Kinder unter vierzehn Jahren erhielten etwas kleinere Portionen. Die Zusammensetzung der Rationen variierte und bestand üblicherweise aus Brot, dazu Kartoffeln, Mais oder Sojaprodukte – je nachdem, was gerade verfügbar war und in welcher Menge. Natürlich reichte eine Ration alleine bei Weitem nicht aus, um einen erwachsenen Mann eine ganze Woche lang zu ernähren, aber die Stagrar konnte nur verteilen, was verfügbar war. Und selbst wenig war besser als nichts.
Schließlich ging gar nichts mehr voran. Auf der Ladefläche des Lastwagens stockte die Ausgabe der Lebensmittel. Zwei Mitarbeiter der Stagrar standen vor einem ID-Scanner und drückten mit ratlosen Gesichtern scheinbar wahllos auf dem Display herum. Offenbar gab es ein technisches Problem mit dem Scanner, der die Ausgabe der Lebensmittel registrierte. Um Missbrauch zu verhindern, musste sich jeder Bürger mit seiner Bürgernummer ausweisen, die gleichzeitig mit der persönlichen Aequitas-ID verknüpft war. Digitale Vollmachten erlaubten es, Rationen von Familienmitgliedern gleich mit in Empfang zu nehmen. Julian besaß solche Vollmachten von seinem Vater und seiner Schwester.
Ein Soldat schritt mit wichtiger Miene auf den Lastwagen zu. Er sprang auf die Ladefläche und machte sich am Scanner zu schaffen. Die Sache zog sich in die Länge. Sehnsüchtig warf Julian einen Blick auf die Reihe neben ihm, in der es deutlich zügiger voranging. Natürlich hatte er sich wieder einmal für die falsche Schlange entschieden. Wie konnte es auch anders sein?
Plötzlich vernahm er von weither ein Martinshorn. Rasch wurde das Jaulen der Sirene lauter. Kurz darauf sah Julian zwischen zwei Fachwerkhäusern hindurch ein Löschfahrzeug der Feuerwehr vorbeirasen. Kaum jemand auf dem Marktplatz schenkte dem Beachtung. Auf den verdorrten Feldern und in den knochentrockenen Wäldern der Umgebung waren Brände um diese Jahreszeit nicht ungewöhnlich. Um ein Feuer zu entfachen, genügte der Funke eines Feuerzeugs oder auch nur glimmende Zigarettenasche, die vom Wind viele Hundert Meter weit durch die Luft getragen werden konnte. Nur wenig später raste ein weiteres Feuerwehrfahrzeug vorbei; diesmal handelte es sich um einen Rettungswagen. Unmittelbar darauf folgte ein Polizeiauto mit eingeschaltetem Blaulicht. Nachdenklich sah Julian dem Streifenwagen hinterher. Was auch immer hinter diesem Alarm steckte, diesmal schien es eine größere Sache zu sein.
Kurz darauf setzte sich die Schlange wieder in Bewegung. Das Problem mit dem Scanner schien behoben zu sein. Bald standen nur noch etwa zwanzig Männer und Frauen vor Julian. Plötzlich spitzte er die Ohren. Im allgemeinen Gemurmel meinte er, seinen Nachnamen herausgehört zu haben. Er musterte die Wartenden in seiner näheren Umgebung, sah aber kein bekanntes Gesicht. Dann hörte er in der Schlange nebenan einen jüngeren Mann mit schmalem Gesicht zu einer alten Frau sagen: »Aber wenn ich es dir doch sag, Mama. Es ist ganz sicher der Thaler-Hof. Der Sepp hat mich grad angerufen und es bestätigt.«
Julian stutzte. Er kannte weder den Mann noch die Frau, doch sie redeten unzweifelhaft über ihn. Genau genommen redeten sie über seinen Hof, aber in einem Dorf wie Fichting lief das auf dasselbe hinaus.
»Wie furchtbar«, entgegnete die Frau. »Der Georg ist doch ein so netter Mann. Vielleicht irrt sich der Sepp ja?«
»Mensch Mama, der Sepp kann den Thaler-Hof doch von seinem Schlafzimmer aus sehen. Er sagt, die Rauchsäule reicht schon in den Himmel und ist so schwarz wie früher die Abgase von seinem alten Diesel.«
Rauchsäule? Sofort dachte Julian an die Einsatzfahrzeuge, die vor kaum zehn Minuten am Marktplatz vorbeigefahren waren. Sein Magen zog sich zusammen. Er wandte sich dem Mann und dessen Mutter zu. »Was ist mit dem Thaler-Hof?«
»Ich hab es gerade erfahren«, sagte der Mann. »Der Thaler-Hof brennt lichterloh.«
Sämtliches Blut wich aus Julians Kopf, und für einen Moment wurde ihm schwindlig.
»Alles in Ordnung mit dir?«, fragte der Mann.