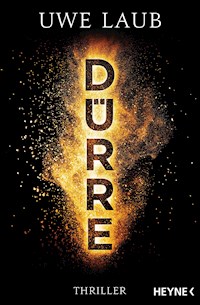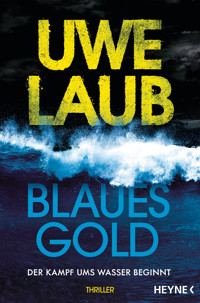
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Der Kampf ums Wasser beginnt
Der Milliardär Ethan Holloway steht kurz vor dem Ziel. Seine Firma Sharpwater hat vor der deutschen Ostseeküste die gigantische Förderplattform „Greifswald“ errichtet. Sie soll unter dem Meeresboden entdeckte Süßwasservorkommen erschließen. In Zeiten von Klimaerwärmung und Dürren könnten diese weltweit vorhandenen Aquifere die Lösung für eines der drängendsten Probleme der Menschheit darstellen. Doch die feierliche Eröffnung der Greifswald gerät zum Albtraum, als ein mysteriöser Unbekannter mithilfe einer Söldnertruppe die Plattform kapert. Sein Ultimatum: Das Trinkwasser muss vergemeinschaftet werden, andernfalls wird die Plattform mit allen darauf befindlichen prominenten Geiseln in die Luft gesprengt. Der Kampf ums blaue Gold beginnt!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Das Buch
Der Milliardär Ethan Holloway steht kurz vor dem Ziel. Seine Firma Sharpwater hat vor der deutschen Ostseeküste die gigantische Förderplattform Greifswald errichtet. Sie soll unter dem Meeresboden entdeckte Süßwasservorkommen erschließen. In Zeiten von Klimaerwärmung und Dürren könnten diese weltweit vorhandenen Aquifere die Lösung für eines der drängendsten Probleme der Menschheit darstellen. Doch die feierliche Eröffnung der Greifswald gerät zum Albtraum, als ein mysteriöser Unbekannter mithilfe einer Söldnertruppe die Plattform kapert. Sein Ultimatum: Das Trinkwasser muss vergemeinschaftet werden, andernfalls wird die Plattform mit allen darauf befindlichen prominenten Geiseln in die Luft gesprengt. Der Kampf ums blaue Gold beginnt!
Der Autor
Uwe Laub wurde 1971 in Rumänien geboren. Er war zwei Jahre alt, als seine Eltern mit ihm nach Deutschland zurückkehrten. Laub arbeitete mehrere Jahre im Pharmaaußendienst, seit 2010 führt er das Unternehmen eigenständig. Seine Liebe gilt dem Schreiben. Für seine Wissenschaftsthriller recherchiert er jahrelang. Sein Roman Sturm wurde zum Bestseller.
www.uwelaub.de
Uwe Laub
BlauesGold
Der Kampf ums Wasser beginnt
Thriller
WILHELMHEYNEVERLAGMÜNCHEN
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Originalausgabe 03/2024
Copyright © 2024 by Uwe Laub
Copyright © 2024 diese Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Thomas Brill
Umschlaggestaltung: DASILLUSTRAT, München, unter Verwendung der Motive von Shutterstock (Anatoli Styf, NatalyFox)
Satz und E-Book Produktion: Satzwerk Huber, Germering
ISBN 978-3-641-31073-8V002
www.heyne.de
Prolog
Juli 2020
Mittelmeer, Malta, fünf Seemeilen vor der Nordküste
Der Sturm erreichte die Hercules mit voller Wucht. Am Himmel fegte die schwarze Wolkenwand über das sechzehn Meter lange Arbeitsschiff hinweg, während trommelartiger Regen herniederging und auf das Deck und Steuerhaus prasselte. Schlagartig fiel die Temperatur und die Umgebung verdunkelte sich. Die hoch aufragenden Hotelburgen von Sliema und St. Julian’s an der Nordküste Maltas, ebenso wie die imposante Kuppel der Karmelitenkirche in Valletta, die Leonie Vargas noch vor wenigen Minuten am Horizont ausmachen konnte, verschwanden hinter einem dichten Regenvorhang. War der Seegang in der letzten Stunde schon grenzwertig gewesen, türmten sich die Wellen jetzt gefährlich auf. Ungestüm prallten sie gegen den Stahlrumpf der Hercules, wo sie zerbarsten und als Gischt vom pfeifenden Wind über das Deck geweht wurden. Das robuste Schiff mit dem drei Meter hohen Stahlbügel am Heck hob und senkte sich bald im Sekundentakt. Um einen einigermaßen festen Stand auf Deck bemüht, hatte Leonie sich mit beiden Füßen zwischen der Reling und der mächtigen Winde vor dem Stahlbügel eingeklemmt. Ihr Regenponcho bot kaum Schutz. Längst war sie klatschnass. Hätte sie dem Wetterbericht doch nur ebenso viel Aufmerksamkeit geschenkt wie der Kapitän der Hercules, der ihr vor dem Ablegen am frühen Morgen geraten hatte, geeignetes Ölzeug mitzunehmen. Stattdessen hatte Leonie in den strahlend blauen Himmel geschaut und lächelnd mit den Achseln gezuckt. Das hatte sie nun davon. Jetzt zitterte sie nicht nur vor Kälte, es fiel ihr auch zunehmend schwer, den wasserdichten, aufgeklappten Laptop in ihren Händen zu balancieren. Wahrscheinlich sah ihr der erfahrene Kapitän mit dem wettergegerbten Gesicht in diesem Augenblick vom trockenen Steuerhaus aus zu und grinste über die junge, eigensinnige Frau, die zwar einen Masterabschluss in Geomatics Engineering aufweisen konnte, dafür aber keine Ahnung vom Wetter auf See hatte.
Eine weitere Welle ließ den Rumpf der Hercules erzittern und wieder klatschte Gischt in Leonies Gesicht. Wasserschlieren auf dem Display des Laptops machten es mittlerweile unmöglich, die stetig eingehenden Messdaten abzulesen. Leonie fluchte. Sie hatte das Schiff für eine Woche gechartert und heute war der letzte Tag. Ihr Budget, das ihr vom GEOMAR-Institut für dieses Projekt zur Verfügung gestellt worden war, war bis auf den letzten Cent aufgebraucht. Sie konnte nicht einfach abbrechen und es morgen oder vielleicht übermorgen erneut versuchen. Jetzt oder nie, sagte sie sich und biss die Zähne zusammen.
Wasser tropfte von ihrer Nasenspitze, während sie sorgenvoll einen Blick auf das Schleppkabel warf, das von der Winde ausgehend über den mächtigen Bügel geführt wurde und einige Meter hinter dem Heck im aufgewühlten Meer verschwand. Am anderen Ende des Kabels, in rund dreißig Metern Tiefe und somit nur knapp über dem Meeresgrund, hing die Messsonde, die Daten über ein Verbindungskabel an Leonies Laptop übertrug. Die kreisrunde Sonde wog etwas weniger als dreißig Kilogramm, was für das Kabel unter normalen Umständen kein Problem darstellte. Sorgen bereitete Leonie allerdings das zunehmende Auf und Ab der Hercules. Die Wellen wurden höher, die Wellentäler tiefer. Sollte die Sonde gegen den Meeresgrund stoßen, würde sie verfälschte Daten senden. Nicht gänzlich auszuschließen war auch, dass sich die Sonde an einem Hindernis verfing, von denen es hier in diesem Seegebiet leider viel zu viele gab. Im Zweiten Weltkrieg war Malta einer der wichtigsten britischen Marinestützpunkte gewesen und somit ein strategisches Ziel der Achsenmächte Italien und Deutschland. Während einer Seeblockade zwischen 1940 und 1942 flogen deren Luftwaffen permanent Angriffe, mit dem Ergebnis, dass heute rund um Maltas Küsten unzählige Schiffs- und Flugzeugwracks auf dem Meeresgrund verrosteten. Für gewöhnlich erkannte das Echolot der Hercules derlei Hindernisse rechtzeitig, doch ob das auch bei diesem Wellengang zuverlässig funktionierte, konnte Leonie nicht abschätzen. Beim Gedanken an das Echolot fiel ihr Kaiden Farrugia ein. Er war Geomorphologe, arbeitete am Zentrum für Physikalische Ozeanografie der Universität Malta und war Leonie von GEOMAR als projektbegleitender Partner zur Seite gestellt worden. Wie er wohl in der kleinen Kabine unter Deck vor seinen Bildschirmen mit diesen Bedingungen zurechtkam? Sie arbeiteten erst seit zwei Wochen zusammen, und obwohl sie sich gut verstanden, kannten sie sich bislang nur oberflächlich. Soweit Leonie wusste, war auch Kaiden nicht gerade ein gestandener Seemann.
Eine Breitseite ließ die Hercules beängstigend weit nach Backbord kippen, bevor sie sich wieder aufrichtete. Leonie kämpfte mit dem Gleichgewicht. Der Kinnriemen ihres Schutzhelms schnitt in ihre Haut, doch um nichts in der Welt hätte sie auf ihn verzichten wollen. Schon bei normalem Seegang stieß sie sich an Bord dieses Schiffes ständig an. Kein Tag verging, an dem sie nicht mit einem neuen blauen Fleck an Armen, Oberschenkeln oder am Hintern in ihr Apartment kam. Heute würden garantiert noch welche dazukommen. Durch den heulenden Wind gedämpft, hörte sie jetzt jemanden rufen. Ein Mann kam über das schwankende Deck auf sie zu. Es war Kaiden. Er trug einen Regenponcho mit eng geschnürter Kapuze, doch auch sein Gesicht war klatschnass.
Erneut rief er ihr durch Wind und Regen etwas Unverständliches zu, während er Leonie gleichzeitig zu sich winkte.
»Was?«, entgegnete sie, so laut sie konnte. »Ich kann dich kaum hören.«
Er kam bis auf zwei Meter an sie heran, hielt sich mit beiden Händen am Stahlbügel fest und rief: »Der Kapitän sagt, du musst jetzt reinkommen. Es wird zu gefährlich. Wir brechen ab.«
»Ich brauche höchstens noch eine halbe Stunde. Sag ihm das.«
»Hab ich schon versucht. Er lässt nicht mit sich reden. Er meint, du hast zwar für sein Schiff bezahlt, aber sein Leben und das seiner Matrosen kannst du nicht kaufen.«
»Nur eine halbe Stunde. Mehr verlange ich nicht.«
»Keine Chance. Kapitän Ahab hat das Sagen. So ist das nun mal. Und ganz ehrlich, mir wird das hier auch zu wild.«
»Wir geben jetzt nicht auf. Nicht so kurz vor dem Ziel.«
Kaiden wischte sich nasse Strähnen aus dem Gesicht und grinste. »Wer sagt denn, dass wir unser Ziel nicht längst erreicht haben?«
»Wie meinst du das?«
»Du solltest dir die neuesten Daten auf meinem Rechner ansehen.« Sein Grinsen wurde breiter. »Ich sag nur: Jackpot.«
Leonie riss die Augen auf. »Verarschst du mich?«
Kaiden schüttelte den Kopf.
»Ist es tatsächlich das, was wir uns erhofft haben?«, hakte Leonie mit klopfendem Herzen nach.
»Das und noch viel mehr. Komm und sieh selbst.«
»Ist das ein Trick? Willst du mich nur von hier weglocken, damit wir abbrechen?«
Kaiden lachte. »Das würdest du mir zutrauen?«
»Um an Land zu kommen, würdest du mir im Augenblick vermutlich alles erzählen.«
Kaiden lachte lauter. »Niemals.«
Unweit von ihnen fuhr ein Blitz ins Wasser, kurz darauf grollte Donner. Leonie zuckte zusammen.
»Hol endlich die Sonde ein und schwing deinen Hintern unter Deck«, befahl Kaiden. Er drehte sich um und tapste über das schwankende Deck zurück zum Niedergang, der zur Kabine führte, wo er seine Computer und Monitore aufgebaut hatte.
Ein Gefühl von Euphorie durchströmte Leonie. Wind, Regen und Kälte waren mit einem Mal vergessen. Konnte es wahr sein? Hatten sie tatsächlich gefunden, wonach Leonie seit Monaten suchte? Hatten sie endlich einen Beweis für ihre Theorie? Falls ja, so war das nichts weniger als eine Sensation. Leonies Herz schlug schneller. Ihr Blick fiel auf das Schleppkabel, das hinter der Hercules im stürmischen Meer verschwand. Nachdenklich kaute sie auf ihrer Unterlippe. Sollte sie, bei aller Euphorie, die Sonde wirklich schon einholen? Sobald diese an Bord und gesichert war, würde der Kapitän unverzüglich den Kurs ändern und den Hafen von Valletta ansteuern. Doch was, wenn Kaiden sich irrte? Was, wenn die Messdaten nicht so eindeutige Ergebnisse lieferten, wie er das offenbar glaubte? In diesem Fall wäre alles umsonst gewesen. Das durfte Leonie nicht riskieren. Besser, sie prüfte die Daten mit eigenen Augen. Das Ganze würde nicht länger als zehn, vielleicht fünfzehn Minuten dauern. Das Risiko war überschaubar. Obwohl die Vorschriften besagten, dass bei herabgelassener Sonde jederzeit eine Person an der Winde stehen und den Kabellauf überwachen musste, presste Leonie ihren Laptop fest gegen ihren Körper und folgte Kaiden in dessen Kabine.
Tief im Bauch der Hercules spürte Leonie den Seegang zwar immer noch, aber nicht mehr ganz so unangenehm wie an Deck. Mit beiden Händen stützte sie sich auf dem am Boden festgeschraubten Holztisch ab, während ihr Blick zwischen Kaidens Monitoren hin- und hersprang. Sie brauchte nicht einmal fünf Minuten, um zu erkennen, dass ihr Kollege die Daten richtig analysiert und gedeutet hatte. Ungläubig starrte sie auf die Messdaten, Diagramme sowie die Abbildung der Sedimentschichten unterhalb des Meeresbodens, die bis in mehrere Hundert Meter Tiefe reichten. Sowohl Leonie als auch Kaiden trieften vor Nässe, doch keinem der beiden kam in den Sinn, sich mit einem der Handtücher abzutrocknen, die hinter ihnen an einer Hakenleiste hingen.
»Ich fass es nicht«, murmelte Leonie.
»Sag ich doch: Jackpot!« Freundschaftlich boxte Kaiden ihr gegen den Oberarm. »Glaub mir zur Abwechslung doch mal was.«
Sie sah ihn an. »Ist dir klar, was das bedeutet?«
»Wir feiern heute Abend mit Champagner und du bezahlst?«
Leonie lächelte. »Vielleicht mache ich das sogar. Das hier ist … es ist mehr, als ich mir je erträumt hatte.«
»Du hast es deinen Kritikern gezeigt. Sie werden sich vor dir in den Staub werfen und um Vergebung betteln.«
»Quatschkopf.« Sie lachte, dann wurde sie ernst. »Wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Das hier ist nur ein Anfang. Wir brauchen noch viele Monate, vielleicht Jahre, bis wir eine aussagekräftige Kartierung vorliegen haben.«
»Immerhin dürften uns frische Fördergelder sicher sein. Dein Projekt hat die erste Hürde genommen.«
»In der Tat. Rettung in letzter Sekunde.«
Eine kräftige Welle krachte gegen die Bordwand, woraufhin Leonie zusammenzuckte.
»Dann können wir ja endlich von hier verschwinden«, sagte Kaiden mit bangem Blick und schob sich an ihr vorbei zur Tür. »Ich gebe Kapitän Ahab Bescheid.«
»Warte.« Leonie hielt ihn am Arm zurück. »Zuerst muss ich die Sonde einholen.«
Kaidens Augen weiteten sich. »Sie ist noch im Wasser? Ohne Aufsicht? Bist du verrückt?«
»Jaja, ich weiß.« Sie rückte ihren Regenponcho zurecht. »Gib mir zehn Minuten, dann kannst du …«
Ein heftiger Ruck fuhr durch die Hercules, als wäre das Schiff gegen ein Hindernis geprallt oder würde unvermittelt aufstoppen. Leonie und Kaiden wurden gegen die Tür geschleudert. Schmerzhaft stieß Leonies Hüfte gegen den Knauf. Ein weiterer blauer Fleck. Sie berappelten sich und sahen sich an.
»Was war das?«, fragte Kaiden.
»Hat sich nicht nach einer Welle angefühlt.« Plötzlich lief es Leonie eiskalt den Rücken hinunter. »Die Sonde!«
»Madonna«, flüsterte Kaiden.
Ohne ein weiteres Wort zu verlieren, hastete Leonie die Stufen hinauf, dicht gefolgt von Kaiden. Kaum hatte sie die Außentür geöffnet, schlug ihr Regen ins Gesicht. Um einen festen Stand bedacht, betrat sie das glitschige und schwankende Deck. Sie erkannte es sofort. Das Schleppkabel, an dessen Ende die Messsonde gehangen hatte, war knapp über der Meeresoberfläche gerissen.
Mit bebenden Lippen starrte Leonie auf das ausgefranste Ende des Kabels, das in weitem Bogen von einer Seite zur anderen schwang. Es war geschehen. Die Sonde war unwiederbringlich verloren. Leonie schluckte. Nicht nur war dieses Hightechgerät eine Einzelanfertigung, die es so nirgendwo zu kaufen gab; die Sonde war auch sündhaft teuer gewesen. Beinahe die Hälfte des Budgets hatten alleine Konstruktion und Material verschlungen. Die Euphorie über ihre heutige Entdeckung wich tiefer Niedergeschlagenheit. Leonie war den Tränen nahe. Das war nicht fair! Keine zehn Minuten war sie unter Deck gewesen. Wie hoch war die Wahrscheinlichkeit für solch ein Desaster? Wie viel Pech konnte man haben? Für diese Nachlässigkeit würde Professor Frentzen, Mitglied des Direktoriums von GEOMAR, sie kreuzigen. Ergebnisse hin oder her. Plötzlich stellte sich nicht mehr die Frage, wann Leonie frische Fördergelder für ihr Herzensprojekt erhalten würde, sondern ob überhaupt.
1
August 2026
Hansestadt Anklam, Landkreis Vorpommern-Greifswald
Deutschland brannte. Vom hohen Norden über den Osten bis tief hinein in den Süden der Republik wüteten die schlimmsten Waldbrände seit über einem Jahrhundert. Auch weite Teile Europas standen in Flammen. Die außergewöhnliche Dürre, die den Kontinent seit nunmehr vier Jahren heimsuchte, sorgte für staubige Erde, verdorrte Felder, verkohlte Wälder und austrocknende Flussläufe. Binnenschifffahrt war seit Wochen vielerorts unmöglich geworden; der letzte Sargnagel für eine ohnehin angeschlagene Wirtschaft. Und jetzt ging Europa auch noch das Trinkwasser aus.
Chris Kellermann hockte auf seinem Mofa und fuhr nördlich von Anklam von der wenig befahrenen Bundesstraße 109 ab. Nach einer lang gezogenen Kurve gab er wieder Gas und knatterte mit der vierzig Jahre alten Zündapp über die Anklamer Chaussee seinem Ziel entgegen. Die gut ausgebaute Landstraße führte inmitten karger Felder und brauner Wiesen schnurgerade nach Norden. Dort am Horizont sah Chris schwarze Rauchwolken aufsteigen. Bei Karlsburg brannte der Wald mitsamt dem Buddenhagener Moor seit Tagen lichterloh. Die lokalen Nachrichten waren voll davon. Straßen waren gesperrt und Anwohner evakuiert worden. Die Behörden hatten sogar einen Badesee abgeriegelt, damit Hubschrauber daraus Löschwasser aufnehmen konnten, um die Brände von oben zu bekämpfen. Am Boden gab sich derweil die Feuerwehr alle Mühe, sah sich aber mit großen Schwierigkeiten konfrontiert. Trockene Moore fingen leicht Feuer, und brannten sie erst einmal, waren sie extrem schwer zu löschen. Doch damit nicht genug. Vor zwei Nächten hatte der Wind aufgefrischt und fachte die Feuersbrunst seitdem zusätzlich an. Als hätten sie in Anklam und Umgebung nicht schon genug Probleme. Allen voran er selbst.
Obwohl der Ort des Geschehens über fünf Kilometer entfernt lag, trug der Wind immer wieder Rauchschwaden herüber. Der beißende Qualm kroch hinter Chris’ Sonnenbrille und reizte seine Augen. Sein Respekt vor den Feuerwehrmännern und -frauen wuchs mit jeder neuen Schreckensnachricht, die es dieser Tage leider zuhauf gab.
Noch im Frühjahr hatte Chris sich nicht sonderlich für Meldungen dieser Art interessiert. Wenn er seinerzeit abends mit den Jungs im Anklamer Eck bei Pils und Korn Skat gespielt hatte, während draußen ein eiskalter Wind um die Häuser pfiff, waren Fußball und Frauen die beherrschenden Gesprächsthemen gewesen. Zwar gehörte beides nicht gerade zu Chris’ Stärken, darüber philosophieren ließ sich dennoch vortrefflich. Themen wie Klima, Wetter und Umwelt waren am Stammtisch erst in letzter Zeit aufgekommen. Am Anfang hatten sie noch Späße über die Klimahysterie der Medien und über so manche Aktion kompromissloser Umweltschützer gemacht. Doch die Stimmung war längst gekippt. Mit jedem weiteren Tag ohne Regen, jedem weiteren Waldbrand, jeder weiteren Evakuierung, jedem weiteren Tag, an dem der private Wasserverbrauch stärker eingeschränkt wurde, war ihnen die Lust am Witzereißen vergangen. Eine permanente Wasserversorgung in den Sommermonaten gab es nicht mehr. Drehte man den Hahn nachts auf, geschah nichts. Die Sorge in der Bevölkerung wuchs, dass es bald weitere Einschränkungen und Reglementierungen geben würde. Und es war definitiv ein Unterschied, ob ab und zu für einige Stunden das WLAN ausfiel oder aus den Wasserhähnen, Duschköpfen und Toilettenspülungen nur röchelnde Geräusche kamen.
Am Ende der Straße sah Chris jetzt die Umrisse von Onkel Radis Gehöft. Es wurde auch Zeit, denn die Zündapp machte ihrem Namen alle Ehre und knallte alle paar Sekunden. Für einen neuen Roller fehlte Chris jedoch die Kohle, und wie die Dinge aktuell standen, würde sich das auch nicht so schnell ändern. Die Lebenshaltungskosten, vor allem für Energie, stiegen scheinbar ungebremst. Und als wäre das nicht schon schlimm genug, explodierten seit diesem Jahr auch noch die Wasserpreise. Das Geld reichte längst vorne und hinten nicht mehr aus.
Chris drosselte das Tempo und bog auf eine kiesbedeckte Zufahrt ab. In Schrittgeschwindigkeit holperte er auf das in die Jahre gekommene Gehöft zu. Radolf Kellermann, der für ihn von Kindesbeinen an nur Onkel Radi war, betrieb eine bei Einheimischen wie Touristen beliebte Alpakafarm. Zweiundzwanzig der knuffigen Tiere hielt er hier. Mit ihnen als Begleitung bot er Spaziergänge über die Felder an, Picknicke sowie Kindergeburtstage, Stallabende und Hofführungen. Bei größeren Gruppen rief er Chris an, der dann vorbeikam, um zu helfen. Heute allerdings suchte Chris seinen Onkel aus einem anderen, wesentlich unerfreulicheren Grund auf.
Während er sich dem alten Bauernhaus und den beiden windschiefen Ställen näherte, warf Chris einen Blick auf die Koppel. Für gewöhnlich grasten die Alpakas dort tagsüber. An manchen Tagen interessierten sie sich nicht die Bohne für sein Auftauchen, an anderen liefen sie ihm am Zaun entlang hinterher, um sich dann am Hals streicheln zu lassen. Dies ließen sie gerne zu, wohingegen sie es überhaupt nicht mochten, an Kopf oder Beinen getätschelt zu werden. Vor allem die Hengste sahen darin eine Art Kampfhandlung, weil sie es gewohnt waren, sich bei Machtkämpfen gegenseitig in die Beine zu beißen. Heute waren jedoch weder streitende noch grasende Tiere auszumachen. Wohin Chris auch blickte, erkannte er einzig braune Wiesen. Sicher hielten sich die Tiere unter den schattenspendenden Unterständen beim Hof auf. Chris lächelte matt. Hätte er es sich aussuchen können, läge er bei dieser Hitze auch lieber im Freibad oder am See. Nur waren die Freibäder wegen Wassermangels geschlossen und der See wegen der Löscharbeiten gesperrt.
Kurz darauf entdeckte Chris seinen Onkel beim Brunnen, der sich inmitten der Koppel befand. Radolf Kellermann hatte ihn zeitgleich mit der Anschaffung seiner ersten Alpakas bohren lassen, um ein Stück weit autarker zu werden. Früher waren landwirtschaftlich genutzte Betriebe häufig von Entgelten für Wasserentnahmen ausgenommen gewesen, weshalb immer äußerst großzügig bewässert worden war. Doch diese Zeiten waren vorbei. Mittlerweile berechneten sämtliche Bundesländer den Wasserverbrauch in der Agrarwirtschaft, abgesehen von Grundwasserentnahmen auf privaten Grundstücken bis zu dreitausend Kubikmeter pro Jahr. Ein weiterer Anreiz für Radolf Kellermanns Entscheidung war der großzügige finanzielle Zuschuss, den er dafür aus einem Förderprogramm der Landesregierung erhalten hatte. Längst hatte sich der hübsche, aus Eisen gefertigte Brunnen mit der kunstvoll geschwungenen Schwengelpumpe als segensreiche Anschaffung erwiesen. Zwar bezweifelte Chris, dass sein Onkel sämtliche Wasserentnahmen vorschriftsmäßig meldete, aber das ging ihn nichts an.
Als Chris auf den Brunnen zusteuerte, sah er auch endlich die Alpakas, die sich wie vermutet im Schatten dreier offener Unterstände vor der Sonne verbargen. Sie drehten ihre flauschigen Wuschelköpfe in seine Richtung, wirkten allerdings nicht sonderlich interessiert. Die Hitze setzte ihnen zu. Vielleicht mochten sie auch den Rauch nicht, der hier draußen auf der Koppel wesentlich intensiver zu riechen war als in der Stadt.
Radolf Kellermann schienen die Temperaturen nichts auszumachen. In einem langärmeligen weinroten Flanellhemd und einer Jeanslatzhose, deren Enden er in grüne Gummistiefel gestopft hatte, stand er neben der Pumpe, umgeben von mehreren Eimern. Sein schütteres weißes Haar war glatt nach hinten gekämmt, Schweiß stand ihm auf der Stirn. Der verkniffene Gesichtsausdruck verriet Chris, dass sein Onkel wegen irgendetwas verärgert war.
»Du solltest einen Hut aufsetzen«, begrüßte Chris ihn. »Einen Sonnenstich kannst du dir nicht leisten. Für morgen steht ein Geburtstag mit fünf Erstklässlern im Terminkalender.«
»Der ist im Augenblick mein geringstes Problem«, entgegnete Radolf Kellermann und zeigte auf den Brunnen. »Dieses verdammte Ding will nicht mehr.«
Chris bemerkte, dass die Eimer allesamt leer waren. Er musterte die Pumpe. »Woran liegt’s? Schon eine Idee?«
Radolf Kellermann schnaubte und bewegte den Schwengel auf und ab. Für gewöhnlich kam das Wasser bereits nach dem zweiten Pumpen, heute aber ertönte nur ein hohles, röchelndes Geräusch. »Hörst du das, Junge? Klingt nicht gut.«
»Vielleicht ein defekter Dichtungsring?«
Sein Onkel schüttelte den Kopf. »Ich fürchte, es gibt kein Wasser mehr. Der Brunnen ist versiegt.«
»Wie kommst du darauf?«
»Zwei Nachbarn, den Borcherts und den Deters, denen ging es diese Woche genauso. Da kam von heute auf morgen auch kein Tropfen mehr. Jetzt ist es also passiert. Der Grundwasserpegel ist weiter abgesunken, als dieser Brunnen tief ist.«
»Und jetzt?«
»Was kann man da schon machen? Das war’s wohl vorerst mit kostenlosem Wasser.« Er zeigte auf die Alpakas. »Durch die Hitze sind sie dehydriert. Sie müssen trinken, bevor sie mir noch kollabieren.«
»Ich hatte mich schon gewundert, warum sie mich nicht begrüßen.«
Radolf Kellermann griff sich vier der leeren Eimer und sagte: »Schnapp dir die restlichen Pützen und komm mit.«
Während sie die Eimer zum Hof trugen, donnerte ein Hubschrauber über die beiden hinweg. Er scheuchte die Alpakas auf, die kreuz und quer über die Koppel jagten, nur um sich danach zurück in den Schatten zu flüchten.
»Das geht schon seit gestern so«, sagte Radolf Kellermann verärgert. »Löschhubschrauber der Polizei, die zum Buddenhagener Moor unterwegs sind. Fliegen jede halbe Stunde hier drüber. Die Tiere drehen jedes Mal durch.«
»Die Armen«, entgegnete Chris. »Mich wundert nur, dass der Küchensee noch genügend Wasser hat. Selbst die Peene ist ja nur noch ein Rinnsal.«
»Frag mich nicht, Junge. Ich weiß nur, dass die Einschläge immer näher kommen.«
»Einschläge?«
»Gestern haben sie Buggow evakuiert, nachdem vorgestern schon alle Einwohner aus Rubkow fortgebracht wurden. Der Borchert sagt, dass wir die Nächsten sind, wenn sich das Feuer weiter in unsere Richtung frisst.«
»Scheiße«, kommentierte Chris.
Radolf Kellermann blieb stehen und sah ihn mit entschlossener Miene an. »Ich sag dir, Junge, mich kriegen sie in keine Turnhalle, in der ich mit dreihundert Fremden die Nächte verbringen soll. Außerdem muss ich mich um die Tiere kümmern.«
»Wenn es tatsächlich so weit sein sollte«, überlegte Chris, »werden sie die Tiere auch in Sicherheit bringen. Und wenn das geschieht, werden wir bei ihnen bleiben. Wir werden sie auf keinen Fall allein lassen.«
»Wir?«
»Na klar. Ich liebe diese Fellknäuel genauso sehr wie du. Das weißt du.« Chris meinte das vollkommen ernst. Sollte die Situation es erfordern, würde er mit den Tieren sogar gemeinsam in einem Stall übernachten. Damit hatte er kein Problem, denn entgegen der landläufigen Meinung rochen Alpakas trotz ihrer dichten Wolle keineswegs unangenehm. Ihr Geruch erinnerte Chris vielmehr an frisches Popcorn.
Radolf Kellermann lächelte. »Bist ein guter Junge. Ach ja, warum bist du überhaupt hier? Heute steht kein Termin im Kalender …«
Chris zögerte. Das war der Moment, um auf das heikle Thema zu sprechen zu kommen, das ihn seit einiger Zeit plagte. Schließlich gab er sich einen Ruck. »Ich wollte etwas mit dir besprechen.«
»Schieß los.«
Sie setzten ihren Weg fort.
»Du weißt, dass ich immer gern hierher zu dir rausfahre und dir helfe …«
»Aber?«
»Nichts aber. Nur eine Bitte.«
»Ich ahne, was jetzt kommt. Raus damit.«
»Na ja … als du mit den Alpakas angefangen hast, da hast du mich ab und zu mal am Wochenende gebraucht. Dann lief es besser, du hast weitere Tiere gekauft, hattest mehr Buchungen und mehr Gäste. Irgendwann hast du mich immer öfter auch unter der Woche angerufen. Während der Pandemie war es dann zwar ruhiger, aber mittlerweile bin ich wieder jeden zweiten oder dritten Tag hier. An den Wochenenden praktisch ständig.«
»Und dafür bekommst du ja auch was bar auf die Kralle.«
Sie erreichten den Stall und stoppten vor dem Wasseranschluss, der aus der Wand ragte. Chris stellte einen der Eimer darunter und drehte den Hahn auf. Gurgelnd begann das Wasser zu fließen.
»Die Sache ist die«, sagte Chris. »Ich habe vielleicht einen Job in Aussicht. Als Malergehilfe. Ist nichts Besonderes, aber die zahlen gut. Nun ja, zumindest für einen ungelernten Arbeiter wie mich. Und du weißt, dass Mama und ich seit der Sache mit Papa finanziell echt zu kämpfen haben. Die Bank macht langsam Probleme. Wir brauchen das Geld.«
»Du willst mir also sagen, dass du nicht mehr kommst?«
»Wenn ich den Job ablehne, können Mama und ich die Raten für das Haus nicht mehr zahlen.«
»Verstehe.«
Der Eimer war fast vollgelaufen und Chris wechselte ihn gegen einen leeren aus. Dann sah er seinem Onkel in die Augen. »Tut mir echt leid, Onkel Radi. Mir bleibt keine Wahl. Es sei denn …«
»Was?«
Chris holte tief Luft. »Ich hab immer vermieden, dich nach mehr Geld zu fragen, weil ich weiß, dass du auch nur gerade mal so über die Runden kommst. Versteh mich bitte nicht falsch. Du drückst mir jeden Monat ein paar Hundert Euro in die Hand. Dafür bin ich dir auch echt dankbar. Nur reicht das eben nicht mehr aus. Die Sache mit Papa hat uns kalt erwischt.«
»Ich versteh schon, Junge. Das ist für uns alle nicht leicht. Du willst also mehr Geld?«
»Nicht wollen. Brauchen.« Er sah seinem Onkel erneut in die Augen und bemerkte die tiefe Traurigkeit in ihnen. »Hör mal, Onkel Radi. Unter der Woche wirst du dir jemand anderen suchen müssen. Aber an den Wochenenden werde ich weiter für dich da sein. Okay?«
»Was bleibt mir anderes übrig? Aber ich versteh dich, Junge. Mach dir keinen Kopf deswegen.«
»Danke.« Trotz der Enttäuschung im Gesicht seines Onkels fühlte Chris sich erleichtert, dass es nun endlich raus war. Zu lange schon hatte er sich vor diesem Gespräch gedrückt.
Aus heiterem Himmel begann der Wasserhahn zu stottern und zu klopfen. Der Strahl gluckerte und ebbte ab, bevor mit einem leisen Zischen und Spucken die Leitung erstarb. Ein letzter Tropfen platschte in den halb vollen Eimer.
Radolf Kellermann stieß einen derben Fluch aus.
»Was ist denn jetzt los?«, fragte Chris.
»Man hat uns das Wasser abgestellt.«
»Woher willst du das wissen?«
»Die neuesten Sparmaßnahmen. Haben sie im Radio gebracht. Erst haben sie uns das Autowaschen verboten, dann das Blumengießen und das Befüllen von Swimmingpools. Nicht, dass mich Letzteres interessieren würde, aber jetzt treiben sie es eindeutig zu weit. Unsere tolle Regierung ist mal wieder überfordert und weiß sich nicht anders zu helfen.«
»So ein Mist.« Chris wischte sich über den verschwitzten Nacken. »Die haben doch erst vor ein paar Wochen diese Nachtregelung eingeführt. Seitdem ist das Wasser doch sowieso zwischen zehn Uhr abends und sechs Uhr morgens abgestellt. Wird das jetzt etwa weiter verschärft?«
»Scheint so. Der Borchert sagt, dass einige Gemeinden inzwischen über Rationierungen tagsüber nachdenken. Ist das zu fassen? Wir leben in einem der reichsten Länder der Welt, und trotzdem stehen wir wie die Idioten vor einem trockenen Wasserhahn. Eine Schande!«
»Na ja, die Wasserverbände drehen uns den Hahn sicher nicht zum Spaß ab. Die Wasserknappheit muss dramatischer sein, als man uns sagt.«
»Ich könnte wetten, dass sie den Megafabriken rund um Berlin den Hahn nicht zudrehen«, echauffierte sich Radolf Kellermann. »Dabei verbraucht jede einzelne von denen hundertmal so viel Wasser im Jahr wie ganz Anklam. Wusstest du, dass die Unternehmen dort auf ihren Grundstücken ihre eigenen Brunnen bohren dürfen und kostenlos Wasser fördern, und zwar ohne Mengenbegrenzung und ohne Genehmigung des Landesumweltamts? Das haben denen ein paar unfähige, vielleicht auch korrupte Politiker vor einigen Jahren zugesagt. Hauptsache, die Wirtschaft brummt. Und ob meine Viecher hier verrecken, da geben die einen Scheiß drauf!«
Chris legte ihm beruhigend die Hände auf die Schultern. »Jetzt komm mal wieder runter. Wenigstens haben wir zweieinhalb Eimer. Damit füllen wir die Tränke auf. Das sollte für den Augenblick genügen. Danach klemmen wir uns hinters Telefon und versuchen, jemanden im Rathaus oder beim Wasserwerk zu erreichen, der uns weiterhelfen kann. Vielleicht schicken sie uns einen Tankwagen, wenn wir ihnen die Situation erklären.«
»Tankwagen?«
»Kannst du seit einigen Tagen bei uns im Landkreis anfordern, wenn du eine gute Begründung hast. In Frankreich und Italien ist das in etlichen Gemeinden längst an der Tagesordnung. Überall da, wo es kein fließendes Wasser mehr gibt. In Spanien sind in einigen Regionen riesige Tankschiffe unterwegs, die täglich dieselben Routen abfahren und Trinkwasser liefern. Die Schweiz macht das sogar mit Armeehubschraubern. Krass, oder?«
Radolf Kellermanns Schultern sackten nach unten. »Egal wie, wir brauchen Wasser.«
Chris zwang sich zu einem Lächeln. »Wir kriegen das hin.«
»Du bist wirklich ein guter Junge.«
»Du, Onkel Radi, da wäre noch eine Sache …«
»Was?«
»Ich hab dich vor zwei Wochen schon darauf angesprochen, und …«
»Und ich habe Nein gesagt.«
»Du weißt doch noch gar nicht, was ich …«
»Das weiß ich sehr wohl.« Radolf Kellermanns Augen verengten sich. »Hat mein Bruder dir aufgetragen, noch mal zu fragen?«
»Papa weiß nicht mal, dass ich mit dir darüber rede.«
»Die Antwort lautet Nein.«
»Onkel Radi …«
»Nein! Niemals.« Damit drehte er sich um und stapfte davon.
Enttäuscht blickte Chris ihm hinterher. Es war abzusehen gewesen, dass sein Onkel über sein Anliegen nicht begeistert sein würde, aber mit so einer heftigen Reaktion hatte er nicht gerechnet. Seine letzte Hoffnung, den Super-GAU noch abzuwenden, der ihm drohte, löste sich soeben in Rauch auf. Jetzt stand er vor einem echten Problem. Und ihm blieb nicht mehr viel Zeit, um eine Lösung für sein Dilemma zu finden.
2
Ostsee, Greifswalder Bodden, acht Seemeilen vor der Küste Rügens
Der Bell-407-Transporthubschrauber hatte seine reguläre Flughöhe verlassen und bewegte sich nun mit zweihundertzehn Stundenkilometern seinem Ziel entgegen. Bis zur Greifswald, der weltweit ersten Offshore-Förderplattform für Süßwasser, waren es keine zehn Minuten mehr. Trotz der dicken Kopfhörer konnte Leonie Vargas das Wummern der Rotorblätter sowie die brüllenden Triebwerke hören. Sie saß neben der Pilotin und sah durch die Frontscheibe hinaus. Es herrschte ideales Flugwetter. Weder trübten Wolken die Sicht, noch zerrten Winde an der Bell 407. Einhundert Meter unter ihnen schimmerte die Ostsee in einem tiefdunklen Blau, dazwischen glitzerten Schaumkronen in der Dünung, während die tief im Westen stehende Sonne den Horizont glutrot färbte. Noch vor wenigen Wochen hätte dieser Anblick Leonies Herz berührt und unweigerlich romantische Gefühle in ihr hervorgerufen. An jenem schicksalhaften 30. April jedoch war ihr Herz zerbrochen und Romantik zu einem Begriff geworden, mit dem sie seitdem nichts mehr anzufangen wusste. Nicht einmal die offizielle Eröffnung der Greifswald, die morgen mit reichlich Prominenz und großem medialen Getöse stattfinden würde, vermochte Leonies Laune zu heben. Dabei hatte die Förderplattform ihr Leben in den letzten beiden Jahren maßgeblich geprägt. Deren Planung sowie die Begleitung der Bauleitung waren zu ihrer Lebensaufgabe geworden, aus der sie tiefe Zufriedenheit gezogen und zugegebenermaßen auch ein wenig Stolz dabei empfunden hatte. Nun sollte der krönende Abschluss einer Geschichte folgen, die im Sommer 2020 auf Malta begonnen hatte und die rückblickend betrachtet nicht skurriler hätte verlaufen können. Doch dann war der Morgen des 30. April angebrochen; der Tag, der Leonies Leben in einen Scherbenhaufen verwandelt hatte. Ein Happy End würde es bei der Eröffnungsfeier für sie nicht geben. Zu allem Überfluss würde sie dort auch noch auf Ethan Holloway treffen, ihren Chef, der ihr seit geraumer Zeit aus dem Weg ging. Natürlich konnte sie sich denken, weshalb Holloway sie ignorierte, nur machte das die Sache nicht besser. Im Gegenteil. Zwischenzeitlich hatte sich auf beiden Seiten so viel aufgestaut, dass bei der Feier ziemlich sicher die Fetzen fliegen würden. Gut möglich, dass Leonie danach – am Ende desjenigen Tages, der eigentlich den Höhepunkt ihrer bisherigen beruflichen Laufbahn markieren sollte – ohne Job dastand.
Mit einem Fingertippen aktivierte sie das Mikrofon ihres Headsets und sah die Pilotin an. »Können wir heute ausnahmsweise eine Extrarunde um die Plattform drehen, bevor wir landen?«
Hinter ihrer verspiegelten Sonnenbrille verzog die Pilotin keine Miene. »Heute ist wegen der vielen anreisenden Gäste mächtig was los in der Luft. Das hier ist mein vierter Anflug seit der Mittagspause. Aber ich kann anfragen, wie unser Slot für die Landung aussieht, wenn Sie darauf bestehen.«
»Fragen Sie«, bat Leonie.
Während die Pilotin Funkkontakt mit der Greifswald aufnahm, erklang eine vertraute Stimme in Leonies Kopfhörern. »Hast du dich an deinem Baby noch nicht sattgesehen? Wie oft bist du die GW dieses Jahr angeflogen? Dreißig Mal mindestens, oder?«
Umständlich drehte sie sich in ihrem Sitz nach hinten um. Jüri Kallas, der estnische Wissenschaftler und seit über einem Jahr Leonies Kollege und enger Vertrauter, saß gemeinsam mit zwei weiteren Forschern in der hinteren Kabine der Bell 407 und grinste sie an. Seine extravagante Frisur glich einem Irokesenschnitt, und wegen der kahl rasierten Seiten sahen die dicken Kopfhörer an ihm aus wie Micky-Maus-Ohren. Obwohl Kallas etwas kleiner als Leonie war, brachte er locker über einhundert Kilogramm auf die Waage. In seinem grauen, leicht abgewetzten Anzug wirkte er wie die sprichwörtliche Wurst in der Pelle. Leonie hatte ihn nie zuvor in einem Anzug gesehen und schätzte, dass er dieses Kleidungsstück seit vielen Jahren im Schrank hängen und einzig dem morgigen Anlass geschuldet herausgekramt hatte. Es entbehrte nicht einer gewissen Komik, wie Kallas zusammengepresst im Mittelsitz zwischen zwei deutlich schlankeren und größeren Kollegen hockte. Er stammte aus Tartu, einer Universitätsstadt in Estland, und war einer der renommiertesten Geoelektroniker Europas. Zudem war er einer der zehn Experten, die von einem EU-Konsortium für die Überwachung und Erstellung wissenschaftlicher Expertisen des Greifswald-Projekts bestellt worden waren. Im Gegensatz zu vielen Kollegen und Kolleginnen, mit denen Leonie meist nur auf beruflicher Ebene kommunizierte, hatten sich mit Jüri Kallas im Laufe der Zeit auch persönliche Gespräche entwickelt. Leonie mochte seine offene, herzliche Art und seinen Humor.
»Dreißig Anflüge reichen nicht«, antwortete sie. »Ich war sicher doppelt so häufig auf der GW wie du. Einer musste ja die ganze Arbeit machen.«
»Latte Macchiato schlürfen und Leute durch die Gegend scheuchen ist keine Arbeit«, entgegnete Kallas augenzwinkernd.
Leonie streckte ihm die Zunge raus.
»Aber mal ehrlich«, sagte er. »Muss die Zusatzrunde sein? Für manche von uns ist dieser Flug heute nicht sonderlich bequem.« Er ließ seine Augen von links nach rechts rollen, sah dann an sich herab und zog eine Schnute.
Damit brachte er Leonie zum Lachen.
»Ist nicht unsere Schuld«, sagte Anton Reitmayr, der österreichische Kollege, der rechts neben Kallas saß. »Hättest heute vielleicht das Frühstück ausfallen lassen sollen.«
»Für den Rückflug empfehle ich vorher eine Session auf dem Laufband im Fitnessraum«, stieg Torben Jepsen in das Geflachse ein. Jepsen war Däne und saß links von Kallas.
Die beiden Männer grinsten sich über Kallas’ Kopf hinweg an. Der fragte: »Es gibt auf der GW einen Fitnessraum?«
Leonie lachte erneut. Still und heimlich dachte sie allerdings, dass auch ihr ein wenig Kardiotraining durchaus guttun würde. Seit der Sache mit Gabrijel hatte sie sich zu keinem Work-out mehr aufraffen können. Mittlerweile war sie an ihrem Gürtel beim äußersten Loch angelangt und auch der Blick auf die Waage sprach Bände. Doch das hatte Zeit bis nach der Eröffnungsfeier. Sie wandte sich wieder nach vorne und sagte: »Seid lieb zueinander. Ihr müsst es nur noch zwei Tage miteinander aushalten.«
»Kann es kaum erwarten, nach Hause zu kommen«, erwiderte Kallas brummend. »Im Gegensatz zu euch freut sich mein Sohn wenigstens, wenn er mich sieht.«
»Steht ein Papa-Wochenende an?«, fragte Leonie.
»In zwei Wochen.«
»Freut mich für dich.« Leonie wusste, wie sehr Kallas seinen Sohn liebte, den er seit seiner Scheidung viel zu selten sah. Sie wusste aber auch, wie sehr Kallas für die Greifswald brannte. Sie beide glaubten aus tiefster Überzeugung an die Technologie der Plattform und an den Wohlstand, den sie damit Menschen auf der ganzen Welt bringen konnten.
»Man hat unseren Slot um fünf Minuten erweitert«, erklärte die Pilotin. »Aktuell sind keine weiteren Helis vor Ort in der Luft. Ein schneller Rundflug vor der Landung wäre also möglich.«
»Dann machen wir das«, entschied Leonie.
»Du bist so herzlos«, sagte Kallas.
»Ach was. Ich spendiere dir morgen ein Eis.«
»Ich nehme zwei Kugeln Schokolade. Mit Sahne.«
»Geht klar.«
Das Gespräch verstummte.
In einiger Entfernung entdeckte Leonie jetzt einen hellen Fleck inmitten der blauen See. Sie näherten sich der Plattform. Der Anflug von guter Laune, den das kleine Geplänkel mit Kallas in ihr hervorgerufen hatte, wich erneuter Besorgnis. Kallas wusste nichts von dem Zerwürfnis zwischen ihr und Ethan Holloway. Weder hatte sie ihm von ihrem Streit erzählt, noch welche Dimensionen dieser angenommen hatte. Kallas hatte nicht die geringste Vorstellung davon, wie tief der Graben zwischen ihr und Holloway mittlerweile war. Wie also sollte er ahnen, dass Leonie befürchtete, die Greifswald heute zum letzten Mal anzufliegen?
Kurz darauf erreichten sie die weltweit erste Offshore-Förderplattform für Süßwasser, die inmitten des Greifswalder Boddens in die Höhe ragte – zwölf Seemeilen südlich der Insel Rügen, getragen von Dutzenden massiver Betonstelzen, deren Fundamente fünfunddreißig Meter tief im Meeresgrund verankert waren. Aus einiger Entfernung konnte man dieses beeindruckende stählerne Konstrukt durchaus für eine herkömmliche, wenn auch überdimensionale Ölbohrplattform halten. Wären da nicht die gigantischen Solarfolien gewesen, die sich im Halbrund um die gesamte nördliche Seite der Plattform sechzig Meter hoch in den Himmel erhoben. Der Anblick der violett schimmernden Folien erinnerte Leonie immer an die Tribünen amerikanischer Baseballstadien. Sie waren Ethan Holloways Idee gewesen. Sie bestanden aus organischen Kohlenstoffverbindungen, die auf Folien aufgedampft wurden und im Vergleich zu herkömmlichen Solarzellen tausendmal dünner waren. Außerdem benötigte ihre Produktion weder Silizium, Aluminium, Blei noch sonstige Schwermetalle oder Rohstoffe, die oft unter fragwürdigen Bedingungen abgebaut wurden. Die Folien trugen nicht nur maßgeblich zur energetischen Unabhängigkeit der Plattform bei, sondern schützten die Deckarbeiter gleichzeitig vor stürmischen Winden, die hier häufig aus nördlichen Richtungen wehten. Ein weiterer Baustein, der einen Beitrag zur Autarkie der Greifswald leistete, waren die Meeresströmungskraftwerke. An sämtlichen Betonstelzen waren in zehn Metern Wassertiefe frei schwenkende Turbinen angebracht, mit deren Hilfe aus der jeweils vorherrschenden Meeresströmung Elektrizität gewonnen wurde.
Während die Pilotin den Hubschrauber einmal langsam rund um die Plattform flog, betrachtete Leonie ihr Baby heute zum vielleicht letzten Mal. Da war zuallererst das schiere Ausmaß der Greifswald, deren einzelne Abschnitte und Module sich über eine Fläche erstreckten, die zwölf Fußballfeldern entsprach. Und das auf gleich drei Ebenen. Demzufolge stand reichlich Platz für die Module mit den Büros, den Kontroll- und Überwachungsstationen, den Aufenthaltsräumen, den Kombüsen sowie den Unterkünften der Ingenieure, Wissenschaftler und Arbeiter zur Verfügung. Auf den Dächern der drei Wohnquartiere befanden sich Hubschrauberlandeplätze. Unweit davon, auf dem Hauptdeck sechsunddreißig Meter über dem Meer, glänzten fünf orangefarbene Freifallrettungsboote in schräg nach unten gerichteten Halterungen in der untergehenden Sonne. Der knapp einhundert Meter hohe Förderturm markierte das Zentrum der Plattform. Um ihn herum bildeten gewaltige Pumpen und Aggregate einen Halbkreis, dem ein Gewirr aus dicken Rohren und Pipelines entsprang, die scheinbar zufällig in alle Himmelsrichtungen verliefen. Einige von ihnen verschwanden im Boden, um das geförderte Süßwasser zur Aufbereitung und Qualitätskontrolle in die entsprechenden Module der unteren Ebenen zu leiten. Dort wurde es in Trinkwasser mit einwandfreier Qualität verwandelt und über drei großvolumige Pipelines zur Verteilerstation in Lubmin gepumpt, die für die bedarfsgerechte Verteilung des Wassers in die einzelnen Bundesländer und Gemeinden verantwortlich war. In Vorbereitung der offiziellen Eröffnungsfeier war die gesamte Plattform mit bunten Fähnchen dekoriert, die in der sanften Brise flatterten. Von allen vier Ecken der Plattform bis hinauf an die Spitze des Förderturms verliefen Bänder mit bunten Wimpeln. Auch sie flatterten und glitzerten in der Sonne. Die Außenseiten der Wohnquartiere waren mit Flaggen aller Herren Länder bedeckt. Auf dem für gewöhnlich freien Platz vor dem Förderturm war die Bühne aufgebaut, auf der Shakira und J.Lo ihre legendäre Performance der Superbowl-Halbzeit-Show von 2020 wiederholen würden. Typisch Ethan, dachte Leonie. Ständig musste alles noch eine Spur größer und glamouröser werden.
Während die Pilotin nun den ihnen zugewiesenen Landeplatz ansteuerte, dachte Leonie an ihre erste Begegnung mit Ethan Holloway zurück. Damals hatte er sie mit seiner Vision der Aqua Citys – vollständige und autarke Städte auf dem Meer – regelrecht überfahren. Am Anfang hatte Leonie ihn noch für einen Spinner mit zu viel Geld gehalten, aber ohne die Fähigkeit, seine Zukunftsträume wahr werden zu lassen, wäre Holloway nicht zu solch einer schillernden Persönlichkeit geworden. Von einer vollständigen Stadt auf dem Meer war die Greifswald zwar noch ein gutes Stück entfernt – schließlich handelte es sich bei dieser Plattform um den Prototyp –, doch Holloways Vision nahm unbestreitbar Gestalt an. Und Leonie hatte einen maßgeblichen Anteil daran.
Gemeinsam waren sie über beinahe vier Jahre hinweg ein unschlagbares Team gewesen. Nur hatte Holloway sich in den letzten Monaten sehr verändert. Am schlimmsten wog, dass er sein Versprechen gebrochen hatte, mit dem er Leonie damals auf Malta geködert hatte. Ihr kam es vor, als hätten sich seine Ansichten um hundertachtzig Grad ins Gegenteil dessen verkehrt, was Holloway früher stets verkörpert hatte. Oder was er vorgegeben hatte zu verkörpern. Das war auch der Grund für die Distanz zwischen ihnen. Doch morgen konnte er Leonie nicht entfliehen. Sie würde ihn endlich zur Rede stellen. Zumindest nahm sie sich das fest vor.
3
Auf der untersten Ebene der Greifswald, sechsundzwanzig Meter über der Meeresoberfläche, beugte sich Atticus über einen Stahlträger und sah nach oben. Obwohl der Wind durch die nach allen Seiten offene Anlage pfiff, hatten seine Ohren ihn nicht getäuscht. Ein Hubschrauber befand sich im Anflug; eine Bell 407. Atticus warf einen Blick auf seine Taucheruhr am Handgelenk. Sofern sich an den eingereichten Flugplänen nichts geändert hatte, musste dies der Hubschrauber sein, in dem Leonie Vargas saß. Bislang lief alles nach Plan. Seine Informationen – vor allem einige sicherheitsrelevante Details, die er erst vor wenigen Stunden erhalten hatte – stimmten bis jetzt ausnahmslos mit den tatsächlichen Gegebenheiten hier vor Ort überein. Es konnte losgehen. Er wandte sich den Männern zu, die in diesem nicht einsehbaren Abschnitt der Plattform ihre Ausrüstung überprüften; in erster Linie die Funktionsfähigkeit ihrer Schusswaffen. Mit Argusaugen musterte Atticus die Truppe.
Sie waren zu zwölft. Alle trugen schwarze Kampfmonturen, schusssichere Westen, schwere Stiefel und an ihren Gürteln hingen wasserdichte DMR-Handfunkgeräte. Keiner war älter als dreißig, jeder einzelne Mann von ihm handverlesen. Sie waren motiviert, verlässlich, und auch wenn Atticus nicht allen ein gesteigertes Maß an Intelligenz bescheinigte, so gab es unter ihnen doch zumindest keinen vollkommenen Schwachkopf. Ein paar der Männer besaßen sogar erstaunliche Fähigkeiten, die selbst Atticus ein anerkennendes Nicken abrangen. Allen gemein war, dass sie denselben, einzig wahren Gott anbeteten: Geld. Bald schon würden sie darin schwimmen, wie Dagobert Duck in seinem Geldspeicher.
Atticus grinste, während er in die entschlossenen Mienen der Männer blickte. Sie alle wussten um das Risiko, diesen Ort womöglich nicht lebend zu verlassen. Dennoch vertrauten sie ihm. Und Atticus würde sie nicht enttäuschen. Lediglich in einem Punkt war er seinen Männern gegenüber nicht vollkommen ehrlich, denn seine Motivation unterschied sich von der ihren in einem ganz entscheidenden Punkt. Atticus verfolgte seinen eigenen Plan, an dessen Ende mehr als nur Reichtum auf ihn wartete.
»Noch dreißig Minuten«, informierte er die Runde. Als Reaktion erhielt er vereinzeltes Nicken.
Er trat neben Kristos, einen jungen schmächtigen Griechen und IT-Experten. Kristos saß auf einer Metallkiste, balancierte einen aufgeklappten Laptop auf seinen dünnen Oberschenkeln und fixierte das Display mit starrem Blick. Ebenso wie die hochwertigen Waffen, die Atticus aus offiziell verloren gegangenen Beständen der israelischen Armee besorgt hatte, gehörte auch der Laptop zu den leistungsstärksten Geräten seiner Klasse. Das schützende Gehäuse war stoßfest und wasserdicht bis fünfzig Meter. Falls der Laptop wider Erwarten beschädigt werden sollte oder eine Funktionsstörung erlitt, befand sich in der Metallkiste unter Kristos’ Hintern ein zweites Modell mit identischer Konfiguration und Software. In den letzten Wochen hatte Atticus das Szenario hundertfach durchgespielt, jedes noch so unwahrscheinliche Risiko identifiziert, analysiert und durch entsprechende Maßnahmen minimalisiert.
»Status?«, fragte er.
»Läuft«, antwortete Kristos, ohne die Augen vom Display abzuwenden. »Die Passwörter und Zugangsdaten funzen bis jetzt alle. Dein geheimnisvoller Kontaktmann ist seine Kohle wert.«
Du hast ja keine Ahnung, dachte Atticus. Er entfernte sich einige Schritte von der Gruppe und fummelte sein Smartphone hervor, das er sich zwischen seinen Kampfanzug und die eng anliegende, schusssichere Weste geklemmt hatte. Noch war die Meldung, auf die er wartete, nicht eingegangen. Seinem Kontakt blieben achtzehn Minuten, um das vereinbarte Codewort zu übermitteln. Atticus grinste diabolisch. Hätten die Männer geahnt, um wen es sich bei dieser Person handelte, wären einige von ihnen vielleicht in letzter Minute ausgestiegen. Doch so gab es für niemanden Anlass zur Sorge. Zumal die Mission bislang nach Plan verlief.
Mit gefälschten Personalausweisen und originalgetreuen Zugangskarten von Sharpwater LLC waren sie an der Verteilerstation in Lubmin an Bord eines der Versorgungsschiffe gelangt, die die Greifswald regelmäßig anfuhren. Neben Lebensmitteln, Getränken und weiteren Gütern des täglichen Bedarfs transportierten diese Schiffe auch Ersatzteile und Werkzeuge sowie Öl und Benzin für die Notfallaggregate, die zum Einsatz kamen, falls die regenerative energetische Versorgung der Plattform aus irgendeinem Grund zusammenbrechen sollte. Auf der Rückfahrt nahmen die Schiffe dann aufbereiteten Müll und chemische Abfälle mit, die nicht recycelt werden konnten. Mit ihren gültigen Zugangskarten und in ihren Arbeiteroveralls hatten Atticus und seine Truppe keinen Verdacht erregt. Auf der Greifswald hatten bereits drei Metallcontainer auf sie gewartet, in denen sich die Kampfmonturen, Waffen sowie weitere Ausrüstung befanden. Die Anlieferung der Container eine Woche zuvor war eine der größeren Herausforderungen dieser Mission gewesen. Atticus’ Kontakt hatte dafür alle Register ziehen müssen und ein Schmiergeld in geradezu obszöner Höhe an zwei Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes bezahlt. Tja, um Geld zu machen, musste man es erst einmal ausgeben. Das hatte Atticus schon als Jugendlicher auf der Straße gelernt, wo er Marihuana vertickt hatte, das er zuvor von einem wesentlich älteren Dealer einkaufen musste. Für einen Zwölfjährigen hatte Atticus damals ziemlich gut verdient. Er zog den rechten Lederhandschuh ein Stück weit nach unten und betrachtete die verblasste, dilettantische Tätowierung auf seinem Handrücken. Sie zeigte einen Holzstab, auf dessen oberes Ende ein Widderkopf gesteckt war. Atticus hatte sich das Tattoo im Alter von vierzehn Jahren mithilfe von schwarzer Tinte und heißen Nadeln selbst gestochen. Damals war er sich wie ein echter Gangster vorgekommen. Obgleich er heute darüber lächelte, hatte sich an der Bedeutung des Tattoos für ihn nichts geändert. Außer ihm gab es nur einen einzigen Menschen auf der Welt, der diese Bedeutung kannte. Bald werden sie verstehen, dachte er.
Die Wartezeit zog sich in die Länge. Im Westen ging bereits die Sonne unter und dunkle Schatten krochen über die unterste Ebene der Plattform. Die Beleuchtung sprang an, farbige Positionslichter an der Außenfassade der Stahlkonstruktion begannen zu blinken. Dann endlich vibrierte sein Smartphone und der Code erschien auf dem Display.
Atticus trat in den Kreis seiner Männer. »Brüder! Es ist so weit. Der Ziegenfisch ist bereit zu fliegen.«
4
Hansestadt Anklam
Chris tunkte den Pinsel in den Farbeimer mit der Aufschrift Weiß Seidenmatt und fuhr dann mit den Borsten über das Abtropfgitter. Während die überschüssige Farbe zurück in den Eimer tropfte, betrachtete er seine Hände, die über und über mit weißen Farbspritzern besprenkelt waren. An den Fingern seiner rechten Hand war die Haut gerötet und es hatten sich sogar zwei Blasen gebildet. Er half zum ersten Mal im Malerbetrieb seines Kumpels Hans aus und Chris war weder das Halten der Pinsel gewohnt noch die ständigen Streichbewegungen aus dem Handgelenk.
Rauf. Runter. Rauf. Runter. Rauf. Runter.
Seit den Mittagsstunden ging das schon so, unterbrochen einzig von einer viel zu kurzen Kaffeepause. Trotz Sonnenuntergang war an Feierabend nicht zu denken. Hans hinkte seinem selbst gesetzten Zeitplan hinterher. Er hatte versprochen, die dreistöckige Villa binnen einer Woche zu streichen. Diese gehörte einem alten, missmutigen Knacker, der mehrmals am Tag vorbeikam, um zu kontrollieren, wie die Arbeiten voranschritten. Seiner Meinung nach viel zu langsam, weshalb er Hans gestern auch damit gedroht hatte, eine andere Firma zu beauftragen. Also hatte Hans als Verstärkung Chris mit ins Boot genommen. Für den war das die perfekte Gelegenheit, um schnell und unkompliziert an Geld zu kommen. Schwarz, versteht sich. Doch so froh Chris darüber auch war, hatte er es mit der Arbeit eigentlich nicht gleich dermaßen übertreiben wollen. Von Blasen an den Fingern war nicht die Rede gewesen. Nur blieb Chris nach der erneuten harschen Abfuhr seines Onkels am Vormittag nichts anderes übrig. Chris brauchte Geld; möglichst viel und möglichst schnell.
»Schlaf nicht ein«, knurrte Hans, der neben ihm auf einer Leiter stand und mit der Stuckdecke beschäftigt war. »Ich bezahl dich nicht fürs Nixtun. Wenn du noch länger vor dich hin starrst, trocknen die Borsten aus.«
»Soll ich nun Farbe sparen oder nicht?« Chris schaute ihn vorwurfsvoll an. Weiße Farbsprenkel überzogen Hans’ Gesicht und Haare. Chris dämmerte, dass er ziemlich sicher genauso aussah. Selten hatte er sich mehr auf eine Dusche gefreut. Hoffentlich schaffte er es nach Hause, bevor die Wasserwerke über Nacht routinemäßig die Versorgung einstellten.
»Machen wir mal kurz Pause?«, fragte Chris. »Ich hab seit dem Mittag nichts mehr gegessen.«
»Wir ziehen das jetzt durch. Sind nur noch zwei Zimmer. Dann sind wir mit dem zweiten Stock fertig.«
»Dafür brauchen wir mindestens drei Stunden. Bis dahin bin ich verhungert.«
»Stell dich nicht so an. Oder willst du, dass ich mir jemand anderes suche?«
»Schon gut«, brummte Chris und nahm die Arbeit wieder auf. In gebückter Haltung strich er mit gleichförmigen Bewegungen über die Raufasertapete bis hinunter zum mit Abdeckfolie geschützten Parkett. Die Blasen an seinen Fingern brannten.
Ein paar Minuten später sagte Hans unvermittelt: »Die Farbeimer gehen uns aus. Ich fahr schnell zum Baumarkt, bevor der schließt, und besorg neue. Kleb du derweil schon mal das Esszimmer ab. Folie und Tape sind noch genug da.«
Chris runzelte die Stirn. »Ich dachte, ich hätte vorhin im Transporter noch ein paar Eimer gesehen.«
»Hast vielleicht ’nen Knick in der Optik.«
»Na gut. Bring was zu essen mit.«
»Ich fahr zum Baumarkt. Nicht zum Italiener.«
»Irgendwelche Schokoriegel wird’s da an der Kasse schon geben.«
»Ich schau mal.« Hans klopfte ihm auf die Schulter und verschwand.
Missmutig ging Chris ins Esszimmer und griff sich eine Rolle Abdeckfolie und Tape. Doch da sein Magen knurrte und ihm keine Ruhe ließ, zog es ihn zuerst zum Mineralwasserkasten. Viel trinken sollte ja angeblich gegen Hunger helfen. Natürlich waren sämtliche Flaschen leer. In einem Nebenraum hörte Chris den Alten umherschleichen und ging zu ihm.
»Entschuldigung«, sagte er, »uns ist das Mineralwasser ausgegangen. Dürfte ich bitte ein oder zwei Flaschen mit Leitungswasser auffüllen? Wir haben heute noch eine Menge Arbeit vor uns.«
»Das wär ja noch schöner«, polterte der Alte los. »Hast du eine Ahnung, was Wasser kostet? Und noch dazu die Filterkartuschen? Hab ich ein Vermögen zu verschenken? Ist nicht mein Problem, wenn ihr jungen Leute nicht haushalten könnt.«
Chris schluckte einen bissigen Kommentar hinunter. Er ging zurück ins Esszimmer, riss die Folie von einem der Fenster ab, öffnete es und streckte seinen Kopf hinaus. Vielleicht konnte er Hans noch abfangen, bevor der davonbrauste. Er lehnte sich vor, sah nach unten und vor Überraschung blieb ihm der Mund offen stehen.
Hans stand auf dem Gehweg, neben seinem grauen Transporter mit der Aufschrift Malerbetrieb Hans Smolarek. Die Seitentür war geöffnet. Im Innern des Transporters konnte Chris zwei weiße Farbeimer ausmachen. Hans gegenüber stand dessen Freundin. Die beiden quatschten und lachten, während sie zwischendurch herzhaft in Döner bissen, die sie in ihren Händen hielten. Chris spürte seinen Blutdruck steigen. Er kam sich vor wie im falschen Film. Hans hatte ihn wegen der Farbe belogen, weil er eine Ausrede gesucht hatte, um mit seiner Freundin in aller Ruhe einen Döner zu futtern. Warum hatte Hans nicht gesagt, dass seine Freundin auf dem Weg hierher war? Sie hätte einfach Döner für alle mitbringen können und alles wäre bestens gewesen. Chris war drauf und dran, seinen Kumpel lautstark als egoistisches Arschloch zu beschimpfen. Allerdings besann er sich darauf, dass er auf das Geld aus diesem Job angewiesen war, und schloss wortlos das Fenster. Ebenso wütend wie enttäuscht stapfte er in die Küche, hielt eine der leeren Flaschen unter den Wasserhahn an der Spüle und füllte sie auf. Es war ihm gleich, ob der Alte das nun mitbekam oder nicht.
Chris löschte seinen Durst, dann fläzte er sich in einen Stuhl in der Ecke und nahm eine der Zeitschriften in die Hand, die auf einem Stapel auf dem runden Beistelltisch lagen. Keinen Finger würde er mehr krumm machen, solange Hans sich da draußen den Bauch vollschlug und sich mit seiner Freundin amüsierte. Chris begann, in der Zeitschrift zu blättern. Eine Reportage über die bevorstehende Eröffnungsfeier einer neuen Förderplattform für Süßwasser in der Greifswalder Bucht weckte seine Aufmerksamkeit. Davon gehört hatte er schon, aber was es mit dieser Plattform tatsächlich auf sich hatte, war ihm bis heute nicht klar geworden. Offenbar war ein global agierender Konzern namens Sharpwater LLC auf direktem Weg, den Weltmarkt für Trinkwasser zu revolutionieren und zu beherrschen. Gefördert wurde dieses Wasser aus riesigen natürlichen Reservoiren, die sich angeblich vor den Küsten aller Kontinente einige Hundert Meter tief unter dem Meeresgrund befanden. Chris’ Interesse an der Story wuchs rapide, als er den Namen des Mannes las, der hinter Sharpwater steckte: Ethan Holloway.
Holloway war einer der reichsten Menschen dieses Planeten und bekannt für seine vielfältigen Vorstellungen einer besseren und nachhaltigeren Welt. Kaum ein Tag verging, an dem er seine vielen Millionen Follower auf allen möglichen Social-Media-Kanälen nicht mit irgendwelchen Neuigkeiten über sich selbst, seine Unternehmen oder seine Zukunftsvisionen versorgte. Tweets von ihm konnten Aktienkurse nach oben schießen oder nach unten rauschen lassen. Nun also träumte Holloway von ganzen Städten auf dem Meer, die er Aqua Citys nannte und in denen die Menschen nicht nur arbeiteten, sondern auch dauerhaft mit ihren Familien lebten – inklusive Kitas, Schulen und Freizeitangeboten wie Kneipen, Kinos, Bowlingbahnen und sogar Sportplätzen. Die offizielle Eröffnungsfeier des Prototyps – die Greifswald – weckte weltweites mediales Interesse. Kein Wunder, glaubte man dem Verfasser des Artikels. Seiner Einschätzung nach würde es sich schon in naher Zukunft kaum eine Nation leisten können, auf das lebenswichtige Wasser aus Offshore-Vorkommen zu verzichten. Sogar die EU war mit einem Konsortium an Wissenschaftlern und großzügigen Fördergeldern an dem Projekt beteiligt. Kritiker hingegen monierten, dass Sharpwater schon bald die Kontrolle über einen Großteil aller Wasservorräte dieses Planeten erlangen könnte. Und wer über die Verteilung von Trinkwasser entschied, so Holloways Kritiker, der beherrschte die Welt.
Chris musste an Onkel Radi und dessen Schimpftirade über die Gigafabriken rund um Berlin denken. Die klimatischen Veränderungen mit immer häufigeren und ausgeprägteren Dürreperioden ließen in ganz Deutschland das Grundwasser kontinuierlich absinken. Gleichzeitig siedelten sich im Großraum Berlin dank großzügiger Subventionen immer mehr internationale Unternehmen an, deren riesige Produktionsstätten gewaltige Mengen Wasser verbrauchten. Schon vor Jahren hatten mehrere Wasserverbände deswegen warnend den Zeigefinger erhoben, doch offensichtlich zählten Arbeitsplätze mehr als planschende Kinder in Freibädern. Wie groß das Ausmaß der Wasserknappheit werden würde und wie schnell dies passierte, damit hatte die Politik allerdings nicht gerechnet. Zusätzlich zu all den Beschränkungen hinsichtlich des Wasserverbrauchs in Privathaushalten, die seit zwei Jahren schrittweise eingeführt wurden, hatte man erst vor einem Monat den erlaubten Pro-Kopf-Verbrauch pro Tag nochmals um ein Drittel reduziert. Dies hatte zu einem empörten Aufschrei der Bevölkerung geführt, der unter dem Strich jedoch weniger laut ausgefallen war, als Chris erwartet hätte. Die meisten Menschen schienen überraschenderweise Verständnis für diese drastischen Maßnahmen aufzubringen. Chris vermutete, dass den wenigsten Bürgern und Bürgerinnen bewusst war, wo ihr kostbares Wasser tatsächlich abblieb – nämlich in den Fabriken und Unternehmen.
Am Ende des Artikels wurde es noch einmal besonders interessant. Sharpwater suchte nach wie vor händeringend nach Leuten, die bereit waren, in einem Zwei-Wochen-Rhythmus offshore zu arbeiten. Die Zwölf-Stunden-Schichten auf der Plattform bei Wind und Wetter verlangten den Arbeitern alles ab, andererseits wurden dafür auch weit überdurchschnittliche Löhne gezahlt. Zwei Wochen Maloche, danach zwei Wochen Urlaub … das hörte sich fraglos super an, kam für Chris aber wegen der Betreuung seiner Eltern eigentlich nicht infrage. Allerdings brachte ihn das Ganze auf eine Idee.
Noch während er diese im Geiste durchspielte, kehrte Hans zurück. Kurz entschlossen riss Chris die vier Seiten mit der Reportage aus der Zeitschrift heraus, faltete sie zweimal und steckte sie in die Tasche seines Overalls. Dann legte er die Zeitschrift zurück auf den Stapel und ging ins Esszimmer, wo Hans gerade dabei war, die beiden Farbeimer abzustellen.
»Was für ein Verkehr«, sagte Hans und stöhnte theatralisch. Eine Wolke aus Zwiebelgeruch und Knoblauchsoße hüllte Chris ein. »Ich hab’s gerade noch vor Ladenschluss in den Baumarkt geschafft.«
»Na so ein Glück aber auch«, entgegnete Chris.
5
Ostsee, zwölf Seemeilen vor der Küste Rügens
Leonie saß mit angezogenen Knien am Rand der inzwischen menschenleeren Plattform, auf der sie vor einer halben Stunde mit der Bell 407 aufgesetzt hatten. Ihre Kollegen waren unmittelbar nach der Landung in ihren Quartieren verschwunden und kurz darauf hatte der Hubschrauber wieder in Richtung Festland abgehoben. Leonie hingegen war geblieben. Mit der Stirn gegen den Schutzzaun gelehnt, der die Plattform umgab, betrachtete sie den Sonnenuntergang. Es war ein traumhafter Anblick, wie der glutrote Ball im Westen im Meer versank, während die letzten Sonnenstrahlen des Tages die Schleierwolken im Osten in ein Gemisch aus lila und violetten Farbtönen tauchten. Dann glomm der hauchdünne rote Streifen am Horizont ein letztes Mal auf, bevor sich überraschend schnell Dunkelheit über die Greifswald legte wie ein undurchdringbares schwarzes Gewand. Bald schon verrieten einzig die blinkenden Positionslichter sowie die hell beleuchteten Decks und Fenster der Büros und Wohnquartiere, dass sich hier, inmitten des Greifswalder Boddens, ein gewaltiges achthundert Tonnen schweres Bauwerk befand. Das Lichtermeer spiegelte sich in den Solarfolien wie in einem surrealen Gemälde. Was für ein Anblick, dachte Leonie nicht zum ersten Mal.
Sie liebte es, hier oben zu sein. Sie liebte auch die Stille. Das stete Brummen der Aggregate und Pumpen, das auf dem Hauptdeck allgegenwärtig war, drang lediglich als Hintergrundgeräusch bis hierher, obwohl am Förderturm geschäftiges Treiben herrschte. Die Arbeiter der Tagschicht wurden gerade von der Nachtschicht abgelöst. Von hier oben aus betrachtet wirkten die stattlichen Männer überraschend klein. An der geschmückten Bühne, die man vor dem Förderturm eigens für das morgige Event aufgebaut hatte, blieb Leonies Blick hängen. Im Gegensatz zur restlichen Plattform war die Bühnenbeleuchtung ausgeschaltet. Die riesigen Lautsprecherboxen sahen wie unheilvolle Monolithen aus einem Stanley-Kubrick-Film aus. Sobald die ersten Beats der Show erklingen würden und Shakira und J.Lo ihre Hüften schwangen, würde sich die Plattform in ein Tollhaus verwandeln. Die Deckarbeiter … ach was … alle Männer auf der Greifswald würden kollektiv ausrasten. Ziemlich sicher auch einige der Frauen. Unwillkürlich musste Leonie lächeln. Man konnte über Ethan Holloway sagen, was man wollte, aber er wusste, wie man Aufmerksamkeit erregte. Der Hashtag #aquacity würde morgen in den sozialen Netzwerken trenden. Holloway würde sich feiern lassen und die Presse würde einmal mehr seine unermüdlichen Ambitionen würdigen, eine bessere, nachhaltige Welt zu erschaffen. Tatsächlich war dies eine Eigenschaft, die Leonie an Holloway lange Zeit bewundert hatte. Von Anfang an, schon bei ihrer ersten Begegnung auf Malta, hatte er sie mit seiner Vision eines weltumspannenden Netzes von Aqua Citys in seinen Bann gezogen. Das Problem mit Ethan Holloway war nur, dass er nicht derjenige war, für den die Öffentlichkeit ihn hielt. Holloway besaß zwei Gesichter, wie Leonie leidvoll erkennen musste. Und sein zweites Gesicht konnte er sehr gut verbergen.