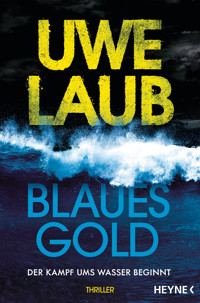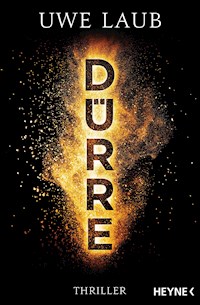2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Die Regeln des Überlebens haben sich geändert
Antilopenherden in Südafrika und Fledermauskolonien auf der Schwäbischen Alb: Weltweit verenden innerhalb kürzester Zeit große Tierpopulationen, ganze Arten sterben in erschreckendem Tempo aus. Experten schlagen Alarm, denn das mysteriöse Massensterben scheint vor keiner Spezies Halt zu machen. Der junge Pharmareferent Fabian Nowack stößt auf Hinweise, dass selbst der Fortbestand der Menschheit unmittelbar bedroht ist. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt, an dessen Ende unsere Erde nie wieder so sein wird wie zuvor.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 456
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Das Buch
Sie überflogen ein breites, an den Rändern ausgetrocknetes Flussbett. Zu beiden Seiten des Ufers wucherte sattgrüne Vegetation, überragt von hohen Bäumen mit breiten Kronen.
»Das ist der Nsizaki«, sagte Adam. »Willkommen im Kruger Nationalpark.«
Brenners Augen glitten über die karge, felsige Landschaft aus Granitgestein, die sich hinter dem dicht bewachsenen Flussufer erstreckte. Unruhig rutschte er in seinem Sitz hin und her, während er auf der Suche nach den ersten Tieren sich fast den Kopf verrenkte. Nach einigen Minuten fragte er: »Wo sind die Tiere? Ich sehe keine. Ist das normal?«
Adam zögerte. »Eigentlich nicht. Seltsam.«
Wenig später ging die Bergregion in eine flache Graslandschaft über, in der vorwiegend dornige Akazien wuchsen. Dazwischen sah man immer wieder beeindruckend hohe Termitenbauten. Die unbefestigten Straßen und Trampelpfade, die kreuz und quer durch die Savanne führten, waren gut zu erkennen. Wie erwartet, war heute kein einziges Fahrzeug unterwegs.
Dafür entdeckte Brenner endlich die ersten Tiere. Er hatte natürlich damit rechnen müssen, der Anblick traf ihn dennoch wie ein Schlag. Sein Mund wurde trocken, und er musste schlucken. Soweit das Auge reichte, bedeckte ein Teppich aus Tausenden Tierkadavern die Savanne.
Der Autor
Uwe Laub wurde 1971 in Rumänien geboren. Er war zwei Jahre alt, als seine Eltern mit ihm nach Deutschland zurückkehrten. Laub arbeitete mehrere Jahre im Pharma-Außendienst, seit 2010 führt er das Unternehmen eigenständig. Seine Liebe gilt dem Schreiben. Für seine Wissenschafts-Thriller recherchiert er intensiv. Sein Roman »Sturm« wurde zum Bestseller.
UWE LAUB
LEBEN
THRILLER
WILHELM HEYNE VERLAG
MÜNCHEN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2020 by Uwe Laub
Copyright © 2020 by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Heiko Arntz
Umschlaggestaltung: DAS ILLUSTRAT, München,
unter Verwendung von Motiven von © Shutterstock
(Inked Pixels/Chores/xpixel)
Satz: Leingärtner, Nabburg
ISBN: 978-3-641-23513-0V006
www.heyne.de
Für Marion
Was wäre das Leben ohne die Liebe?
»Ein Schwan ist immer weiß.
Schwarze Schwäne existieren nicht.«
Gesellschaftlicher Konsens in Europa bis 1697
ERSTER TEIL
Tag null
»Kruger-Nationalpark bis auf Weiteres geschlossen. Gründe dafür noch unklar. Parkverwaltung lehnt Stellungnahme bislang ab.«
BBC, Breaking News
Johannesburg, Südafrika
Der Lanseria International Airport im Nordwesten Johannesburgs war ein mittelgroßer Flughafen, auf dem mehrere regionale Fluggesellschaften hauptsächlich Inlandsflüge nach Kapstadt und Durban anboten. Die Cessna 182, die in diesem Moment abhob und nach wenigen Sekunden scharf in Richtung Osten schwenkte, gehörte zur Charterflotte der Firma Llungala Aviation, die sich auf touristische Rundflüge spezialisiert hatte. Mark Brenner saß mit angezogenen Knien auf dem Sitz neben dem Piloten. In der engen Kabine war es heiß und stickig, und es roch nach Kunstleder. Er trug eine Sonnenbrille, ein luftiges Leinenhemd, dunkelblaue Shorts und Sneakers. Dennoch trieb ihm die Hitze den Schweiß aus allen Poren, und das Leder der Kopfhörer klebte an seinen Ohren. Neben ihm saß der dunkelhäutige Pilot, der sich ihm als Adam vorgestellt hatte und der die Instrumente der einmotorigen Propellermaschine während des gesamten Startvorgangs konzentriert im Blick behielt.
Ohne nennenswerte Vibrationen stieg die Cessna auf in einen dunkelblauen, grenzenlos erscheinenden Himmel. Keine Wolke war zu sehen, keine Thermik zu spüren. Laut Adam rieten die Meteorologen allerdings zur Vorsicht, da auf ihrer geplanten Flugroute gegen Nachmittag ein Schlechtwettergebiet aufziehen sollte. Durch das Seitenfenster sah Brenner hinunter auf grüne Wälder und Wiesen, die letzten Ausläufer des Northern-Farm-Naturreservats.
»Hey Mann«, erklang Adams elektronisch verzerrte Stimme in Brenners Kopfhörer. »Alles klar? Entspannen Sie sich. Dieses Baby und ich haben über fünfhundert Flugstunden auf dem Buckel.«
»Ich bin entspannt«, log Brenner.
»Gut. Ich bringe Sie sicher ans Ziel.« Adam grinste und zeigte dabei gepflegte weiße Zähne.
Brenner nickte und sah wieder hinaus. Unter ihnen zogen jetzt braune Ackerflächen, Straßen sowie versprengte Siedlungen vorbei. Gelegentlich blitzten reflektierende Sonnenstrahlen auf, die am Boden auf Glas oder Stahl trafen.
»Was führt Sie hierher?«, wollte Adam wissen.
»Was alle hierher führt. Safari.«
Adam lachte spöttisch. »Na klar. Ein Deutscher mit einer Sonderfluggenehmigung des südafrikanischen Ministeriums für Umwelt und Touristik für den Kruger-Park, gerade mal einen Tag nachdem der Park komplett abgeriegelt wurde. Hey Mann, kommen Sie.«
Brenner betrachtete den Piloten genauer. Adam war jung, höchstens Ende zwanzig. Die krausen Haare waren kurz geschnitten. Er trug eine verspiegelte Pilotenbrille sowie braune Fliegerhandschuhe. Aus der Brusttasche seines Hemdes ragte ein Smartphone. »Was wissen Sie über die Schließung des Parks, Adam?«
»Nur das, was in der Zeitung steht. Anscheinend grassiert dort so eine Art Tollwut, und bis man herausgefunden hat, ob das für Menschen gefährlich ist, hat die Regierung den Park dichtgemacht. Das Militär hat Straßensperren auf sämtlichen Zufahrtsstraßen errichtet und überwacht die Parkeingänge. Keiner darf mehr rein. Absolut niemand. Sämtliche Rastplätze, Camps, Lodges und Hotels wurden geräumt. Alle Touristen wurden in Unterkünfte außerhalb des Parks untergebracht. Bis auf Weiteres finden keine Safaris statt.«
»Tollwut also.« Nachdenklich trommelte Brenner mit den Fingern auf seinen Oberschenkel.
»Totaler Bullshit, wenn Sie mich fragen.« Adam winkte ab. »Das glaubt hier doch kein Mensch. Das ist nur die offizielle Version für die Touristen. Vor einer Stunde wurde sogar die Grenze nach Mosambik geschlossen. Da geht was richtig Großes ab, sag ich Ihnen. Die Verantwortlichen halten sich natürlich bedeckt.«
»Der Kruger-Nationalpark ist riesig«, sagte Brenner. »Ich bezweifle, dass man ein fast zwanzigtausend Quadratkilometer großes Gebiet abriegeln kann.«
»Sehe ich genauso. Das Militär überwacht zwar die Eingänge, aber es gibt tausend Wege, um in den Park zu gelangen. Die Zäune, die es früher gab, um Tierwanderungen zu verhindern, wurden ja schon vor vielen Jahren entfernt.«
»Also, Adam, wenn Sie nicht an Tollwut glauben – was glauben Sie, geht dann im Park vor?«
Die Gesichtszüge des Piloten verhärteten sich. »Keine Ahnung, aber hey, du kannst die Menschen nicht so offensichtlich belügen. Ich meine, wir reden hier über den Kruger-Nationalpark. Hunderttausende Touristen kommen jedes Jahr nur deswegen hierher. Und die Regierung schließt den Park einfach so wegen Tollwut? Lächerlich. Je mehr Geheimnisse man um die Vorgänge dort macht, desto neugieriger werden die Menschen. Wissen Sie, die Leute reden.«
»Ach ja? Was reden sie denn?«
»Dies und das.« Adam machte eine vage Handbewegung. »Mein Onkel kennt jemanden, der in Matsulu eine Lodge betreibt und geführte Safaris anbietet. Dieser Mann steht vor dem Ruin, wenn sich die Situation nicht bald normalisiert. Auf jeden Fall behauptet er, Park-Ranger würden hinter vorgehaltener Hand von einem Ebola-Ausbruch reden.«
»Das sind nur wilde Spekulationen«, warf Brenner ein. »Aufgrund des enormen Gefahrenpotenzials würde niemand eine Ebola-Epidemie unter den Tisch kehren.«
»Mag sein. Okay, wie klingt das für Sie. Der Großvater einer Bekannten behauptet, mitten im Park hätte sich ein gewaltiger schwarzer Riss in der Erde aufgetan, aus dem Geister der Unterwelt heraufsteigen. Wer mit ihnen in Berührung kommt, ist dem Tod geweiht.«
»Böse Geister?« Brenner schmunzelte. »Wie kommt er darauf?«
»Anscheinend hatte er eine Vision.«
»Tatsächlich?«
»Natürlich darf man nicht alles wörtlich nehmen, was die Alten so reden, aber man sollte es auch nicht ins Lächerliche ziehen.«
»Wenn Sie das sagen.«
Adam checkte seine Anzeigen auf der Instrumententafel des Cockpits, dann wandte er sich wieder an Brenner. »Weshalb sind Sie wirklich hier?«
»Wie lange noch bis zur Parkgrenze?«
»Etwa neunzig Minuten.«
»Dann wecken Sie mich bitte, wenn wir da sind. Ich habe die letzten Tage nicht sonderlich viel Schlaf bekommen.«
Brenner schloss demonstrativ die Augen, obwohl er nicht damit rechnete, schlafen zu können. Zu viele Gedanken beschäftigten ihn. Die überraschende Schließung und Abriegelung des Kruger-Nationalparks für die Öffentlichkeit hatte weltweit Aufsehen erregt. Die Tatsache, dass die südafrikanische Regierung den Park-Rangern sowie den Betreibern der Touristencamps Maulkörbe verpasst hatte, trug natürlich mit dazu bei, dass in den Medien, vor allem im Internet, die wildesten Gerüchte ins Kraut schossen. Sogar von Aliens, die im Park gelandet seien, war in einschlägigen Foren die Rede. Das war natürlich lächerlich, zeigte aber doch nur, wohin es führte, wenn man über Dinge spekulierte, ohne über gesichertes Faktenwissen zu verfügen. Und dasselbe galt für ihn, Brenner. Er musste es erst mit eigenen Augen sehen.
Der weitere Flug verlief ruhig. Adam schwieg – wenn er nicht gerade mit Fluglotsen kurze Funksprüche wechselte –, und die Cessna lag so sanft in der Luft, dass Brenner wider Erwarten tatsächlich einschlief.
»Hey Mann, wachen Sie auf. Wir sind da.«
Brenner öffnete die Augen und blinzelte. Die Sonne brannte unvermindert grell vom Himmel, und die Thermik war nach wie vor ruhig, doch am Horizont näherten sich von Osten tiefdunkle Wolken.
»Wird uns diese Schlechtwetterfront erreichen?«, fragte Brenner.
»Schwer zu sagen«, meinte Adam. »Kommt darauf an, wie weit Sie in den Park hineinfliegen wollen. Vor fünf Minuten haben wir den Kruger Mpumalanga Airport überflogen. Dorthin werden wir später zurückkehren.«
Brenner richtete sich in seinem Sitz auf, massierte den verspannten Nacken und sah durch die Frontscheibe. Unter ihnen zog eine hügelige, spärlich bewaldete Landschaft vorbei. In einiger Entfernung näherte sich ein grünes Band dichter Vegetation, das, wie Brenner vermutete, die Grenze zum Park markierte.
»Wir haben die Einflugschneise des Flughafens verlassen und können jetzt tiefer gehen, wenn Sie wollen«, informierte Adam ihn.
»Fliegen Sie so niedrig Sie können.«
Adam drückte das Steuer nach vorn, und die Cessna begann sachte an Höhe zu verlieren. Nur Sekunden später knarzte das Funkgerät, und eine Stimme meldete sich. Brenner verstand die Unterhaltung nicht, aber aus Adams Antworten schloss er, dass sich das Militär für die anfliegende Cessna interessierte. Nachdem Adam ihre Flugkennung übermittelt hatte und die Sondererlaubnis zum Tiefflug über den Nationalpark bestätigt worden war, ließ man sie in Ruhe. Einmal mehr fragte Brenner sich, wie es seinem Auftraggeber gelungen war, an diese Erlaubnis zu gelangen. Sein Auftraggeber schien über ein erstaunliches Netzwerk zu verfügen, das bis in Regierungskreise reichte. Im Augenblick aber zählte nur, dass sie in hundertfünfzig Metern Höhe der Parkgrenze entgegenflogen. Straßen, Autos, einzelne Gebäude, baufällige Hütten, Bäume, Büsche und sogar Menschen waren jetzt erstaunlich gut zu erkennen.
»Können Sie noch tiefer gehen?«, fragte Brenner.
Adam schüttelte den Kopf. »Wir fliegen schon mit Mindestsicherheitsabstand zum Boden. Noch niedriger, und ich kassiere eine Strafe.«
Sie überflogen ein breites, an den Rändern ausgetrocknetes Flussbett. Zu beiden Seiten des Ufers wucherte sattgrüne Vegetation, überragt von hohen Bäumen mit breiten Kronen.
»Das ist der Nsizaki«, sagte Adam. »Willkommen im Kruger Nationalpark.«
Brenners Augen glitten über die karge, felsige Landschaft aus Granitgestein, die sich hinter dem dicht bewachsenen Flussufer erstreckte. Unruhig rutschte er in seinem Sitz hin und her, während er auf der Suche nach den ersten Tieren sich fast den Kopf verrenkte. Nach einigen Minuten fragte er: »Wo sind die Tiere? Ich sehe keine. Ist das normal?«
Adam zögerte. »Eigentlich nicht. Seltsam.«
Wenig später ging die Bergregion in eine flache Graslandschaft über, in der vorwiegend dornige Akazien wuchsen. Dazwischen sah man immer wieder beeindruckend hohe Termitenbauten. Die unbefestigten Straßen und Trampelpfade, die kreuz und quer durch die Savanne führten, waren gut zu erkennen. Wie erwartet, war heute kein einziges Fahrzeug unterwegs.
Dafür entdeckte Brenner endlich die ersten Tiere. Er hatte natürlich damit rechnen müssen, der Anblick traf ihn dennoch wie ein Schlag. Sein Mund wurde trocken, und er musste schlucken. So weit das Auge reichte, bedeckte ein Teppich aus Tausenden Tierkadavern die Savanne. Es handelte sich um eine Antilopen-Herde, genauer gesagt um Impalas, wie die senkrechten schwarzen Streifen am Steiß der rehbraunen Körper verrieten. Die Herde musste riesig gewesen sein, denn ein Ende der umherliegenden, verwesenden Kadaver war nicht abzusehen.
»Sangoma steh uns bei«, keuchte Adam.
»Gehen Sie tiefer«, forderte Brenner.
»Ich sage Ihnen doch, das geht nicht, ich …«
»Ich verdopple Ihr Honorar«, sagte Brenner, ohne den Blick von den verendeten Tieren abzuwenden.
Adam stieß geräuschvoll Luft aus. »Okay, scheiß drauf.« Er ließ die Cessna absacken, bis sie in lediglich fünfzig Metern Höhe über die Savanne schossen.
Mit einem Bestand von rund 150 000 Tieren war die Impala-Antilope das am häufigsten anzutreffende größere Säugetier im Park, wie Brenner noch am frühen Morgen einer Broschüre der Parkverwaltung entnommen hatte. Während sie die verendete Herde überflogen, schätzte er die Anzahl der in der Sonne verwesenden Kadaver auf über zehntausend. Weder er noch Adam sagten etwas. Der furchtbare Anblick sprach für sich.
Eine künstlich angelegte Wasserstelle von der Größe eines kleinen Badesees kam in Sicht. Im Park gab es viele solcher Gewässer, die bei Touristen äußerst beliebt waren, da dort in der Regel die besten Chancen auf Tiersichtungen bestanden. Rund um die Wasserstelle lagen Hunderte verendete Kaffernbüffel. Sie besaßen massive Hornplatten mit abwärts geschwungenen Hörnern auf der Stirn, die sie häufig als Rammen benutzten. Diese Tiere dort unten jedoch würden nie wieder um Reviere streiten oder sich gegen Fressfeinde verteidigen müssen. Ihre über eine halbe Tonne schweren Körper lagen aufgedunsen im Umkreis der Wasserstelle, als wären sie geradewegs während des Trinkens umgekippt. Brenner überschlug die Anzahl der Kadaver und kam auf mindestens fünfhundert tote Büffel.
Sie flogen weiter. Um sie herum erstreckte sich die Savanne jetzt in alle Richtungen so weit das Auge reichte. Brenner warf einen raschen Blick auf die tiefdunkle Wolkenfront, die deutlich schneller heranzog, als von Adam vorhergesagt. Nur noch wenige Kilometer entfernt, trieb sie einen Vorhang aus dichtem Regen vor sich her. Grelle Blitze leuchteten im Innern der Gewitterwolken auf. Der Anblick war beängstigend, auch weil es hier im Fall der Fälle kaum Chancen für eine saubere Notlandung gab. Doch so Angst einflößend die Schlechtwetterfront auch war, der wahre Schrecken ging von dem Anblick unter ihnen aus. Tod und Verwesung, wohin sie auch blickten.
Im Laufe der nächsten halben Stunde sahen sie tote Elefanten, Giraffen, Nashörner, sowie mehrere verendete Gnu- und Zebraherden. Die wenigen lebenden Tiere, die sie mit der Cessna aufscheuchten und für kurze Zeit vor sich hertrieben, erweckten den Eindruck, dass auch sie krank und längst dem Tode geweiht waren. Unter den Opfern des Massensterbens befanden sich auch Hyänen, Löwen und Geparden, die allesamt stark verwesende Züge aufwiesen. Demnach schien es die Großkatzen als Erste erwischt zu haben. Überhaupt waren auffällig wenige Kadaver von Raubtieren angefressen, was Brenner zu dem Schluss verleitete, dass nicht nur die Großkatzen, sondern der überwiegende Teil aller im Park ansässigen Raubtiere, inklusive der Aasfresser, von diesem Sterben betroffen waren. Über Hunderte Quadratkilometer hinweg erstreckte sich das Massensterben. Was um alles in der Welt mochte diese Katastrophe ausgelöst haben?
Sie überflogen einen weiteren Fluss, und Adam deutete aufgeregt nach unten. »Dort! An den Ufern!«
»Ich sehe es«, flüsterte Brenner.
Dutzende verendete Nilpferde säumten die Flussufer. Ihre mächtigen Leiber waren halb im Schlamm versunken, die Bäuche aufgebläht, die rissige Haut in der sengenden Sonne aufgeplatzt. Auf dem Wasser trieben dicht an dicht tote Reiher und Flamingos.
»Es ist viel schlimmer, als ich gedacht hatte«, sagte Brenner mehr zu sich selbst als zu Adam.
»Schlimm?«, echote Adam. »Das ist eine verdammte Katastrophe! Jetzt mal ehrlich, Mann, was wissen Sie darüber?«
»Bisher nicht viel mehr als Sie.«
»Das nehme ich Ihnen nicht ab.«
Brenner atmete tief durch. »Massensterben treten in den letzten Jahren gehäuft auf. Überall auf der Welt. Aber dabei ist normalerweise immer nur eine einzige Tierart oder eine bestimmte Spezies betroffen. Man hat zum Beispiel 2018 festgestellt, dass die größte Königspinguin-Kolonie der Erde, auf einer Insel zwischen Afrika und der Antarktis, in kürzester Zeit um fast neunzig Prozent geschrumpft war.«
»Okay, das ist tragisch«, sagte Adam, »aber das können Sie nicht mit dem hier vergleichen. Pinguine sind keine bedrohte Tierart, oder? Hier sterben Nashörner und andere seltene Tiere.«
»Ich gebe Ihnen recht, Adam, aber die Häufung von Massensterben in den letzten Jahren führt eben genau dazu, dass zuvor nicht bedrohte Tierarten plötzlich durchaus vor dem Aussterben stehen.« Brenner löste seinen Blick von den Tierkadavern, um Adam anzusehen. »Vielleicht haben Sie von dem weltweiten Amphibienrückgang gehört. Seit etwa drei Jahrzehnten lässt ein Pilz weltweit Froschpopulationen aussterben. In Mittel- und Südamerika sind in manchen Regionen bis zu neunzig Prozent der Froschbestände verschwunden. Tendenz weiter steigend.«
»Und dafür gibt es keine Erklärung?«
Brenner rieb sich die Augen. »Es gibt verschiedene Theorien. Auslöser eines Massensterbens sind meist Infektionskrankheiten, verursacht fast immer durch Viren, Bakterien oder Pilze. Zweithäufigste Ursache sind menschliche Eingriffe in Ökosysteme. Allerdings gibt es hier im Park eine Besonderheit, und die macht mir ehrlich gesagt höllische Angst.«
»Und die wäre?«
»Wir haben es hier mit einem artenübergreifenden Sterben zu tun, das in diesem Ausmaß und in dieser kurzen Zeitspanne untypisch ist. Nicht nur eine Tierart ist betroffen, sondern wie es scheint Säugetiere allgemein. Sogar Vogelarten sterben. Das alles ist extrem besorgniserregend.«
Die Thermik wurde instabiler. Die Cessna lag jetzt unruhiger in der Luft, und die erste ernst zu nehmende Windböe ließ sie für einen Moment zur Seite kippen. Brenner schloss für einen Moment die Augen.
»Fliegen wir zurück«, sagte er. »Ich habe gesehen, was ich sehen wollte.«
»Und? Was werden Sie unternehmen?«
»Ich?«
»Sie sind doch nicht zufällig hier. Ich wette, Sie sind Wissenschaftler. Biologe oder so.«
»Ich wette nie«, entgegnete Brenner.
Brenner musterte den jungen Piloten, der jegliche Lockerheit verloren hatte, die er noch zu Beginn ihres Fluges an den Tag gelegt hatte. Adam wirkte verzweifelt, schien regelrecht unter Schock zu stehen, was Brenner ihm nicht verübeln konnte. Ihm erging es kaum anders. Eine weitere Windböe traf die Cessna und rüttelte sie durch. Die Gewitterfront hatte sie beinahe erreicht.
»Bitte drehen Sie jetzt um, und fliegen Sie zurück«, wies er Adam an. »Ich muss Bericht erstatten.«
»Für wen arbeiten Sie? Die Regierung?«
Der Junge war hartnäckig, das musste Brenner ihm lassen. »Das geht Sie nichts an. Aber der Auftraggeber, der meinen Bericht erwartet, kann möglicherweise etwas gegen das Sterben da unten unternehmen.«
»Sicher?«
»Vielleicht.« Brenner hasste es zu lügen. Doch was sollte er diesem armen, verzweifelten Jungen sonst sagen? Adam sah seine Heimat sterben, und sobald die Touristenströme versiegten, würde er arbeitslos werden. Und das würde schneller geschehen, als Adam sich das vorstellen konnte. Kein Tourist wollte Tod und Verwesung sehen.
Brenner nestelte in seiner Brusttasche, zog ein Bündel Geldscheine hervor, zählte einige Scheine ab und steckte sie Adam zu. »Wie versprochen, das Doppelte des vereinbarten Honorars.«
Ohne großen Enthusiasmus nahm Adam das Geld entgegen.
Brenner musterte ihn, zählte dann erneut einige Scheine ab und drückte sie ihm in die Hand. »Und nochmals dieselbe Summe, wenn Sie kein Wort darüber verlieren, was Sie heute gesehen haben.«
»Das hier wird sich wie ein Lauffeuer verbreiten«, sagte Adam.
»Das wird es. Aber wir müssen Zeit gewinnen, bevor die Medien über die Sache herfallen.«
Adam verzog den Mund, steckte das Geld aber ein. »Zeit gewinnen? Wozu?«
»Wir müssen alles versuchen, um das hier zu beenden«, sagte Brenner leise, wohl wissend, dass kein Mensch auf der Welt, keine Umweltbehörde, keine Regierung und auch keine private Umweltschutzorganisation die Macht besaß, diesen furchterregenden Prozess zu stoppen. Das Einzige, was Brenner im Augenblick für den Jungen tun konnte, war, ihm ein bisschen Hoffnung zu machen, und mit dem zusätzlichen Geld würde er wenigstens einige Wochen über die Runden kommen.
»Gut«, sagte Adam mit wässrigen Augen, während er eine Kurve beschrieb und die Cessna auf Kurs Richtung Mpumalanga Airport brachte, fort von der Gewitterfront. »Danke, Mann.«
Brenner starrte aus dem Fenster. Den Rest des Fluges über schwieg er.
Tag 1
»Schließung des Kruger-Nationalparks wirft Fragen auf. Die Verantwortlichen halten sich bedeckt.«
The Budapest Times, Daily Journal
Budapest, Ungarn
Lajos Farkas betrat das Kaffeehaus Müvész, zog seine Hände aus den Manteltaschen und rieb sie warm. Farkas fror am ganzen Körper, die Gelenke seiner knöchrigen Finger schmerzten. Dort machte sich die Gicht immer besonders stark bemerkbar. Farkas hatte nicht erwartet, dass die Temperaturen noch einmal so stark fallen würden, obwohl der Wind selbst Mitte März noch eisig durch Budapests Straßen fegen konnte. Offenbar weigerte sich der Winter, dem Frühling das Feld zu räumen, und wagte einen letzten, trotzigen Versuch zur Rückkehr.
Das Müvész empfing Farkas mit wohliger Wärme, gedämpftem Licht und dem angenehmen Hintergrundgemurmel der Gäste. Der tägliche Besuch dieses altehrwürdigen Etablissements war längst zu einer Routine geworden, die Farkas nur durchbrach, wenn ihn dringende Angelegenheiten ins Ausland trieben oder er erkrankt war, was selten vorkam. Mit müden Augen sah er sich im vorderen Teil des gut besuchten Kaffeehauses nach einem freien Nichtrauchertisch um. Zu seiner Enttäuschung waren sämtliche Tische besetzt. Trotz seiner Aversion gegen Zigarettenrauch beschloss er, im hinteren Salon nach einem Tisch zu sehen. Er ging an der verspiegelten Bar vorbei und passierte Vitrinen, in denen sich auf mehreren Etagen ein beeindruckendes Sortiment an allerlei süßen Köstlichkeiten im Kreis drehte. Torten, Kuchen, Karamellcremeschnitten und kleine Marzipan-Kunstwerke führten die Gäste hier in Versuchung. Unweigerlich lief Farkas das Wasser im Mund zusammen. Vielleicht würde er sich heute eine der ausgezeichneten Mehlspeisen des Müvész gönnen.
Er betrat den Salon, entdeckte einen freien Tisch, hängte seinen Mantel an die Garderobe und nahm Platz. Zigarettenqualm waberte durch den Raum und sammelte sich unter der klassizistischen Stuckdecke. Seit jeher hatten sich hier im Müvész Budapester Künstler und Bohemiens getroffen, um über Gott und die Welt zu diskutieren. Unter Farkas’ Vorsitz hatte an dieser Stelle vor vielen Jahren sogar der Innere Zirkel eine inoffizielle Versammlung abgehalten. Farkas hatte dafür den Salon für einen Tag exklusiv gemietet. Damals war er noch in seinen besten Jahren gewesen, körperlich fit, voller Tatenkraft und Ideale. Heute stand er wenige Wochen vor seinem fünfundsiebzigsten Geburtstag, seine Knochen ächzten jeden Morgen beim Aufstehen, und immer häufiger quälten ihn Gichtanfälle. Einzig die Überzeugung für seine Ideale war ungebrochen. Für diese Ideale würde Lajos Farkas bis zu seinem Tod kämpfen.
Ein Kellner kam auf ihn zu, ganz in Schwarz, mit einer goldenen Krawatte, wie sie auch die weiblichen Bedienungen im Müvész trugen. Zielstrebig bahnte er sich mit katzenhafter Geschmeidigkeit seinen Weg zwischen den Tischen hindurch. In einer Hand balancierte er ein leeres Tablett. Farkas schätzte ihn auf Ende zwanzig. Er hatte glänzende schwarze Locken, war athletisch gebaut und hatte außergewöhnlich strahlende grüne Augen.
»Der Herr?«, fragte der Kellner und deutete eine Verbeugung an.
»Presszókávé, bitte.«
»Sehr wohl.« Der Kellner lächelte. »Dazu vielleicht eine kleine Süßigkeit?«
»Was können Sie denn empfehlen?« Farkas merkte, wie er einen Tick schneller atmete. Die leuchtenden Augen des Kellners, dazu das Grübchen an dessen markantem Kinn, faszinierten ihn. Es war lange her, dass er auf einen Mann so reagiert hatte.
Der Kellner sah ihm tief in die Augen. Sein wissendes Lächeln wurde eine Spur breiter. »Lassen Sie sich von mir überraschen, mein Herr.«
»Sie denken, Sie kennen meine Vorlieben?«
»Vertrauen Sie mir.«
Nun huschte auch über Farkas’ faltiges Gesicht ein Lächeln. Das Müvész legte immer schon Wert auf ein attraktives, zuvorkommendes Personal, das sich um das Wohl des Gastes zu kümmern wusste. Er nickte und sah dem Kellner auf dessen Weg zur Theke hinterher. Noch vor zehn Jahren hätte Farkas diesen hübschen Burschen mit zu sich nach Hause genommen. Seit dem überstandenen Prostatakrebs geschah dies aber nur noch in seiner Fantasie. Die Träume allerdings ließ Farkas sich nicht nehmen. Was blieb einem Mann, der nicht mehr träumen durfte?
Eine weibliche Bedienung mit blasser Haut und einem Ring in der linken Augenbraue kam an seinen Tisch und fragte ihn, was er wünsche.
»Ich habe bereits bei Ihrem Kollegen bestellt«, teilte er ihr mit.
Die junge Frau wirkte irritiert. »Aber das ist mein Tisch.«
Er breitete seine Hände aus. »Was soll ich sagen, werte Dame? Wer zuerst kommt …«
»Darf ich fragen, welcher Kollege Sie bedient hat?«
»Der Herr mit den grünen Augen«, antwortete Farkas lächelnd.
Sie zog eine Schnute. Farkas sah ihr an, dass sie mit seiner Beschreibung nicht viel anzufangen wusste. Schließlich zuckte sie mit den Schultern. »So, so«, sagte sie und ging davon.
Farkas gegenüber saß ein älterer, gebeugter Mann und las Zeitung. In seiner Hand brannte eine Zigarette ab. Er schien vergessen zu haben, dass er sie angezündet hatte. Er erinnerte Farkas an Kristóf Sándor, einen alten Freund und Weggefährten, der Kettenraucher gewesen war und dessen Zigarettenasche selten im Aschenbecher, sondern meistens irgendwo auf dem Boden gelandet war. Trauer überkam Farkas, als er an Kristófs tragischen Tod dachte. Erst eine Woche war das her. Kristóf war eben nicht mehr der Jüngste gewesen, nur so konnte Farkas sich das Unglück erklären. Er war mit glimmender Zigarette in der Hand auf dem Sofa eingeschlafen. Offenbar hatte der Teppich zuerst Feuer gefangen, danach hatten die Flammen rasch auf die alten Holzmöbel übergegriffen. Feuerwehr und Polizei hatten übereinstimmend geäußert, dass Kristóf mit Sicherheit nicht von den Flammen getötet worden war, sondern bereits zuvor von den giftigen Rauchgasen. Schon wenige Atemzüge Kohlenstoffmonoxid waren tödlich. Wenigstens hatte Kristóf nicht leiden müssen. In zwei Tagen fand die Beerdigung statt. Danach würde der Innere Zirkel zusammentreten und einen neuen zweiten Vorsitzenden wählen müssen. Die Einladungen an die Club-Mitglieder zur Trauerfeier und dem anschließenden Treffen hatte Farkas bereits versandt. Es würde eine traurige Zusammenkunft werden.
»Einmal Presszókávé, der Herr.«
Farkas schrak aus seinen Gedanken. Der Kellner mit den grünen Augen stand vor ihm und stellte eine Porzellantasse mit dampfendem Espresso auf dem Tisch ab. In einer eleganten Bewegung nahm er einen Teller vom Tablett und präsentierte Farkas eine ovale Patisserie aus dunkler Schokolade, garniert mit einem Blatt grüner Minze und einem Klecks Marmelade.
»Mein persönlicher Favorit«, sagte der Kellner. »Eine Cukrászda. Einfach himmlisch. Sie werden begeistert sein.« Einmal mehr sah er Farkas tief in die Augen und lächelte verführerisch.
Farkas schluckte trocken. In diesem Augenblick hätte er seine Seele dafür verkauft, wieder jung zu sein und anstatt der Cukrászda diesen Burschen vernaschen zu können. »Danke. Ich bin sehr gespannt.«
Der Kellner deutete eine Verbeugung an und verschwand in Richtung Theke.
Die Cukrászda roch ein klein wenig wie Weihnachten. Farkas steckte sie sich zur Gänze in den Mund. Sie war klebrig süß, wie erwartet. Farkas kaute langsam und genießerisch. Der volle Geschmack von dunkler Schokolade und Erdbeermarmelade breitete sich an seinem Gaumen aus. Farkas fühlte sich geradezu berauscht von der Süße. Der Kellner hatte nicht zu viel versprochen.
Keine Minute später ging das berauschende Gefühl in leichten Schwindel über, der rasch zunahm. Im schummrigen Licht des Salons begannen sich die Tische mitsamt den Gästen um Farkas herum zu drehen. Er stützte sich mit einer Hand an seinem Tisch ab und schluckte die Reste der halb zerkauten Cukrászda mit Hilfe des Espressos hinunter. Stechende Kopfschmerzen setzten ein, so rasch, als hätte jemand auf einen Knopf gedrückt, um sie auszulösen. Farkas stöhnte leise und kniff die Augen zusammen. Am Ausgang stand der Kellner. Er sah Farkas mit starrer Miene an. Farkas wollte mit der Hand signalisieren, dass er Hilfe benötigte, doch seine Arme lagen wie gelähmt auf seinen verhärteten Oberschenkeln. Überhaupt fühlten sich jetzt alle seine Muskeln hart und verkrampft an. Er schwitzte stark, das Atmen fiel ihm zunehmend schwerer.
Die Kellnerin mit dem Augenbrauenring tauchte auf, gefolgt von einem wichtig aussehenden Mann in einem grauen Anzug. Sie deutete auf Farkas’ Kellner, woraufhin der Mann im Anzug energisch auf diesen zusteuerte. Der Kellner warf Farkas einen letzten Blick zu und eilte in Richtung der vorderen Eingangstür davon. All dies nahm Farkas noch wahr, doch dann begann sein Blick einzutrüben. Sein Kopf dröhnte. Er saß da, unfähig, auch nur den kleinen Finger zu rühren, und schnappte nach Luft wie ein Fisch an Land. Dann verließen ihn seine Kräfte, und sein Kopf schlug auf die Tischplatte. Um ihn herum hörte er Aufschreie.
Die Cukrászda, dachte Farkas in einem letzten Moment geistiger Klarheit. Jemand hat mir eine vergiftete Cukrászda untergejubelt.
Aber warum? Wer konnte seinen Tod wollen? Farkas hatte keine Feinde und nie jemandem etwas zuleide getan. Ganz im Gegenteil. Sein ganzes Leben hatte er danach getrachtet, der Menschheit zu dienen.
Jetzt spürte er Hände, die ihn ergriffen und versuchten, ihn aufzurichten. Doch dann setzte sein Atemreflex aus, und Lajos Farkas erstickte bei vollem Bewusstsein.
Tag 2
»Hunderte tote Delfine sind in den vergangenen Tagen an der russischen Schwarzmeerküste angeschwemmt worden. Die Hintergründe des Massensterbens sind noch unklar. Viren, Bakterien oder mangelnde Wasserqualität schließen Veterinärmediziner als Ursachen aus.«
Krasnodar (dpa)
München, Deutschland
Fabian Nowack saß im nüchtern eingerichteten Wartezimmer der internistischen Praxis des Ärztehauses am Sendlinger Tor und atmete schwer. Ausgerechnet heute wurde der Aufzug im Gebäude gewartet. Es waren nur zwei Stockwerke, trotzdem war Fabian völlig aus der Puste, und so schwer war sein Aktenkoffer ja nun wirklich nicht. Vornübergebeugt saß er auf einem unbequemen Plastikstuhl und unterdrückte einen Hustenreflex. Seine Fitness ließ wirklich zu wünschen übrig. Einmal mehr nahm er sich vor, endlich wieder joggen zu gehen. Was gab es Schöneres, als in den frühen Morgenstunden entlang der Isar auf noch menschenleeren Wegen zu laufen. Doch er war seit Monaten nicht mehr dazu gekommen. Schuld daran war sein neuer Job. Ständig war er müde, und an den Wochenenden schaffte er es nur noch, sich mit einer Tüte Chips aufs Sofa zu hauen und sich Serien auf Netflix reinzuziehen. Aber solange sich die unbezahlten Rechnungen auf seinem Küchentresen stapelten, musste er unter der Woche im Job Vollgas geben.
Ein Hustenanfall schüttelte ihn. Heute fühlte er sich ganz besonders schlapp. Womöglich brütete er etwas aus? Er rieb sich den verschwitzten Nacken und lockerte die Krawatte. Nur allzu gerne hätte er sie abgenommen und den obersten Knopf seines Hemdes geöffnet, doch die Kleidungsvorschriften von Artinova Pharma waren streng. Artinova erwartete von seinen Pharmareferenten einen seriösen Auftritt beim Arzt. Dazu gehörte, nach Meinung von Fabians Arbeitgeber, zwingend eine Krawatte zum Anzug. In seiner Freizeit trug Fabian lieber Jeans und T-Shirt. Doch er wollte sich nicht beklagen. Dieser Job stellte für ihn einen Neuanfang dar. Er hatte eine zweite Chance bekommen, und diesmal würde er es nicht verbocken.
Eine Arzthelferin mit blondem Pferdeschwanz steckte ihren Kopf ins Wartezimmer und rief den Namen einer Frau auf. Eine ältere Dame erhob sich. Fabian seufzte. Die Frau war nach ihm gekommen, das wusste er genau, allerdings gehörte Warten zu diesem Job wie Anzug und Krawatte. Sein Blick fiel auf eine brünette Frau, die sich mit ihrem Handy beschäftigte. Die Art und Weise, wie sie es in ihren Händen hielt und mit beiden Daumen tippte, erinnerte Fabian an Bea. Im Gegensatz zu ihm hatte Bea ständig Nachrichten verschickt. Sie schrieb lieber Dutzende Nachrichten, als einmal kurz anzurufen.
Leider waren er und Bea nicht nur in Sachen Handy sehr verschiedener Auffassung gewesen. Am Anfang hatte jeder die Eigenarten des anderen noch als liebenswerte Marotten abgetan, doch nach und nach war die Toleranzschwelle gesunken. Zum Schluss hatte es beinahe täglich Streit gegeben. Inzwischen wusste Fabian, dass er und Bea einfach nicht füreinander geschaffen waren. Die Art und Weise, wie sie ihn abserviert hatte, schmerzte noch immer. Zumal das Ende ihrer Beziehung auf einem großen Missverständnis beruhte. Leider hatte Bea ihm nie die Möglichkeit gegeben, diese blöde Geschichte aufzuklären. Seitdem sie Knall auf Fall ausgezogen war, hatte sie ihn komplett aus ihrem Leben verbannt. Nun, vielleicht war das auch besser so. Trotz allem gab es aber immer wieder Momente, in denen Fabian sie vermisste, und zwar zu seinem eigenen Erstaunen mehr, als ihm guttat.
Die Brünette hob ihren Kopf und sah ihn an, als hätte sie seine Blicke gespürt. Sogar ihr leicht vorwurfsvoller Blick erinnerte Fabian an Bea. So hatte sie ihn immer angesehen, kurz bevor sie wegen irgendeiner Lappalie Streit vom Zaun gebrochen hatte. Rasch wandte er seinen Blick ab.
Um sich abzulenken, zog er ebenfalls sein Smartphone aus der Hosentasche. Er überflog die Nachrichten. Das Massensterben im Kruger-Nationalpark war die Schlagzeile des Tages. Vor wenigen Stunden hatte die südafrikanische Regierung erste Bilder des Ausmaßes der Katastrophe veröffentlicht und vorsorglich eine Reisewarnung für den Park herausgegeben. Die Ursachen für das weitreichende Artensterben lagen vollkommen im Dunkeln. Offizielle Zahlen sprachen von mehr als fünfhunderttausend toten Tieren, Tendenz steigend. Vor allem die Tatsache, dass sich das Sterben nicht nur auf eine Tierart beschränkte, ließ Experten rätseln. Die Sorgen waren groß. Veterinärmedizinern vor Ort war es bislang nicht gelungen, Krankheitserreger nachzuweisen, die zum Tod der Tiere geführt haben könnten.
Niedergeschlagen steckte Fabian das Smartphone weg. Er liebte Tiere. Wenn er nicht den ganzen Tag außer Haus wäre, hätte er sich längst einen Hund zugelegt. Immerhin hatte er Bob, zu dem er wie die Jungfrau zum Kind gekommen war. Zwar konnte man Bob beileibe nicht mit einem Hund vergleichen, aber unbeaufsichtigt in der Wohnung, stellte Bob mindestens ebenso viel Blödsinn an wie ein solcher. Bob war ein Chamäleon.
Die Arzthelferin mit dem blonden Pferdeschwanz erschien wieder in der Tür, und diesmal rief sie Fabian auf. Sie führte ihn durch einen Korridor, von dem drei Behandlungszimmer abgingen. In dem ersten saß ein kleines weinendes Mädchen mit seiner Mutter, und das zweite war geschlossen. Die Tür des dritten Zimmers war einladend weit geöffnet. Die Arzthelferin führte ihn hinein. In einer Ecke stand ein weiß glänzender Schrank, daneben eine Liege, gegenüber befanden sich zwei Rollcontainer, auf denen Pflaster und Verbandmittel lagen. In der Luft lag der unverwechselbare Geruch nach alten Menschen, Krankheit und Desinfektionsmittel. Die Arzthelferin kippte das Milchglasfenster und sagte: »Der Herr Doktor kommt gleich.«
»Danke.«
Sie verschwand, und Fabian wuchtete seinen Aktenkoffer auf die Liege. Dann richtete er seine Krawatte und strich sein Sakko glatt. Wieder hieß es warten. Er massierte sich den Nacken. Kopfschmerzen kündigten sich an. Vermutlich war wirklich ein grippaler Infekt im Anmarsch.
In seiner Hosentasche vibrierte sein Smartphone. Rasch riskierte er einen Blick. Seine Schwester Charlotte hatte ihm eine SMS geschickt. Offenbar war Fabians dreijähriger Neffe Marvin an Scharlach erkrankt, und Charlotte bat Fabian deswegen um Rückruf. Er lächelte. Seit seiner Ausbildung zum Pharmareferenten dachten alle, er sei nun so etwas wie ein Arzt, weshalb man ihn ständig um medizinischen Rat fragte. In der Tat hatte er sich in den letzten Monaten einiges an medizinischem Fachwissen angeeignet, und so wusste er immerhin, dass Scharlach bei Kleinkindern zwar unangenehm, aber in aller Regel nicht gefährlich war. Sobald er wieder im Auto saß, würde er Charlotte zurückrufen.
Eine Viertelstunde später rauschte Dr. Schwarz ins Zimmer. Er war Mitte fünfzig, schlank, und unter seinem Arztkittel trug er ein blaues Hemd. »Na, Herr Nowack, was gibt’s Neues?«
»Guten Tag, Herr Doktor Schwarz.« Fabian reichte ihm die Hand. »Danke, dass Sie sich heute Zeit für mich nehmen.«
Dann spulte Fabian sein antrainiertes Verkaufsgespräch ab. Doch er hatte Mühe, sich zu konzentrieren. Das Pochen hinter seinen Augen wurde von Minute zu Minute stärker. Vermutlich hatte er inzwischen sogar leichtes Fieber. Dr. Schwarz schien von alldem nichts zu bemerken. Er nickte zu seinen Ausführungen, stellte die eine oder andere unverbindliche Frage und begutachtete die Probepackungen, die Fabian ihm reichte.
Schließlich hatte Fabian es überstanden. Er bedankte sich erneut, ließ sich den Musterbeleg für die mitgebrachten Arzneimittelmuster abzeichnen und verabschiedete sich.
Im Korridor stieß er beinahe mit der Frau zusammen, die er in dem ersten Behandlungszimmer gesehen hatte. Das Mädchen an ihrer Hand hatte verheulte Augen und ein aufgeschürftes Knie, über das lieblos ein braunes Heftpflaster geklebt war. Fabian griff in die Innentasche seines Sakkos und zog zwei Packungen Kinderpflaster mit Teddybären-Muster hervor. Lächelnd hielt er sie dem Mädchen hin. »Für dich. Dann wird alles ganz schnell wieder gut, und zu Hause kannst du deiner Lieblingspuppe auch ein Pflaster aufkleben.«
Über ihr fleckiges Gesicht huschte ein Lächeln. Sie sah ihre Mutter an. »Darf ich?«
»Natürlich, Schatz.« Die Mutter nickte Fabian zu. »Sehr freundlich von Ihnen.«
»Gute Besserung«, wünschte Fabian und verließ die Praxis.
Im Treppenhaus nahm er eine Ibuprofen ein und entschied, trotz seiner Kopfschmerzen der Praxis im vierten Stock auch noch einen Besuch abzustatten. Artinova forderte von seinen Pharmareferenten einen Besuchsdurchschnitt von neun Ärzten pro Tag, und den erreichte man nicht, wenn man wegen jeder kleinen Unpässlichkeit zu Hause blieb. Wehmütig warf Fabian einen Blick auf das Wartungsschild an der Aufzugtür. Aber hatte er nicht gerade erst vor ein paar Minuten beschlossen, sich mehr zu bewegen? Das ständige Sitzen im Auto und in den Wartezimmern war nicht nur fatal für seinen Rücken, sondern auch für seine Figur. Längst war die kleine Speckrolle über seinem Gürtel nicht mehr zu übersehen. Wenn das so weiterging, würde er im Sommer am Langwieder See sein T-Shirt nicht mehr ausziehen, so viel stand fest.
Auf dem zweiten Treppenabsatz spürte Fabian, dass etwas ganz und gar nicht stimmte. Sein Herz pochte heftig und irgendwie unregelmäßig. Kalter Schweiß brach ihm aus. Ihm fiel ein, dass es ihm erst vor einer Woche beim Treppensteigen ähnlich ergangen war. Damals hatte er mehrere Minuten gebraucht, um wieder zu Kräften zu kommen.
Fabian verlangsamte sein Tempo, doch das drückende Gefühl in Brust und Magen wollte nicht verschwinden. Seine Beine wurden schwer, jeder Tritt, jede einzelne Treppenstufe kostete ihn Überwindung. Sein Aktenkoffer schien Tonnen zu wiegen. Magenkrämpfe setzten ein, weiße Blitze zuckten durch sein Gesichtsfeld.
Nur mit allerletzter Kraft schaffte er es in den vierten Stock. Die Eingangstür zur Arztpraxis tauchte wie aus dichtem Nebel auf. Er drückte sie mit dem Gewicht seines Körpers auf und taumelte auf die Anmeldung zu.
»Kann ich Ihnen helfen?«, hörte er eine Frauenstimme sagen, dann in deutlich höherer Stimmlage: »Mein Gott, was ist mit Ihnen? Geht es Ihnen nicht gut?«
Fabian wollte die Arzthelferin beruhigen und ihr sagen, dass er sich nur ein wenig ausruhen müsse, doch er brachte kein Wort heraus. Seine Zunge klebte am Gaumen.
Ein Schlaganfall, schoss es ihm durch den Kopf. Mein Gott, habe ich etwa gerade einen Schlaganfall?
»Elke, komm schnell!«, hörte er die Arzthelferin rufen.
Dann eine andere Frau: »Der ist ja weiß wie die Wand.«
Alle Kraft wich aus Fabians Körper. Sein Aktenkoffer glitt ihm aus der Hand. Sein Magen rebellierte. Fabian ging auf die Knie. Dann übergab er sich lautstark auf dem cremefarbenen Teppich.
Tag 4
»Der Zustand der Artenvielfalt in Deutschland ist alarmierend. Ein Drittel aller in Deutschland vorkommenden Arten steht inzwischen auf der Roten Liste und gilt in seinem Bestand als gefährdet.«
Bundesamt für Naturschutz, Artenschutzreport
München, Deutschland
Über München schien die Sonne an einem wolkenlosen Himmel. Die Sonnenstrahlen fielen durch Fabians Fenster und offenbarten gnadenlos eine dünne Staubschicht auf dem Laminat, während er auf allen vieren auf der Suche nach Bob durch das Wohnzimmer kroch. Am Wochenende musste er endlich mal wieder die Wohnung auf Vordermann bringen. Er blickte unter das Sofa, sah hinter Kissen und Vorhänge und zog sogar die Kommode ein Stück von der Wand ab. Bob blieb verschwunden. Nicht zum ersten Mal.
Fabian sah auf seine Armbanduhr. Er sollte längst auf dem Weg zu Dr. Quandt sein. Er wollte aber auf keinen Fall Bob den ganzen Tag unbeaufsichtigt umherlaufen lassen. Der Kerl würde die Bude auf den Kopf stellen. Fabian versuchte sein Glück in der Küche. Er schob Kochbücher, Tupperdosen und Konservenbüchsen beiseite und stieg sogar auf den Küchentresen, um auf dem Kühlschrank nachzusehen. Vergeblich. Notgedrungen entschied er, Bob ein paar Stunden die Freiheit zu gönnen.
Während er sich den blau-weißen Hoodie mit dem Logo seines Eishockey-Vereins SC Riessersee sowie die dazu passende Baseballcap von der Garderobe schnappte, entdeckte er Bob schließlich doch noch. Er hockte auf der Garderobenstange, hatte den hellbraunen Farbton des Holzes angenommen und starrte Fabian mit seinen großen Augen an.
»Wolltest du etwa ausgehen?«, fragte er und nahm Bob vorsichtig in die Hand. Er steckte das Chamäleon zurück ins Terrarium und vergewisserte sich, dass der Deckel richtig schloss. Bob nutzte jede Möglichkeit abzuhauen, und für heute hatte Fabian genug gesucht. Außerdem befürchtete er, dass er nach dem Termin bei seinem Hausarzt ganz andere Probleme haben würde.
Bei der Haustür traf er auf den Postboten. Dieser nutzte die Gelegenheit und drückte Fabian drei Briefe in die Hand. Er überflog die Absender. Zwei Mahnungen, der dritte Brief schien ein Strafzettel zu sein. Fabian seufzte und steckte die Briefe in seinen Briefkasten. Die Mahnungen mussten bis zum nächsten Gehaltseingang warten. Wenn das Konto bis dahin nicht wieder überzogen war.
Eine knappe Stunde später saß er auf dem Freischwinger vor Dr. Quandts Schreibtisch. Die schräg stehenden Jalousien vor den Fenstern warfen Schatten, die sich über das Fischgrätenparkett, den Schreibtisch sowie die Behandlungsliege zogen. An den Wänden hingen Tafeln mit anatomischen Abbildungen menschlicher Gliedmaßen und Organe. Fabian sah auf die Baseballcap in seiner Hand. Zwei Tage nach seinem unerklärlichen Zusammenbruch lagen die Ergebnisse der Blutuntersuchung vor. Zum Glück war es kein Schlaganfall gewesen, allerdings verhieß die Tatsache, dass Fabians Hausarzt die Ergebnisse nicht telefonisch, sondern persönlich mit ihm besprechen wollte, nichts Gutes. Nervös ließ er die Kappe in seiner Hand rotieren.
Endlich öffnete sich die Tür, und Dr. Quandt trat ein. Mit seinem grauen Haarkranz, der Lesebrille, dem weißen Kittel und dem Stethoskop, das er um den Hals trug, wirkte er wie der gute alte Onkel Doktor aus einer Fernsehserie des letzten Jahrhunderts. Reflexhaft erhob sich Fabian und streckte ihm die Hand entgegen. »Guten Tag, Herr Doktor Quandt.«
»Herr Nowack, wie fühlen wir uns heute?«
»Ein wenig müde vielleicht, aber eigentlich ganz gut. Als wär nichts gewesen.«
»Das ist schön zu hören.« Dr. Quandts Gesichtsausdruck blieb neutral. Er ging langsam um seinen Schreibtisch und setzte sich mit einem leisen Ächzen in den altgedienten, speckigen Ledersessel. Obwohl die Einrichtung der Praxis ebenso altmodisch anmutete wie Dr. Quandt selbst, vertraute Fabian dessen Erfahrung. Trotz stetig steigenden Kostendrucks im Gesundheitswesen nahm er sich immer viel Zeit für seine Patienten. Von Berufs wegen kannte Fabian mittlerweile Dutzende Ärzte, die heimlich mit Stoppuhren arbeiteten, damit die Patienten keinesfalls mehr Zeit in Anspruch nahmen, als abrechnungstechnisch für sie vorgesehen war.
»Und?«, fragte Fabian ungeduldig. »Was ist mit mir los?«
Dr. Quandt nahm eine Mappe vom Schreibtisch und schlug das Deckblatt auf. »Dieser Schwächeanfall war nicht der erste dieser Art, richtig?«
»Ungefähr vor zwei Wochen ist mir etwas Ähnliches passiert, aber das war bei Weitem nicht so schlimm.«
»Erzählen Sie mir davon.«
»Das war auch beim Treppensteigen.« Er dachte nach. »Die Symptome waren dieselben … Kurzatmigkeit, Herzrasen, Übelkeit … aber längst nicht so dramatisch wie diesmal.«
»Im Bericht des Kollegen steht, dass Sie sich in seiner Praxis zunächst erbrochen haben und dann für mehrere Minuten nicht ansprechbar waren.«
Betreten starrte Fabian auf die Kappe in seinen Händen. »Sie können sich gar nicht vorstellen, wie peinlich mir das ist. Ich kann mich in dieser Praxis nie wieder blicken lassen.«
Dr. Quandt sah von der Mappe auf. »Vergessen Sie jetzt mal die Arbeit. Wie ging es danach weiter?«
»Das wissen Sie doch«, sagte Fabian irritiert. »Ihr Kollege hat noch an Ort und Stelle Blut abgenommen und mir eine Kochsalzinfusion verpasst. Nach einer Stunde war ich wieder auf dem Damm und durfte die Praxis verlassen.«
»Das meinte ich nicht.« Dr. Quandt klopfte mit der flachen Hand auf die Mappe. »Ich habe den Bericht des Kollegen gelesen. Was ich meinte, Herr Nowack – wie ist es Ihnen die Tage danach ergangen? Hat sich ein derartiger Vorfall wiederholt?«
»Nein. Wie gesagt, eigentlich geht es mir gut. Mir tut nichts weh. Manchmal fühle ich mich ein wenig schlapp, aber in letzter Zeit schlafe ich auch nicht besonders gut. Ist sicher nur der Stress.«
»Haben Sie Muskel-, Glieder- oder Gelenkschmerzen?«
»Nein. Jetzt sagen Sie schon. Was fehlt mir?«
Dr. Quandt legte die Mappe zurück auf den Schreibtisch und deutete auf die Behandlungsliege. »Machen Sie sich bitte frei, und legen Sie sich hin.«
Zunehmend unruhig, zog Fabian sein T-Shirt aus und legte sich auf die Liege. Weshalb sagte der Arzt ihm nicht einfach frei heraus, was die Blutuntersuchung ergeben hatte? Dafür konnte es nur eine Erklärung geben: Es war tatsächlich etwas Schlimmes. Mit einem Mal war Fabians Mund staubtrocken.
»Ihre Haut ist sehr hell«, bemerkte Dr. Quandt, während er Fabians Oberkörper mit den Fingern abklopfte. »An manchen Stellen wirkt sie fast ein wenig durchscheinend.«
»Durchscheinend?«
»Dazu kommen wir noch. Haben Sie in letzter Zeit Gewicht verloren?«
»Sehe ich vielleicht so aus?« Beinahe hätte er laut aufgelacht. »Seitdem ich Pharmareferent bin, habe ich fünf Kilo zugelegt.«
»Setzen Sie sich bitte auf.« Dr. Quandt griff nach seinem Stethoskop. Nachdem er Fabian abgehört hatte, legte er ihm die Manschette des Blutdruckmessgeräts um den Oberarm. »Treiben Sie Sport?«
»Kaum noch. In meiner Jugend habe ich Eishockey beim SC Riessersee gespielt. Wir haben dreimal die Woche trainiert. Ich war gut. Ich hätte es in die Profimannschaft schaffen können, aber na ja, irgendwie haben mich zu der Zeit Mädchen mehr interessiert, und ich habe das Training schleifen lassen.«
»Ihr Blutdruck ist normal.« Dr. Quandt nahm ihm die Manschette ab. »Sagen Sie, gibt es in Ihrer Familie irgendwelche … ungewöhnlichen Erkrankungen?«
»Ungewöhnlich? Was meinen Sie damit?«
»Na schön, vergessen wir das für den Moment.« Mit einer kleinen Lampe leuchtete er in Fabians Augen. »Der Pupillenreflex ist in Ordnung. Sie können sich wieder anziehen.«
»Irgendwie klingt das für mich, als ob alles andere nicht in Ordnung wäre«, entgegnete Fabian, während er sich das T-Shirt überstreifte. »Sagen Sie mir bitte die Wahrheit. Habe ich Krebs?«
Dr. Quandt blinzelte überrascht. »O nein, Herr Nowack, Sie haben keinen Krebs. Sie leiden auch an keinem viralen oder bakteriellen Infekt. In dieser Hinsicht sind Sie gesund.«
»Nun spannen Sie mich doch nicht länger auf die Folter!« Fabian ließ sich in den Freischwinger fallen und kratzte sich nervös über den Handrücken.
»Ich habe eine molekularbiologische Untersuchung Ihres Blutes in Auftrag gegeben.« Dr. Quandt lehnte sich in seinem Sessel zurück und legte die Fingerspitzen aneinander. »Wir haben Ihr Blut mehreren spezifischen DNA-Analysen unterzogen.«
Fabians Herz schlug schneller. »Was haben Sie gefunden?«
Dr. Quandt betrachtete ihn mit einem Gesichtsausdruck, der Fabian an seinen Vater erinnerte. Genau so hatte sein Vater ihn vor vielen Jahren während der Beerdigung seiner Mutter angesehen, als sie gemeinsam an ihrem Grab gestanden und geweint hatten. Schlagartig wurde ihm klar, was er im Gesicht des Arztes sah. Es war Mitleid.
»Zuerst wollte ich es nicht glauben«, sagte Dr. Quandt mit belegter Stimme, »denn die Wahrscheinlichkeit, dass man als praktizierender Arzt einen solchen Fall in der Praxis sieht …« Er suchte nach Worten. »Wie auch immer, ich habe den Ergebnissen des ersten Labors nicht getraut, deshalb habe ich umgehend ein zweites Labor mit denselben Analysen beauftragt. Doch das Ergebnis ist dasselbe. Herr Nowack, wir konnten bei Ihnen Mutationen im WRN-Gen und das Fehlen des normalen WRN-Proteins nachweisen.«
Fabian schüttelte verwirrt den Kopf. »Bitte reden Sie Klartext.«
»Sagt Ihnen das Werner-Syndrom etwas?«
Fabian schüttelte erneut den Kopf.
»Das Werner-Syndrom ist eine Form von Progerie und wird auch als ›Progeria adultorum‹ bezeichnet.«
»Progerie?« Diesen Begriff kannte Fabian. Groteske, Furcht einflößende Bilder drangen auf ihn ein. Kinder, die aussahen wie Greise, klein, dünn, mit kahlen Köpfen und faltigen Gesichtern. Teenager, deren Körper schon in jungen Jahren alt und gebrechlich waren und die fast immer früh starben. »Ich verstehe nicht. Was hat das mit mir zu tun?«
»Das Werner-Syndrom ist eine sehr seltene Krankheit«, dozierte Dr. Quandt weiter. »Weltweit weist nur einer von zweihunderttausend Menschen diesen vererbten Gendefekt auf. In Deutschland gibt es etwa vierhundert Patienten, die an Progeria adultorum leiden. Ich muss Ihnen leider mitteilen, Herr Nowack, dass Sie einer dieser vierhundert Betroffenen sind.«
»Aber ich bin doch kein Kind mehr«, platzte es aus Fabian heraus. Er weigerte sich, eine derart abwegige Diagnose zu akzeptieren, und schoss aus seinem Stuhl. »Ich soll widernatürlich schnell altern? Ist es das, was Sie mir sagen wollen? Das ist wohl ein Witz! Ich bin topfit.«
»Das sind Sie leider nicht, Herr Nowack«, entgegnete Dr. Quandt, in dessen Stimme Bedauern sowie Verständnis mitschwangen. »Ich kann nachvollziehen, dass diese Nachricht ein Schock für Sie sein muss. Nur bitte beruhigen Sie sich, damit wir über alles reden können.«
»So ein Quatsch! Es gibt unzählige Ursachen für derartige Schwächeanfälle.«
»Sie werden lernen müssen, Ihre Krankheit zu akzeptieren, Herr Nowack. Glauben Sie mir, ich habe alles andere ausgeschlossen. Die DNA-Analyse ist eindeutig.«
»Ach ja? Ist sie das?« Aufgewühlt begann Fabian durch das Besprechungszimmer zu tigern.
Dr. Quandt seufzte. »Wenn es um Progerie geht, denkt man meistens an betroffene Kinder, weil die Auswirkungen der Krankheit bei ihnen extremer und anschaulicher sind. Es ist in der breiten Öffentlichkeit kaum bekannt, dass diese Krankheit ebenso erwachsene Menschen treffen kann, meistens um das dreißigste Lebensjahr herum.«
Fabian war stehen geblieben. Er starrte den Arzt einen Moment an und setzte sich dann wieder in Bewegung. »Erzählen Sie mir mehr darüber.«
»Der Gendefekt, der zum Werner-Syndrom führt, wird autosomal-rezessiv vererbt. Deswegen hatte ich nach Ihrem Familienhintergrund gefragt. Das ist in Ihrem Fall jedoch eine Sackgasse. Typische Werner-Syndrom-Patienten sind bei der Geburt und in den Kinderjahren gesundheitlich vollkommen normal und unauffällig. Allerdings fehlt der pubertäre Wachstumsschub. Das war bei Ihnen augenscheinlich anders. Sie haben sich zu einem stattlichen jungen Mann entwickelt. Das ist mit diesem Gendefekt äußerst ungewöhnlich.«
»Also irren Sie sich, was die Diagnose betrifft«, beharrte Fabian. »Ich war schon in der Grundschule sportlicher als die meisten meiner Freunde. Nein, ich habe keinen verdammten Gendefekt. Ich hatte einfach nur zwei stressbedingte Schwächeanfälle.«
Dr. Quandt musterte ihn. »Ich gebe zu, Ihr Fall ist außergewöhnlich. Einige der charakteristischen klinischen Symptome scheinen bei Ihnen verzögert aufzutreten, oder sie treten sogar in atypischer Reihenfolge auf.«
»Was für Symptome?«
»Nun, üblicherweise entwickeln Betroffene typische Alterserscheinungen in sehr kurzer Zeit. Die Haare ergrauen und dünnen aus, häufig entwickelt sich Grauer Star. Die Haut verändert sich markant. Altersflecken, schlecht heilende Wunden oder sonstige Hautveränderungen sind die Folge. Die Haut wird dünn, häufig durchscheinend und ist anfällig für Verletzungen.«
Fabian hob das T-Shirt über seinen Bauch und sah prüfend an sich herab. »Und Sie denken, das ist bei mir der Fall?«
Dr. Quandt nickte.
»Okay, ich bin käsig, das gebe ich zu.« Er zog sein T-Shirt wieder herunter. »Mal angenommen, ich glaube Ihnen … Was jetzt? Werde ich bald aussehen wie mein eigener Opa?« Es sollte wie ein Scherz klingen, aber Dr. Quandt verzog keine Miene. »Also, wie muss ich mir das vorstellen?«, fuhr er daher fort. »Was erwartet mich?«
Dr. Quandt holte tief Luft. »In den meisten Fällen treten neben Alterungsprozessen zusätzliche altersabhängige Störungen auf, darunter Osteoporose, Diabetes mellitus, Arteriosklerose sowie erhöhte Wahrscheinlichkeit auf Tumorwachstum und, wie erwähnt, sehr häufig Grauer Star. Progeria adultorum bedeutet nicht einfach nur vorzeitiges Altern. Wir sprechen hier vielmehr von einem Prozess, der den normalen Alterungsprozess exponentiell beschleunigt.«
Resignierend ließ Fabian sich in den Freischwinger sacken. »Wie geht es jetzt weiter?«
»Wie gesagt, Ihr Fall ist sehr speziell. Vor allem die Diskrepanz zwischen den bekannten klinischen Symptomen und dem Verlauf bei Ihnen stellen mich vor ein Rätsel. Ich habe natürlich auch keinerlei praktische Erfahrung mit dem Werner-Syndrom bisher. Zu diesem Zeitpunkt bleibt uns nicht viel mehr übrig, als regelmäßige Untersuchungen vorzunehmen, um die erwähnten Symptome frühzeitig zu erkennen.«
»Frühzeitig? Das heißt also, ich werde alle diese Krankheiten, die Sie gerade aufgezählt haben, irgendwann bekommen?«, fragte Fabian entsetzt.
»Mit großer Wahrscheinlichkeit zumindest einige davon. Sie sollten ab sofort weder rauchen noch Alkohol trinken. Eine fettarme Ernährung kann nicht schaden. Gegen körperliche Betätigung in vernünftigem Umfang ist nichts einzuwenden, sofern Sie sich nicht überanstrengen. Falls Sie psychologische Begleitung wünschen, so kann ich Sie hierfür an einen guten Kollegen verweisen.«
»Ich brauche keinen Seelenklempner. Ich will eine zweite Meinung, und zwar von einem Experten.«
»Das steht Ihnen natürlich frei.«
Fabian starrte ins Leere. Was sollte er zu alldem sagen? Tausend Fragen schossen ihm durch den Kopf, doch er war nicht in der Verfassung, sie laut zu formulieren. Er fühlte sich wie im falschen Film, innerlich leer und ausgelaugt. Schließlich räusperte er sich. »Gibt es Medikamente? Ich meine, es gibt doch sicher was dagegen?«
Die Mundwinkel des Arztes zuckten kurz, dann beugte er sich in seinem Sessel vor und sprach aus, was Fabian längst vermutete: »Für das Werner-Syndrom gibt es keine Therapie. Es gibt keine Medikamente, die ein Fortschreiten des Alterungsprozesses verlangsamen könnten. Betroffene wie Sie, Herr Nowack, weisen leider eine stark verkürzte Lebenserwartung auf. Die Behandlung beschränkt sich auf die Therapie der Komplikationen.«
Fabian ließ die Antwort sacken, dann stellte er seine letzte Frage: »Wie lange habe ich noch?«
Dr. Quandt zögerte. »Die meisten Betroffenen versterben vor dem fünfzigsten Lebensjahr. Viele deutlich früher. Aber wie gesagt, bei Ihnen scheinen einige Symptome von der Norm abzuweichen, daher wäre alles, was ich Ihnen jetzt dazu sagen könnte, reine Spekulation.«
»Dann spekulieren Sie.«
»Bei der Heftigkeit Ihrer Schwächeanfälle und in Anbetracht der DNA-Analysen würde ich sagen, zwei bis drei Jahre. Wenn Sie Glück haben.«
Fabian erwiderte nichts. Der Arzt, der Schreibtisch, der ganze Raum schien plötzlich in weite Ferne gerückt. Es dauerte eine Weile, bis er begriff, dass Dr. Quandt bereits weitersprach.
»Auf jeden Fall müssen wir Ihren Fall sehr viel besser untersuchen, Herr Nowack, bevor wir exakte Aussagen hierzu treffen können. Doch dafür bin ich nicht der richtige Arzt. Ich mache Ihnen einen Vorschlag.« Er tippte mit dem Zeigefinger auf Fabians Patientenakte. »Ich werde nach einem Kollegen Ausschau halten, der sich mit dem Werner-Syndrom auskennt. Ich verspreche Ihnen, ich werde eine Koryphäe auf diesem Gebiet finden. Er oder sie wird Ihnen weiterhelfen.«
»Sagten Sie nicht gerade, es gäbe keine Hilfe?«
Dr. Quandt erhob sich schwerfällig aus seinem Sessel. Er kam um den Schreibtisch herum, trat neben Fabian und legte ihm eine Hand auf die Schulter. »Sie dürfen die Hoffnung nicht aufgeben.«
Seine brüchige Stimme verriet, dass er an seine eigenen Worte nicht glaubte.
Tag 6
»Das Massensterben im Kruger-Nationalpark weitet sich aus. Behörden und Wissenschaftler sind ratlos. Urlaubsstornierungen für Südafrika schießen in die Höhe. Die Tourismusbranche steht vor einem Desaster.«
Die Welt, Ressort »Wirtschaft«
Cuxhaven, Deutschland
Der Bug des Lotsenbootes teilte das schmutzig braune Wasser der Elbe und katapultierte es in hohen Fontänen zur Seite. Die Dieselmotoren der Lotse 3 dröhnten. In Anbetracht der Dringlichkeit holte der Kapitän das Maximale aus ihnen heraus. Mark Brenner spürte die Vibrationen des Stahlrumpfs unter seinen Füßen. Breitbeinig stand er achtern, im Windschatten der Steuerkabine. Um diese Jahreszeit war es am frühen Morgen auf dem Fluss noch eisig, und die Kälte drang Brenner bis auf die Knochen. Er hielt sich mit der Linken an der Reling fest, mit der Rechten fummelte er an der Rettungsweste herum, die seiner Meinung nach viel zu eng saß und sein Sakko mitsamt Krawatte zerknitterte. Brenner bevorzugte legere Kleidung, wie er sie vor wenigen Tagen noch in Südafrika getragen hatte. Kleidung, die ihn einengte, konnte er ebenso wenig leiden wie einnehmende Frauen, die versuchten, über sein Leben zu bestimmen. Zu allem Überfluss roch die Weste muffig.
Zwei Schnellboote der Wasserschutzpolizei näherten sich unter Blaulicht mit hoher Geschwindigkeit von achtern und überholten die Lotse 3 in knappem Abstand. Für einen Augenblick trug der Wind knarzenden Funkverkehr herüber, dann waren die Schnellboote auch schon an ihnen vorbei. Brenner wischte sich übers Gesicht, das feucht vom aufsprühenden Elbwasser war. Von einem der Lotsen wusste er, dass die Polizei längst vor Ort war. Wie es schien, hatten die Beamten dort Verstärkung angefordert. Weshalb? Brenner hoffte inständig, dass es nicht mit seiner heiklen Fracht zusammenhing, die sich an Bord des havarierten Containerschiffes befand.