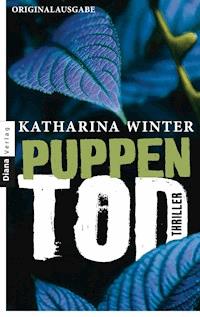2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diana
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Spannend, mitreißend, abgründig
Als Carla von dem alten Herrenhaus in der Eifel erfährt, das sich seit Jahrzehnten im Besitz ihrer Familie befindet, ist sie fassungslos: Wieso hat ihr nie jemand davon erzählt? Da Carla sich gerade in einer schwierigen Lebenssituation befindet, zieht sie mit ihrer kleinen Tochter dort ein und macht schon bald eine grausige Endeckung: Im Garten des Hauses gibt es ein Grab, auf dessen Grabstein ihr eigener Name steht, der Tag ihrer Geburt und der ihres Todes …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 472
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
KATHARINA WINTER ÜBER »STURMNÄCHTE«
Wann haben Sie zum ersten Mal daran gedacht, ein Buch zu schreiben? Schon als Kind habe ich gern Geschichten geschrieben und davon geträumt, irgendwann selbst ein Buch zu veröffentlichen. Immer wieder habe ich es versucht, unzählige unvollendete Manuskripte landeten im Papierkorb. Doch der Wunsch ließ mich nicht los, und so ist es mir schließlich mit viel Leidenschaft und Disziplin gelungen, meinen ersten Roman zu vollenden.
Was ist Ihrer Meinung nach das Wichtigste bei spannender Unterhaltung? Und gibt es eine Autorin, die Sie besonders inspiriert hat?
Zweifellos Daphne du Maurier, die Meisterin der düsteren Spannung! Auch meine Hauptfigur Carla muss unweigerlich an den alten Herrensitz Manderley denken, als sie ihre erste Nacht in dem einsamen Haus in der Eifel verbringt. Noch ahnt sie nicht, was sie erwartet, bis sie im Garten ein Grab entdeckt, auf dem ihr eigener Name steht. Es gilt, ein dunkles Geheimnis zu ergründen, das zwei Familien auf ewig miteinander verbindet. Und wenn es den Lesern Freude macht, meinen Figuren bis zur Auflösung zu folgen, habe ich das wichtigste Kriterium für einen spannenden Roman erfüllt – ich habe eine Handlung entworfen, die fesselt und berührt.
Wie entwerfen Sie Ihre Plots? Wissen Sie von Anfang an, wie die Geschichte ausgeht?
Zuerst ist es nur eine flüchtige Idee; ein Haus, ein Bild, ein Wort, das die Fantasie berührt. Das passiert ganz plötzlich und ist nie vorhersehbar. Viele Gedanken verlassen meinen Kopf so schnell, wie sie gekommen sind. Doch manchmal setzt sich eine Idee fest und beginnt zu wachsen. Dann grüble ich tagelang über Personen, Orte und Geschehnisse nach, bis eine fertige Geschichte geboren ist, mit einem Anfang und einem Ende.
ÜBER DIE AUTORIN
Katharina Winter, geboren in Sangerhausen im Südharz, verbrachte ihre Kindheit und Jugend in der ehemaligen DDR, bevor sie 1989 nach Westdeutschland ausreisen konnte. Nach verschiedenen beruflichen Stationen begann sie, ihren alten Traum vom Schreiben weiterzuverfolgen. »Sturmnächte« ist nach »Puppentod« ihr zweiter Roman im Diana Taschenbuch. Die Autorin lebt mit ihrem Mann in der Nähe von Offenburg.
Inhaltsverzeichnis
… und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.
MATTHÄUS 6, 12
PROLOG
Seit Langem hatte niemand mehr dieses Zimmer betreten. Vor Jahrzehnten war es verschlossen und nie wieder geöffnet worden. Zu vieles darin erinnerte an das, was damals hier geschehen war. Selbst die Blutflecke auf dem Fußboden hatten sich nicht auswaschen lassen. Das Blut war tief in die alten Holzdielen gesickert und zu einem stummen Zeugen geworden.
Die Frau, die am Fenster des Erkers stand, hielt ein Testament in der Hand und starrte hinaus in den Garten. Eisiger Ostwind trieb das welke Herbstlaub vor sich her.
Die Entscheidung, die sie treffen musste, fiel ihr schwer. Ihre Hand, die das Testament festhielt, zitterte. Durfte sie wirklich Schicksal spielen? Hatte sie das Recht, den letzten Willen einer Toten zu missachten, obwohl dieser das Unrecht triumphieren ließ? Das konnte nicht im Sinne Gottes sein. Gott war am Ende immer gerecht! Ist der Zorn des Herrn auch langsam, er lässt gewiss keinen ungestraft — so stand es schon im Alten Testament geschrieben.
Was sollte sie tun? Immer wieder stellte sie sich diese Frage. Die Antwort darauf musste sie allein finden, denn außer ihr war keiner mehr in diesem großen, unglückseligen Haus. Es war still. Nichts war zu hören, bis auf den Wind, der um die steinernen Mauern pfiff. Unter seiner Kraft bogen sich die Kronen der Bäume, denen er die letzten Blätter entriss. Nur die der alten Rotbuche hielten ihm stand. Ihre Zweige hingen herab wie lange Arme, die das Grab schützten, das sich darunter verbarg. Auch das gehörte zu den stummen Zeugen. Ein einsames Grab im Garten des Hauses, an das sich niemand mehr erinnert.
Sie verließ das Zimmer, verschloss sorgfältig die Tür und stieg langsam die Treppe hinunter, Stufe für Stufe, bis in die Eingangshalle. Dort drehte sie sich noch einmal um und glaubte für einen Moment, oben auf der Galerie Helena zu sehen. Sie hatte eine Strickjacke über ihr langes weißes Nachthemd gezogen. Das blonde Haar fiel ihr zerzaust über die Schultern, und sie lachte. Ein trauriges, unglückliches Lachen, das seit ihrem Tod durch das Haus hallte.
Es hätte nicht geschehen dürfen, was damals geschah. Sie alle trugen Schuld daran, auch sie selbst. Gab Gott ihr jetzt die Chance, ein Stück dieser Schuld zu begleichen? Sie sah auf das Testament in ihrer Hand. Sie durfte nicht zulassen, dass für immer und ewig in Vergessenheit geriet, was nicht gesühnt worden war. Sie musste es tun. Kein Weg führte daran vorbei. Sie ging ins Wohnzimmer und verweilte noch einen Augenblick lang zögernd vor dem Kamin. Dann warf sie das Testament ins Feuer. Stück für Stück ergriffen die Flammen das Papier und verwandelten es in Rauch und Asche. Der Schleier des Vergessens lüftete sich, die Geister der Vergangenheit erwachten wieder zum Leben.
Zu dem Ort, wo die Flüsse entspringen, kehren sie zurück, um wieder zu entspringen – auch das stand geschrieben.
ERSTER TEIL
1
Vier Sekunden dauerte es, bis das Freizeichen sich wiederholte. Genau vier Sekunden. Das wusste Carla seit dem zwölften Februar. Sie hatte es mitgezählt, bei jedem Anruf, den sie an jenem Tag getätigt hatte. Und seitdem versetzte es sie in Angst, wenn niemand das Gespräch annahm.
Nervös sah sie zur Uhr, während sie das Handy fester an ihr Ohr presste. Wieso ging ihre Mutter nicht ans Telefon? Es war vier Uhr nachmittags. Um diese Zeit saß sie sonst immer an der Nähmaschine. Minutenlang ließ Carla es klingeln, doch es meldete sich niemand. Dann legte sie das Handy zurück in ihre Handtasche, schob diese unter die Ladentheke und nahm nachdenklich ihre Arbeit wieder auf. Eine Lieferung Sherry musste in die Regale einsortiert werden, ein edler Almacenista-Sherry, der am Vormittag aus Andalusien eingetroffen war. Er kam direkt aus Jerez, war über dreißig Jahre alt und unerhört teuer. Sherry-Liebhaber waren ganz verrückt danach, gerade jetzt, in der Vorweihnachtszeit. Diese Rarität gab es sonst in ganz Köln nicht zu kaufen, nur hier, in dem kleinen spanischen Spezialitätengeschäft der Familie Sanchez, in dem Carla seit einigen Jahren aushalf.
»Geht deine Mutter noch immer nicht ans Telefon?«, erkundigte sich Adelina Sanchez, die ihr rundes Gesicht durch den Spalt des Vorhangs gestreckt hatte, der den Laden vom Büro trennte.
Carla schüttelte den Kopf. »Allmählich mache ich mir Sorgen. Ich versuche es jetzt schon seit einer Stunde.«
Adelina kam hinter dem Vorhang hervor. Um ihre breiten Hüften hatte sie eine rote, mit grünen Oliven verzierte Schürze gebunden und trug, passend dazu, ein rotes Haarband, das ihre widerspenstigen schwarzen Locken bändigen sollte. »Bestimmt ist sie nur schnell einkaufen gegangen«, sagte sie mit ihrem typisch andalusischen Akzent. Wie alle Andalusier kürzte sie die Worte ab und verschluckte gern eine ganze Silbe, was auf Deutsch ein ziemliches Kauderwelsch ergab. Deshalb war Adelina nur schwer zu verstehen, und Carla sprach am liebsten spanisch mit ihr.
»Sie geht nachmittags nie einkaufen«, gab Carla zurück. »Bis achtzehn Uhr ist die Schneiderei geöffnet, und erst gestern hat sie mir erzählt, wie viel sie im Augenblick zu tun hat. Sie würde ihre Arbeit nicht einfach liegen lassen und weggehen. «
»Vielleicht hat sie nur vergessen, das Telefon mit nach unten zu nehmen, und es liegt oben in der Wohnung, wo sie es nicht hört«, überlegte Adelina.
Doch auch das war keine plausible Erklärung. Luise nahm das Telefon stets mit in den Laden, denn sie verfügte nur über einen einzigen Anschluss, ihre Privatnummer war auch die Nummer der Änderungsschneiderei. Außerdem wollte sie für ihre Enkelin Pauline immer erreichbar sein, falls wieder einmal ein Notfall vorlag und eine von Paulines Barbiepuppen für ein spontanes Date kein passendes Kleid fand. Dann zauberte die Oma ruckzuck eines aus Stoffresten, in dem die Puppe ausnahmslos die schönste war.
»Warum fährst du nicht zu ihr?«, schlug Adelina vor.
»Ich habe den Sherry noch nicht einsortiert«, erwiderte Carla pflichtbewusst, »und eine Lieferung Oliven ist gekommen. «
Adelina winkte ab. »Darum werde ich mich kümmern. Du fährst jetzt erst einmal zu deiner Mutter und überzeugst dich davon, dass es ihr gut geht.«
»Kann Pauline so lange bei euch bleiben?«, wollte Carla wissen.
»Natürlich. Wahrscheinlich würde sie sowieso nicht mitfahren, denn sie und Mara spielen gerade mit den Barbiepuppen.« Augenzwinkernd fügte Adelina hinzu: »Sie haben sich eben heftig gestritten, wer heute Abend mit Ken ausgehen darf.«
»Wieso streiten sie sich darüber?«, fragte Carla erstaunt. »Sie haben doch nicht nur einen Ken.«
Adelina lachte herzhaft. »Das stimmt. Aber wie im richtigen Leben wollen scheinbar auch die Barbiepuppen immer nur den einen.«
Carla nickte wissend, während sie ihren Mantel anzog, einen hellgrauen Kurzmantel aus feinster Wolle. Das teure Designerstück war ein Relikt aus ihrem früheren Leben. Jan hatte ihn ihr letztes Jahr zu Weihnachten geschenkt.
Um Jan hatten sich damals auch alle gestritten. Jedes Mädel wollte ihn haben, diesen gut aussehenden Typen, der ein schnelles Auto fuhr und immer nur die besten Klamotten trug. Alle waren verrückt nach ihm. Doch sie hatte ihn bekommen. Wie stolz war sie darauf gewesen, und wie glücklich, als er ihr den Heiratsantrag machte. Das Brautkleid kaufte er bei Chanel in Paris. Es wurde eigens für sie angefertigt, hatte eine kleine Schleppe und einen langen Schleier. Zu diesem Zeitpunkt konnte er sich das noch gar nicht leisten, aber das interessierte ihn nicht. Geld war zum Ausgeben da, auch wenn man keines hatte.
»Sag den beiden, es bringt nichts, sich um einen Mann zu streiten«, rief Carla und wickelte sich den Schal um den Hals. »Und sag ihnen auch, dass die Männer, um die man sich streitet, am Ende sowieso nichts taugen.« Sie winkte Adelina von der Tür aus zu und wollte gerade gehen, als eine Stammkundin das Geschäft betrat. Frau Felden, eine Dame aus der Nachbarschaft, in einen eleganten Pelzmantel gehüllt, blieb bei Carlas Anblick überrascht in der offenen Tür stehen.
»Ach, Frau Sandberg, sind Sie jetzt auch nachmittags da?« Sie lächelte süffisant. »Sie Ärmste, müssen ja nun so viel arbeiten. Spaß macht Ihnen das bestimmt nicht.«
»Ich liebe meine Arbeit«, erwiderte Carla kurz angebunden und schluckte ihren Ärger herunter. Wie ein Giftpfeil bohrte sich diese Bemerkung tief in ihre Wunde und brannte dort wie Feuer. Doch sie hatte gelernt, sich das nicht anmerken zu lassen. Tapfer rang sie sich ein Lächeln ab und sagte freundlich: »Der Sherry ist eingetroffen.« Dann zwängte sie sich an Frau Felden vorbei, lief über die Straße zu ihrem Auto und stieg in den kleinen silbergrauen Peugeot ein. Es regnete in Strömen und wurde schon dunkel. Den ganzen Tag über war es nicht ein einziges Mal richtig hell gewesen. Nur kalt und grau. Sie schaltete die Scheibenwischer ein und fuhr in Richtung Rheinuferstraße. Leise dudelte das Radio vor sich hin, während sie sich durch den beginnenden Feierabendverkehr quälte und ihren Gedanken nachhing. Immer dieselben Fragen, immer dieselben Vorwürfe. Warum hatte sie damals ihren Job bei Beckmann & Söhne aufgegeben? Nur weil Jan das so wollte? Hatte sie nie von finanzieller Unabhängigkeit gehört? Sie hatte eine gut bezahlte Arbeit gehabt, war Fremdsprachensekretärin für Englisch und Spanisch bei einer renommierten Kölner Firma gewesen, mit netten Kollegen und besten Aufstiegschancen. Jan aber war der Meinung gewesen, sie sollte nicht arbeiten, sondern sich stattdessen um Haus und Familie kümmern. Und sie fand die Idee toll! Anfangs lief auch alles sehr gut. Ein Jahr nach der Hochzeit kam Pauline zur Welt, Jan machte eine Bilderbuchkarriere, und sie kauften die Villa im feinen Stadtteil Marienburg. Es war alles perfekt. Sie war nie auf die Idee gekommen, dass etwas nicht stimmen könnte. Nichts war ihr aufgefallen in ihrem schönen, bequemen, luxuriösen Leben. Nur ihre Mutter hatte sich nicht von Jan blenden lassen, doch auf Luise hatte sie nicht gehört.
Beim Gedanken an ihre Mutter zog sie automatisch das Handy aus der Tasche und drückte die Taste für die Wahlwiederholung. Ihre Mutter ging nicht ans Telefon. Irgendetwas stimmte da nicht.
Die blauen Lichtstreifen des Krankenwagens durchzuckten blitzartig die Dunkelheit. Erschrocken parkte Carla das Auto am Straßenrand. Zwei Krankenpfleger brachten ihre Mutter auf einer Trage aus dem Haus heraus. Eine Ärztin kümmerte sich um sie.
»Was ist passiert?«, rief Carla aufgeregt.
»Sind Sie mit der Patientin verwandt?«, fragte die Ärztin.
»Ich bin die Tochter«, antwortete Carla.
»Verdacht auf Herzinfarkt«, erklärte die Ärztin in nüchternem Tonfall. »Wir bringen sie ins Antoniuskrankenhaus.«
Die Pfleger schoben die Trage mit ihrer Mutter in das Innere des Wagens. Dann schlossen sich die Türen, und der Krankenwagen rauschte mit Blaulicht und Sirene davon. Carla blieb bestürzt im Regen stehen und sah ihm nach, bis das Licht verschwand und sie nur noch den Klang der Sirene hörte.
Zwei Stunden später saß sie auf einem unbequemen Stuhl in dem langen Krankenhausflur vor einer Flügeltür mit Milchglasscheiben, und wartete darauf, etwas über den Zustand ihrer Mutter zu erfahren. Zwei Stunden, die zur Ewigkeit wurden! Über der Tür hing eine Uhr, deren schwarze Zeiger sich im Schneckentempo vorwärtsbewegten. Die Zeit wollte einfach nicht vergehen. Unentwegt starrte Carla auf die Tür. Dahinter kämpften die Ärzte vielleicht um das Leben ihrer Mutter, während sie hier draußen saß und nichts tun konnte. Rechts neben der Tür hingen Bilder, von Kindern gemalt – ein Haus mit einer Sonne, Strichmännchen, die sich an den Händen hielten, ein Apfelbaum und ein Drache mit einem langen Schwanz. Pauline würde ihrer Oma auch ein Bild malen. Darauf wäre sicherlich das Pony zu sehen, das ihr Vater ihr versprochen und das sie nie bekommen hatte. Carla dachte daran zurück, wie sehr sie sich als Kind ein eigenes Pferd gewünscht hatte. Seit ihrem zehnten Lebensjahr, genau genommen seit dem 24. Dezember 1987, ihrem Geburtstag. Obwohl ihr Ehrentag auf den Heiligabend fiel, hatte sie sich nie benachteiligt gefühlt, denn ihre Mutter hatte immer streng darauf geachtet, die Geschenke voneinander zu trennen. Mittags wurde Geburtstag gefeiert und abends war dann Weihnachten. An jenem Tag fuhr ihre Mutter mit ihr nach dem Mittagessen zum Gestüt Eichhoff, dort durfte Carla regelmäßig reiten. Deshalb war ein eigenes Pferd ihr sehnlichster Wunsch gewesen, und ihre Mutter hatte Tag und Nacht gearbeitet, doch sie konnte Carlas großen Traum nicht erfüllen. Finanziell ging es ihnen nie richtig gut. In den Sommerferien machten sie Fahrradtouren, statt in den Urlaub zu fahren, und ein neues Kleid wurde nicht gekauft, sondern genäht. Wie sehr hatte sie ihre Freundinnen beneidet, weil deren Mütter ihnen schöne Kleider in schicken Boutiquen kauften. Und weil sie die Wochenenden in Freizeitparks verbrachten und nach Spanien in den Urlaub fuhren. Nicht ein einziges Mal war ihre Mutter mit ihr nach Spanien gefahren oder nach Italien. Nicht einmal an die Nordsee. Es war nicht möglich gewesen, das Geld war zu knapp. Den ersten Urlaub ihres Lebens hatte sie mit Jan an der Côte d’Azur verbracht, in einer tollen Villa in Saint-Tropez. Kein Wunder, dass sie vollkommen fasziniert war. Diese paradiesische Umgebung hatte es ihm leicht gemacht, sie um den Finger zu wickeln.
Wieder blickte sie zur Uhr über der Tür. Mit einem leisen Klack rückte der schwarze Zeiger voran. Sie konnte ihm bei seiner Reise von der einen zur nächsten Minute zuschauen. Mal verlief die Zeit extrem langsam, mal schien sie zu verfliegen – so wie in den letzten Jahren, als Carlas Leben einer Achterbahnfahrt glich. Erst war sie fast bis in den Himmel gerauscht und danach tief in den Abgrund gestürzt, den ihre Mutter vorhergesagt hatte. Luise hatte immer vor Jan gewarnt. Er sei ein Taugenichts und ihrer nicht wert – das waren ihre Worte gewesen. Carla hatte es gehasst, wenn sie so etwas gesagt hatte. Schließlich war sie bis über beide Ohren in Jan verknallt. Erst neulich hatte sie gelesen, dass Verliebtsein einem Drogenrausch glich. Es war also unmöglich, verliebt zu sein und einen Menschen gleichzeitig mit klaren Augen zu sehen. Natürlich war das keine Entschuldigung, aber vielleicht eine Erklärung dafür, dass sie so fest geglaubt hatte, Jan sei der Mann ihres Lebens. Wie der Prinz und die Prinzessin aus dem Märchen, so hatte sie sich jahrelang gefühlt und alle Warnzeichen ignoriert. Ihrer Mutter hatte sie vorgeworfen, von Männern und Beziehungen nichts zu verstehen. Irgendwie stimmte das ja auch. Der einzige Mann in Luises Leben war wahrscheinlich Carlas Vater gewesen, über den Luise nie sprach. Trotzdem hatte sie sich in Jan nicht getäuscht, das musste Carla letztendlich zugeben.
Unentwegt starrte sie auf die Flügeltür. Wieso kam nicht endlich jemand heraus, um zu berichten, wie es ihrer Mutter ging? Die Anspannung wuchs ins Unerträgliche. Sie versuchte, sich zu beruhigen. Sie hatte bestimmt keinen Herzinfarkt erlitten, sondern nur einen Schwächeanfall. Luise hatte wieder einmal zu viel gearbeitet und zu wenig geschlafen. Nichts Ernstes. Richtig krank war ihre Mutter noch nie gewesen. Sie bekam nicht einmal einen Schnupfen. Nur hin und wieder schmerzte ihre Hüfte, Folge eines lange zurückliegenden Reitunfalls.
Inzwischen waren fast drei Stunden vergangen, und Carlas Optimismus schwand. Wann hatte sie ihre Mutter zum letzten Mal in den Arm genommen? Und ihr gesagt, dass sie sie lieb hatte? Sie konnte sich nicht mehr daran erinnern, es war zu lange her. Warum wurde ihr das erst hier, auf dem Flur eines Krankenhauses bewusst?
Endlich erschien ein Arzt. Ruckartig sprang sie vom Stuhl auf.
»Wie geht es ihr?«, fragte sie aufgeregt.
»Den Umständen entsprechend gut«, antwortete der Arzt. »Es war kein Infarkt, aber eine gefährliche Herzrhythmusstörung. Sie muss ein paar Tage bei uns bleiben, damit wir sie beobachten und ein Langzeit-EKG machen können. Wir bringen sie jetzt auf die Station, in zehn Minuten können Sie zu ihr. Zimmer 311.« Dann verschwand er so plötzlich, wie er gekommen war.
Auf dem schneeweißen Kopfkissen des Krankenbettes wirkte das Gesicht ihrer Mutter so blass wie nie zuvor. Jegliche Farbe war aus ihren Wangen gewichen, die schmalen Lippen schimmerten bläulich, und ein grauer Schleier lag um die grünbraun gesprenkelten Augen.
Carla setzte sich an den Bettrand und fragte mit liebevollem Vorwurf in der Stimme: »Was machst du denn für Sachen? «
Luise lächelte müde. In ihrem rechten Arm steckte eine Kanüle, und neben ihrem Bett stand ein Gerät mit einem Monitor.
Carla spürte, wie die Finger ihrer Mutter nach ihrer Hand tasteten. Wie immer waren ihre Finger eiskalt, als flösse schon seit Langem kein Blut mehr hindurch.
»Ich muss ein paar Tage hierbleiben«, sagte sie.
»Ich weiß«, flüsterte Carla. »Ich werde dir von zu Hause holen, was du brauchst und gleich wieder zurück sein. Schlaf ein bisschen.« Sie gab ihrer Mutter einen Kuss auf die Stirn. Dann schlich sie aus dem Zimmer und zog sacht die Tür hinter sich zu.
Das Kopfsteinpflaster schluckte das trübe Licht der Straßenlaternen, sodass der Weg zum Haus ihrer Mutter kaum zu erkennen war. Für Carla war das kein Hindernis, sie war hier aufgewachsen und mit jedem Stein vertraut. Fast zwanzig Jahre lang hatte sie in dieser Siedlung gelebt, in der alle Häuser gleich aussahen und Sechzigerjahre-Charme versprühten.
Carla schloss die Haustür auf und schaltete das Licht ein. Auf der Ladentheke, neben der altmodischen Kasse, lag ein Stapel von Hosen, Röcken und Mänteln. Sie waren alle mit gelben Zetteln versehen, auf denen die Namen der Kunden standen. Dahinter hatte Luise ein dickes Häkchen gesetzt, was bedeutete, die Sachen waren zur Abholung bereit. Deshalb hängte Carla sie an die Kleiderstange neben der Theke — erst die Röcke, dann die Hosen, danach die Mäntel. So hätte es auch ihre Mutter getan. Unordnung duldete sie nicht. Der Laden und die Nähstube waren immer aufgeräumt, nirgendwo lagen Stoffreste oder Nähgarn herum. Auch jetzt nicht. Lediglich ein Rock hing in einer der beiden Nähmaschinen fest. Wahrscheinlich hatte Luise daran gearbeitet, bevor sie zusammengebrochen war. Zum Glück war kurz darauf eine Kundin gekommen und hatte den Notarzt alarmiert.
Carla löste den Rock aus der Maschine und legte ihn über die Stuhllehne. Danach ging sie über eine schmale Wendeltreppe hinauf in die Wohnung. Der Geruch von Pellkartoffeln lag in der Luft. Sie konnte sich nicht daran erinnern, dass es in diesem Haus je anders gerochen hatte.
Die Wohnung war klein und eng, zwei Zimmer sowie eine Küche und ein Bad ohne Fenster. Als Carla ein Teenager war, schlief ihre Mutter jahrelang im Wohnzimmer auf dem Sofa, damit sie – wie die anderen Mädchen auch – ein eigenes Zimmer hatte. Erst als sie mit neunzehn Jahren auszog, richtete Luise sich wieder ein Schlafzimmer ein. Carla sah sich darin um. Lindgrün gestrichene Wände, Möbel im Buchedesign von Ikea, und über dem Bett hing ein Bild von weidenden Pferden auf einer Koppel. Der Raum war so groß wie Jans begehbarer Kleiderschrank. Oft hatte sie ihre Mutter gebeten, zu ihnen in die Villa nach Marienburg zu ziehen. Doch Luise hatte jedes Mal abgelehnt. Sie wollte ihr Häuschen nicht aufgeben, und auch nicht die Schneiderei. Gut, dass sie so entschieden hat, dachte Carla deprimiert, so hat wenigstens einer von uns zukünftig noch ein Dach über dem Kopf. Sie zog die Schiebetür des Kleiderschrankes auf, holte Unterwäsche und Schlafanzüge heraus und fand dabei den schönen hellblauen Frotteebademantel, den sie ihrer Mutter letztes Jahr zum Geburtstag geschenkt hatte. Sicherlich war er Luise zu schade gewesen, um ihn tagtäglich zu benutzen. Kopfschüttelnd verstaute Carla die Sachen in der einzigen Reisetasche, die ihre Mutter besaß, und legte auch den Bademantel dazu. Sie erinnerte sich daran, dass sie als Kind die schönsten Kleider immer nur am Sonntag tragen durfte. Es gab Sonntagskleider, Sonntagshosen, Sonntagspullover und auch Sonntagsschuhe. Sie fand das furchtbar. Als sie im rebellischen Alter von vierzehn Jahren diese Sachen dann auch in der Woche anzog, kam es zum ersten großen Streit. Von da an stritt sie fast täglich mit ihrer Mutter, zuerst um Kleinigkeiten wie Kleidung und Frisur, bis die Auseinandersetzungen heftiger wurden, weil Carla wissen wollte, wer ihr Vater war. Sie wollte endlich etwas über den Mann erfahren, der sie gezeugt hatte und einfach fortgegangen war. Er hatte sich nie wieder blicken lassen und nicht ein einziges Mal nach ihr gefragt. Sie war wütend auf ihn, aber neugierig war sie auch. Was war er für ein Mensch? Wie sah er aus? War er ihr ähnlich? Was tat er? Sie suchte nach Antworten auf ihre Fragen. Doch von ihrer Mutter erfuhr sie nichts. Nicht einmal seinen Namen. Luise schwieg beharrlich. Carla ließ ihre Mutter nicht in Ruhe, konfrontierte sie häufig mit diesem Thema, durchsuchte die Wohnung nach Fotos und war am Ende nicht nur wütend auf ihren Vater, sondern auch auf ihre Mutter. Bis heute hatte sich daran nichts geändert. Den Namen ihres Vaters kannte Carla noch immer nicht. Die Wut auf ihre Mutter war geblieben.
Nachdem sie alles in der Tasche verstaut hatte, stellte sie diese an die Treppe und ging in die Küche. Im Krankenhaus hatte man sie gebeten, Luises Versicherungskarte mitzubringen, die – soweit sie sich erinnerte — in einer Schublade im Küchentisch aufbewahrt wurde. Doch die Karte lag dort nicht. Carla fand nur allerlei Papierkram, Bestellungen für Nähgarn und Stoffe, verschiedene Rechnungen, einen Kassenzettel. Die Versicherungskarte war nicht dabei. Auch im Portemonnaie ihrer Mutter suchte sie danach sowie in der schwarzen Mappe mit den Ausweispapieren und dem Führerschein. Ohne Erfolg. Wo sonst könnte die Karte sein? Sie ging ins Wohnzimmer hinüber und öffnete die linke Tür des altmodischen dunkelbraunen Wohnzimmerschranks. Wie vermutet, löste sich die Tür aus dem Scharnier. Deshalb hob Carla sie an, stellte sie auf dem Teppichboden ab und lehnte sie gegen die Wand. Vor zwei Jahren wollte Jan ihrer Mutter neue Möbel schenken, die sie sich selbst aussuchen sollte. Luise hatte dankend abgelehnt. Sie wollte keine Geschenke von Jan. Manchmal war sie einfach schrecklich stur.
Ratlos blickte Carla in das Innere des Schranks. Aktenordner reihten sich aneinander, alle sauber beschriftet und nach Rubriken geordnet. Bei Luise hatte alles seinen Platz. Nur Familienalben und Erinnerungsstücke gab es nicht, angeblich waren sie beim Umzug in das Reihenhäuschen verloren gegangen. Jemand musste sie versehentlich weggeworfen haben. Anders konnte sich Luise ihr Fehlen nicht erklären. Doch Carla glaubte ihr diese Ausreden schon lange nicht mehr. An dem Tag, an dem Carla das Licht der Welt erblickt hatte, schien ihre Mutter vom Himmel gefallen zu sein. Auf ein Leben vorher – eine Familie, eine Kindheit, die Schulzeit, die erste Liebe – fehlte jeder Hinweis. Es existierte kein Foto, kein Bild, kein Brief, kein Zeugnis, nicht einmal eine Lieblingspuppe. Und es gab keine Geschichten.
Nur zu gut erinnerte sich Carla an eine Hausaufgabe, die sie als Schülerin über die Sommerferien erledigen musste. Jeder sollte seine Ahnen erforschen und einen Aufsatz über die Großeltern oder vielleicht sogar die Urgroßeltern schreiben. Es ging darum, so viel wie möglich über deren Leben in Erfahrung zu bringen. Carla jedoch erfuhr nichts. Nach den Ferien behauptete sie der Lehrerin gegenüber, dass ihre Mutter eine Vollwaise sei, was nicht der Wahrheit entsprach. Luise hatte durchaus eine Familie. Das wusste Carla sehr genau, denn sie hatte die Ohren gespitzt, als Luise in einem seltenen Moment von ihrem Vater erzählt hatte, der gern Roulette spielte und zu viel trank, und von einer Kusine mit langen, blonden Haaren, die nach Paris entführt wurde. Aus heutiger Sicht fand Carla die Entführung nach Paris etwas komisch, aber so hatte Luise es damals wiedergegeben.
Carla hatte sich stets nach einer Familie gesehnt, einer richtigen Familie, wie ihre Freundin Karin sie hatte. Karins Vater arbeitete bei der Krankenkasse, Karins Mutter halbtags beim Friseur, und die Großeltern lebten auf dem Land. Manchmal war Carla am Wochenende mitgefahren, Karins Oma und Opa besuchen. Sie hatte diese Ausflüge geliebt. Nachmittags gab es Kaffee und Kuchen, und abends wurde im Garten gegrillt. Karins Großeltern hatten einen Wellensittich, der quietschvergnügt in einem Käfig in der Küche lebte, und ein Meerschweinchen in einem selbst gebauten, palastartigen Stall auf der Terrasse. Inständig hatte Carla sich auch so eine Familie gewünscht. Ihr Wunsch blieb unerfüllt, bis sie Jan kennenlernte. Heute wusste sie, dass sie sich nicht allein in ihn verliebt hatte, sondern auch in seine Familie, in das Haus seiner Eltern in Rodenkirchen am Rhein, in die Grillfeste, die Geburtstagsfeiern und den Sonntagnachmittagskaffee, in die selbst gestrickten Pullover seiner Mutter und die Geschichten seines Großvaters.
Während sie ihren Gedanken nachhing, durchsuchte sie weiter die Papiere im Schrank. Die Versicherungskarte fand sie nicht, dafür ein Schwarz-Weiß-Foto mit einem schwarzen Rassehengst. Sie drehte es um. Auf der Rückseite war nichts vermerkt, weder ein Name noch ein Ort oder ein Datum. Als sie es in den Schrank zurücklegte, fiel ihr Blick auf einen grauen Briefumschlag, der einen Stempel des Amtsgerichts Schleiden trug. Das war ein kleiner Ort in der Eifel. Wieso bekam ihre Mutter Post vom dortigen Amtsgericht? Sie nahm den Umschlag zur Hand und spürte etwas Hartes darin. Ihre Finger tasteten den Gegenstand ab. Es fühlte sich an wie ein Schlüssel. Schnell legte sie den Umschlag zurück. Sie hatte nicht das Recht, in den Sachen ihrer Mutter zu stöbern. Trotzdem zog der Brief sie magisch an. Sie haderte mit sich, bis die Neugier siegte und sie hineinschaute. Tatsächlich lag ein Schlüssel darin, außerdem ein amtliches Schreiben. Trotz des schlechten Gewissens zog sie es heraus, faltete es auseinander und überflog den kurzen Text: »… wird Luise Volkmann … als Alleinerbin eingesetzt … Herrenhaus Hoheneck …« Was hatte das zu bedeuten? Sie las den Text noch einmal, dieses Mal langsam und sorgfältig. Sie hielt einen Erbschein in der Hand, ausgestellt vom Nachlassgericht der Stadt Schleiden, der ihre Mutter als Alleinerbin einer gewissen Sophie von Waldheim auswies. Luise erbte eine Immobilie namens Herrenhaus Hoheneck sowie den dazugehörigen Landbesitz. Landbesitz? Erstaunt legte Carla die Stirn in Falten. Ihre Mutter hatte ein Haus mit Landbesitz geerbt und ihr nichts davon erzählt? Das war seltsam. Ausgesprochen seltsam sogar. Der Brief trug das gestrige Datum. Sollte diese Neuigkeit eine Überraschung werden? Diese Möglichkeit schloss sie kategorisch aus. In ihrer momentanen Situation wäre eine solche Erbschaft lebensrettend, davon hätte ihre Mutter ihr sofort berichtet. Wer war überhaupt diese Sophie von Waldheim? Den Namen hatte Carla noch nie zuvor gehört. Irritiert steckte sie das Schreiben zurück in den Umschlag und legte auch den Schlüssel wieder in den Schrank. Ein Haus zu erben wäre wie ein Lottogewinn. Sie atmete tief durch. Der Gedanke ließ sie fast euphorisch werden. Doch sie durfte sich nicht zu früh freuen. Sie musste erst erfahren, was es damit auf sich hatte. Ihr Blick fiel auf die Uhr. Es war spät geworden. Sie sollte jetzt schnell ins Krankenhaus fahren, auch ohne die Versicherungskarte, und danach wurde es höchste Zeit, Pauline abzuholen.
Als Carla bei der Familie Sanchez eintraf, war es fast zweiundzwanzig Uhr. Der Laden war längst geschlossen, hinter den Schaufenstern war es dunkel. Nur die Lichterketten leuchteten hell und erinnerten Carla unbarmherzig daran, dass bald Weihnachten war. In fünf Wochen war Heiligabend und auch ihr dreiunddreißigster Geburtstag. Doch vorher kam noch der zehnte Dezember. Dieses Datum lastete wie ein Felsbrocken auf ihrer Seele. Ihr Herz zog sich zusammen. Dieses intensive Erleben von Angst hatte sie früher nicht gekannt. Heute gehörte es zu ihrem Alltag. Sie hasste das Gefühl. Nicht an den zehnten Dezember denken, ermahnte sie sich.
Sie klingelte. Herr Sanchez öffnete ihr und ließ sie herein. Schon von unten hörte sie Mara und Pauline lachen. Sie war der Meinung gewesen, die beiden würden längst schlafen, doch sie hatte sich geirrt. Adelina hatte sie lediglich in Schlafanzüge stecken und auf dem Sofa positionieren können, wo sie alle zusammen Lauras Stern auf DVD anschauten. Pauline war todmüde, das sah Carla ihr sofort an, als sie das Wohnzimmer betrat.
»Hallo, mein Schatz.« Sie gab ihrer Tochter einen Kuss. Pauline trug Maras Mickymaus-Schlafanzug, ein echter Freundschaftsbeweis. Carla war froh, dass die beiden sich so gut verstanden und Pauline bei den Sanchez bleiben konnte, wenn sie damit beschäftigt war, ihr neues Leben zu organisieren.
Pauline und Mara gingen zusammen in den Kindergarten und sollten nächstes Jahr gemeinsam eingeschult werden. Schon jetzt redeten sie unaufhörlich von der Schule und davon, in dieselbe Klasse zu gehen und nebeneinander zu sitzen. Daraus würde nichts werden, denn für Carla war es vollkommen unmöglich, in Marienburg zu bleiben. Selbst ein kleines Apartment in diesem Stadtteil war für sie aller Voraussicht nach unerschwinglich.
Pauline schlang die Arme um Carlas Hals und kuschelte sich an sie. »Geht es der Oma wieder besser?«, wollte sie wissen. Liebevoll strich Carla ihrer Tochter über das halblange, strohblonde Haar.
»Viel besser«, antwortete sie. »Die Oma ist jetzt im Krankenhaus. Dort kümmern sich viele Menschen um sie.«
»Kann ich sie anrufen?«, fragte Pauline.
Carla schüttelte entschieden den Kopf. »Erst morgen früh wieder, jetzt muss sie schlafen.« Dann machte sie ein ernstes Gesicht. »Und ich kenne noch jemanden, der jetzt schnell schlafen muss.«
»Wir wollen noch Lauras Stern zu Ende gucken«, nörgelten Pauline und Mara gleichzeitig.
»Pauline kann gerne bei uns bleiben und bei Mara schlafen«, bot Adelina an. Doch dieser Vorschlag gefiel Carla gar nicht, und zum Glück schüttelte auch Pauline den Kopf.
»Ich gehe besser mit der Mama nach Hause«, sagte sie, während sie vom Sofa rutschte. »Die Mama hat nämlich Angst, wenn sie alleine ist.« Dann tippelte sie in ihren rosa Söckchen vom Wohnzimmer in den Flur, kroch in ihre Stiefel und zog sich den Anorak über den Schlafanzug. »Fertig!« Abmarschbereit stand sie an der Tür. Über eine knarrende Treppe gingen Carla, Pauline und Adelina hinunter in den Laden. Dort roch es nach Schinken und Oregano. Wie immer, wenn es draußen schon dunkel war, blieb Adelina so lange an der Ladentür stehen, bis Carla und Pauline die Straße überquert hatten und an der Villa angekommen waren. Diese befand sich schräg gegenüber auf der anderen Straßenseite.
Nachdem Carla die Haustür aufgeschlossen hatte, winkte sie Adelina noch einmal zu und schlüpfte mit Pauline schnell hinein. Sofort riegelte sie von innen ab und schaltete überall das Licht ein. Wenn Pauline behauptete, ihre Mutter habe Angst, lag sie damit nicht ganz falsch. Nur war es nicht die Angst vor einem Einbrecher, die Carla quälte, sondern vielmehr die vor der Zukunft. Und in der fast leeren Villa, wo sich seit Wochen die gepackten Umzugskartons stapelten, verstärkte sich dieses Gefühl ins Unerträgliche.
Carla bemühte sich sehr, Pauline das nicht merken zu lassen, trotzdem schien sie es zu spüren. Für ihre sechs Jahre war Pauline manchmal ziemlich erwachsen.
»Jetzt aber sofort ab ins Bett«, rief Carla, woraufhin Pauline sich die Stiefel auszog, den Anorak an die Kindergarderobe hängte und die geschwungene Marmortreppe hinaufstieg. Weißer Marmor aus Carrara. Auf so etwas hatte Jan größten Wert gelegt. Wahrer Luxus steckte seiner Meinung nach im Detail.
Pauline lag schon im Bett, als Carla in ihr Zimmer trat. Das Mädchen hatte seinen Teddy im Arm, ohne den es niemals einschlief. Allein aus diesem Grund wäre sie nicht über Nacht bei Mara geblieben. Pu, so hieß der Teddy, war ein beigefarbener Bär mit einem blau-weiß getupften Halstuch und einem fröhlichen Gesicht, der Pauline jede Nacht unter Einsatz seines Lebens vor Feuer speienden Drachen und bösen Hexen beschützte.
»Können wir die Oma morgen im Krankenhaus besuchen?«, fragte Pauline.
»Natürlich«, sagte Carla, während sie sich zu ihr an den Bettrand setzte. »Was hältst du davon, wenn du der Oma ein schönes Bild malst? Das verpacken wir dann mit einer großen Schleife und nehmen es ihr als Geschenk mit.«
»Das ist eine gute Idee«, murmelte Pauline. Ihr fielen bereits die Augen zu, und sie hatte den Kopf dicht an Pu geschmiegt. Carla gab ihr einen Kuss auf die Wange.
»Schlaf schön, mein Engel«, sagte sie leise und wollte gerade aufstehen, als Pauline die Augen wieder aufschlug.
»Wann schreiben wir eigentlich ans Christkind?«, wollte sie wissen.
Carla tat so, als würde sie angestrengt überlegen. Dann antwortete sie: »Damit haben wir noch zwei Wochen Zeit.« Und fragte spitz: »Hast du schon einen Wunsch?«
Pauline nickte. »Ja, aber den verrate ich dir nicht.«
»Schade.« Betont gleichgültig zuckte Carla mit den Schultern. »Sonst hätte ich das Christkind schon einmal darauf angesprochen, wenn ich es in den nächsten Tagen treffe.«
»Wo triffst du es denn?«, fragte Pauline erstaunt und brachte Carla damit in Bedrängnis. Zum Glück fiel ihr schnell eine Antwort ein: »Es fährt doch jedes Jahr an Köln vorbei, wenn es in Engelskirchen die Briefe und Wunschzettel der Kinder abholt, und da trifft man es manchmal. Aber versprechen kann ich das nicht.«
»Ach so«, sagte Pauline und drückte nachdenklich den Teddy an sich. Sie zögerte noch, ihren Wunsch zu verraten, doch die Aussicht, das Christkind schon einmal darauf vorzubereiten, schien verlockend. Deshalb sagte sie nach einer Weile: »Ich wünsche mir, dass der Papa zurückkommt. Meinst du, solche Wünsche erfüllt das Christkind auch?« Carla spürte einen dicken Kloß im Hals. »Ich weiß nicht«, flüsterte sie. »Aber wir werden das Christkind fragen.«
Sie konnte wieder einmal nicht schlafen. Sie lag allein in dem großen Bett, hatte sich die Decke bis unters Kinn gezogen und sah durch das Fenster hinaus in die Nacht. Am Himmel war kein Stern zu sehen. Selbst der Mond hatte sich verkrochen. Es war düster, und der Regen trommelte gegen die Fensterscheiben. Die Dunkelheit ließ den Gedanken viel Freiraum. Wie Nachtfalter schwirrten sie durch ihren Kopf. Um sie zu vertreiben, knipste Carla das Licht an und stand auf. Ihre Schläfen dröhnten vom vielen Grübeln, sie brauchte dringend ein Glas Wasser. Sie zog ihren Bademantel an und ging nach unten. Leer und trostlos wirkten die hohen Räume der herrschaftlichen Villa, denn die meisten Möbel waren schon abgeholt und im Wohnzimmer türmten sich die Kisten. Ihr Blick glitt an dem Stapel hinauf bis zur Decke, wo der Stuck leicht beschädigt war. Sie hatte deswegen einen Stuckateur bestellen wollen. Das war nun nicht mehr notwendig. Was sollte sie nur mit all den Kisten machen? Wohin damit? Die Dinge darin waren ein Teil ihres Lebens, sie konnte das alles nicht einfach wegwerfen. Aus einer offenen Kiste zog sie ein Fotoalbum heraus. Saint-Tropez – der erste Urlaub mit Jan. Sie blätterte langsam die Seiten um. Auf den Fotos war der Himmel so blau wie das Wasser im Pool. Jan hatte sie oft nackt fotografiert oder in einem knappen schwarzen Bikini. Sie sah damals wirklich sehr sexy aus. Sie war ein klein wenig schlanker gewesen, nicht viel, nur ein bisschen. Und ihre Haare waren länger. Sie reichten ihr fast bis zum Po und schimmerten goldblond. Dieser Urlaub lag zehn Jahre zurück, keine einzige Stunde davon hatte sie vergessen. Von den Eltern eines Freundes hatte Jan eine abgeschiedene Villa gemietet. Tagelang hatten sie in dem riesigen Garten unter Schatten spendenden Bäumen gelegen, miteinander geredet, sich geliebt und von der Zukunft geträumt. Dieses Landhaus war die perfekte Kulisse für ein frisch verliebtes Pärchen gewesen. Es gab eine Terrasse umrankt von Kletterrosen, einen Pool, auf dem die Magnolienblüten schwammen wie Seerosen auf einem Teich, und in den lauen Nächten hörten sie das Zirpen der Grillen. In Jans Armen war sie eingeschlafen und wieder aufgewacht – vier Wochen wie im Paradies. Obwohl Jan damals schon sein wahres Gesicht zeigte, sie hatte es nur nicht wahrgenommen. Ohne mit der Wimper zu zucken, verspielte er im Casino von Monte Carlo ihre Urlaubskasse und trat dabei so wichtigtuerisch auf, als sei er der Scheich von Brunei. Allen Leuten erzählte er von seiner Jacht, die angeblich im Hafen von Saint-Tropez lag, und von der Villa, die er gerade gekauft hatte. Nachdem er vollkommen pleite war, borgte er sich von seinem Nachbarn am Roulettetisch, Herrn Lückdorf-Malbach, einen stolzen Betrag und spielte damit eiskalt weiter. Zum Glück gewann er an diesem Abend und konnte das geborgte Geld zurückzahlen. Der Clou aber war, dass er Herrn Lückdorf-Malbach nebst Gattin in die Villa zum Essen einlud und diese für einen Abend lang kurzerhand in seine eigene verwandelte. Dazu wechselte er das Namensschild an der Eingangstür aus und stellte überall Fotos von Carla sowie von Kindern auf, die er am Strand fotografiert hatte und die er nun als seine Neffen und Nichten ausgab. Für das Essen engagierte er den Koch und den Kellner einer nahe gelegenen Brasserie, die an diesem Tag geschlossen hatte.
Als Jan wenig später seinen Job bei der Bank aufgab, um sich selbstständig zu machen, gehörte Lückdorf-Malbach zu seinen ersten Kunden und verschaffte ihm den Zugang zur feinen Gesellschaft. Du musst das Glück herausfordern, hatte Jan immer gesagt, es reagiert nur, wenn du es kitzelst. Wie verliebt war sie bloß gewesen, um nicht zu begreifen, dass sie diesen Mann nicht heiraten durfte?
Sie legte das Album zurück. Alle Erinnerungen an Jan endeten stets mit der Frage nach dem Warum. Warum hatte sie nicht ihre Augen aufgemacht? Warum nicht besser hingeschaut? Die Antwort war einfach. Sie wollte nicht hinschauen. Sie wollte dieses Leben mit ihm. Es versprach die Verwirklichung ihrer Träume. Wie einfältig und dumm! Doch nicht nur sie selbst war so naiv gewesen, auch seine Eltern hatten ihn nicht durchschaut und waren am Ende nicht weniger entsetzt.
Sie ging in die Küche, nahm ein Glas aus dem Schrank, drehte den Wasserhahn auf und ließ das kühle Nass durch ihre Kehle laufen. Ihr Mund war wie ausgetrocknet. Sie dachte daran, sich einen Tee zu kochen. Das tat sie oft, wenn sie nicht schlafen konnte, wenn Erinnerungen und Selbstvorwürfe ihr fast den Verstand raubten. Doch heute musste sie zurück ins Bett, morgen früh hatte sie einen wichtigen Termin. Ein Vorstellungsgespräch bei einem großen Versicherungsunternehmen, das sie auf keinen Fall verderben durfte, weil sie müde und unausgeschlafen war. Unzählige Bewerbungen hatte sie in den letzten Monaten verschickt und nur Absagen erhalten. Deshalb musste sie nun, da jemand an ihr Interesse zeigte, alles geben, um den Job zu bekommen. Ihre Zukunft abzusichern hatte im Augenblick oberste Priorität. Das war sie ihrer Tochter schuldig. Also ging sie zurück ins Bett und schaltete das Licht aus. Sie lag noch lange wach. Doch kaum war es dunkel, schwirrten ihre Gedanken wieder wie Nachtfalter umher.
Ein letzter Blick in den Rückspiegel ihres Autos bewies ihr, dass sie gut aussah. Sie zupfte eine Strähne aus den hochgesteckten Haaren, um nicht so streng zu wirken, und überprüfte ihr Gesicht. Das dezente Make-up ließ ihre Haut seidig schimmern, der zarte Lidschatten unterstrich das Himmelblau ihrer Augen, auf den Wangen trug sie etwas Rouge und auf den Lippen Gloss – gerade so viel von allem, dass die Spuren der schlaflosen Nacht unerkannt blieben. Sie fand, dass sie frisch und erholt wirkte, obwohl sie todmüde war, und übte noch einmal, sympathisch zu lächeln. Niemand sollte ihre Anspannung bemerken. Sie war nervös. Doch sie musste ruhig und konzentriert bleiben. Schließlich ging es für sie nicht um irgendeinen Job, es ging ums Überleben. Sie sprach sich Mut zu. Sie würde es schaffen. Sie musste sich nur selbst vertrauen. In dem grau-weiß gestreiften Hosenanzug sah sie aus wie eine Businessfrau, hatte weder ihr Englisch noch das Spanisch verlernt, und ihre Computerkenntnisse waren auf dem neusten Stand.
Sie stieg aus und lief durch die Parkgarage zu den Fahrstühlen. Die Büros der Firma Meteco Industries, einem der größten Industrieversicherer weltweit mit Hauptsitz in Amsterdam, lagen im achten Stock eines modernen Glaspalastes am Rheinufer in Köln. Als sie per Knopfdruck den Fahrstuhl rief, wurden plötzlich ihre Hände feucht, und während der geräuschlosen Fahrt nach oben begann ihr Herz zu klopfen. Dann ertönte ein leiser Gong, und die Türen öffneten sich. Ein lichtdurchfluteter Raum empfing sie. Riesige Fenster reichten vom Boden bis zur Decke, und der Ausblick auf den Rhein war fantastisch. Doch Carla konnte ihn jetzt nicht genießen. Sie ging geradewegs auf die Rezeption zu, hinter der eine junge Dame im dunkelblauen Kostüm saß.
Carla war so aufgeregt, dass sie glaubte, kein Wort herauszubekommen. Als sie mit zittriger Stimme ihren Namen genannt hatte, bat die Empfangsdame sie, auf einem schwarzen Ledersofa unter einem großen Hundertwasser-Bild Platz zu nehmen. Sie war zu früh gekommen und musste warten. Die Frau bot ihr einen Kaffee an. Carla lehnte dankend ab. Ihr war sowieso schon viel zu warm. Es war heiß hier. Furchtbar heiß. Neben dem Sofa stand ein hochgewachsener Kaktus. Sie konnte verstehen, dass eine Wüstenpflanze sich hier wohlfühlte. Die Temperaturen in dieser Büroetage entsprachen durchaus seinem Herkunftsgebiet.
»Frau Sandberg?«, hörte sie eine weibliche Stimme plötzlich sagen und sah in das lächelnde Gesicht der jungen Frau, die eben noch hinter der Rezeption gesessen hatte. »Herr van der Veelt hätte jetzt Zeit für Sie.«
»Schön«, erwiderte Carla und folgte ihr in einen Besprechungsraum. Dort setzte sie sich an einen runden Glastisch und wartete auf ihren Gesprächspartner. Die Ausstattung des Raumes war edel und teuer, die Möbel allesamt Designerstücke und das Firmenlogo in den beigefarbenen Teppich eingewebt. Auch hier sah man durch eine breite Fensterfront auf den Rhein und das andere Ufer. Genauso war es auch in Jans Büro gewesen. Sie sollte jetzt nicht an Jan denken.
Als van der Veelt erschien, stand Carla auf und gab ihm die Hand. Mit seinen dunklen, nach hinten gekämmten Haaren sah er aus wie ein Italiener, dem Akzent und dem Namen nach war er eindeutig Holländer. Sie schätzte ihn Mitte vierzig. Er trug eine schmale Brille mit silberner Umrandung, einen dunklen Anzug mit Weste und eine Armbanduhr von Cartier. Cartier von Rolex zu unterscheiden hatte Carla in den letzten Jahren gelernt; nur bezweifelte sie stark, dass ihr das in Zukunft weiterhalf.
Van der Veelt blätterte in ihren Bewerbungsunterlagen und stellte ein paar Fragen zu ihrem Werdegang, unter anderem auch die, mit der Carla gerechnet und deren Antwort sie auswendig gelernt hatte. Die letzten Jahre hatten der Erziehung ihrer Tochter gehört, erklärte sie und betonte, dass sie nun unbedingt in den Beruf zurückkehren wolle. Sie war immer noch aufgeregt und fand ihre Stimme flatterig. Doch im Verlauf des Gespräches wurde sie ruhiger. Van der Veelt erwies sich als sympathisch, und Carla bekam ein gutes Gefühl. Als er sich erkundigte, ob sie bereits am ersten Dezember anfangen konnte und dies auf ihrer Bewerbermappe notierte, machte ihr Herz einen Sprung. Bekam sie eine Chance? Sie begann, Hoffnung zu schöpfen.
» Allerdings habe ich noch eine letzte Frage«, sagte van der Veelt plötzlich. Er lächelte flüchtig und fügte mit einer entschuldigenden Geste hinzu: »Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass ich Sie das frage, Frau Sandberg … Aber haben Sie etwas mit Jan Sandberg zu tun?«
Überrascht sah Carla ihn an.
»Wahrscheinlich nicht«, ergänzte er, »doch der Name Sandberg kommt nicht allzu oft vor, und es ging ja monatelang durch die Presse …«
»Er ist mein Ehemann«, gab Carla tonlos zurück.
Van der Veelt hüstelte in seine vorgehaltene Hand. »Ach so, das konnte ich natürlich nicht wissen. Das geht aus Ihren Bewerbungsunterlagen nicht hervor.«
»Müsste es denn daraus hervorgehen?«, fragte Carla provozierend und deprimiert zugleich. Ihr war klar, dass sie den Job nun nicht mehr bekommen würde.
»Nun ja.« Er räusperte sich verhalten. »Als großer Industrieversicherer leben wir in erster Linie von unserer Seriosität und der unserer Mitarbeiter. Sie werden also verstehen, Frau Sandberg, dass ich Sie unter diesen Umständen …«
»Nein, das verstehe ich nicht«, sagte Carla, während sie sich erhob. Sie konnte gehen. Es war alles verloren. Sie zog ihm die Bewerbermappe aus der Hand und verließ wortlos den Besprechungsraum. Hoffnung ist die letzte Weisheit der Narren – auch das hatte Jan immer gesagt.
Weinend fuhr sie nach Hause und warf sich aufs Bett. Sie hasste Jan. Sie hasste ihn so sehr! Wenn sie an ihn dachte, empfand sie nichts anderes als Abscheu, Verbitterung und Wut. Wie konnte er ihr das nur antun? Zehn Jahre lang hatte sie ihn geliebt, und er hatte sie nur benutzt. Alles hatte er auf lange Sicht geplant, davon war Carla inzwischen überzeugt. Die kleine Familie bot den idealen Rahmen, um solide und seriös zu erscheinen. Wem, wenn nicht ihm, vertraute man gern sein Geld an? Er war der gute Geschäftsmann, der treu sorgende Ehemann, der fürsorgliche Vater, der selbst aus einer bodenständigen Familie kam. Er gab den Menschen, was sie haben wollten – eine Fassade, die ihnen gefiel. Im Gegenzug dafür gaben sie ihm ihr Geld. Und er wusste, wie man es vermehrte, wie man mit Banken verhandelte und Traumrenditen erreichte. Somit wurde der Finanzdienstleister Jan Sandberg schnell zum Geheimtipp für Leute, die zu viel hatten und noch mehr wollten. Er lockte sie mit kleinen Zuckerstückchen und zahlte ihnen Gewinne aus, die ihnen schier den Atem raubten. Daraufhin gaben sie ihm Summen, die selbst ihn ganz schwindelig werden ließen. Und nun machte er sich mit diesem Geld irgendwo auf der Welt ein schönes Leben, während Carla und Pauline am Abgrund standen.
Niemals würde Carla den zwölften Februar dieses Jahres vergessen. Es war der schwärzeste Tag ihres Lebens. Morgens um acht – sie wollte gerade Pauline in den Kindergarten bringen – stand plötzlich die Polizei vor der Tür. Ein Kommissar hielt ihr einen Durchsuchungsbefehl vor und erklärte, dass Jan sich abgesetzt und die Millionen seiner Kunden gleich mitgenommen hatte. Carla wollte das nicht glauben, denn Jan war auf einer Geschäftsreise in Barcelona. Noch am Vorabend hatte sie mit ihm telefoniert. Am Nachmittag sollte er zurück sein. Der zwölfte Februar war der Geburtstag seiner Mutter. Das machte alles noch viel schlimmer. Carla rief ihn an, er ging nicht an sein Handy. Auch die Mailbox sprang nicht an. Sie probierte es im Zehn-Minuten-Rhythmus, ließ das Telefon klingeln und klingeln, so lange, bis das monotone, sich ständig wiederholende Freizeichen ihren Kopf zu sprengen drohte. Irgendwann gab sie auf. Der Polizei aber glaubte sie immer noch nicht. Erst Tage später, als das Beweismaterial erdrückend wurde, akzeptierte sie schließlich, dass ihr Ehemann ein Betrüger war. Und nach dem ersten Gespräch mit der Bank erkannte sie, dass er nicht nur fremde Menschen, sondern auch sie selbst betrogen hatte. Rücksichtslos hatte er sie den Kreditvertrag für die Villa mitunterzeichnen lassen, obwohl er wahrscheinlich schon damals vorgehabt hatte, sich eines Tages abzusetzen. Sie hatte das alles nicht durchschaut. Sie war wie eine Marionette gewesen, an der er nur die Fäden zu ziehen brauchte.
Nachdem er weg war, blieb ihr kein Cent mehr. Die Konten wurden gesperrt, die Kreditkarten ebenso. Der Porschehändler bekam das Cabrio zurück, die Villa wurde zwangsversteigert. Dreihundertfünfzigtausend Euro Schulden blieben übrig, und solange Jan nicht auffindbar war, wandte die Bank sich mit dieser Forderung an sie. Außerdem rückte der Tag, an dem Carla und Pauline die Villa verlassen mussten, näher. Am zehnten Dezember. Eine neue Wohnung konnte sie nicht suchen, denn ohne regelmäßiges Einkommen konnte sie keinen Mietvertrag unterschreiben. In den letzten Monaten hatten sie und Pauline von dem wenigen gelebt, was sie bei den Sanchez’ verdiente.
Sie musste irgendwie an Geld kommen. Sie hatte oft darüber nachgedacht, ihr Pferd zu verkaufen. Es war das Letzte, was ihr an Wert noch geblieben war. Bei dem Gedanken, Nachtfalke wegzugeben, wurde ihr übel. Doch Sentimentalitäten konnte sie sich nicht leisten. Sie setzte sich aufs Bett, trocknete die Tränen und starrte aus dem Fenster. Der Tag war trübe und grau. Genau so war es auch am zwölften Februar gewesen. Seitdem waren alle Tage grau.
Kaum hatte Carla die Tür zum Krankenzimmer ihrer Mutter geöffnet, da riss Pauline sich los und stürmte auf ihre Oma zu. Luise saß in ihrem hellblau-weiß geblümten Frotteebademantel auf dem Bett, hatte zwei Kopfkissen im Rücken und breitete die Arme aus, um Pauline aufzufangen. Pauline gab ihrer Oma einen dicken Kuss und hielt ihr das Geschenk unter die Nase. Carla hatte es in glänzendes Papier eingewickelt und mit einer kunstvollen rosa Schleife versehen. Rosa war Paulines Lieblingsfarbe.
»Das habe ich dir gemalt«, rief Pauline stolz, während Luise gespannt das Päckchen öffnete. Ein Bild kam zum Vorschein, auf dem ein braun-weiß geschecktes Pony zu sehen war, umgeben von unzähligen Sternen, die einen eindeutigen Hinweis auf den Namen des Ponys lieferten. Es hieß Sterntaler und stand im Gestüt Eichhoff. Jan hatte es seiner Tochter zum Geburtstag schenken wollen, doch an dem Tag war er längst über alle Berge gewesen.
»Das ist aber ein schönes Bild«, lobte Luise und fragte: »Hast du Sterntaler mal wieder besucht?«
»Na klar.« Pauline nickte heftig mit dem Kopf.
Unterdessen stellte Carla den roten Weihnachtsstern, den sie mitgebracht hatte, auf das Nachtschränkchen und legte eine Packung Spekulatiusplätzchen daneben, die ihre Mutter so gern mochte. Dann gab sie ihr einen flüchtigen Kuss auf die Stirn und setzte sich aufs Bett, direkt neben das Gerät mit dem Monitor, an das ihre Mutter angeschlossen war. Eine feine Nadel zeichnete ein Diagramm auf, eine Linie, die in leichtem Zickzack verlief, langsam anstieg und senkrecht wieder abfiel.
»Das arme Kind vermisst seinen Vater«, sagte Luise leise, während sie einen kurzen Blick auf Pauline warf, um sicherzugehen, dass sie nicht zuhörte. Doch Pauline war damit beschäftigt, auf dem leeren Nachbarbett ihren Rucksack auszuschütten, um der Oma ihre neuste Errungenschaft, eine Pelzstola für die Barbie, zu zeigen. Sie hatte sie mit Mara gegen ein Abendkleid getauscht.
»Ich weiß, dass sie ihren Vater vermisst«, erwiderte Carla leicht genervt. Sie quälte sich schon genug mit Schuldgefühlen und Selbstvorwürfen, da musste ihre Mutter den Finger nicht auch noch in die offene Wunde legen.
»Ist ja schon gut«, wehrte Luise ab. »Es tut mir eben leid, dass das Kind so etwas durchmachen muss.«
Bevor Carla darauf etwas entgegnen konnte, kam Pauline mit ihrer Barbie zurück. Luise bewunderte die neue Stola, ein extrem teures Stück. So etwas gab es nur in Paris zu kaufen.
Nachdem Pauline sich wieder verzogen hatte, fragte Luise: »Wieso kommt ihr so spät?«
»Wir waren noch auf dem Friedhof, am Grab von Opa Aribert«, erklärte Carla und fügte betrübt hinzu: »Heute ist sein Todestag. Vor genau acht Monaten ist er gestorben.«
»Wenigstens hat er nicht mehr mitbekommen, was sein geliebter Enkel dir und der Familie angetan hat«, meinte Luise.
»Ja«, sagte Carla. »Das hätte ihn wirklich sehr getroffen.«
»Hast du eigentlich mal wieder eine Nachricht von Jans Eltern erhalten?«, fragte Luise.
»Sie haben mir neulich eine E-Mail geschickt«, erzählte Carla. »Das Haus in Rodenkirchen ist verkauft. Dafür haben sie sich ein kleines Häuschen in Neuseeland zugelegt. Ich glaube nicht, dass sie je zurückkommen werden. Seine Mutter schämt sich so sehr, dass das alles passiert ist.«
Mit verschränkten Armen stellte Carla sich vor das Fenster und blickte hinaus. Welke Blätter wirbelten durch die Luft. Der Herbstwind hatte sie den Bäumen entrissen. Auch sie selbst fühlte sich oft wie ein Blatt im Wind. Für ein paar Jahre war ihre Welt in Ordnung gewesen. Nun war alles zerbrochen, der Wunsch nach einer Familie wie eine Seifenblase zerplatzt. Nur das eiserne Schweigen ihrer Mutter war geblieben. Gern hätte Carla etwas über ihren Großvater erfahren, der Roulette spielte, über die Kusine, die nach Paris entführt wurde. Und über ihren Vater. Vor allem von ihm wollte sie mehr wissen. Wie sah er aus? War er groß oder klein, dunkelhaarig oder blond? Als Kind hatte sie sich vorgestellt, er sei Matrose, dann war er ein Mafioso, später ein Abenteurer, ein Schauspieler, ein Rennfahrer. Der Wunsch, ihn kennenzulernen, war seit Langem zur fixen Idee geworden, doch bisher war sie stets an Luise gescheitert. Die unsichtbare Mauer zwischen ihnen wuchs immer höher, und Carlas Wut wurde immer heftiger. Seufzend setzte sie sich zurück aufs Bett. Das Krankenzimmer war nicht der richtige Ort, die alten Auseinandersetzungen auszutragen. Deshalb wechselte sie das Thema.
»Ich habe beschlossen, Nachtfalke zu verkaufen«, sagte sie.
»Das habe ich befürchtet«, erwiderte Luise bekümmert. Wenn sie traurig war, wirkten die braunen Sprenkel in ihren grünen Augen wie Tränen. Carla wusste, wie schwer es Luise fiel, sich von dem prachtvollen Pferd zu trennen. Sie selbst hatte den schwarzen Hengst mit dem hervorragenden Stammbaum ausgesucht, als Jan damals Carla ein Pferd kaufen wollte. In ihrer Jugend war auch sie eine leidenschaftliche Reiterin gewesen, so wie Carla heute. Dann, mit einundzwanzig, hatte sie einen schweren Reitunfall gehabt. Danach war sie nur noch sehr selten geritten, doch die Liebe zu den Pferden war geblieben. Luise kümmerte sich um Nachtfalke, wenn Carla keine Zeit hatte, und brachte Pauline das Reiten bei. Sie hatte ihre Enkelin auf ein Pferd gesetzt, bevor diese richtig laufen konnte.
»Gibt es schon einen Interessenten?«, wollte sie wissen.
»Bis jetzt noch nicht«, sagte Carla. »Ich habe Herrn Eichhoff gebeten, sich darum zu kümmern.«
»Welchen Preis willst du verlangen?«
»Einhunderttausend Euro.« Carla sah das Zucken in Luises Gesicht.
Ihre Mutter war skeptisch. »Das ist sehr viel Geld in Zeiten, in denen alle von Krise reden. Heutzutage gibt es wahrscheinlich nicht viele Leute, die sich so ein teures Pferd leisten können.«
»Leute mit Geld gibt es immer«, meinte Carla. »Ich bin nur froh, dass Dr. Beltheim uns im Februar empfohlen hat, das Pferd sofort auf dich zu überschreiben.«
»Sonst würde es jetzt der Bank gehören«, ergänzte Luise. Damit hatte sie recht, denn alles, was Carla besaß, war Eigentum der Bank. Selbst wenn es ihr gelingen sollte, Nachtfalke gut zu verkaufen, hatte ihr Anwalt, Dr. Beltheim, zur Vorsicht gemahnt. Die Banken waren wie Hyänen, die sich auf jedes noch so kleine Stück Aas stürzten. Sofort würden sie mit detaillierten Nachforschungen beginnen und herausfinden, dass Nachtfalke am zwölften Februar nicht Luise, sondern ihr gehört hatte und dann Anspruch auf den Verkaufserlös erheben.
Trotzdem hatte Carla beschlossen, es zu versuchen, denn bei den Sanchez verdiente sie nur vierhundert Euro im Monat. Sie hatte diesen Job angenommen, als Pauline in den Kindergarten gekommen war. So konnte sie vormittags etwas arbeiten und verlernte ihr Spanisch nicht. Außerdem verstand sie sich gut mit Adelina, und Mara und Pauline wurden schnell Freundinnen.
»Wie war eigentlich dein Bewerbungsgespräch?«, erkundigte sich Luise. »Hattest du Erfolg? Hast du Aussicht auf den Job?«
»Nein.« Deprimiert schüttelte Carla den Kopf.
»Was willst du nun tun?«, fragte Luise besorgt. »Wohin willst du gehen, wenn du aus der Villa ausziehen musst?«
»Ich weiß es nicht.«
»Bei mir ist für dich und Pauline immer Platz.«
Carla wirkte verärgert. Schon wieder dieses leidige Thema. »Wie stellst du dir das vor, Mama? Bei dir ist es schon für dich allein zu eng. Wo sollen Pauline und ich denn schlafen? Und wohin mit all unseren Sachen?«
»Da findet sich schon eine Lösung«, entgegnete Luise. »Aber was willst du machen, wenn du bis zum zehnten Dezember keinen Job gefunden hast?«