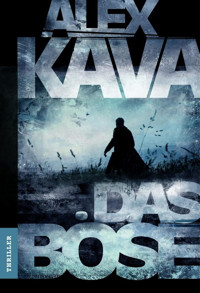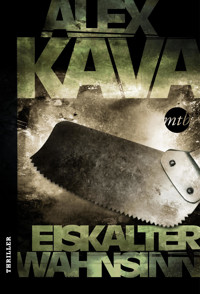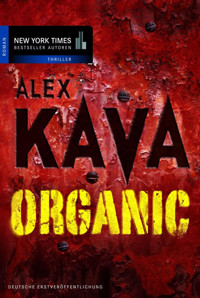9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diana Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Kava, Alex
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
In Chicago springt ein Mann aus dem dreizehnten Stock eines Hotels. Kurz darauf werden Hunderte von toten Schneegänsen auf einem See in der Nähe des Missouri entdeckt. Als Ryder Creed mit seinem Spürhund schließlich die Leiche einer jungen Frau findet, ahnt er noch nicht den unheilvollen Zusammenhang zwischen diesen Fällen. Mit FBI-Profilerin Maggie O’Dell an seiner Seite gerät er der Wahrheit auf die Spur und mitten hinein in die Jagd nach einem der kaltblütigsten Killer der USA.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 332
Ähnliche
Das Buch
»Braunes Gras mit ersten Sprenkeln von Frühlingsgrün umgab den See. Der leuchtend blaue Himmel nahm zum Horizont hin einen tiefen Violett-Ton an, als die Sonne hinter die Bäume zu sinken begann. Je näher der SUV dem See kam, desto stärker wurde der Eindruck, die Wasseroberfläche sei von dickem Schnee bedeckt.
Die Vögel trieben so dicht beieinander, und es waren so viele, dass nirgends mehr Wasser zu sehen war. Einige lagen sogar übereinander.
Es war niemand dort. Kein Verkehr, und über Meilen gab es keine Häuser oder sonstigen Gebäude. Nicht einmal andere Vögel waren in den Bäumen auszumachen. Das einzige Geräusch war das leise Säuseln des Windes im hohen Gras.«
Was haben eine Reihe von mysteriösen Suiziden und ein unerklärliches Vogelsterben miteinander zu tun? Hundeführer Ryder Creed und FBI-Profilerin Maggie O’Dell ermitteln in einem rasanten Fall, der für die gesamte amerikanische Bevölkerung zur tödlichen Bedrohung wird.
Die Autorin
Alex Kava ist seit ihrem Debütroman Das Böse mit ihren Thrillern regelmäßig auf den internationalen Bestsellerlisten vertreten. Sturzflug ist der dritte Teil von Alex Kavas Serie um den charmanten Hundeführer Ryder Creed, der FBI-Profilerin Maggie O’Dell zur Seite steht.
ALEX
KAVA
THRILLER
Aus dem Amerikanischen
von Sabine Schilasky
1
Chicago
Tony Briggs spuckte Blut, dann wischte er sich den Mund mit dem Ärmel seines Hemdes ab. Das war übel. Auch wenn er damit klarkam. Er hatte schon Schlimmeres durchgemacht. Viel Schlimmeres. Obwohl sie ihm nicht gesagt hatten, dass er so krank werden würde. Und allmählich kam ihm der Verdacht, dass die Schweine ihn gelinkt hatten.
Er tippte »Schöne Scheiße, in die ich mich geritten habe« in sein Handy und schickte die Nachricht ab, ehe er es sich anders überlegen konnte.
Textnachrichten entsprachen nicht seinen Anweisungen. Sie gehörten nicht zum Deal, doch das war ihm egal. Dann sollten es die Beobachter doch mitkriegen. Was konnten sie ihm jetzt noch antun? Er fühlte sich bereits beschissen. Viel schlimmer konnten sie es wohl kaum machen.
Er warf das Telefon zusammen mit einigen Broschüren, die er tagsüber eingesammelt hatte, in den Papierkorb. Sein Reiseplan erschien ihm wie ein Familienausflug zu Sehenswürdigkeiten. Oder in seinem Fall, das Geschenk eines Wohlfahrtsverbandes – eine letzte Rundreise, alle Kosten inklusive.
Er lachte darüber, was in einem erneuten Hustenkrampf endete. Blut spritzte auf den Flachbildfernseher und auch auf die Wand dahinter. Er verabscheute, dem Reinigungspersonal des Hotels solch ein Schlamassel zu hinterlassen. Nur war es dafür ein bisschen zu spät. Vor allem da seine Anweisungen lauteten, im Laufe des Tages so viel wie möglich hier zu berühren. In seinem Kopf leierte er die Liste herunter: Lichtschalter, Aufzugsknöpfe, Speisekarten, Fernbedienungen und Rolltreppengeländer.
Am Vormittag bei McDonald’s – vor dem Husten und kurz bevor das Fieber in die Höhe schoss, als er noch ein bisschen wagemutiger gewesen war und Appetit gehabt hatte – war ihm erstmals eine finstere Ahnung gekommen. Er hatte sein Tablett aufgenommen und war vor dem Stand mit Ketchup, Senf, Mayo und Gewürzen stehen geblieben.
So viele Oberflächen wie möglich.
Das hatten sie ihm gesagt. Auf glatten, festen Oberflächen überlebten Keime bis zu achtzehn Stunden. Und er mochte vieles in seinem Leben vermasselt haben, doch Anweisungen konnte er immer noch befolgen.
Das dachte er, als er eine Berührung an seinem Ellbogen fühlte.
»Hey Mister, können Sie mir bitte zwei Strohhalme geben?«
Der Junge war sechs, vielleicht sieben Jahre alt. Er trug eine Nerd-Brille; das dicke schwarze Gestell war viel zu groß für sein Gesicht. Automatisch schob er sie immer wieder auf seinem Nasenrücken nach oben. Der Junge hatte Tony sofort an Jason erinnert, seinen besten Freund. Sie hatten sich mit sechs kennengelernt und waren zusammen aufgewachsen. Dieselben Schulen. Dasselbe Football-Team, gemeinsam zur Army. Sie kamen sogar zusammen aus Afghanistan zurück, jeder auf seine Weise geschädigt. Tony war der Sportler, Jason der Kopf. Schon mit sechs war er schlau und hartnäckig gewesen. Trotzdem trottete er immer hinter Tony her.
Olle Brillenschlange.
»Und was jetzt?«, war Jasons Lieblingssatz.
In der Grundschule gab es eine Phase, in der Jason alles nachmachte, was Tony tat. In der Highschool war er hinreichend kräftig geworden, dass er mit Tony ins Football-Team gewählt wurde. Tony vermutete stets, dass Jason nur zur Army gegangen war, um an Tonys Seite zu sein. Und wo hatte es sie hingeführt?
Tony verdrängte seine Schuldgefühle. Und plötzlich überkam ihn der Wunsch, dass Jason nie herausfinden würde, was für ein Feigling er in Wirklichkeit war.
»Mister?« Der Junge wartete mit ausgestreckter Hand.
Unwillkürlich wollte Tony nach den verfluchten Strohhalmen greifen, hielt jedoch inne.
»Nimm sie dir doch selbst«, sagte er zu dem Kind. »Du bist doch nicht behindert.«
Dann drehte er sich weg, ohne sich selbst einen Strohhalm oder eine Serviette zu nehmen. Er hatte rein gar nichts an dem ganzen bescheuerten Tresen berührt. Vielmehr nahm er sein Tablett und ging raus, wobei er die Tür mit der Schulter aufschob, sodass er sie genauso wenig anfassen musste. Das Tablett mit dem Essen warf er in den nächsten Mülleimer. Der Junge hatte ihn derart verwirrt, dass es fast eine Stunde dauerte, bis er weitermachen konnte.
Nun, zurück in seinem Hotelzimmer, rann ihm Schweiß übers Gesicht. Er wischte sich die Stirn mit demselben Ärmel, den er für seinen Mund benutzt hatte.
Mit dem Fieber hatte er gerechnet. Die verschwommene Sicht kam unerwartet.
Nein, das war mehr als verschwommenes Sehen. Seit ungefähr einer Stunde hatte er Halluzinationen. Zuerst glaubte er, seinen alten Militärausbilder in der Eingangshalle des John-Hancock-Building zu sehen. Aber auf der Sternwarte war ihm zu schlecht gewesen, um es zu überprüfen. Dennoch dachte er daran, jeden einzelnen Knopf zu berühren, als er in den Fahrstuhl stieg. Mit zunehmender Übelkeit und weichen Knien.
Und er schämte sich.
Sein Verstand mochte dank dem, was die Ärzte eine traumatische Hirnschädigung nannten, nicht mehr der alte sein, doch Tony war stolz darauf, seinen Körper schlank und stark gehalten zu haben, wo doch so viele seiner Kameraden ohne das eine oder andere Körperteil zurückgekehrt waren. Jetzt setzte die Muskelermüdung ein, und es wurde richtig anstrengend zu atmen.
In dem Moment hörte Tony ein Klicken im Hotelzimmer. Es kam von irgendwo hinter ihm. Es klang wie die Tür.
Am Zimmereingang befand sich eine kleine Nische mit der Minibar und dem Wasserkocher. Deshalb konnte Tony die Tür nicht sehen, ohne das Zimmer zu durchqueren.
»Ist da jemand?«, fragte er, während er sich aus dem Sessel erhob.
Halluzinierte er wieder, oder hatte sich da ein Schatten bewegt?
Auf einmal drehte sich alles und kippte nach rechts. Tony stützte sich auf den Teewagen vom Room Service. Er hatte ihn bestellt, wie es die Beobachter befohlen hatten, sobald er wieder auf seinem Zimmer war. Dass er gar nichts essen konnte, spielte keine Rolle. Schon beim Geruch der frischen Erdbeeren rebellierte sein Magen.
Keiner war da.
Vielleicht machte ihn das Fieber paranoid. Auf jeden Fall fühlte er sich, als würde er von innen nach außen verbrennen. Er musste sich abkühlen, brauchte frische Luft.
Tony öffnete die Balkontür und begann umgehend zu schlottern. Der kleine Balkon hatte eine schmiedeeiserne Brüstung, wahrscheinlich noch das Original, das man bei der Renovierung erhalten hatte – hübsch und nostalgisch.
Die Luft war wohltuend. Kalt auf seinem schweißnassen Körper, aber gut. Er fühlte sich lebendig. Und er lächelte. Komisch, dass er sich so lebendig fühlen konnte. In Afghanistan war er mehrmals nur knapp dem Tod entronnen, und er kannte das typische Hochgefühl danach.
Nun trat er in die Nacht hinaus. Sein Kopf war immer noch drei Pfund zu schwer, aber das Drehen wurde etwas weniger. Und er konnte endlich atmen, ohne Blut zu husten.
Während er dem Brummen und Rauschen des Verkehrs unter sich lauschte, wurde ihm klar, wenn er wollte, wäre es leicht. Seit seiner Rückkehr hatte er seinen eigenen Tod öfter in Betracht gezogen, es sich aber nie genau ausgemalt.
Schlagartig wusste er, dass es genauso wäre, wie aus einer C-130 zu springen.
Bloß ohne Fallschirm.
Neunzehn Stockwerke ließen alles unten wie eine Miniaturwelt erscheinen. Matchbox-Autos wie die, mit denen Jason und er als Kinder gespielt, um die sie sich gestritten, die sie getauscht und geteilt hatten.
Und da holte ihn die zweite Welle von Übelkeit ein.
Vielleicht musste er dies hier nicht bis zu Ende durchziehen. Inzwischen interessierte ihn nicht mehr, ob die ihn bezahlten. Vielleicht war es noch nicht zu spät, um in eine Notaufnahme zu gehen. Sicher könnten die ihm etwas geben. Danach würde er einfach nach Hause zurückfahren. Es gab leichtere Arten, sich ein paar Scheine zu verdienen.
Doch als er sich gerade umdrehen wollte, spürte er einen Stoß. Das war nicht der Wind. Es waren starke Hände. Ein Schatten. Tony fuchtelte mit den Armen, um das Gleichgewicht wiederzufinden.
Noch ein Schubs.
Seine Finger griffen nach dem Geländer, doch der Rest von ihm kippte bereits nach hinten. Das Metall schnitt ihm in den Hintern. Er sah verschmierte Lichtstreifen, hörte nichts mehr außer dem Echo eines Windkanals. Die kalte Luft umfing ihn.
Keine zweite Chance. Er fiel bereits.
2
Conecuh National Forest
Nördlich der Bundesgrenze von Alabama/Florida
Ryder Creed klebte das T-Shirt am Rücken. Seine Wanderstiefel waren so dick von rotem Lehm behaftet, dass sie sich wie Zementklötze anfühlten. Die Luft wurde schwerer, feucht und stickig. Der Duft von Kiefernharz mischte sich mit der deutlichen Wildnote der Körperausdünstungen von Mann und Hund. So tief im Wald waren selbst die Vogelgeräusche anders. Das helle Hämmern des Kokardenspechts bildete die einzige Unterbrechung im unablässigen Surren der Mücken.
Creed war froh, ein langärmliges T-Shirt zu tragen und sich wie auch Grace ein Halstuch umgebunden zu haben. Die Tücher waren getränkt mit einer Spezialmischung, die seine Geschäftspartnerin Hannah gemischt hatte, und wehrte verlässlich Insekten ab. Hannah scherzte gerne, dass nur noch eine weitere Zutat fehlte, dann würde das Zeug sie sogar vor Vampiren schützen.
In wenigen Stunden wäre es Nacht im Wald, und so tief im Niemandsland, wie das Gebiet zwischen Alabama und Florida gern genannt wurde, gab es hinreichend Gründe, an Vampire zu glauben. Der Kudzu, ursprünglich eine asiatische Schlingbohne, rankte sich so dicht an den Bäumen hinauf, dass er wie eine Ansammlung dichter, grüner Netze aussah. An einigen Stellen schaffte es kein einziger Sonnenstrahl durch das Geflecht.
Der Trampelpfad, auf dem sie losgegangen waren, wurde bald überwuchert. Dornenranken zerrten an Creeds Hosenbeinen, und er befürchtete, dass sie Grace die kurzen Beine zerkratzten. Schon bereute er, den Jack Russell und nicht einen seiner kräftigeren, größeren Hunde ausgewählt zu haben; andererseits war Grace die beste Spürhündin in seinem nicht eben kleinen Rudel. Und sie tänzelte fröhlich voraus, genoss das Abenteuer und bewegte sich mühelos zwischen dicht an dicht stehenden hohen Kiefern, um die Creed immer wieder herumgehen musste, weil er nicht zwischen den Stämmen durchpasste.
Ihnen blieb keine Stunde mehr bis Sonnenuntergang, doch der Federal Agent aus Atlanta hatte nach wie vor seine Zweifel.
»Meinen Sie nicht, dass Sie mehr als einen Hund brauchen?«
Agent Lawrence Tabor hatte schon mehrfach angemerkt, wie klein Grace sei und »irgendwie winzig«. Creed war auch nicht entgangen, wie er Sheriff Wylie zuflüsterte, er sei »ziemlich sicher, dass Labbis oder Deutsche Schäferhunde die besseren Spürhunde sind«.
Das kannte Creed bereits. Gewöhnlich entsprachen weder er noch seine Hunde den Erwartungen der Gesetzeshüter. Seit sieben Jahren trainierte und führte er Hunde. In seiner Firma, K9 CrimeScents, gab es eine Warteliste für seine Hunde. Trotzdem erwarteten die Leute immer, dass er älter und seine Hunde größer wären.
Grace war tatsächlich einer seiner kleinsten Hunde, ein struppiger braun-weißer Jack Russell Terrier. Creed hatte sie ausgesetzt am Ende seiner langen Auffahrt gefunden. Da war sie nur Haut und Knochen gewesen, allerdings mit einem schlaffen Bauch, weil sie kürzlich einen Wurf geboren und gesäugt hatte. Die Leute in seiner Gegend hatten sich angewöhnt, ihre unerwünschten Hunde irgendwo am Rand von Creeds riesigem Anwesen auszusetzen. Und Grace war nicht die erste Hündin gewesen, die kurzerhand entsorgt wurde, wenn dem Besitzer eine Kastration zu teuer wurde.
Hannah gefiel nicht, dass die Leute Creeds weiches Herz ausnutzten. Doch was niemand – nicht mal Hannah – verstand, war, dass die Hunde, die Creed rettete, zu seinen besten Spürhunden geworden waren. Können war natürlich eine Voraussetzung für das Training. Die andere aber war der starke Bezug zum Hundeführer. Seine geretteten Hunde vertrauten ihm bedingungslos. Sie wollten lernen und ihn begeistern. Und Grace war eine seiner besten.
»Mit mehreren Hunden gleichzeitig zu arbeiten kann problematisch sein«, erklärte er dem Agent schließlich. »Die Hunde glauben sich in einem Wettbewerb, sodass es zu Fehlalarmen kommt, weil sich die Suchraster überlappen. Glauben Sie mir, ein Hund ist effektiver.«
Creed blieb um Graces willen sachlich, denn Gefühle wanderten die Leine abwärts. Hunde hatten ein feines Gespür für die Stimmung ihres Trainers, deshalb bemühte Creed sich stets, beherrscht zu bleiben, auch wenn ihm Typen wie Agent Tabor begannen auf den Wecker zu gehen.
Überhaupt fragte er sich, was Tabor hier wollte, behielt es aber für sich. Creed war weder von der Polizei noch vom FBI. Er war angeheuert worden, um einen Job zu erledigen, und hatte keine Lust, die gesetzlichen Vorgaben infrage zu stellen oder sich in das Zuständigkeitsgerangel zwischen regionaler und Bundespolizei ziehen zu lassen.
»Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie so weit gelaufen ist«, sagte Sheriff Wylie.
Gemeint war die junge Frau, nach der sie suchten. Der Grund, weshalb sie hier draußen waren. Doch jetzt begriff Creed, dass der Sheriff begann, auch sein Urteilsvermögen anzuzweifeln, obwohl sie beide schon viele Male zusammengearbeitet hatten.
Creed ignorierte beide Männer, so gut er konnte, und konzentrierte sich auf Grace. Er konnte hören, dass ihre Atmung schneller wurde. Sie begann, die Nase höher zu recken, und er spannte die Leine. Grace war eindeutig in dem Geruchskegel, auch wenn er keine Ahnung hatte, ob es ein sekundärer oder ein primärer war. Alles, was er riechen konnte, war der Fluss, nur achtete Grace nicht auf den.
»Wie lange ist sie schon weg?«, fragte er Sheriff Wylie.
»Seit vorgestern Abend.«
Man hatte Creed erzählt, dass Izzy Donner neunzehn Jahre alt war, früher drogenabhängig und dabei, ihr Leben wieder auf die Reihe zu bekommen. Sie hatte sich Teilzeit am College eingeschrieben und freute sich auf einen Ausflug nach Atlanta, den sie mit Freunden geplant hatte. Creed war bisher nicht sicher, warum ihre Familie in Panik geraten war. Ein paar Nächte nichts von einem Teenager zu hören schien ihm nicht ungewöhnlich.
»Erklären Sie mir noch mal, wie Sie darauf kommen, dass sie in den Wald gelaufen ist? Sind Sie sicher, dass sie nicht gegen ihren Willen verschleppt wurde?«
Es schien ihm logisch, dass ein Federal Agent eingeschaltet wurde, wenn das Mädchen entführt worden war. Die beiden Männer wechselten einen Blick. Vermutlich enthielten sie ihm Informationen vor.
»Was würde das für einen Unterschied machen?«, fragte Tabor schließlich. »Wenn Ihr Hund etwas taugt, sollte er sie doch trotzdem finden können, oder?«
»Es würde einiges ändern, weil der Geruch einer anderen Person ins Spiel käme.«
»Wir hatten einen anonymen Hinweis«, gestand Wylie, was ihm sofort einen strengen Blick von Tabor eintrug, sodass er verstummte.
Bevor Creed nachhaken konnte, begann Grace, an der Leine zu ziehen. Sie atmete noch schneller, und ihre Nase und die Tasthaare zuckten. Sie wollte zum Fluss.
»Ein bisschen langsamer, Grace«, sagte Creed.
Langsamer war ein Kommando, das ein Hundeführer nicht gerne gab. Aber manchmal konnte der Trieb überhandnehmen und einen Hund durch gefährliches Terrain rasen lassen. Creed kannte Geschichten von Hunden, die sich die Pfoten blutig gewetzt hatten, weil sie völlig darauf fixiert waren, den Duft zu finden, für den sie belohnt würden.
Grace zog immer noch. Creed lief so schnell, wie es seine langen Beine zuließen, um mit ihr Schritt zu halten. Das Rankengewirr drohte, ihn zu Fall zu bringen, während Grace schlicht hindurchhuschte, über herabgefallene Äste hüpfte und weiter an der Leine zerrte. Creed konzentrierte sich darauf, ihr Tempo nicht zu drosseln und nicht loszulassen.
Es dauerte daher eine Weile, ehe er bemerkte, dass Agent Tabor und Sheriff Wylie zurückgefallen waren. Zwar drehte er sich nicht um, hörte aber, dass ihre Stimmen gedämpfter wurden, unterbrochen von Flüchen, als sie sich durch das dornige Unterholz kämpften.
Endlich wurde Grace langsamer, bevor sie ganz stehen blieb. Die kleine Hündin schnupperte hektisch in die Luft. Creed konnte den Fluss gut anderthalb Meter entfernt sehen und hören. Er beobachtete Grace und wartete. Dann sah die Hündin zu ihm auf und starrte ihm in die Augen.
Das war ihr Signal. Creed wusste, dass die Hündin nicht zu entscheiden versuchte, welche Richtung sie als Nächstes einschlagen sollte; ebenso wenig wartete sie auf neue Befehle. Grace sagte ihm, dass sie das Zielobjekt gefunden hatte. Dass sie genau wusste, wo es war, aber nicht näher rangehen wollte.
Hier stimmte was nicht.
»Was ist los?«, fragte Sheriff Wylie, als er und Tabor näher kamen. Sie rangen nach Luft und blieben in sicherem Abstand.
»Ich glaube, sie ist im Wasser«, antwortete Creed.
»Was meinen Sie damit, sie ist im Wasser?«, fragte Tabor.
Wylie hingegen verstand es. »Oh Mist.«
»Grace, bleib«, sagte Creed zu dem Hund und ließ die Leine fallen.
Er wusste, er brauchte das Kommando nicht. Die Hündin scheute zurück, und Creeds Magen verkrampfte sich.
Er bahnte sich seinen Weg über den schlammigen Lehmboden am Ufer, wobei er sich an Ästen festhielt, um nicht wegzuschlittern. Dass Wylie direkt hinter ihm war, bemerkte er erst, als der ältere Mann gleichzeitig mit ihm beim Anblick der Mädchenleiche nach Luft rang.
Ihre Augen starrten nach oben, als würden sie die Wolken betrachten. Die Windjacke des Mädchens war noch geschlossen und hatte sich aufgebläht, weshalb ihr Oberkörper auf dem Wasser trieb, während der Rest auf dem sandigen Grund lag. An dieser Stelle war der Blackwater River nicht mal einen Meter tief. Und obwohl das Wasser die Färbung von Tee hatte, konnte man hindurchsehen. Im fahler werdenden Sonnenlicht erkannte Creed, dass die Taschen des Mädchens beschwert worden waren.
»Teufel auch«, hörte er Wylie hinter sich sagen. »Wie es aussieht, hat sie sich Steine in die Taschen gepackt und ist geradewegs in den Fluss gegangen.«
3
Creed behielt Grace an der Leine, auch wenn er die Arbeits- gegen die Flexileine austauschte, die ihr mehr Bewegungsfreiheit ließ. Er hatte sie zurück auf die Lichtung am Fluss geführt, knapp vier Meter weit weg, wo sie ihre Belohnung genießen konnte. Sie kaute auf ihrem rosa Spielzeugelefanten, brachte ihn immer wieder zum Quietschen. Hier draußen, inmitten des Insektensummens und des leisen Plätscherns, nahm sich das Geräusch befremdlich aus.
Von seiner Warte aus konnte Creed die Leiche flussabwärts noch sehen. Sein Job bestand im Auffinden, wonach sie suchten, aber mit den Ermittlungen hatte er nichts zu tun. War die Suche abgeschlossen, nahm er seinen Hund und ging aus dem Weg, es sei denn, es musste noch etwas anderes gefunden werden.
Als früherer Marine und K-9-Leiter blieb Creed auch nach dem Militär ein geprüfter Hundetrainer und Suchhundeführer. Hannah regelte das Geschäftliche, Creed bildete die Hunde aus. Innerhalb der letzten sieben Jahre hatte sich ihre kleine Firma im Florida Panhandle zu einem millionenschweren Unternehmen entwickelt. Inzwischen waren sie landesweit bekannt für die hervorragende Ausbildung und die Erfolgsrate ihrer Spürhunde. Und das alles hatten sie erreicht, indem sie ausgesetzte Hunde aufnahmen und zu Helden machten.
Als er zusah, wie Grace ihr Spielzeug in die Luft warf und hinterhersprang, um es aufzufangen, konnte er sich nicht vorstellen, wie jemand solch ein kluges und munteres Tier einfach aussetzte. Andererseits hatte Creed schon so viel Gemeinheit gesehen, dass es für ein ganzes Leben reichte.
Wieder blickte er zur Leiche der jungen Frau. Auch wenn er nichts mit den Ermittlungen zu schaffen hatte, konnte er nicht umhin sich zu fragen, was passiert war. So wie sie auf dem Wasser wippte, sah sie klein, fast kindlich aus, trotz der aufgeblähten Jacke.
Sheriff Wylie hatte vorhin gesagt, dass ihre Familie behauptete, sie könnte sich verirrt haben. War sie wirklich allein in den Wald spaziert und hatte sich dann verlaufen? Auszuschließen war es nicht. Leute verirrten sich. Das passierte häufig, oft wurden Creed und seine Leute in solchen Fällen gerufen.
Der Conecuh National Forest erstreckte sich über 340 Quadratkilometer zwischen Andalusia, Alabama und der Bundesgrenze zu Florida. Der Conecuh Trail war zweiundzwanzig Meilen lang und im Winter oder den ersten Frühlingsmonaten ein beliebter Wanderweg. Nur lag er oben im Nordostteil des Waldes und nicht hier in der Nähe. Vielmehr hatten sie schon seit geraumer Zeit nichts mehr gesehen, was einem Weg ähnelte.
Falls Izzy Donner zu einem Spaziergang im Wald aufgebrochen war, warum hatte sie sich dann so weit vom Weg entfernt? Hatte sie sich wirklich Steine in die Taschen gesteckt und war in den Fluss gegangen?
Creed beobachtete Sheriff Wylie und Agent Tabor. Beide Männer hatten ihr Handy am Ohr. Sie standen am Flussufer. Keiner versuchte, näher an die Leiche zu kommen. Der Sheriff sprach sehr bewegt in sein Telefon, schwenkte den freien Arm, schob seinen Hut nach hinten und zog die Krempe gleich wieder tiefer in die Stirn. Agent Tabor wirkte ruhiger, schien mehr zuzuhören als selbst zu sprechen.
Das Sonnenlicht trübte sich merklich ein. Die moosbedeckten Äste, die über die Lichtung hingen, warfen lange Schatten. Creed holte sein GPS-Gerät hervor und speicherte die Koordinaten. Das würde es dem Bergungsteam leichter machen, diese Stelle zu finden, egal ob sie zu Fuß oder mit einem Boot kamen.
Dann kramte er Graces faltbaren Trinknapf aus seinem Rucksack, zusammen mit seiner Taschenlampe. Letztere klippte er sich an den Gürtel, bevor er Grace Wasser in den Napf goss. Sie kam sofort, setzte sich hin, legte ihr Spielzeug ab und wartete geduldig, bis ihr zu trinken angeboten wurde. Creed hockte sich hin, um sicherzustellen, dass keine Feuerameisen in der Nähe waren, ehe er ihr den Trinknapf hinstellte. Und in dem Moment fiel ihm etwas Rotbraunes unter dem dürren Zypressenstrauch auf.
Er verließ Grace, um es sich näher anzusehen. Die Schatten machten es schwierig, etwas unter dem Unterholz zu erkennen. Creed schaltete seine Taschenlampe ein, als er etwa einen Meter von der kleinen Zypresse ein Knie auf den Boden setzte.
Vor ihm lag ein toter Vogel, ein Rotkehlchen mit dem Bauch nach oben. Die rote Brust hatte Creeds Aufmerksamkeit auf das Tier gelenkt. Er konnte keine Spuren von einem Raubtier erkennen. Der Vogel sah unberührt aus. Dann hörte Creed Zweige hinter sich knacken und drehte sich um. Da war Grace. Sie tänzelte und wedelte stolz mit dem Schwanz, weil sie ihm etwas brachte. Und Creeds Magen rutschte ein gutes Stück tiefer.
Noch ein totes Rotkehlchen.
»Gib her, Grace.« Er sprach betont ungerührt, als er der Hündin seine offene Hand hinhielt. Sie gab das Rotkehlchen frei, sodass es in Creeds Hand fiel.
»Ich dachte, Ihre Hunde sollen keine toten Sachen ins Maul nehmen.«
Sheriff Wylie war über die Lichtung zu ihnen gekommen und stand vor Creed. Kudzu-Zweige hingen an seinen Hosenbeinen, während er die Mücken von seinem Gesicht wegklatschte. Er sah aus wie eine Figur aus einem alten Slapstick, die sich selbst ins Gesicht schlug und rote Striemen hinterließ.
»Sie kennen den Unterschied zwischen toten Tieren und toten Menschen«, erklärte Creed. »Ich trainiere sie nicht auf das Aufspüren von toten Tieren, also sind die nicht tabu. Sie hat gesehen, dass ich mich für dieses Tier interessierte, und da brachte sie mir noch eines.«
Creed nahm zwei verschließbare Plastiktüten aus seinem Rucksack und steckte die Rotkehlchen hinein. Er wollte Grace nicht für etwas bestrafen, das ihrem Naturell entsprach, aber sie sollte auch nicht seine Sorge sehen.
Tatsache war, dass er ein ungutes Gefühl hatte, was diese toten Vögel betraf, und er hasste es, dass Grace einen ins Maul genommen hatte.
Zwei Tage später
Montag
4
Chicago
Als Maggie O’Dells Flug zur Landung ansetzte, bedeckte eine dünne Schneeschicht den O’Hare International Airport. Sie hatte Washington D.C. bei strahlendem Sonnenschein verlassen. Ob Sonne oder Schnee, O’Dell hasste Fliegen. Aber wenn sie schon bei Schnee landen musste, dann lieber auf einem Flughafen, wo man an solche Witterung gewöhnt war. Und wo war es besser als in Chicago?
Beim Anrollen des Flugzeugs ans Gate sah O’Dell die Bodencrew, von denen einige zwar Jacken, aber keine Kopfbedeckung trugen, als hätte sie der Märzschnee eiskalt erwischt. Das letzte Aufbäumen des Winters. Und O’Dell hatte nicht bloß einen sonnigen Himmel hinter sich gelassen, sondern auch angenehme Wärme. Die Ostküste wurde schon seit Wochen mit wunderbarstem Frühlingswetter verwöhnt.
Beim Blick aus dem Fenster fröstelte O’Dell plötzlich. Sie zog den Reißverschluss ihrer Strickjacke zu, dabei hatte ihr Frösteln nichts mit dem Wetter zu tun. Es war der Auftrag. Vor Monaten war dieser Fall schon zu den Akten gelegt worden. Es hatte keine Hinweise, keine Anhaltspunkte, keine digitalen Spuren gegeben. Nichts.
Beinahe schien es, als sei das Zielobjekt, Dr. Clare Shaw, schlicht verschwunden. Als sei sie in dem Erdrutsch in North Carolina begraben worden, bei dem die von ihr geleitete Forschungseinrichtung verschüttet wurde. Dort war die Wissenschaftlerin zuletzt gesehen worden. Dennoch bestand Grund zu der Annahme, dass Dr. Shaw nicht nur dem Tod entkommen war, sondern möglicherweise auch mehrere Menschen ermordet hatte, um ihre Flucht zu verschleiern.
O’Dell war die Aufgabe zugefallen, Shaw zu finden, und nach vier Monaten fühlte es sich allmählich an, als würde sie einen Geist jagen.
Bis jetzt.
Detective Lexington Jacks wollte sie an der Gepäckausgabe abholen. O’Dell erkannte sie sofort – die einzige Frau in der Menge ohne Handtasche oder Koffer. Außerdem sah sie aus wie ein Cop: Trenchcoat und lange Hose. Sie stand da, die Beine leicht ausgestellt, die Arme an den Seiten, und musterte alles und jeden. Ihr Blick streifte O’Dell und tat sie als harmlos ab.
Dann sah sie erneut hin. Sie stellte Blickkontakt her und wartete, um sicher zu sein. Als O’Dell nickte, kam Jacks ihr entgegen.
Der weibliche Detective war groß und hatte einen selbstbewussten Gang. Ihr Haar war zurückgebunden, sodass die glatte braune Haut ihres Gesichts betont wurde, makellos bis auf eine blasse weiße Narbe oben an der linken Wange. Aus der Nähe erkannte O’Dell, dass die Frau älter war als sie, wahrscheinlich in den Vierzigern. Krähenfüße zeichneten sich in ihren Augenwinkeln ab.
»Detective Jacks«, begrüßte O’Dell sie.
»Agent O’Dell, sagen Sie Lexi. Haben Sie noch mehr Gepäck?«, fragte sie und wies mit dem Daumen über ihre Schulter zum Kofferkarussell.
»Nein, nur das hier.«
»Keine Jacke.«
»Im Handgepäck.«
»Die werden Sie brauchen.« Jacks blieb stehen und verschränkte die Arme, als erwartete sie, dass O’Dell ihren kleinen Rollkoffer öffnete und die Jacke herausholte. O’Dell musste beinah lachen. Sie erinnerte sich nicht, wann sich zuletzt ein Gesetzeshüter um ihr Wohlergehen gesorgt hatte.
Als O’Dell sich nicht rührte, sagte Jacks: »Okay, wie Sie meinen. Wir müssen direkt los. Sie wollen jetzt das Zimmer durchsuchen. Wie ich hörte, warten sie nur noch auf Sie.« Jacks schob die Hände in die Taschen, drehte sich um und wollte vorausgehen.
»Wie gut konnten Sie den Raum abschotten, bevor die CDC kam?«, fragte O’Dell, die neben dem Detective herging und sich bemühte, mit den großen Schritten der Frau mitzuhalten. Gemeint war die Gesundheitsbehörde, die in solchen Fällen übernahm.
»Das Hotelmanagement war so klug, das Zimmer sofort zu versiegeln, als sie entdeckten, dass das Opfer ein Gast von ihnen war.«
»Der Zimmerservice war noch nicht drin?«
»Laut Hotelmanagement nicht.«
»Keine Polizisten?«
»Wir hatten schon eine Leiche auf dem Gehweg. Natürlich haben wir das Zimmer versiegelt, aber bei einem Springer ist normalerweise keine Eile geboten. Was auch gut ist, denn unsere Techniker wären gar nicht darauf gekommen, dass der Ort heiß sein könnte.«
Mit »heiß« meinte sie, dass das Zimmer mit einem möglicherweise tödlichen Virus kontaminiert war. Der Gerichtsmediziner hatte bei der Autopsie entdeckt, dass die Organe des Mannes schon Tage vorher zu bluten begonnen hatten.
Jacks führte O’Dell durch die Menge zum Ausgang vorn. O’Dell folgte ihr in die Kälte. Weit mussten sie nicht gehen. Ein Sicherheitsmann vom Flughafen stand neben einer dunkelblauen Limousine. Als er Jacks sah, öffnete er O’Dell die Beifahrertür, nahm ihr das Handgepäck ab und packte es hinten in den Kofferraum.
»Danke, Carl.« Jacks belohnte ihn mit einem breiten Lächeln, ehe sie sich in den Wagen duckte.
Sobald sie unter dem breiten Vordach hinausfuhren, sprenkelten dicke Schneeflocken die Windschutzscheibe.
»Hat jemand ihn springen gesehen?«, fragte O’Dell.
»Nein, aber mehrere Leute sahen ihn auf dem Gehweg aufschlagen. Wir glauben nicht, dass ihn irgendwer angefasst hat.« Jacks streckte eine Hand vor und drückte einen Knopf, worauf warme Luft aus dem Gebläse pustete. »Neunzehn Stockwerke, direkt aufs Gesicht. Haben Sie schon mal jemanden nach solch einem Sturz gesehen?«
O’Dell kannte Leichen in vielen Stadien des Verfalls, aus dem Wasser gezogen oder ausgegraben, ebenso wie gefolterte oder verstümmelte, aber, nein, sie hatte noch nie eine nach so einem Sturz gesehen. Sie schüttelte den Kopf.
»Eigentlich sieht es gar nicht so schlimm aus«, sagte Jacks. »Von außen. Ich weiß nicht, was ich erwartet hatte. Der Gerichtsmediziner sagte, dass es im Inneren reichlich Einblutungen gab. Die Lunge war ein einziger blutiger Matsch.«
»Welche Schutzkleidung hat der Gerichtsmediziner getragen?«
Jacks verzog das Gesicht, als sie antwortete: »Offensichtlich nicht genug. Sie haben ihn in Quarantäne geschickt.«
5
Chicago
Keiner beachtete Agent O’Dell und Detective Jacks, als sie durch die riesige, luxuriöse Hotelhalle gingen. Schlangen von Reisenden warteten, um einzuchecken. Pagen schoben beladene Gepäckwagen umher. Klüngel von Männern und Frauen in Businesskleidung steckten die Köpfe zusammen und machten Pläne. Abgesehen von dem Police Officer, der am Rand auf- und abging, gab es keinerlei Anzeichen, dass etwas nicht stimmte. Das Vier-Sterne-Hotel in der Michigan Avenue war eine seltsame Wahl, um sein Leben zu beenden.
Jacks hatte erklärt, dass die gesamte neunzehnte Etage evakuiert und abgeriegelt worden war. Der einzige Zugang war der über einen Personalaufzug, für den man einen Code eingeben musste. Als sich die Fahrstuhltüren öffneten, nickte ihnen einer von Jacks’ Officern von seinem Posten aus zu. Detective Jacks führte O’Dell zu einem Sammelpunkt gleich um die Ecke. Der Korridor war in beide Richtungen mit Polizeiband abgesperrt. Einen Meter hinter dem einen Band hing eine Plastikplane von der hohen Decke bis zum Fußboden.
Auf einem Edelstahlwagen standen Schachteln mit Latexhandschuhen und Mundschutz. Ein Stapel weißer Overalls, einzeln gefaltet und in Plastiktüten versiegelt, lag ebenfalls bereit, und auf dem unteren Regal des Wagens fanden sich Hauben mit Plastikvisieren vorn.
Beim Anblick dieser Ausrüstung zögerte O’Dell. Vor einigen Jahren war sie in der Isolierzelle von Fort Detrick gewesen, wo alle anderen um sie herum Schutzanzüge tragen mussten. Nachdem sie dem Ebola-Virus ausgesetzt gewesen war, landete sie im »Bau«. Es war ein klaustrophobischer Albtraum gewesen. Und nun, als sie die Schutzanzüge betrachtete, stellte sie fest, dass die Ausrüstung diese Gefühle wieder auslöste.
»Alles okay?«, fragte Jacks.
O’Dell verkniff sich eine Grimasse. Sie hasste es, dass sogar eine Fremde ihr ansah, wie unwohl ihr war.
»Mir geht es gut«, antwortete sie. Sie ging den Stapel der Anzüge durch und tat, als nähme sie Anstoß daran. »Wann begreifen sie endlich, dass die Einheitsgröße nicht allen passt?«
Jacks grinste und zog ihr Handy hervor.
»Ich schreibe ihnen, dass Sie hier sind.«
»Kommen Sie nicht mit?«
»Darf ich nicht. Sie wissen doch, wie die von der CDC sind. Alles streng geheim. Zutritt nur auf besondere Einladung. Obwohl wir hier vor Ort vielleicht wissen müssen, was zur Hölle da los ist.«
O’Dell spürte, wie Jacks ihre Reaktion abwartete. Obwohl sie bezweifelte, dass Jacks sich darum scherte, ob sie mit der Bemerkung zu weit gegangen war. Sie fuhr fort: »Wir stellen die Officer, die alles absperren, helfen bei der Einrichtung des Sammelpunkts und bewachen alles. Sie wissen schon, damit auch ja keiner mitbekommt, dass die CDC hier ist.«
»Man will die Öffentlichkeit nicht in Panik versetzen.«
Wieder beäugte Jacks sie misstrauisch.
»Die Leute sollen um Himmels willen nicht wissen, dass sie in Gefahr sind«, ergänzte O’Dell.
Jacks’ Mundwinkel bog sich nach oben, als sie O’Dells Sarkasmus erkannte.
»Sie wollten uns nicht mal verraten, was überhaupt los ist, und tun so, als wäre es eine reine Routine-Überprüfung.«
»Aber der Gerichtsmediziner hatte es Ihnen schon erzählt.«
»Stimmt.«
»Hey Maggie«, rief eine verhüllte Gestalt vom Ende des Korridors.
O’Dell hatte mit Roger Bix gerechnet, dem Direktor der CDC, der sie angefordert hatte. Doch noch ehe der Mann sein Visier hochschob, erkannte sie Colonel Benjamin Platt an der Stimme.
»Ben?«
Platt gehörte nicht zur CDC. Er leitete das USAMRIID (United States Army Medical Research Institute of Infectious Diseases). Und er war der Arzt, der sie im Bau von Fort Detrick behandelt hatte, nachdem sie dem Ebola-Virus ausgesetzt gewesen war. Während der Quarantänezeit hatten sie sich angefreundet … mehr als nur angefreundet. Momentan konnte O’Dell sich nicht entscheiden, ob sie durcheinander war, weil er ihr nicht erzählt hatte, dass er hier sein würde, oder weil seine Anwesenheit bedeutete, dass sie es mit einem sehr ernsten Fall zu tun hatten.
»Assistant Director Kunze hat nicht erwähnt, dass du hier sein würdest.«
Doch anstatt zu antworten, lächelte er Detective Jacks an und sagte: »Danke, dass Sie Agent O’Dell heil hergebracht haben.«
Jacks blickte von Platt zu O’Dell und begriff, dass sie weggeschickt wurde. Sie reichte O’Dell ihre Karte. »Rufen Sie mich an, wenn ich irgendwie helfen kann oder Sie Fragen an mich haben.«
»Ich würde gerne den Autopsiebericht sehen«, antwortete O’Dell.
Jacks sah zum Colonel, und Platt sagte: »Ich kann dir eine Kopie besorgen.«
Die beiden Frauen wechselten einen Blick, der ihrer beider Verärgerung über die Regierungsbürokraten spiegelte. Ironischerweise sah Jacks in O’Dell eine Verbündete, obwohl sie eine FBI-Marke trug. Andererseits verstand O’Dell auch, wie es für Detective Jacks war: Platt schloss sie aus, obwohl er und die CDC wie selbstverständlich die Ressourcen der Chicagoer Polizei nutzten und sich von ihnen Schutz und Tarnung geben ließen, damit sie heimlich arbeiten konnten.
O’Dell wollte ihn daran erinnern, dass so langfristig alles nur schwieriger würde. Sie hatte schon oft genug mit Gesetzeshütern vor Ort gearbeitet, um zu wissen, dass ein Verweis auf den Dienstrang oder die Oberhoheit der Bundesbehörden bloß Verstimmungen erzeugte und einen bisweilen in Gefahr bringen konnte, wenn man auf die Rückendeckung der anderen angewiesen war.
Jacks lächelte O’Dell an, nickte Platt zu und ging. Platt blickte ihr nach, bis sie im Fahrstuhl war und die Türen sich vollständig geschlossen hatten.
»Ich glaube, wir haben sie gefunden«, sagte er dann.
O’Dell wusste sofort, dass er von Dr. Clare Shaw sprach, der Wissenschaftlerin-Schrägstrich-Wahnsinnigen, die O’Dell schon seit vier Monaten aufzuspüren versuchte.
Vor Grauen krampfte sich ihr Bauch zusammen. Sie glaubten, dass die Wissenschaftlerin bei ihrem Verschwinden einen speziellen Schließbehälter aus ihrer Forschungseinrichtung entwendet hatte, der wahrscheinlich mindestens drei tödliche Viren enthielt.
»Bix macht die Bluttests selbst. Deshalb hat er mich gebeten, mit dir zusammen das Zimmer zu untersuchen.«
Roger Bix leitete die Seuchenkontrolle bei der CDC. Er und Platt hatten schon oft bei Fällen zusammengearbeitet, die gleichermaßen gefährlich wie beängstigend waren. Einer davon war O’Dells Ebola-Verdacht gewesen.
»Selbst wenn dieser Springer mit einem der Viren infiziert war, die Shaw gestohlen hat, wie können wir sicher sein, dass er von ihr kam? Es gibt doch sicher noch andere Möglichkeiten, wie er damit in Kontakt gekommen sein könnte.« Sie begann, die Schutzkleidung anzuziehen, und tat ihr Bestes, ihr Unbehagen nicht zu zeigen.
»Ich weiß, dass dies hier nicht leicht für dich ist, Maggie.«
Sie sah zu ihm auf. Der Bürokrat, der so unhöflich Detective Jacks weggeschickt hatte, war verschwunden. Sanfte braune Augen blickten sie an. Er hatte die Schutzhaube abgenommen, und nun stand ihm sein kurzes Haar zu Berge. Dies war der Mann, der ihre Freundschaft und sogar ein Stück von ihrem Herzen gewonnen hatte.
»Du musst das nicht machen«, fuhr er fort. »Sicher, Shaw ist dein Fall, aber A.D. Kunze könnte jemand anderen schicken, der diesen Teil übernimmt.«
»Nein, ist schon gut.« Sie griff nach einer der Hauben und einem Paar Handschuhe. »Außerdem bin ich schon hier, also fangen wir an.«
Ihr entging nicht, dass er sie immer noch musterte. »Du hattest meine Frage nicht beantwortet«, sagte sie, während sie die Ärmel des Overalls aufkrempelte, dann die Klettbänder unten an ihren Fesseln und anschließend die an ihren Handgelenken stramm festzog. »Woher weiß man, dass der Virus in diesem Springer mit Dr. Clare Shaw zu tun hat?«
»Von den Proben, die der Gerichtsmediziner der CDC gegeben hat. Bix hat bereits festgestellt, dass der junge Mann mit der Vogelgrippe infiziert war. Er überprüft es noch mal und wiederholt einige Tests, klingt jedoch ziemlich sicher, dass es sich um einen neuen Virenstamm handelt. Einen wie wir ihn noch nie vorher gesehen haben.«
»Und Dr. Shaw?«
»Wir wissen, dass sie daran gearbeitet hatte, bevor ihre Forschungseinrichtung bei dem Erdrutsch zerstört wurde.«
»Warte mal. Wenn man diesen Virenstamm noch nie gesehen hat, wie konnte sie dann daran arbeiten?«
»Sie hat mitgeholfen, das Virus zu züchten.«
6
Pensacola, Florida
»Was soll denn so besonders an einem verfluchten Hund sein?«
Der alte Mann lauerte Creed und Jason auf, als sie die Hunde durch die Sicherheitstür des Altenheims brachten. Creed erkannte den Mann von seinem letzten Besuch wieder. Der alte Knabe hatte ihn sofort ausgequetscht, wie er überhaupt reingekommen war. Creed hatte zur Tür gezeigt, allerdings nicht erwähnt, dass er den Sicherheitscode kannte.
»Die Tür ist immer abgeschlossen«, hatte er zu Creed gesagt, und Creeds lässige Haltung schien ihn erst recht misstrauisch zu machen.
Anfangs dachte Creed, dass der Mann sich um die Sicherheit sorgte und fürchtete, jeder könnte ohne Weiteres die Sicherheitsvorkehrungen austricksen. Aber dann sagte er zu Creed: »Sag mir Bescheid, wenn du gehst. Damit ich mit dir verschwinden kann.«
Das hatte Creed nicht vergessen. Er konnte sich nicht vorstellen, an einem Ort gegen seinen Willen festgehalten zu werden, von dem ihm alle einredeten, er wäre sein neues Zuhause. Fast wäre er heute nicht wieder hergekommen, doch Hannah hatte gedrängt und ihn – wie immer – am Ende überzeugt, dass es ein gutes Training für die Hunde sei.
Also hatte er Jason mitgenommen. Doch nun sah Creed ihm an, dass der alte Mann den Jungen ebenfalls aus der Ruhe brachte. Er war sichtlich angespannt. Jason hatte Creed auf der Fahrt erzählt, dass sein Großvater kürzlich hier eingezogen war. Und er gestand, dass er ihn noch nicht besucht hatte. Aber er wirkte gar nicht schuldbewusst, als er sein Gewicht von einem Fuß auf den anderen verlagerte.
Sobald der alte Mann weg war, gab Jason flüsternd zu: »Ich fühle mich unter alten Leuten einfach nicht wohl.«
»Warum?«, fragte Creed, und diese einfache Frage verunsicherte Jason. Als hätte der Junge nie weiter als bis zu dieser aufrichtigen Antwort gedacht.
»Wie jetzt, warum?«
»Warum fühlst du dich unter alten Leuten unwohl?«
Jason überlegte eine Weile.
»Erst mal die Art, wie sie die blödesten Sachen sagen können, und damit durchkommen. Oder irgendwas raushauen, was für jeden offensichtlich ist. Als hätten die einen Freifahrtschein, unhöflich oder peinlich zu sein, bloß weil sie alt sind. Ich wette einen Zehner, dass wir keine Viertelstunde da drinnen sind, ehe einer auf mich zeigt und was sagt wie, ›Oh, guckt mal, dem Jungen fehlt ein halber Arm‹.«
»Genauso wie Kinder. Vielleicht musst du sie so sehen – als wären sie wieder Kinder.«
»Klar, aber eines von diesen Kindern hat mir Fahrradfahren beigebracht. Hat mich hochgehoben und getragen, wenn ich müde war. Es fällt mir schwer, ihn als Kind zu betrachten. Ich habe mal zu ihm aufgesehen.«