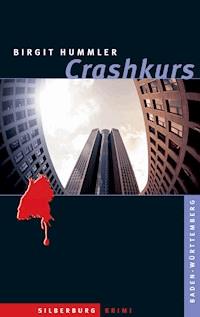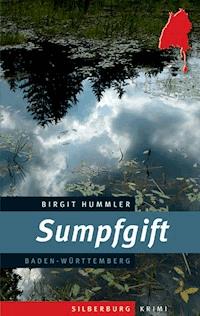
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Silberburg-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Auf einem Wanderparkplatz beim Stuttgarter Rotwildpark wird der Europa-Abgeordnete Ewald Angelhoff tot aufgefunden. Mit einer Schusswunde im Kopf, die Pistole noch in der Hand. Auf den ersten Blick wirkt alles wie Selbstmord. Doch Gerd Stoevesandt, Leiter der Abteilung für Wirtschaftskriminalität am LKA, hat seine Zweifel. Denn der EU-Abgeordnete hatte ihn nur wenige Tage zuvor angerufen und von hochbrisantem Material und unterschlagenen Informationen gesprochen. Auch Hauptkommissar Andreas Bialas, der den Tod von Angelhoff untersucht, findet immer mehr Ungereimtheiten. Und es zeigt sich, dass der Tote im EU-Parlament eine äußerst zwiespältige Rolle in der Umwelt- und Chemikalienpolitik gespielt hat. Ein Geflecht von Beziehungen wird deutlich, durch das die Industrie massiven Einfluss auf Politik und Gesetzgebungen in Europa nimmt. Und der Abgeordnete scheint immer tiefer in den Sumpf geraten zu sein …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 575
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Birgit Hummler
Sumpfgift
Birgit Hummler
Sumpfgift
Ein Baden-Württemberg-Krimi
Birgit Hummler, Jahrgang 1953, ist in Stuttgart aufgewachsen und lebt heute in Breisach am Rhein. Sie hat Sprach- und Literaturwissenschaften (Deutsch und Russisch) sowie Journalistik und Kommunikationswissenschaften studiert. Ihre Laufbahn als Journalistin führte sie bald zu Themen aus der Arbeits- und Wirtschaftswelt, in der es manchmal mörderisch zugeht. Ihr Krimidebüt »Stahlbeton« wurde 2011 mit dem Stuttgarter Krimipreis in der Kategorie »Bester Wirtschaftskrimi« ausgezeichnet.
1. Auflage 2016
© 2016 by Silberburg-Verlag GmbH,
Schönbuchstraße 48, D-72074 Tübingen.
Alle Rechte vorbehalten.
Lektorat: Michael Raffel, Tübingen.
Umschlaggestaltung: Christoph Wöhler, Tübingen.
Coverfoto: Roland Bauer, Braunsbach.
E-Book im EPUB-Format: ISBN 978-3-8425-1714-1
E-Book im PDF-Format: ISBN 978-3-8425-1715-8
Gedrucktes Buch: ISBN 978-3-8425-1457-7
Besuchen Sie uns im Internet
und entdecken Sie die Vielfalt unseres Verlagsprogramms:
www.silberburg.de
Inhalt
Über die Autorin
Montag, 22. Juli 2013
Dienstag, 23. Juli 2013
Mittwoch, 24. Juli 2013
Donnerstag, 25. Juli 2013
Freitag, 26. Juli, 2013
Wochenende, 27. und 28. Juli 2013
Montag, 29. Juli 2013
Dienstag, 30. Juli 2013
Mittwoch, 31. Juli 2013
Freitag, 2. August 2013
Wochenende, 3. und 4. August 2013
Montag 5. August 2013
Mittwoch, 7. August 2013
Donnerstag, 8. August 2013
Freitag, 9. August 2013
Wochenende, 10. und 11. August 2013
Montag, 12. August 2013
Dienstag, 13. August 2013
Mittwoch, 14. August 2013
14. bis 16. August – WiKri-Tage
Die Nacht von Samstag, 17. August, auf Sonntag, 18. August 2013
Montag, 19. August 2013
Dienstag, 20. August 2013
Mittwoch, 21. August
Freitag, 23. August 2013
Wochenende, 24. und 25. August
Dienstag, 27. August, 16.00 Uhr
Freitag, 30. August 2013
Samstag, 31. August 2013
Sonntag, 1. September 2013
Montag, 2. September 2013
Dienstag, 3. September, 5.30 Uhr
Mittwoch, 4. September 2013
Freitag, 6. September 2013
Montag, 9. September 2013
Dienstag, 10. September 2013
Mittwoch, 11. September 2013
Donnerstag, 12. September 2013
Freitag, 13. September 2013
Montag, 16. September 2013
Zeitlose Septembertage
Freitag, 4. Oktober 2013
Freitag, 25. Oktober 2013
Anfang November 2013
Ende November 2013
Weitere Bücher und E-Books aus dem Silberburg-Verlag
Das Sumpfgift, auch Wasserschierlinggenannt, ist eine Doldenpflanze, dieam Rande von Gewässern oder inSümpfen gedeiht. Alle Pflanzenteilesind sehr giftig, besonders aber die süßschmeckende Wurzel. Bei Verzehrkommt es zu Übelkeit und Brechreizsowie zu schweren Krampfanfällen, diezum Tode führen können.
Montag, 22. Juli 2013
1
E. A.
Er trat hinaus in die Morgenluft. Sie war noch frisch und klar, aber es würde wieder ein heißer Tag werden. Ein erster lichter Streifen zeigte sich zur Stadt hin am Himmel. Ein erster Vogel zwitscherte zögerlich, als wäre er sich nicht sicher, ob er nicht doch etwas zu voreilig war.
Es war schon einige Zeit her, dass er so früh los musste. Bei irgendeiner Fernreise, als er zum Flughafen nach München fuhr. Ihm machte es nichts aus, beizeiten aufzustehen. Vor allem heute nicht. Er wollte die Unterlagen haben, und wenn eben jetzt die letzte Gelegenheit war, dass der Typ ihm die Ergebnisse übergeben konnte, dann war es eben so.
Er war leise aufgestanden, um Felicitas nicht zu wecken. Er würde mit ihr frühstücken, wenn er wieder zurück wäre. Er holte den Wagen aus der Garage und fuhr hinauf zum Kräherwald. Ein Blick auf das Navigationsgerät zeigte ihm, dass er rechtzeitig dran war und sich nicht hetzen musste. In etwa fünfundzwanzig Minuten würde er an dem angegebenen Parkplatz sein, immer noch zehn Minuten zu früh.
Der Ort, den der Mann gewählt hatte, war etwas seltsam. Wenn man von Karlsruhe kam und nach Frankfurt weiter wollte, dann gab es bessere Treffpunkte. Zumal die Straße kurz vor Leonberg wegen Bauarbeiten voll gesperrt war und man wieder umständlich zurückfahren musste. Aber der Typ war ohnehin ein bisschen verpeilt – ein Wissenschaftler eben. Der hatte es noch nicht einmal hinbekommen, selbst Kontakt zu ihm aufzunehmen, was ihm doch sauer aufgestoßen war. So behandelte man einen Mann in seiner Position nicht. Die Schwester des Mannes hatte bei ihm angerufen und ihm quasi verordnet, wohin er kommen sollte. Aber was tat man nicht alles, wenn es wichtig war. Und diese Ergebnisse waren ihm wichtig.
Mit ihnen hatte er etwas in der Hand, womit er in die Offensive gehen konnte. Und er wollte raus aus dieser Sackgasse, in der er steckte. Er fragte sich in letzter Zeit ohnehin des Öfteren, wie er da hineingeraten war. Sicher nicht von jetzt auf nachher. Es war ein schleichender Prozess gewesen.
Wann hatte das angefangen? Mit dieser Tasse aus Meißner Porzellan? Felicitas war vor Verzückung dahingeschmolzen. Sie hatte sich benommen wie ein Kind an Weihnachten. Niemand hatte ihren Wert auch nur erwähnt. Auch er nicht. Weil er geahnt hatte, dass damit seine Unschuld verloren war?
Aber eigentlich hatte es damit begonnen, dass er Felicitas geheiratet hatte. Dieses süße, verwöhnte Mädchen aus halbaristokratischem Hause, das nicht erwachsen werden wollte. Er war ihren rotblonden Haaren, dem feinen Alabaster-Teint und den graugrünen Katzenaugen umgehend verfallen, als er sie kennengelernt hatte. Und als sie tatsächlich seine Frau wurde, da wollte er ihr etwas bieten. Der arme Schlucker aus einfachem Hause musste zeigen, was er in sich hatte. Und es musste mehr sein als ein glänzend hingelegtes Studium und eine begehrte Partnerschaft in einer Anwaltskanzlei.
Die Politik, das war sein Feld. Dort hatte er das Gefühl, sich wirklich profilieren zu können. In der Politik konnte er seine Fähigkeit, auf Menschen zuzugehen und Netzwerke zu knüpfen, zur Geltung bringen. Dort wurde sein Ehrgeiz, Ideen zu entwickeln und umzusetzen, befriedigt. Und Felicitas fand es schick, mit einem Politiker verheiratet zu sein, auch wenn sie sich nie wirklich für das interessierte, was er tat. Was ihm wiederum egal war, weil er nicht ihretwegen in die Partei eingetreten war.
Es waren anfangs auch nicht machtpolitische Erwägungen gewesen, die ihn in die Politik gedrängt hatten. Er hatte Visionen, durchaus. Gerade im Südwesten gab es damals doch eine Reihe von Köpfen in der Partei, die neue Wege gehen wollten. In der Außenpolitik, in der Wirtschaft und in Rechtsfragen. Eine moderne Gesellschaft mit Selbstverantwortung und Entfaltungsmöglichkeiten für alle Bürger – das war das große Ziel.
Er war ein Shootingstar, ein Senkrechtstarter mit Charisma, dem man schnell viel zutraute. Eine Zeitlang tummelte er sich in der Lokalpolitik – und auf einmal war er EU-Abgeordneter. Damit kamen die Connections und Verbandelungen, und er kannte diesen Ministerialdirigenten und jenen Bundestagsabgeordneten, traf sich mit Aufsichtsratsvorsitzenden, CEOs und IHK-Präsidenten und verkehrte in den Kreisen, in denen sich Felicitas so wohl fühlte. Man wurde eingeladen zu Workshops und zu Reisen in ferne Länder. Der ersten Tasse aus Meißner Porzellan folgte eine zweite. Plötzlich war er ein gefragter Referent und Berater, und die Honorare wurden immer höher.
Doch manchmal geschehen Dinge, die man so nicht eingeplant hat. Die plötzlich einen anderen Blick auf manche Fragen notwendig machen. Durch die die Perspektive gänzlich verändert wird. Argumente, die man früher abgetan hatte, bekommen einen neuen Sinn. Und plötzlich merkt man, dass man gefangen ist in einem Netzwerk, in Seilschaften, aus denen man sich nur schwer befreien kann. Doch genau dazu war er jetzt entschlossen.
Er fuhr über den Botnanger Sattel zum Schattenring und weiter vorbei am Rotwildpark. An dem Kreisverkehr, bei dem man nach Büsnau abbiegen oder aber – wie man ihn angewiesen hatte – Richtung Leonberg weiterfahren konnte, stand er plötzlich vor einer Absperrung. Er fand es doch etwas befremdlich, dass der Straßenbelag hier schon abgetragen worden war. Man konnte die Schranke zwar umfahren, fuhr dann jedoch auf holprigem Grund. Wahrscheinlich hatte der Typ das einfach nicht gewusst.
Linkerhand kam dann das »Bruderhaus«, das ihm die Frau am Telefon als Wegmarke genannt hatte. Kurz danach sah er das Hinweisschild zum Wanderparkplatz. Er folgte ihm und hatte das Gefühl, mitten in den Wald zu fahren. Erst als er eine kleine Brücke über einen schmalen Fluss passiert hatte, sah er den großen Parkplatz.
Kaum hatte er den Wagen zum Stehen gebracht, als neben dem Auto, wie aus dem Boden geschossen, eine Gestalt stand. War das der Mann, mit dem er telefoniert hatte? Der sah beileibe nicht aus wie ein Akademiker. Der Kerl stand so nahe an der Autotür auf der Fahrerseite, dass man sie praktisch nicht öffnen konnte, und er bedeutete ihm, die Scheibe herunterzulassen. Als die sich gesenkt hatte, reichte der Mann ihm eine braune Mappe.
»I come from Mister Mayer-Mendel. And he told me to give you this.« Der Mann sprach Englisch mit einem heftigen Akzent, wahrscheinlich spanisch, italienisch oder griechisch, wofür auch sein Äußeres sprach.
Er öffnete die Kladde und sah sich den Inhalt an. Genau das war es, was er wollte. Das waren die Ergebnisse der Studie, mit denen er Fabian Montabon und seine Hintermänner von nun an in Schach halten konnte.
2
»… wurde heute Morgen beim Rotwildpark tot aufgefunden. Zur Todesursache konnte die Polizei noch keine Angaben machen.«
Gerd Stoevesandt legte die Zeitung beiseite. Er sah die HiFi-Anlage an, als wollte er den Ton zurückspulen. Dann holte er den Tablet-PC, öffnete den Internetbrowser und suchte nach den aktuellen News. Es gab noch keine Meldung zu dem Fall.
Den Kaffee trank er noch leer, das Brötchen blieb angebissen liegen. Er holte die Aktentasche aus dem Zimmer, das ihm als Heimbüro diente, überprüfte den Inhalt, zog die Schuhe an und nahm, obwohl es schon jetzt recht warm war, das obligatorische Jackett über den Arm. Dann verließ er die Wohnung und fuhr mit dem Wagen zum Landeskriminalamt. Er war spät dran. Der schlimmste Berufsverkehr war abgeebbt. Heute kam er mit dem Auto wahrscheinlich zügiger zur Arbeit als mit dem öffentlichen Nahverkehr, der zurzeit chronisch an Ausfällen litt.
In seinem Büro öffnete er am Computer den Informationsdienst der Landespolizei. Bei den WE-Meldungen, den »Wichtigen Ereignissen«, wurde er sofort fündig. Er hatte sich nicht verhört. Ansonsten erfuhr er nicht viel Neues. Nur, dass der Fall von der Polizeidirektion Böblingen übernommen worden war. Stoevesandt fragte sich, woher der Radio-Sender die Nachricht schon hatte.
Einen Moment überlegte er, ob er seine Nase da überhaupt reinstecken sollte. Dann rief er doch den Kollegen in Böblingen an, der in der WE-Meldung als ermittelnder Kommissar genannt war. Als er ihn erreichte, fiel ihm wieder einmal auf, wie selbstverständlich die Leute hier ihren Dialekt benutzten. Er hatte sich in all den Jahren eingehört in diese brabbelnde Sprache – und sich doch nie ganz daran gewöhnt, dass selbst hochrangige Polizeibeamte, Vorsitzende von Landesverbänden oder Führungskräfte in weltweit operierenden Unternehmen im Beruf, ja selbst bei halboffiziellen Gelegenheiten sich ungeniert der breiten Mundart bedienten.
»Der hat sich erschossa«, informierte der Hauptkommissar der Böblinger Kripo.
»Sie gehen von einem Selbstmord aus?«
»I dät mi wundern, wenn’s net so wär.«
»Wie war die Auffindesituation?«, wollte Stoevesandt wissen.
»Isch in seim Auto g’sessa, hat eine Knarre in der Hand g’habt und ein Loch im Kopf. Was soll des sonscht sei?«
Einen Moment überlegte Stoevesandt, ob er dem Mann sagen sollte, was er wusste. Doch er zögerte. Das war nicht der Typ, mit dem er konnte. Zu schnell mit seinen Urteilen. Zu undifferenziert in seinen Beobachtungen. Er bedankte sich und legte auf.
Stoevesandt wandte sich Routineaufgaben zu. Berichte lesen, E-Mails beantworten, Dienstpläne überarbeiten … Doch die Worte des Böblinger Kollegen waberten ständig durch sein Gehirn.
Er griff wieder zum Telefon. Bialas meldete sich sofort.
»Andreas, ihr müsst den Fall Angelhoff übernehmen«, sagte er zu dem Kollegen, ohne ihm einen guten Morgen zu wünschen. »Gibt es irgendeine Möglichkeit, dass man euch die Sache überträgt?«
Andreas Bialas räusperte sich. »Wir sind hier gerade gar nicht scharf auf publikumswirksame Fälle. Hier stehen alle noch unter Schock. Du weißt schon … der Präsident …«
»Steht nicht schon fest, wer der Neue wird?«
»Doch, aber hier haben alle noch nicht wieder richtig Tritt gefasst.« Bialas hatte ohnehin fast eine Stimme wie Rod Steward. Jetzt klang sie zudem leicht belegt.
Es war eine tragische Geschichte. Das Stuttgarter Polizeipräsidium hatte wohl noch nie eine ähnliche Persönlichkeit zum Präsidenten gehabt. Einer, der höchst beliebt war. Und nicht nur bei den Kollegen. Auch bei Partnern und selbst bei Widersachern der Polizei. Er hatte in nur zwei Jahren eine ganze Reihe von Reformen auf den Weg gebracht, die frischen Wind in das alte Gemäuer des Präsidiums wirbelten. Und dann dieser tödliche Motorradunfall …
»Trotzdem.« Stoevesandt war sich sicher: Den Fall würde besser das Dezernat für Todesermittlungen am Stuttgarter Polizeipräsidium übernehmen. »Ich habe mit dem verantwortlichen Kollegen in Böblingen gesprochen. Der Mann ist voreingenommen. Der weiß schon vor der Obduktion und der Spurenauswertung, dass es ein Selbstmord war.«
»Und du glaubst das nicht?«
»Ich habe vor etwa vierzehn Tagen mit Ewald Angelhoff gesprochen. Er hat mich angerufen. Hat mir etwas von hochbrisantem Material erzählt, das er über eine Firma hier in Baden-Württemberg hätte.«
Andreas Bialas schwieg. Wahrscheinlich putzte er sich wieder mal ausgiebig die Nase, eine Art Marotte, die er sich als Pausenfüller angewöhnt hatte, wenn seine grauen Zellen ungestört arbeiten wollten.
»Und du denkst, dieses Material könnte was mit seinem Tod zu tun haben?«
»Man muss das überprüfen.«
Wieder schwieg Bialas. »Ich weiß, wer den Fall in Böblingen hat«, sagte er dann. »Wenn du Recht hast, dann ist der wirklich nicht unbedingt in den richtigen Händen …«
Stoevesandt wartete. Doch so schnell ließ sich Bialas nicht dazu hinreißen, ihm Zusagen zu machen. »Was ist denn das für einer, dieser Angelhoff? Ein EU-Abgeordneter, okay. Ich habe aber noch nie etwas von dem gehört.«
»Ewald Angelhoff ist – oder besser: war Vorsitzender eines Ausschusses im Europäischen Parlament. Umwelt, Gesundheit, Lebensmittelsicherheit – für solche Themen ist der zuständig.«
Bialas klang noch immer nicht begeistert. Doch immerhin versprach er: »Okay, Gerd, ich hab zumindest mal ein Auge drauf, was die Böblinger so treiben. Bei so einem Politiker entscheidet wahrscheinlich ohnehin das Innenministerium, wer die Sache bearbeitet.«
3
Stoevesandt konnte sich nicht sofort auf seine Berichte und Dienstpläne konzentrieren, nachdem er aufgelegt hatte. Das Telefonat mit Ewald Angelhoff ging ihm durch den Kopf. Er hatte noch dessen ärgerliche Stimme im Ohr. Eigentlich ging ihn der Fall nichts an. Das war das Terrain der Todesermittler. Aber so einfach wie der Böblinger Kollege konnte man es sich nicht machen. Das ging gegen den Strich seiner Dienstauffassung. Er hatte sich hier nicht einzumischen, aber wenn er etwas dafür tun konnte, dass das Dezernat für Tötungsdelikte am Stuttgarter Polizeipräsidium den Fall übernahm, würde er sich dafür einsetzen. Dort waren die richtigen Leute.
Stoevesandt hatte schon einige Male mit den Kollegen vom Stuttgarter Polizeipräsidium zu tun gehabt. Manchmal kam es vor, dass Fälle sich überschnitten. Zweimal hatten sie intensiv zusammengearbeitet. Bei Todesfällen im Zusammenhang mit wirtschaftskriminellen Machenschaften.
Andreas Bialas – das war ein Kollege, den er nicht in seiner Abteilung hätte haben wollen. Zu eigensinnig, zu aufmüpfig. Er hatte es selbst erlebt bei der ersten Zusammenarbeit mit ihm, als Stoevesandt die Leitung einer Sonderkommission übernommen hatte. Der Mord an einem Bauarbeiter hatte auf illegale Beschäftigung in großem Ausmaß hingewiesen. Bialas hatte in der SoKo das Tötungsdelikt bearbeitet. Der Hauptkommissar war nicht leicht zu führen gewesen. Doch Stoevesandt entdeckte in ihm auch den brillanten Kriminalisten. Er hatte Spürsinn und Biss. Und sie hatten im Laufe der gemeinsamen Ermittlungen festgestellt, dass sie sich beide den gleichen ethischen Grundsätzen in der Polizeiarbeit verpflichtet fühlten, was trotz der hohen moralischen Ansprüche an Polizisten keineswegs immer selbstverständlich war.
Bialas hatte außerdem ein gutes Team. Auch das war keine Selbstverständlichkeit in einem System, in dem die Leiter ihre Mitarbeiter quasi durch ein ominöses Beurteilungssystem zugeteilt bekamen. Bialas und seine Stellvertreterin, eine freundliche, erfahrene Frau, waren aufeinander eingespielt. Beide führten die Truppe kollegial, aber bestimmt. Beide waren geachtet und akzeptiert. Man spürte auch als Außenstehender die gute Arbeitsatmosphäre in diesem Dezernat. Die Leute fühlten sich geachtet. Und sie hatten die uneingeschränkte Rückendeckung ihrer Führung – was Stoevesandt seinerseits oft bitter vermisste.
Er machte sich wieder an sein Alltagsgeschäft. Er war routiniert und fachlich versiert genug, um den Stand der laufenden Ermittlungen zu erfassen und zugleich den einen oder anderen Gedanken an Ewald Angelhoff zu verschwenden. In der Tat – wer wusste schon etwas über diesen Abgeordneten? Was wusste man schon über das EU-Parlament und den ganzen Bürokraten-Apparat in Brüssel? Man las Zeitung und informierte sich über Fernsehen und Internet. Der Eindruck, der sich daraus ergab, war, dass die Europäische Union immer mehr in das Leben der Menschen hineinregierte. Aber was Leute wie Angelhoff dort trieben, wusste man nicht. Und wie dort Vorschläge eingebracht und Entscheidungen getroffen wurden, war auch Stoevesandt nicht klar.
Schließlich gewannen die aktuellen Fälle der »Wirtschaftskriminalität, Umwelt und Kunst« seine volle Aufmerksamkeit. Mehr als ein Dutzend Jahre war er Leiter dieser Abteilung, und er konnte sich nicht erinnern, jemals so viele Ermittlungen gleichzeitig am Laufen gehabt zu haben, die in der Öffentlichkeit und in den Medien für Furore sorgten. Seit vier Jahren beschäftigten die Landesbanken die Wirtschaftskriminalisten und Staatsanwaltschaften. Die Führungskräfte, die die Banken mit exorbitanten Risiken in die Finanzkrise hatten rauschen lassen, wurden nach und nach angeklagt. Auch die Stuttgarter Staatsanwaltschaft hatte sich zu einer Anklage gegen die Führung der Landesbank entschlossen.
Der Porsche-Fall und die Spekulationen mit den VW-Aktien waren in der heißen Phase. Auch hier hatte man es mit hochkarätigen Managern und ebensolchen Anwälten zu tun. Einer der Manager war bereits verurteilt. Bei einem weiteren Prozess würde es um die Marktmanipulationen gehen, durch die der Kurs von VW-Aktien plötzlich in die Höhe geschossen war und viele Spekulanten eine Menge Geld verloren hatten. Manche sogar ihre Existenz.
Der dritte Fall hatte es erst recht in sich. Denn hier ging es im Grunde um einen politischen Skandal mit wirtschaftlichem Hintergrund. Der Rückkauf der EnBW-Aktien durch den damaligen Ministerpräsidenten Stefan Mappus unter Umgehung aller demokratischen Gepflogenheiten schlug nach wie vor hohe Wellen. Momentan warteten alle auf das Gutachten eines unabhängigen Experten. Doch man munkelte bereits, dass das Land weit mehr als 500 Millionen Euro zu viel für den Rückkauf der Anteile an dem Energieunternehmen gezahlt hätte.
Stoevesandt konnte sich gottlob auf eine erfahrene Truppe von Wirtschaftskriminalisten stützen, allen voran Rudolf Kuhnert, mit dem ihn eine langjährige Zusammenarbeit verband, die weit in gemeinsame Zeiten beim Bundeskriminalamt zurückreichten. Rudolf, der den Porsche-Fall federführend bearbeitete, wirkte auf den ersten Blick unscheinbar, ja unbedarft. Aber er hatte die Gabe, hinter die Zahlen zu sehen bis in die dritte Dimension und erkannte Zusammenhänge in Transaktionen und Finanzverwirrungen, bevor andere diese überschaut hatten.
Auch die Stellvertreterin des Abteilungsleiters, Charlotte Zahn, war eine erfahrene Kriminalistin, die ihr Team im Griff hatte. Für Stoevesandts Geschmack war sie zu obrigkeitshörig, und einen Draht bekam er nicht zu der Kollegin, die ihm Inspektionsleiter Kriminalrat Winfried Bechtel vor ein paar Jahren ohne Rücksprache zur Seite gestellt hatte. Die Frau trug eine unvorteilhafte Kurzhaarfrisur und farblose Kleidung, war um die fünfzig, unverheiratet und das, was man früher einen Blaustrumpf genannt hätte. Genauso phantasie- und leidenschaftslos, doch zuverlässig und gewissenhaft, machte sie ihren Job.
Stoevesandt war froh, dass bei der Menge an Arbeit, die sie momentan hatten, nicht auch noch der Fall Schlecker zu einem Dauerbrenner geworden war. Auch wenn er Nicole Marinescu im Grunde seines Herzens gut verstand, die die Schlecker-Ermittlungen geleitet und vor Empörung über die Einstellung des Verfahrens im ganzen Gesicht und am Hals rote Flecken bekommen hatte. Nicole Marinescu war in vieler Hinsicht das Gegenteil von Charlotte Zahn. Sie war hübsch und kleidete sich geschmackvoll. Für die Tätigkeit in einem so anspruchsvollen Bereich wie der Wirtschaftskriminalität war sie mit ihren sechsunddreißig Jahren noch recht jung. Sie machte den Mangel an Erfahrung jedoch durch ein leidenschaftliches Engagement und hohe fachliche Kompetenz mehr als wett. Und die älteren Kollegen, die Stoevesandt ihr zur Seite stellte, passten schon darauf auf, dass sie sich nicht zu sehr in die Rolle der Jeanne d’Arc stürzte. Akribisch hatte sie bei der Schlecker-Insolvenz recherchiert. Besonders die Verschiebungen, durch die die Schlecker-Familie einen Teil des Vermögens kurz vor der Insolvenz auf die Seite schaffen wollte, nahm sie unter die Lupe. Und sie konnte es kaum fassen, als der Insolvenzverwalter mit den Schleckers einen sogenannten Kompromiss aushandelte, demzufolge zehn Millionen aus deren Privatvermögen wieder in die Insolvenzmasse der Drogeriemarkt-Kette zurückgezahlt werden sollte, und man daraufhin das Verfahren einstellte.
»Zehn Millionen – überlegen Sie das mal«, hatte sich Nicole Marinescu aufgeregt. »Der Schlecker hat in den letzten Jahren seiner Frau jeden Monat sechzigtausend Euro Gehalt gezahlt. Das sind ja alleine schon drei Millionen. Und die ganzen Nobelkarossen und die Grundstücke und die Immobilien – das ist doch alles das Drei- und Vierfache wert. Fünfundzwanzigtausend Leute haben da ihren Job verloren! Sechshundert Millionen Euro an unbezahlten Rechnungen haben die hinterlassen. Und der zahlt gerade mal zehn Millionen und kauft sich von der Strafverfolgung frei? Jeder Ladendieb, der mal was klaut und erwischt wird … Wenn der sagt: ›Na ja, die Hälfte vom Geklauten, die kriegt ihr halt wieder‹ … Lässt man den dann auch laufen? Der käme vor Gericht, auch wenn er alles wieder zurückgibt!«
Stoevesandt konnte nur den Kopf schütteln. Wie konnte man nur so naiv und emotional an diesen Job herangehen? Er mochte die junge Kollegin, ja, hatte fast so etwas wie väterliche Gefühle für sie. Aber manchmal ging ihm jedes Verständnis für ihre Gefühlswelt ab. Eine Abteilung für Wirtschaftskriminalität war keine Plattform für die Rächer der Witwen und Waisen. Gerade bei diesen großen Fällen ermittelte man nicht selten gegen Personen, mit denen man niemals im selben Restaurant speisen würde, die in anderen Kreisen verkehrten und denen selbst die Staatsanwälte nicht auf Augenhöhe begegneten. Hier herrschten ohnehin andere Gesetze. Solchen Leuten wurde nie kriminelle Energie unterstellt. Es sei denn, sie trieben es so weit, dass jeder Normalsterbliche schon fünfmal verknackt worden wäre. Und dann das Problem, dass man es meist mit sehr vertrackten Sachverhalten zu tun hatte. Wirtschaftsstraftäter waren in der Regel nicht blöde. Sie nutzten Grauzonen und verzwickte Rechtslagen. Die Staatsanwälte hatten oftmals ihre liebe Mühe, die Anklagen hieb- und stichfest zu begründen. Die Gegenseite konnte sich hochkarätige, mit allen Wassern gewaschene Verteidiger leisten, und viele Prozesse gingen aus wie das Hornberger Schießen. Mit Gerechtigkeit hatte das nur bedingt etwas zu tun.
Er selbst sah trotzdem einen Sinn in dem, was er tat, auch ohne Zorro-Attitüden. Ihm lag diese systematische, gründliche Arbeit, die bei der Auswertung von Aktenschränken füllenden Zahlenwerken und Schriftstücken notwendig war. Er mochte es, seinen Grips einzusetzen, um in einem komplexen Umfeld Klarheit zu bekommen. Die Tatbestände, die verfolgt wurden, machten zwar nur ein bis zwei Prozent aller Straftaten aus, und die Dunkelziffer im Bereich Wirtschaftskriminalität war hoch. Doch der Schaden war immens. Wenn man ihn in Geld aufwog, dann ging die Hälfte der Verluste, die die Allgemeinheit durch Straftaten hinnehmen musste, auf das Konto der Wirtschaftskriminalität. Noch schlimmer war aus Stoevesandts Sicht jedoch der soziale Schaden. Vor allem der Kampf gegen die Korruption lag ihm am Herzen. Es war ein Gift, das ganze Gesellschaften untergrub und eine Atmosphäre schuf, in der redliche Arbeit und die Bemühungen, besser zu sein als andere, keine Chance hatten. Der Ehrliche und Fleißige war der Gelackmeierte, die Schmierer wurden reicher. Alles in allem war die Arbeit Stoevesandts und seiner Kollegen mühsam, trocken und nicht immer von Erfolg gekrönt. Aber durch Polizei und Staatsanwälte schwebten immerhin die Strafverfolgung und das Recht über den Tätern. Und manchmal schlug das Schwert doch auch empfindlich zu, wenn auch für die breite Öffentlichkeit eher unspektakulär und unbemerkt. Ein Stoff für Kriminalromane war das jedenfalls nicht.
4
Zum Mittagessen ging er heute in die Kantine, obwohl ihm das Geklapper und Geplapper von Tellern und Menschen regelmäßig auf den Hörnerv ging. Wenn er Zeit hatte, bevorzugte Stoevesandt, eines der kleinen Restaurants in der Cannstatter Altstadt aufzusuchen, in denen es einen preiswerten und meist guten Mittagstisch gab.
Heute wollte er vorab noch mit seinen Ermittlungsleitern sprechen, bevor er mit der Truppe bei Bechtel vortanzen musste. Er wollte auf der sicheren Seite sein und den wirklich letzten Stand und die Details kennen. Diese Art von Kontrolle mochte er eigentlich nicht. Das waren alles gestandene und selbstständig arbeitende Beamte. Es war – bei seiner Erfahrung und seinem Werdegang – eigentlich auch unter seiner Würde, dass er vor dem Vorgesetzten katzbuckelte. Aber der Kriminalrat Dr. Winfried Bechtel hatte nun mal die Angewohnheit, Mitarbeiter aus Stoevesandts Abteilung wegen haarspalterischer Details herunterzuputzen oder ihn selbst bei der LKA-Leitung madig zu machen. Stoevesandt wollte diesen Ärger, soweit es ging, vermeiden.
Der Anruf von Andreas Bialas kam, als er sich gerade mit seinen Leuten zusammengesetzt hatte.
»Hallo Gerd, du bekommst deinen Willen. Das Innenministerium hat uns den Fall Angelhoff aufs Auge gedrückt. Die Notrufzentrale hat den Fundort den Böblingern zugeordnet. Der Jogger, der den Toten gefunden hat, war wohl nicht ganz präzise bei seinen Angaben. Aber leider liegt der Parkplatz noch auf Stuttgarter Gebiet. Na ja, und außerdem scheint die Politik bis nach Berlin da ein gehöriges Wörtchen mitzureden …
Wir werden morgen früh zusammen mit den Böblingern eine SoKo zusammentrommeln. Die haben schließlich als Erste den Tatort dokumentiert. Ich gehe mit unseren Leuten von der Kriminaltechnik aber nachher trotzdem noch mal da raus in den Glemswald. Ich will, dass sich Wildermuth da so schnell wie möglich noch mal umschaut. Wenn du Zeit hast, kannst du ja dazukommen.«
Stoevesandt setzte die Besprechung fort. Zum Glück verstanden seine Leute, warum er so pedantisch ins Detail ging. Bis auf Frau Zahn. Sie schmollte, als er sie darauf aufmerksam machte, dass sie bei der Analyse der Mail-Flut von Mappus und anderen ehemals führenden Landespolitikern einen Suchbegriff wie »Vergleichsangebot« nicht durch das System gejagt hatte. Denn genau ein solches Angebot wurde niemals eingeholt. Stoevesandt konnte sich des Eindrucks nicht erwehren, dass Charlotte Zahn noch immer einem Ex-Ministerpräsidenten Loyalität entgegenbrachte, der mitsamt seiner Partei längst abgelöst worden war. Sie war nicht fähig oder willens, ganz offensichtliche Zusammenhänge aus E-Mails herauszulesen, die bei dem Deal mehr oder weniger flapsig über die Satelliten gejagt worden waren. Aber Frau Zahn würde bei Bechtel ohnehin nicht in Ungnade fallen.
Nach der Sitzung checkte er auf dem Laptop noch mal die E-Mail, in der ihn Dr. Winfried Bechtel aufgefordert hatte, heute Nachmittag den Stand der wichtigsten Fälle durch die zuständigen Ermittler referieren zu lassen. In dem Text stand nichts davon, dass der Abteilungsleiter der Wirtschaftskriminalität selbst anwesend sein sollte. Unter Umständen war es sogar besser, wenn er fehlte. Die Erfahrung zeigte, dass Bechtels Befragungen dann nicht ganz so hochnotpeinlich ausfielen. Stoevesandt beschloss, zum Rotwildpark zu fahren.
5
Der Wanderparkplatz lag abseits der Straße. Hätte nicht ein ganzer Aufzug aus blauen und zivilen Polizeiautos, aus weißen Bussen der Kriminaltechnik und einem Abschleppwagen entlang der Fahrbahn gereiht gestanden – man hätte die Einfahrt leicht verfehlen können. Hier von der Straße aus konnte man den Platz überhaupt nicht einsehen. Nur das blaue Schild mit dem P und den Wandersleuten machte auf ihn aufmerksam.
Wie Bialas ihm erklärt hatte, war die Straße, die mitten durch den Wald nach Leonberg führte, ab dem Kreisel gesperrt, von dem die Magstadter Straße vom Schattenring kommend weiter nach Büsnau führte. Man konnte, an der Absperrung vorbei, trotzdem weiterfahren. Der Straßenbelag wurde hier erneuert, die oberste Asphaltschicht war abgetragen. Mit dem Wagen bis zum Bruderhaus zu kommen, das direkt an der Straße oberhalb des Parkplatzes lag, war kein Problem. Ein paar Kilometer weiter würde, wie am Kreisel angekündigt, die Vollsperrung der Straße sein. Es gab hier also keinerlei Verkehr. Und das Bruderhaus, in dem eine Ausbildungsstätte untergebracht war, wurde offenbar renoviert und war momentan menschenleer. Die Stille, die Stoevesandt umgab, als er ausstieg, wirkte durchdringend.
Er ging, dem Parkschild folgend, einen geschotterten, etwas abschüssigen Weg in den Wald. Es war ein Idyll, das ihn hier erwartete. Ein Flüsschen schlängelte sich zwischen dichter Vegetation, plätscherte und glitzerte in der heißen Sonne. Eine Brücke mit hölzernem Geländer führte darüber, der man kaum zutraute, tatsächlich das Gewicht von Autos zu tragen. Dann lag rechts der Parkplatz. Für diese versteckte Lage war er sehr groß. Überall flatterten die rotweißen Absperrbänder und wirkten völlig deplatziert. Auch die Menschen, die in den weißen Overalls gleichmäßig über den Platz verteilt ihren Tätigkeiten nachgingen, gehörten nicht wirklich in diesen opulenten Sommerwald. An allen möglichen Stellen standen große Koffer und Vermessungsgeräte herum. Der einzige Wagen, der sich auf dem Parkplatz befand, war ein silberner Audi A8 mit dem Kennzeichen S-EA 2000. Seine Türen standen weit offen.
Auch hier lag über allem eine satte Stille. Zwar hörte man das Knirschen der Schuhe auf dem Schotter und die Stimmen der Menschen, die sich gedämpft verständigten. Aber es fehlte jedes Verkehrsgeräusch, und kein Vogel war zu hören. Die Hitze des Tages lastete über der Szene und schien jeden Ton zu verschlucken.
Bialas kam auf ihn zu und drückte fest seine Hand. Der Kollege hatte sich seit ihrem letzten Treffen kaum verändert. Vielleicht waren die Falten zwischen den Augenbrauen und um die Mundwinkel etwas tiefer geworden – was nicht verwunderlich war beim favorisierten Gesichtsausdruck des Hauptkommissars, einer finsteren Miene, die Stoevesandt an einen Schauspieler erinnerte, der in Abenteuerfilmen einen tollkühnen Archäologen spielte und auch nicht lachen konnte. Bialas’ dunkelblondes Jahr war noch immer voll, obwohl er jetzt stramm auf die fünfzig zugehen musste. Stoevesandts blondes Haar war in diesem Alter, vor etwa zehn Jahren, bereits durchweg silberweiß gewesen, auch wenn ihm, wie Bialas, die Haare zum Glück nicht ausfielen. Es freute ihn, den Hauptkommissar mal wieder zu sehen. Solange es keine Hierarchien zu klären gab, fühlten sie sich freundschaftlich verbunden.
»Schön, dass du’s geschafft hast, Gerd. Schwierige Lage hier. Wildermuth, komm doch mal her«, rief Bialas einem der Kollegen im weißen Overall zu. Der machte sich sichtbar widerwillig auf den Weg. Aus der Richtung der Straße kam in Ganzkörperweiß eine Frau, wie man aus den Bewegungen erkennen konnte. Den Chef der Kriminaltechnik am Polizeipräsidium Stuttgart, Hans Wildermuth, kannte Stoevesandt. Die Frau war ihm unbekannt. Beide zogen die Kapuzen vom Kopf, beiden lief der Schweiß in Strömen übers Gesicht, bei beiden pappte das nasse Haar am Kopf. Stoevesandt fragte sich, ob Wildermuth nicht langsam auf die Pensionierung zuging. Noch immer aber machte der drahtige Kriminaltechniker einen durchtrainierten und fitten Eindruck. Wahrscheinlich lief er noch immer Marathon, wie Stoevesandt mal mitbekommen hatte.
»Keine Chance«, sagte Wildermuth und sah Stoevesandt unter seinen schwarzen Augenbrauen durchdringend an. »Der Boden ist seit Tagen trocken. Wenn es Wagen- oder Fußspuren gibt, dann sind die zeitlich nicht zuzuordnen. Das haben die Böblinger Kollegen schon ganz richtig gesehen. Ob hier heute Morgen noch ein weiteres Fahrzeug war, oder ob hier jemand rumgelatscht ist … das wissen nur die Götter, wenn ihr keine Zeugen beibringt.«
Die Frau im Schutzanzug nickte: »Da drüben, nach der Brücke, da geht ein Weg zu einer schmalen Unterführung. Offensichtlich für Wanderer, die rüber in den Rotwildpark auf der andern Seite wollen. Die können da unter der Straße hindurch. Ein paar Leute suchen das Gebiet ab. Aber wenn es da Fußspuren gibt, dann sind die bestimmt schon ein paar Tage alt, so trocken, wie der Weg da ist.«
»Also gibt es keine Hinweise darauf, dass außer Angelhoff heute Morgen noch jemand hier war«, stellte Stoevesandt mehr für sich selbst fest. »Und das da ist sein Wagen?« Er deutete auf den silbergrauen A8.
»Der muss in die Werkstatt der KTU, und zwar so schnell wie möglich.« Wildermuth sah Andreas Bialas eindringlich an. »Wir haben noch mal alles fotografiert. Aber jede weitere Untersuchung muss im geschützten Raum stattfinden. Hier draußen gibt’s einfach zu viele Quellen für Fehlspuren.«
»Ich will die Bilder sehen. Danach könnt ihr den Wagen wegbringen«, erwiderte Bialas und wandte sich an Stoevesandt. »Ich habe Luca zu den Böblinger Kollegen geschickt. Die haben heute früh ja schon die Leiche im Wagen fotografiert. Ich will mir noch mal ein Bild machen, wie das genau ausgesehen hat.«
»Und wo ist der Tote jetzt?«, fragte Stoevesandt.
»Im Robert-Bosch-Krankenhaus. Die mussten ihn hier wegbringen, so schnell es ging. Bei dieser Hitze hätten den die Fliegen umgehend aufgefressen. Morgen Nachmittag ist Obduktion.«
Oben an der Straße hörte Stoevesandt Motorengeräusche. Wagentüren schlugen. Dann kamen zwei Personen den Weg über die Brücke zum Parkplatz. Die eine war die athletische Gestalt von Luca Mazzaro, einem der jüngsten Mitarbeiter von Andreas Bialas. Fast schwarzes dichtes Haar, die dunklen Augen und die unverwechselbare Körpersprache verrieten seine italienischen Wurzeln. Dabei sprach er fließend Deutsch in der moderaten Form des hiesigen Dialekts und fühlte sich – auch wenn er durch den reichlichen Gebrauch von italienischen Sprich- und Schimpfwörtern mit seiner Herkunft kokettierte – gewiss nicht mehr als Ausländer. Stoevesandt wusste, dass Bialas große Stücke auf die fast deutsche Gründlichkeit von Mazzaro hielt. Ihm selbst kam der junge Italiener immer etwas oberflächlich und unreif vor. Dazu trugen sicher seine flapsige Sprache und sein Spleen bei, fast jeden Menschen und jede Situation mit Figuren und Geschichten aus den sogenannten Star-Trek-Episoden zu vergleichen. Ihn selbst hatte Luca einmal als Vulkanier bezeichnet, und Stoevesandt hatte keine Ahnung, ob er dies als Anerkennung oder Beleidigung auffassen sollte. Ihm ging jeder Sinn für diesen Science-Fiction-Quatsch ab.
In der zweiten Person erkannte Stoevesandt einen Staatsanwalt der Stuttgarter Behörde. Er war um gut einen Kopf kleiner als Luca Mazzaro, um einiges fülliger und doch flink wie ein Wiesel. Obwohl der Mann drei Schritte brauchte, wenn Mazzaro zwei machte, war er ihm eine Nasenlänge voraus. Stoevesandt hatte bisher nicht oft mit Staatsanwalt Friedebald Frenzel zu tun gehabt, der bei der Stuttgarter Staatsanwaltschaft in der Abteilung für Kapitaldelikte tätig war. Als Leiter der Wirtschaftskriminalität am LKA hatte er vorwiegend mit der Stuttgarter Schwerpunktstaatsanwaltschaft für Wirtschaftsstrafsachen zu tun. Bei den wenigen Gelegenheiten, die sie zusammengearbeitet hatten, hatte Stoevesandt durchaus den Eindruck bekommen, dass Frenzel seine Aufgaben engagiert wahrnahm. Doch auch ihn konnte Stoevesandt einfach nicht richtig ernst nehmen. Frenzel gab gerne den Clown. Seine Anekdoten und Bonmots, die er genussvoll zum Besten gab, hatten durchaus Esprit und Witz. Selbst ihn, den ernsthaften und eher nüchternen Norddeutschen konnte der Mann zum Schmunzeln bringen. Doch Stoevesandt war nun einmal so gestrickt, dass ihm durch diesen Klamauk etwas der Respekt abhandenkam.
Auch jetzt kam Friedebald Frenzel wieder fröhlich auf die Gruppe der Kommissare zu: »Guten Tag, die Herren und die Damen, haben wir mal wieder eine schöne Leiche? Und dazu noch eine prominente.« Er schüttelte allen freudestrahlend die Hand. »War gar nicht leicht, hierherzukommen. Ein echtes mathematisches Problem. Die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten ist gewöhnlich wegen Bauarbeiten gesperrt, ha ha.« Während Mazzaro ein leichtes, modisches Jungmänner-T-Shirt trug, war Frenzel, der kaum älter war, in ein konservatives weißes Langarmhemd gekleidet und trug trotz der Temperaturen eine Krawatte. Seine Glatze und das Gesicht glänzten entsprechend vor Schweiß. »Herr Stoevesandt, was treibt Sie hierher?«, fragte er interessiert.
»Dazu später«, griff Bialas nun ein. »Ich will die Bilder sehen.«
Luca Mazzaro schwenkte ein dickes braunes Kuvert durch die Luft, bevor er es seinem Chef aushändigte. Bialas entnahm ihm eine Mappe und dieser nun die Fotos, eines nach dem andern, und reichte sie weiter. Jedes machte seine Runde, angefangen bei Wildermuth und seiner Mitarbeiterin von der Kriminaltechnik über den Staatsanwalt zu Stoevesandt und zurück an Luca Mazzaro. Sie zeigten den Audi A8, wie er aufgefunden worden war: Alle Türen waren geschlossen. Die Fensterscheiben an der Fahrer- und Beifahrerseite waren heruntergelassen. Der Parkplatz und der Wagen waren aus allen erdenklichen Perspektiven abgelichtet. Es folgte eine lange Reihe von Detailaufnahmen und die ersten Fotos vom Toten, geschossen durch das offene Seitenfenster. Ewald Angelhoff war nach vorne rechts auf das Lenkrad gekippt. Am Kopf, schräg über dem Ohr, war deutlich die Einschusswunde zu sehen.
Weitere Bilder waren bei offenen Wagentüren und von beiden Seiten gemacht worden. Von der Fahrerseite aus sah man den hängenden Arm des Toten. Sein Unterarm war mit Blut bespritzt, in der Hand hatte er noch immer einen Revolver. Eine FN High Power, erkannte Stoevesandt, eine Nachfolgerin des legendären Browning. Nahaufnahmen der Waffe und des Toten folgten. Von der Beifahrerseite her waren die besudelten Armaturen zu sehen. Die Einschlagsöffnung des Projektils in der Armatur war auf Nahaufnahmen dokumentiert. Auch der Tote war aus unterschiedlichen Winkeln zu sehen. Dem Mann hatte es ein Stück des Schädels und das rechte Auge weggerissen. Jede Menge Blut und Gehirnmasse war auf den Armaturen, der Frontscheibe und den Ledersitzen verspritzt.
»Porca miseria, was für eine Sauerei«, kommentierte Luca Mazzaro.
»Oioioi, wirklich kein schöner Anblick«, kommentierte Frenzel und wackelte mit seinem runden Kopf.
Wildermuth nahm Bialas die Bilder aus der Hand, bei dem sie gelandet waren, wählte eine ganze Reihe davon aus und meinte, zu seiner Kollegin gewandt: »Die schauen wir uns direkt am Wagen noch mal an«, womit die beiden hinüber zu dem A8 gingen.
Bialas nahm eines der zurückgebliebenen Fotos zur Hand und reichte es Stoevesandt. Es zeigte den herunterhängenden Arm von Ewald Angelhoff und die Waffe, die die Hand fest zu umklammern schien. »Ich könnte nachvollziehen, warum die Böblinger Kollegen von einem Suizid ausgehen – wenn Ewald Angelhoff Linkshänder war. Weißt du da was drüber?«
Stoevesandt schüttelte mit dem Kopf. Er hatte zu wenig mit dem Mann zu tun gehabt, als dass ihm so etwas aufgefallen wäre. Aber ein anderer Umstand beschäftigte ihn: »Fällt die Pistole nach einem Suizid nicht aus der Hand?« Er war in Hamburg nicht lange bei einer Mordkommission gewesen, und es war auch schon eine Weile her. Aber daran erinnerte er sich noch, dass keiner der Selbstmörder, die er je gesehen hatte, nach dem Schuss noch die Waffe in der Hand gehabt hatte.
Mazzaro nahm ihm das Bild aus der Hand. »Schon komisch. Ist ja eigentlich keine leichte Waffe.«
»Die Waffe setzt hier auf, auf dem Schweller der Autotür. Siehst du?« Bialas zeigte ihm ein Bild, das von der Beifahrerseite durchs Fenster gemacht worden war und in Nahaufnahme die Waffe und die Hand zeigte. »Die Bilder sind gut. Die Kollegen haben das schon ordentlich gemacht. Wenn die Waffe hier aufgesetzt hat, dann wurde ein Teil des Gewichts abgefangen. Da kann es schon sein, dass sie mal nicht aus der Hand fällt.«
Auch der Staatsanwalt wollte noch einmal einen Blick auf das Foto werfen. »Tja‚ schon hält der Schnitter die Waffe bereit«, zitierte er irgendein altes Gedicht.
»Woher kanntest du Angelhoff eigentlich, Gerd?«, fragte Bialas.
Frenzel und Mazzaro sahen Stoevesandt an. Er überlegte. Wie lange war das jetzt her? »Das sind jetzt etwa vier Jahre, da war ich bei einer Tagung und musste einen Vortrag über Umweltkriminalität halten. Angelhoff war ebenfalls Referent. Er hat zu Fragen der europäischen Umwelt- und Chemikalienpolitik Stellung genommen. Danach hatten wir noch ein interessantes Gespräch.«
Ewald Angelhoff war ein beeindruckender Mann gewesen. Groß, kräftig, aber nicht korpulent. Gepflegt, aber nicht schnöselig. Sein dichtes, leicht gewelltes Haar war bereits graumeliert. Er hatte eine angenehme volle Stimme gehabt, und sein direkter Blick aus braunen Augen hatte dem Gesprächspartner Aufmerksamkeit und Wertschätzung vermittelt. Er war, wie Stoevesandt sich erinnerte, ein guter Redner gewesen. Und durchaus einer, der nicht nur oberflächliche Floskeln von sich gegeben hatte. Sein Vortrag war sehr informativ gewesen und hatte auch widersprüchliche Aspekte und Interessenlagen beleuchtet. Stoevesandt erinnerte sich an die roten Plastikschüsseln. Der Verbraucher greift zu billigen, farbenfrohen und elastischen Schüsseln. Er setzt die Industrie damit unter Druck. Die greift zu Weichmachern, die den eigentlich spröden roten Schüsseln eine gewisse Elastizität verleihen, wohl wissend, dass diese die Fortpflanzungsfähigkeit bei Mensch und Tier beeinträchtigen können, und werden dafür von den Verbraucherorganisationen gescholten.
Beim Abendessen hatten sie nebeneinander gesessen und sich sehr lange und angeregt über ethische Probleme und die Vereinbarkeit von wirtschaftlichen und Umweltinteressen unterhalten. Es war um Gesetze und deren Auswirkungen auf die Konkurrenzfähigkeit von Unternehmen in Deutschland und Europa gegangen. »Die Großen, die international aufgestellt sind – die haben damit kaum Probleme«, hatte Angelhoff argumentiert. »Aber die Kleinen und Mittleren. Gerade in der chemischen und der pharmazeutischen Industrie. Die Auflagen, die auf die jetzt zugekommen sind, durch die neue Chemikaliengesetzgebung der EU – das können die überhaupt nicht mehr stemmen.«
Stoevesandt selbst war als Beamter vor allem dafür auf seinem Posten, damit die Gesetze eingehalten wurden, ob sie nun Sinn machten oder nicht. Aber er hatte selbstverständlich auch eine Meinung als Staatsbürger und Mensch. Und gerade, wenn es um Umweltfragen, Schadstoffe und Chemikalien ging, dann tauchte auch immer die Frage nach Auswirkungen auf Mensch und Natur auf. Man musste einen Ausgleich zwischen Gesundheit und Naturerhalt auf der einen Seite und den ökonomischen Interessen auf der anderen finden. Dem stimmte auch Angelhoff zu. Doch wo lag die richtige Mitte bei einem solchen Kompromiss? Darüber hatten sie sich nicht einigen können. Trotzdem – es war ein anregendes und niveauvolles Gespräch gewesen.
»Und dann habe ich ihn noch mal vor etwa einem Jahr auf einem Empfang im Innenministerium getroffen. Wir haben aber hauptsächlich über irgendein soziales Engagement seiner Frau gesprochen«, erinnerte er sich und fügte hinzu: »Die Ehefrauen waren eingeladen bei der Veranstaltung.«
Es war hauptsächlich um die frühmusikalische Erziehung gegangen. In großartiger Manier hatte Felicitas… Ja, genau, so war der Name von Angelhoffs Frau: Felicitas. Begeistert hatte sie geschildert, wie die Stiftung aussehen sollte, die sie ins Leben rufen wollte, zur frühkindlichen Förderung für alle sozialen Schichten, mit Geigen und Pianos, durch die die Intelligenz gefördert würde. Ines hatte sich später darüber mokiert, dass die Dame wohl sonst nicht viel zu tun habe und wie ein Hartz-IV-Kind wohl zuhause Klavier üben solle. Beide Paare hatten, wie sich herausstellte, keine Kinder, und gerade deswegen, so schwärmte Felicitas Angelhoff, liege ihr die Förderung der Kleinen besonders am Herzen. Ihr Mann, gut einen Kopf größer als sie, sah wohlwollend auf seine zierliche Frau hinab und schien es zu genießen, dass einmal nicht er selbst im Mittelpunkt stand.
»Und warum hat er dich angerufen?«, wollte Bialas nun von ihm wissen.
Was hatte Angelhoff eigentlich zu ihm gesagt, in diesem seltsamen Telefonat vor etwa zwei Wochen? Stoevesandt musste einen Moment nachdenken. »Er wollte wissen, ob man eine Anzeige wegen Betruges erstatten kann, wenn ein Unternehmen mit unterschlagenen Informationen Geld verdient. Er hat Andeutungen gemacht, dass es sich um eine große internationale Firma in Baden-Württemberg handelte. Das Ganze war ziemlich kryptisch.«
»Mit unterschlagenen Informationen – womit man nicht alles Geld verdienen kann«, wunderte sich Friedebald Frenzel.
Andreas Bialas zog ein großes Stofftaschentuch aus der Hosentasche und rieb sich damit nachdenklich die beachtliche Nase. »Mehr hat er nicht rausgelassen?«, fragte er.
»Nein. Ich habe ihm gesagt, dass ich dazu die Fakten näher kennen müsste. Er hat mir darauf ziemlich eindringlich versichert, dass er bald Unterlagen bekommen würde. Brisantes Material – ich meine, so drückte er sich aus. Und er drang auf ein Treffen mit mir, sobald er es hätte. Er wollte es mir unbedingt zeigen.«
»Und daraus schließt du, dass es vielleicht doch kein Selbstmord war.« Es war mehr eine Feststellung als eine Frage von Andreas Bialas.
Stoevesandt hob unbestimmt die Hände: »Wie ich schon sagte: Man muss das überprüfen. Er hat auf mich nicht den Eindruck gemacht, dass er sich das Leben nehmen will. Er war wohl eher wütend. Und kampfeslustig. Das sind Selbstmörder in der Regel ja weniger.«
»Es hilft alles nichts«, sagte Bialas resolut. »Wir müssen die Spuren auswerten und die Obduktion abwarten. Haben dir die Leute in Böblingen noch keinen Bericht mitgegeben, Luca? Was ist mit dem Bericht des Arztes, der da war? Was ist mit Schmauchspuren?«
Mazzaro wedelte mit Armen und Händen: »Die stellen sich an, als wollten wir sie assimilieren. Misstrauisch wie die Romulaner. Und genauso kommunikativ. Ich habe noch nicht einmal herausbekommen, ob es überhaupt schon irgendwelche Berichte gibt.«
»Das klären wir morgen früh«, meinte Bialas. »Auf jeden Fall müssen wir wissen, ob der Mann Schmauchspuren an den Händen hatte. Wir brauchen die Obduktion … der Einschusswinkel und der Schusskanal … Und die Schusswaffe muss untersucht werden. Am liebsten bei euch im LKA mit dem ganzen Programm«, wandte er sich an Stoevesandt. »Gehören Waffe, Projektil und Hülse zusammen? Fingerspuren auf Waffe und Hülse. DNA-Spuren. Und die Herkunft der Waffe muss geklärt werden.«
Stoevesandt nickte: »Stell den Antrag. Das wird kein Problem sein, bei so einem Fall.«
»Andreas, kannst du mal kommen?« Die warme Altstimme von Hanna Stankowski, der rechten Hand von Bialas, schallte vom Waldrand zu ihnen herüber. Bialas’ Stellvertreterin wirkte auf den ersten Blick wie eine gemütliche Matrone. Doch sie war eine erfahrene und kluge Polizeibeamtin, und Stoevesandt wusste, dass Bialas fast jeden Fall mit ihr durchsprach und ihre Einschätzungen niemals überging. Ihre Stimme weckte bei Stoevesandt sofort Erinnerungen. Augenblicklich hatte er wieder diese eine Nacht vor Augen, die er und seine Leute gemeinsam mit Stankowski in der skurrilen Villa eines Verdächtigen verbracht hatten. Sie hatte in einer endlosen, zermürbenden Ermittlung eine Sonderkommission geleitet, bei denen sie auf das Fachwissen der Wirtschaftskriminalisten zurückgreifen musste. Bis in den frühen Morgen hatten sie nach Hinweisen gesucht, um ein weiteres Verbrechen zu verhindern. Stoevesandt selbst hielt sich für sehr zäh. Doch diese Frau stand ihm in nichts nach.
Die Männer gingen hinüber zu ihr. Hanna Stankowski begrüßte ihn herzlich: »Herr Stoevesandt, Sie helfen uns mal wieder? Andreas sagte mir schon, Sie kannten den Toten. Und Herr Frenzel, Sie haben den Fall? Na, da ist ja das Dream-Team mal wieder beieinander.«
Sie sah gut aus, fast jünger als damals. Ihre braunen Augen und ihr Gesicht wirkten wach und frisch. Sie mochte auf die sechzig zugehen und neigte mit ihrer kleinen, etwas stämmigen Statur zu Übergewicht, aber sie hatte eher abgenommen, und die verbliebenen Pölsterchen standen ihr gut.
»Kommt mal mit«, bat sie die Kollegen. »Wir haben da was entdeckt.«
Gemeinsam gingen sie vom Weg ab ins Unterholz des Waldes. Ein kaum sichtbarer Trampelpfad führte in ein dunkles Dickicht. Dornige Zweige und Brennnesseln gefährdeten Stoevesandts Arme und Hosenbeine. Während die drei Kollegen von der Todesermittlung sich recht flott durch das Gestrüpp arbeiteten, hatte der Staatsanwalt seine liebe Mühe, ihnen zu folgen. »Für so etwas bin ich einfach nicht richtig angezogen«, jammerte Frenzel. »Etwas overdressed, ha ha.«
Schließlich kamen sie zu einer offeneren Stelle, die kaum die Bezeichnung Lichtung verdiente. Einige Leute in weißen Overalls waren hier bereits am Fotografieren. Das Objekt war eine Art Iglu. Dafür, dass es aus Brettern, Stangen und Planen zusammengezimmert war, hatte das Gebilde eine erstaunliche Größe. Davor stand ein Einkaufswagen, daneben – aus Obst- und Getränkekisten gebaut – eine Art Tisch und Hocker. Es war eindeutig die Unterkunft eines Obdachlosen. Sie wirkte jedoch fast ordentlich, keineswegs verwahrlost. Auf dem provisorischen Tisch stand eine gekappte Plastikflasche mit Wiesenblumen. Auch beim Blick in die Behausung wurde klar, dass der Bewohner versuchte, Ordnung zu halten. Auf dem Boden lag ein großer alter Teppich und sonst nichts. Im Hintergrund sah man ein Bett aus einer dreiteiligen Matratze, wie man sie vor hundert Jahren einmal gehabt hatte. Damit die nicht auseinanderrutschte, waren Bretter an ihren Seiten vernagelt. Eine Wolldecke lag akkurat geglättet darüber. Holzkisten, wie sie für edle Weine verwendet wurden, dienten als Schränke. Die wenigen Habseligkeiten waren darin sauber gestapelt.
»Das ist ziemlich ungewöhnlich«, meinte Hanna Stankowski, »aber hier wohnt eine Frau.« Sie deutete auf ein paar Kleidungsstücke in den Holzkisten, bunte Pullover, wie sie Männer eher nicht trugen.
»Da sieht man doch, dass Armut keine Schande ist«, meinte Frenzel strahlend, der nun endlich zu ihnen aufgeschlossen hatte und sich die Pflanzenreste von der Anzugshose klopfte.
Stoevesandt überlegte. »Bei Angelhoff wurde doch nichts entwendet, oder? Wisst ihr darüber schon was?«, wandte er sich an Bialas.
Der schüttelte den Kopf: »Nicht dass ich wüsste. Sonst wären die Kollegen ja nicht so schnell von einem Selbstmord ausgegangen. Aber das muss sicher noch mal abgeklopft werden.«
»Dass die was geklaut hat?« fragte Mazzaro und spazierte ungeniert in die Obdachlosenbehausung. »Oder sogar, dass die den umgebracht hat? Das müsste dann ’ne Cardassianerin sein. Aber woher sollte die die Waffe haben?«
»Komm sofort da raus!«, herrschte Hanna Stankowski ihn an.
»Vielleicht haben wir ja eine Zeugin«, meinte Frenzel. »Dass man obdachlos ist, muss ja nicht heißen, dass man nichts hört oder sieht, nicht wahr.«
Stoevesandt hatte denselben Gedanken gehabt.
Eine Frau im weißen Overall kam auf sie zu: »Wir haben jetzt alles fotografiert. Müssen hier Spuren gesichert werden?«
Bialas machte nun auch einen Schritt in die Behausung. »Wie ist das? Bräuchten wir hier eigentlich einen Durchsuchungsbefehl?«, wandte er sich an den Staatsanwalt.
Der verzog das Gesicht: »Grundgesetz, Artikel 13, die Unverletzlichkeit des Wohnraums. Und der schützt alle Räumlichkeiten, die einem Wohnzweck gewidmet werden.«
»Und wie ist es mit DNA?« Bialas deutete auf eine Haarbürste, die neben einem kleinen Spiegel in einem der provisorischen Regale lag.
»Hach«, meinte Frenzel und verdrehte die Augen. »Wenn ich nicht weiß, woher Sie die Probe haben … Aber wenn wir die verwenden wollen, brauchen wir zuvor was Handfestes. Das wissen Sie ja.«
»Wir sollten hier verschwinden«, warf Hanna Stankowski ein, »und alles belassen, wie’s ist. Die Person, die hier lebt, hat sicher schon mitbekommen, dass es hier vor Polizei nur so wimmelt. So ungefähr weiß ich, wie wohnungslose Frauen ticken. Die sind oft recht schutzlos. Sie muss sich hier weiterhin sicher und geborgen fühlen. Wenn wir in ihren Sachen rumwühlen, dann schnappt sie die, sobald wir weg sind, und wir finden die Frau nie wieder.«
Sie hatte recht. Auch Andreas Bialas nickte.
»Die Haarprobe nehmt ihr noch«, wandte er sich an die Frau von der Spurensicherung. »Und dann sind wir hier so schnell wie möglich alle weg.«
Als sie zurück zum Parkplatz kamen, wurde gerade der Wagen von Ewald Angelhoff auf den Transporter geladen. Die weiß verhüllten Gestalten packten ihre Gerätschaften und Koffer zusammen. Die Bäume warfen schon lange Schatten, und die Hitze hatte ein bisschen nachgelassen.
Stoevesandt hatte hier nichts mehr zu tun. Er wollte sich verabschieden, als Bialas ihn auf die Seite nahm: »Wir werden morgen früh gleich eine Sonderkommission zusammennageln. Den Kollegen Hahnelt von der Böblinger Polizeidirektion nehme ich mit rein. Und ein paar seiner Leute. Die haben den ›Ersten Angriff‹ am Fundort und die ersten Dokumentationen gemacht. Deswegen will ich die dabei haben. Wir drei, Hanna, Hahnelt und ich, bilden erst mal das engste Führungsteam der SoKo.« Bialas machte eine kurze Pause und fragte dann: »Was denkst du? Soll ich euch auch anfordern? Als fachliche Unterstützung der Sonderkommission? Immerhin hat sich Angelhoff an dich als Wirtschaftskriminalist gewandt.«
Stoevesandt dachte nach. In seiner Abteilung am Landeskriminalamt gab es wahrlich genug zu tun. Und was sollte er in der SoKo, solange es nicht wirklich einen Anhaltspunkt dafür gab, dass der Tod von Ewald Angelhoff mit dem Telefonat in Verbindung stand, das Stoevesandt mit ihm geführt hatte? Bedächtig schüttelte er den Kopf: »Nein, Andreas. Bei euch stehen jetzt ohnehin die Auswertung der Spuren und die ganze Ermittlungslitanei auf dem Programm. Was sollen ich oder meine Leute dabei? Nur …« – eines wollte er sich trotzdem nicht nehmen lassen, gerade weil es ihm nicht in den Kopf wollte, dass Angelhoff sich selbst das Leben genommen hatte – »… bei der Obduktion – da wäre ich gerne dabei. Wenn da wirklich Fremdeinwirkung festgestellt wird, dann können wir ja noch mal überlegen, ob wir mit unseren Mitteln etwas für euch tun können.«
»Kein Problem. Komm einfach dazu. Ich halte dich auf dem Laufenden.« Mit festem Händedruck verabschiedeten sich die beiden Männer.
6
Ines saß auf dem kleinen Balkon, als er nach Hause kam, vor sich einen Campari Orange mit viel Eis. Auf dem Gartentisch, der hier stand, hatte sie bereits das Abendbrot angerichtet und wartete offensichtlich nur noch auf ihn. Alle Fenster in der Wohnung waren weit aufgerissen. Ob das etwas half, oder ob die Hitze nicht erst recht hereindrückte, war fraglich. Aber irgendwie musste man versuchen einen leichten Luftzug zu erzeugen.
Gerd Stoevesandt und seine Frau lebten in einer geräumigen Wohnung direkt an der Uhlandshöhe. Das Haus hatte es Ines angetan, weil es sie etwas an die Jugendstilvillen in Hamburg erinnerte. Aber auch die Lage war genial. Es war hier erstaunlich ruhig – dafür, dass man sich quasi im Zentrum der Stadt befand –, und die urbane Geräuschkulisse war im Hintergrund kaum vernehmbar. Von hier aus konnte man über eine der »Staffeln« locker zu Fuß zu den Stuttgarter Kultureinrichtungen, dem Staatstheater, der Oper im »Alten Haus« oder zur Staatsgalerie gelangen. Auch in die Innenstadt und zu den Shopping-Meilen war es nicht weit. Sie waren beide Stadtmenschen, brauchten den Rummel und ein kulturelles Angebot. Aber jetzt, in diesem heißen Sommer, zeigte sich die Kehrseite. Die Luft stand im Talkessel der Stadt und schien immer schwerer zu werden.
Ines sah erschöpft aus. Sie war Anästhesistin an einem der traditionsreichen Stuttgarter Krankenhäuser. Das große Klinikum in der Nähe von Universität und Liederhalle war wie fast alle anderen in den letzten Jahren zur Gesundheitsfabrik geworden, hatte sich aber seinen guten Ruf bewahrt. Es war ein beliebtes Haus, auch aufgrund von hohen Qualitätsstandards. Doch der durchorganisierte Operationsbetrieb und die enge Taktung der Arbeit forderten ihren Tribut, und manchmal wusste Stoevesandt, dass Ines den schwereren Beruf hatte. In der Nacht zuvor hatte sie Rufbereitschaft gehabt, und prompt hatte der Piepser sie, aber auch Stoevesandt um zwei Uhr aus dem Schlaf gerissen. Er konnte weiterschlafen, sie hetzte ins Krankenhaus. Es musste eine schwierigere Operation gewesen sein, denn sie war vor ihrem regulären Dienst nicht mehr nach Hause gekommen, was zum Glück nur noch äußerst selten passierte. Denn das ging doch an die Substanz, und auch Ines wurde nicht jünger.
»Was Schlimmes heute Nacht?«, fragte er sie und setzte sich zu ihr in die gemütliche Balkonecke, die sie sich hier mit vielen Topfpflanzen eingerichtet hatten.
»Ein Aneurysma. Der Mann hat einen solchen Dusel gehabt. Wenn der Notarzt da nicht gleich dran gedacht hätte … Und ich habe Blut und Wasser geschwitzt.«
Sie sprachen nicht mehr oft über Ines’ Patienten. Sie war lange im Beruf und hatte schon viel gesehen. Nur schwierige Fälle gingen ihr nahe, solche, bei denen auch die Anästhesie über Leben und Tod entschied. Oder wenn etwas schief gegangen war und sie sich immer noch fragte, ob sie irgendetwas versäumt hatte. Dann brauchte sie ihn, um darüber zu reden.
»Und bei dir?«, fragte sie müde.
»Da geht alles seinen ordentlichen polizeilichen Gang«, meinte er, während er sich eine Stulle mit frisch angerichtetem Mett bestrich. Er sprach nicht über Angelhoff. Das gehörte schließlich nicht zu seinem Dienstbereich. Er erzählte ein bisschen etwas über die aktuellen Fälle. Sie unterhielten sich noch eine ganze Weile über Aktien- und Firmendeals und die Selbstherrlichkeit von Politikern und Wirtschaftsbossen, über die Hitze und darüber, dass es jetzt an der Nordsee sicher angenehmer war, und ob sie noch versuchen sollten, für das Open-Air-Konzert am Wochenende auf der Solitude Karten zu bekommen. Ines war dafür – sie war Klassikfan. Ihm war es egal – seine Musik war der Jazz.
Sie ging früh zu Bett – kein Wunder. Stoevesandt holte sich noch ein Glas Chardonnay. Im Süden Deutschlands war er, das ›Nordlicht‹, zum Weintrinker geworden. Er nahm das Buch, das ihm sein Kollege Kapodakis gegeben hatte, machte die Wandleuchte auf dem Balkon an und setzte sich wieder nach draußen. Hier war es jetzt wirklich erträglich. Sie hatten oft bedauert, dass die kleine Veranda nach Nord-Osten ging. Jetzt war es von Vorteil.
Georg Kapodakis war Leiter der Abteilung OK – Organisierte Kriminalität. Er war damit auf derselben Führungsebene wie Stoevesandt. Die beiden waren in vielem sehr unterschiedlich. Kapodakis hatte einen schwarzen Humor, der für Stoevesandt manchmal grenzwertig war. Als Ausgleich liebte er deutsche Schlager, allen voran Helene Fischer und Dieter Thomas Kuhn. Was sie gemeinsam hatten, war das Interesse an gesellschaftsphilosophischen Fragen, wie sie bei einem Mittagessen in der Cannstatter Altstadt vor etlichen Jahren entdeckt hatten. Kapodakis behauptete, sein Urururururgroßvater sei griechischer Philosoph gewesen. Man wisse nur nichts von ihm, weil er schon vor zweitausend Jahren die ethische Verwerflichkeit von Steuerhinterziehung und Korruption erörtert habe, worauf er aus dem Lande gejagt worden sei und alle seine Werke vernichtet worden seien.
Seit einiger Zeit beschäftigte beide, was Menschen dazu trieb, zu schauderhaften Monstern und verantwortungslosen Charakterschweinen zu werden – die alte Frage nach Gut und Böse und ihren Ursachen. Was war Veranlagung und genetische Disposition? Welche Rolle spielten Erziehung und die Gesellschaft, in der ein Mensch aufwuchs? Sie hatten sich gemeinsam über den neuesten Trend geärgert, der durch die Hirnforschung en vogue geworden war: Gehirn-Scans würden zeigen, dass Täter nicht aus freien Stücken so handelten, wie sie es taten. Nicht die Massenmörder, Steuerhinterzieher und Kinderschänder seien schuldig, sondern die Anomalien in ihren Gehirnen. Täter als willenlose Opfer einer abnormen Biologie? Und wo blieb da das Verantwortungsbewusstsein?
Kapo, wie seine Leute ihn nannten, hatte ihm dieses Buch gegeben. »Ist von einer Seelenklempnerin«, meinte er. »Die hat’s mit der Traumdeuterei und mit den Märchen. Zum Teil bohrt sie furchtbar in der Tiefenpsychologie rum. Hab ich einfach überblättert. Aber vor allem am Anfang … Ganz interessante Gedanken …«
»Der Schatten in uns« hieß das schmale Bändchen. Und es war, wie Stoevesandt feststellen musste, eine beunruhigende Lektüre. Jeder, aber auch wirklich jeder von uns habe Schattenseiten, behauptete die Psychologin. Das seien Persönlichkeitszüge, die auf gar keinen Fall offen vor der Welt daliegen und gesehen werden sollten. Tun sie es doch, so verliere der Betreffende zumindest vorübergehend das Gesicht. Und weil damit oft große Scham und Angst verbunden sei, schaue keiner hin. »Wir versuchen einfach, uns selbst so schön wie möglich zu finden und dies von der Umwelt auch bestätigt zu bekommen, damit wir ein gutes Selbstwertgefühl aufrechterhalten können.« Doch gerade aus dem Nicht-Wahrhaben-Wollen der eigenen Schattenseiten, so die These der Therapeutin, entstehe sehr viel Destruktives – vom Zerbrechen von Beziehungen bis hin zu Mord und Totschlag.
»Eine Schattenseite auch in mir?«, überlegte Stoevesandt. Er hielt sich selbst für einen Gutmenschen. Für integer und verantwortungsbewusst, für aufrichtig und gerecht. Und außerdem für ziemlich klug. Wo sollte da bei ihm eine Schattenseite sein?
Dienstag, 23. Juli 2013
1
DIE SCHÖNE JULE
Er lag wieder auf ihr. Er keuchte in ihr Ohr. Das Messer lag kalt an ihrem Hals. Er keuchte und keuchte, und es hörte nicht auf. Es hörte nicht auf, und sie war erstarrt, gelähmt, wie abgestorben. Sie konnte keine Faser ihres Körpers regen. Noch nicht einmal die Augen schließen. Sie sah nur das Gitter an der Decke und hörte sein nicht enden wollendes Stöhnen. Es nahm einfach kein Ende.
Schweißgebadet schreckte sie hoch. Dieser verfluchte Traum. Wieder einmal. So lange hatte sie Ruhe gehabt, und nun kam er zurück, der Horror.
Sie setzte sich auf. Horchte in die Nacht. Das gewöhnliche Rascheln und Knacken des nächtlichen Waldes. Da ist nichts, versuchte sie sich selbst zu beruhigen. Er hat dich nicht gesehen, versicherte sie sich. Er kommt nicht wieder. Sie hatte zusammengekauert unter der Brücke gesessen. Ein Steinchen hatte sich gelöst, durch ihren Fuß. Es war ins Wasser gekullert. Und hatte die Aufmerksamkeit von diesem Mann erregt. Er war ein paar Schritte an der Böschung zum Fluss entlanggegangen. Auf die Brücke zu. Sie hatte seine weißen Turnschuhe gesehen, mit diesen dunklen Tropfen. Den Gürtel mit der großen Schnalle um die schmalen Hüften. Und die Mappe in seiner Hand. Beides, Mappe und Hand, mit blutigen Spritzern. Und das Tattoo zwischen Daumen und Zeigefinger, den fünfzackigen Stern und darüber, über dem Handgelenk die Schlange, die sich um einen Dolch wand.
Noch einen Schritt, und er hätte sie gesehen, wie sie da kauerte, angespannt bis zum Zerreißen, um das Zittern zu unterdrücken. Doch er war stehen geblieben, hatte sich dann umgewandt und war mit schnellen Schritten davongegangen. Sie hatte das Knirschen des Kieses unter seinen weißen, befleckten Turnschuhen gehört. Er hatte sich eilig entfernt. Dann war Stille gewesen.
2
Stoevesandt hatte am Morgen die wichtigsten Informationen im Polizeiinformationssystem gecheckt und wollte seine E-Mails bearbeiten, da stand Winfried Bechtel schon vor ihm und presste die Hände ins Nussbaumholz von Stoevesandts Schreibtisch. Der Inspektionsleiter funkelte den untergebenen Kriminaldirektor wütend an. Sogar eine Strähne des wohldrapierten Haares war verrutscht.
»Wo waren Sie gestern? Hatte ich nicht um Bericht gebeten?«
Stoevesandt antwortete erst mal nicht. Ruhig durchsuchte er die Mails von den Vortagen. Dann las er vor: »›… möchte ich über den aktuellen Stand folgender Ermittlungen informiert werden.‹ Meines Wissens ist dies gestern doch geschehen. Oder etwa nicht? Ich bin gestern noch mal mit allen betroffenen Mitarbeitern die Fälle durchgegangen. Und die haben Ihnen doch sicher nichts vorenthalten.«
»Wenn ich einen Bericht über die Arbeit der Abteilung will, dann will ich, dass der Leiter der Abteilung anwesend ist. War das jemals anders?« Bechtel hatte ohnehin eine blecherne Stimme, und wenn er sich aufregte, klang er wie Micky Maus. Leider reizte diese Tonlage Stoevesandt erst recht dazu, den Vorgesetzten auflaufen zu lassen. Er faltete die schmalen Hände vor sich auf dem Schreibtisch und sah auf sie hinunter. Die Geste war seine Art des Pausenfüllers, wenn seine grauen Zellen ungestört arbeiten wollten.
»Sie haben Fälle genannt, Herr Dr. Bechtel, über die Sie informiert werden möchten. Von einem Bericht über die Arbeit der Abteilung steht hier nichts.«