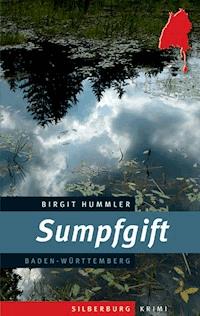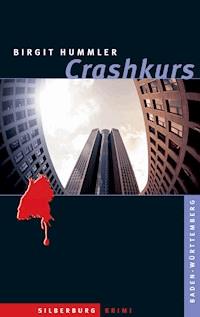Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
DAS LEBEN IST ZU KURZ, UM DEUTSCH ZU LERNEN Deutschland ist längst ein Einwanderungsland. Menschen aus vielen Ländern und Regionen der Welt finden hier einen neuen Lebensmittelpunkt. Damit stehen sie auch vor der Herausforderung, die deutsche Sprache zu erlernen. Denn Deutsch ist das Tor zur Integration. Wenn aber ein Ausländer sich mit dieser Sprache befasst, dann fangen die Wehklagen an, selbst bei Schriftstellern wie Mark Twain und Abbas Khider: Oh, wie schwer ist die deutsche Sprache. Auch bedauert jeder, der ein bisschen von deutscher Grammatik versteht, zutiefst die armen Menschen, die Deutsch lernen wollen. Aber kein Gedanke wurde bisher an diejenigen verschwendet, die das Martyrium auf sich nehmen, diese unergründliche Sprache Ausländern beizubringen, die in all den Einwanderungswellen der Vergangenheit und der Zukunft das Tor zur Integration aufstoßen und damit beherzt und unerschrocken die Vergreisung Deutschlands verhindern: An die Lehrer für Deutsch als Fremdsprache. Birgit Hummler schildert mit Humor, augenzwinkernd, manchmal auch nachdenklich, wie diese ehrenwerten Wegbereiter den Neuankömmlingen über sprachliche und andere Hürden helfen. Sie macht darüber hinaus - nicht ganz ernst gemeinte - Vorschläge für eine Reformierung der deutschen Sprache, die Ausländern, Deutschlehrern, aber auch den deutschen Kindern das Leben ungemein erleichtern würden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 198
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die WÜRDE des Menschen ist kein Konjunktiv.
Über die Autorin:
Birgit Hummler, Jahrgang 1953, ist in Stuttgart aufgewachsen und lebt heute in Breisach am Rhein.
Sie hat Sprach- und Literaturwissenschaften sowie Journalistik und Kommunikationswissenschaften studiert und als Fachjournalistin für Hörfunk und Printmedien gearbeitet. In verschiedenen Verlagen hat sie Sachbücher und Kriminalromane veröffentlicht: www.birgithummler.de
Seit 2015 ist sie in der Flüchtlingshilfe und im Helferkreis Breisach aktiv und unterstützt Zugewanderte, insbesondere beim Deutschlernen.
Inhalt
Ein Wort zum Anfang
Endlich Deutsch für alle
Deutsch – das Tor zur Integration
Sprachlos
Enthusiasten
Das Verbzweit
Ein Nürnberger Trichter
Trockene Tränen
Lückentexte
Wohnen nach Wunsch
Lernbeschleuniger
Situative Lernbeschleuniger
Artikel – wer braucht denn sowas?
Das Drama des deutschen Kindes
Lernen von anderen Sprachen
Helft den deutschen Kindern
Gebrochene Zungen, geborstene Lippen
Briefe vom Amt
Tretminen
Die ganz normale Asyl-Narretei
Berufsschul-Deutsch
Der türkische Plural
Wenn Deutsche kein Deutsch können
Schlussplädoyer
Danksagung
Literatur
Ein Wort zum Anfang
Es war zu Zeiten, als man noch unbeschwert reisen konnte. Ich war für ein paar Tage an den Bodensee gefahren, wo ich ein kleines Refugium gefunden hatte, um auszuspannen, weil ich vom Schreiben die Nase voll hatte. Ich schlenderte durch die mittelalterlichen Sträßchen des konziliaren Konstanz und fand mich vor dem Schaufenster einer Buchhandlung wieder. Mitten in der Auslage sprang mir ein kleines Büchlein ins Auge. „Deutsch für alle“ war der Titel.
Ich bin ein Sprach-Junkie. Ich gehöre zu jenen absonderlichen Menschen, die Spaß daran haben, in Bastian Sicks diversen Büchern der Reihe „Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod“ zu stöbern. Mich fasziniert die menschliche Fähigkeit, in einer Welt, die doch für alle Menschen gleich ist, eine unendliche Vielfalt sprachlicher Welten zu schaffen und damit die Wirklichkeit in eigenwilliger und origineller Weise widerzuspiegeln. Ich liebe die deutsche Sprache mit ihrer Kreativität der Wortneubildungen, mit ihrer Möglichkeit, alleine durch die Stellung von Satzgliedern subtile Feinheiten auszudrücken, mit ihrem riesigen Wortschatz und den Redewendungen, mit denen selbst die skurrilsten philosophischen Ergüsse präzise wiedergegeben werden können. Wie andere Leute Liebesromane lese ich „Das kleine Etymologicum – eine Entdeckungsreise durch die deutsche Sprache“ oder „Sprachen der Welt – warum sie so verschieden sind und sich doch alle gleichen“. Und natürlich auch Mark Twains Essay „The Awful German Language“.
Ganz klar, ich kaufte das Büchlein sofort, las es in einem Rutsch durch, um festzustellen, dass es wieder einmal minutiös die Qualen der Ausländer beim Deutschlernen behandelte, auf durchaus unterhaltsame und witzige Weise, aber einen fundamentalen Aspekt vollkommen ausließ: Die Qualen der Deutschlehrer.
Okay, man kann versuchen mit Computerprogrammen eine Fremdsprache zu erlernen. Das kann sogar funktionieren. Vielleicht mit Italienisch oder Persisch oder Japanisch. Niemals aber mit Deutsch. Mit dieser Sprache sind selbst Computer überfordert. Also braucht es Deutsch-als-Fremdsprache-Lehrer und -Lehrerinnen. Ohne sie kommt man dieser Sprache nicht bei. Und doch kommen sie nie vor in all den Klagen und dem Wehgeschrei.
Das muss geändert werden. Das habe ich mir vorgenommen. Das Ergebnis halten Sie nun in der Hand.
Wenn Sie nach diesen Worten tatsächlich gewillt sind, auf die nächste Seite zu blättern, dann möchte ich zuvor eine Warnung aussprechen. Sollten Sie zu der Gruppe von Menschen gehören, die bei dem Wort „Flüchtling“ die Krätze bekommen und dafür plädieren, die ganze Bagage wieder ins Meer zu jagen oder in libyschen Gefängnissen und griechischen Elendslagern vergammeln zu lassen, dann legen Sie dieses Buch ganz schnell wieder weg.
Wenn Sie aber zu jenen Menschen gehören, die sagen „Flüchtlinge, na ja, müssten nicht sein, sind aber nun mal da. Hauptsache, es werden nicht mehr“, dann könnten Sie von der Lektüre dieses Buches durchaus profitieren, weil es Ihnen zwei gute Gefühle vermitteln wird.
Das erste ist Hochachtung.
Hochachtung ist eine altruistische Emotion und ziert den Menschen daher grundsätzlich. Sie werden Respekt empfinden vor jedem der eingewanderten Menschen, ganz gleichgültig, aus welchem Grunde sie hier bei uns sind, die diese Sprache auch nur rudimentär beherrschen. Ihre empathischen Fähigkeiten werden damit intensiv geschult.
Das zweite Gefühl ist eine unendliche Dankbarkeit.
Dankbarkeit – je nach Ihrer weltanschaulichen oder religiösen Ausrichtung – an das Schicksal, Allah oder Gott oder einfach das Sein und das Universum dafür, dass Sie die deutsche Sprache nicht als Fremdsprache erlernen mussten. Erst wenn Sie begreifen, welch groteske Regeln und bizarre sprachliche Konstrukte Sie als Kind ganz intuitiv und selbstverständlich, quasi mit der Muttermilch, ohne Qualen und Leiden, in sich aufgenommen haben, werden Sie Ihr Glück zu schätzen wissen. Das Glück, dass Sie niemals fliehen mussten, und schon gar nicht in einen Staat, der eine solche Landessprache hat.
Ich verspreche Ihnen: Ein wohliges Gefühl wird Sie durchströmen.
Endlich Deutsch für alle
Was für ein Werk hielt ich da in Händen! Ich war begeistert, nachdem ich an einem wunderschönen Frühlingstag am Bodensee in einer antiquarisch anmutenden Buchhandlung das kleine Büchlein erstanden hatte.
Endlich hatte jemand den Mumm und die Verve. Endlich ist jemand das Wagnis eingegangen, sich dieser störrischen Sprache anzunehmen, diese krude Grammatik anzugehen und die Abstrusitäten wenigstens etwas zu glätten. Es war eine Heldentat, und die Vorschläge des Autors, wie man die deutsche Sprache so vereinfachen könnte, dass ein Nichtmuttersprachler überhaupt die Chance hat, diese Sprache halbwegs korrekt zu sprechen und zu schreiben, konnte ich nur voll und ganz begrüßen.
An manchen Stellen gingen sie mir nicht weit genug. Aber dazu später mehr.
Trotz allen Lobes und aller Dankbarkeit – ein bisschen geärgert haben mich die Wehklagen. Angefangen bei Mark Twain, der sich bitter über die „Awful German Language“, die „schreckliche deutsche Sprache“ beschwert, über Marcel Proust, der die „schwerfällige germanische ‘Feinheit‘“ belächelt, den syrischdeutschen Schriftsteller Rafik Shami, der indirekt auf die furchtbaren Germanistinnen schimpft, die unentwegt grammatikalische Fehler korrigieren, die US-amerikanische Berliner Autorin Elvia Wilk, die konstatiert, „diese Sprache ist felsiges Gelände“, die nicht dazu geeignet sei, Neuankömmlinge in Deutschland einzugliedern, bis hin zum Autor von „Deutsch für alle“, dem irakisch-deutschen Schriftsteller Abbas Khider. Immer wieder dieses Wehgeschrei.
Okay, es ist nicht leicht, wenn wir – sagen wir einmal – uns über deutsches Brot unterhalten, sich an alle notwendigen Vokabeln wie „Backwarenherstellung“, „Backofentemperatureinstellung“ oder „Getreidemahlerzeugnisse“ zu erinnern, dabei die Worte „Herstellung“ und „Einstellung“ nicht zu verwechseln, zugleich zu überlegen, ob Gebäck, Brezeln oder Kuchen männlich, weiblich oder sächlich sind, wie die Mehrzahl davon heißt und ob es überhaupt eine gibt. Es ist mir völlig klar, dass man als Nichtmuttersprachler zugleich überlegen muss, ob es „den süßem Kuchen“ oder „dem süßem Kuchen“ oder eventuell ganz anders heißt, parallel dazu den Satzaufbau bewältigen und überschauen muss, welches der Haupt- und welches der Nebensatz ist, dann noch die Verben korrekt positionieren und schließlich die Worte „süß“ und „Brötchen“ richtig aussprechen sollte, weil „sis“ und „Bretschen“ kein (deutscher) Mensch versteht.
Alles nicht einfach. Ich verstehe durchaus, dass einen diese Sprache „an den Rand des Wahnsinns“ treiben und im „Gehirn (…) vieles durcheinander“ bringen kann. Aber dass sie den Autor „mehr Tränen vergießen“ ließ „als manch schreckliche Erfahrung während“ seiner Flucht, das scheint mir doch übertrieben. Glauben die Ausländer eigentlich, dass nur sie leiden? Warum sind sie so beleidigt? Immerhin sind solche Schriftsteller das beste Beispiel dafür, dass es tatsächlich gelingen kann. Dass ein Nichtmuttersprachler diese Sprache so erlernen kann, dass er nicht nur die deutschen Philosophen liest und verstehen kann, sondern sogar Bücher in dieser aberwitzigen Sprache verfasst!
Sie klagen alle: Ach, die deutsche Sprache erlernen – so schwer, so schwer. Sie haben keine Ahnung. Sie wissen nicht, was wirkliches Leiden ist. Das wahre Martyrium, die ultimative Herausforderung ist es, DEUTSCH ZU UNTERRICHTEN!
Deutsch – das Tor zur Integration
Da denkt man, das habe ich ja schon mal gemacht, das bekomme ich hin. Denn immerhin habe ich während meines Studiums der deutschen Sprache und Literatur meinen Lebensunterhalt damit verdient, italienischen Gastarbeitern eben diese Sprache beizubringen. Um dies möglichst gut zu machen, studiert man dann auch „Deutsch als Fremdsprache“, eignet sich die Methoden der Kontrastiven Grammatikvermittlung an und lernt ein bisschen Italienisch. Denn hätte ich meinen Sizilianern erklärt, dass im Deutschen die Negation nach dem Verb steht, dann hätten sie mich angeschaut wie ein Cinquecento, weil sie mit ihren vier Jahren Grundschule weder den Begriff Negation noch Verb jemals gehört hatten. Wenn ich ihnen aber erklärte, dass man im Deutschen nicht „io non vado“ (ich nicht gehe) sondern „io vado non“ (ich gehe nicht) sagt, dann lachten sie sich halbtot, aber sie verstanden es. Die Schlauen konnten es manchmal sogar richtig anwenden. So habe ich immerhin meinen integrativen Beitrag dazu geleistet, dass wir uns nicht nur von Burger und Döner ernähren müssen, weil heute jedes Kaff seine Pizzeria hat, und dass „Spaghetti-Fresser“ kein Schimpfwort mehr ist, weil wir alle welche sind.
Ich war also gewappnet und guter Dinge, als die Flüchtlingswelle über uns hereinbrach. Deutsch – das ist das Tor zur Integration. Ohne Deutsch hat keiner eine Zukunft in diesem Land. Ich würde wieder Deutsch unterrichten.
Die erste Schülerin, die ich hatte, war aus Eritrea, sprach kein Wort Englisch, nicht Französisch oder sonst eine Sprache, von der ich wenigstens ein paar Brocken verstanden hätte. Ihre Muttersprache war Amharisch. Ich hatte zuvor gar nicht gewusst, dass eine solche Sprache existiert, geschweige denn, dass ich die Schriftzeichen je gesehen hätte. Da stand ich nun mit meiner Kontrastiven Grammatik.
Ob Maryam von dieser Art Fremdsprachenvermittlung durch den Vergleich der Wortstellungen und der Wortbildung profitiert hätte, weiß ich nicht. Es fiel ihr nach all den Monaten, in denen ich mich redlich bemüht hatte, nach wie vor schwer, einen deutschen Satz korrekt zu sprechen, der mehr als fünf Worte hatte. Es lag wohl nicht an einem Mangel an Talent. Dumm war sie sicher auch nicht. Ihr Vater war bei einem Pogrom gegen evangelikale Christen, einer nicht anerkannten religiösen Minderheit, ums Leben gekommen. Die restliche Familie hatte fliehen müssen. Als ich sie einmal fragte, ob sie überhaupt in einem Zimmer mit muslimischen und katholischen Frauen leben könnte, wiegte sie den Kopf und meinte: „Wir wissen längst, dass es nur einen Gott gibt, egal wie er genannt wird.“
Vielleicht war es auch einfach so, dass ihr Kopf nie richtig bei der Sache war, weil Erinnerungen und Kümmernisse sie gefangen hielten. Erinnerungen an ein Leben, in dem sie fast immer auf der Flucht war, herumgeschubst und wohl ein paar Mal vergewaltigt worden war. Kummer und Sorgen um ihre kleine Tochter, hervorgegangen aus eben einer solchen Gewalttat, die bei der Großmutter in Somalia aufwuchs und zum großen Kummer von Maryam im fernen Deutschland keine Chance hatte, zur Schule zu gehen. So wie die Mutter, die heimatlos nie die Gelegenheit gehabt hatte, kontinuierlich eine Schule zu besuchen.
Aber auch solche Menschen können eine Fremdsprache lernen, wie ich später immer wieder festgestellt habe. Ich sah das Versagen vor allem bei mir und in der Tatsache, dass aufgrund meiner rudimentären Amharisch-Kenntnisse keine vernünftige Verständigung möglich war. Auf die Idee, dass es auch maßgeblich an meiner vertrackten Muttersprache liegen könnte, kam ich noch nicht.
Die nächsten Schüler waren zwei junge Männer aus Gambia. Dort spricht man neben den Stammessprachen Englisch. Wunderbar – das müsste funktionieren.
Doch ich verstand kein Wort. Ich zweifelte daran, ob ich tatsächlich acht Jahre Englischunterricht gehabt hatte. Es war natürlich klar, dass die beiden kein Oxford-English sprachen. Aber in den USA hatte ich mich nach ein paar Tagen so eingehört, dass ich doch wesentlichen Teilen der Konversation folgen konnte. Mit den Gambiern – keine Chance.
Zum Glück waren Lamin und Omar nicht auf den Kopf gefallen, für gambische Verhältnisse sehr gut gebildet, hatten acht oder neun Schuljahre hinter sich. Wohlgemerkt auf der Englischen Schule, nicht nur auf der Koranschule wie manche andere. Die beiden waren ein echter Segen für mich. Denn hätte ich zunächst Westafrikaner unterrichten müssen, wie ich sie später immer wieder traf, die ihr ganzes junges Schulleben nur damit verbracht hatten, arabische Schriftzeichen zu üben und die Suren des Korans auswendig zu lernen, die nie systematisch die lateinische Schrift und außer Mandinka, Wolof oder Fula nur das Arabisch des Korans gelernt hatten, ich hätte den Job wahrscheinlich geschmissen.
So hatte ich immerhin die Möglichkeit, die englischen Wörter an die Tafel zu schreiben und tatsächlich ein verstehendes Nicken zu ernten. Wir konnten ein Wörterbuch zurate ziehen. Und es gelang mir dadurch die fremden Klänge zu entschlüsseln und zu verstehen, dass „brosso“ „brother“ hieß. Hinzu kam, dass die beiden eine nicht unwesentliche Zahl an deutschen Vokabeln sehr schnell lernten, weil die englischen Wörter germanischen Ursprungs doch sehr ähnlich sind. Die Aussprache der Wortkombination schw in Schwester konnte natürlich von keinem der beiden korrekt gemeistert werden. Aber ich war gnädig. Solange ein Durchschnittsdeutscher verstand, was eine Swester ist, war mir das schnurzpiepegal. Die Parallele zu „sister“ machte das Ganze erträglich für die beiden.
Zur Qual für uns alle wurde es jedoch, als ich den Akkusativ und den Dativ erklären wollte.
Akkusativ, Dativ – wozu braucht man das? Wissen Sie’s, verehrte Leserin, verehrter Leser?
Über diese Frage habe ich lange nachgedacht. Bis ich schließlich zu diesen Satzkonstrukten kam:
Der Hund beißt den Mann oder Den Mann beißt der Hund.
Der Mann beißt den Hund oder Den Hund beißt der Mann .
Na, das ist doch wohl ein Unterschied. Wer wen? Damit wäre doch zumindest der Akkusativ mal erklärt. Ich triumphiere.
Große, entsetzte afrikanische Augen schauen mich an.
„Passiert das wirklich in Deutschland?“
„Machen deutsche Männer wirklich so etwas?
Ich resignierte.
Und ich war nicht die Einzige. Wie viele Enthusiasten hatten sich spontan gemeldet, um zu helfen, um zu unterrichten. In unserer kleinen Stadt mit den grade mal 14.000 Einwohnern hatten sich mehr als vierzig Leute bereit erklärt, beim Deutschlernen zu unterstützen oder gar ganze Klassen zu unterrichten. Weit mehr als hundert Menschen waren bereit, Angela zu unterstützen beim „Wir schaffen das“. Aus Volksverbundenheit und Fremdenfreundlichkeit. Weil sie wussten (die meisten jedenfalls), dass die Deutschen ohne die vielen Einwanderungswellen der letzten Jahrzehnte längst ein Volk im Altersheim wären. Weil sie nicht nur Menschen in Not helfen, sondern auch dafür sorgen wollten, dass diese eine Bereicherung für unser Land werden und nicht den Einheimischen durch Reibungspunkte und Konflikte Kummer bereiten. Mit einer ungeheuren Tatkraft, mit Feuereifer und Hilfsbereitschaft machten wir uns ans Werk, stürzten uns in die Klassenzimmer, die uns überall, bei der Caritas, bei der Volkshochschule, in kirchlichen Gemeindezentren zur Verfügung gestellt wurden, sammelten Lehrmaterialien, didaktisch aufbereitet, extra für Flüchtlinge entwickelt, knieten uns rein – und resignierten.
Nicht nur Laien, die sich ihrer unendlichen Naivität sagten: „Ich kann Deutsch, also kann ich helfen.“ Da waren auch ehemalige und aktive Grundschullehrer, Lehrerinnen und Lehrer von höheren Schulen, der ehemalige Rektor einer Berufsschule, Leute, die Jahrzehnte an Volkshochschulen Fremdsprachen unterrichtet hatten. Man muss voll Anerkennung konstatieren, dass diese Gruppe von Lehrern oft am längsten durchhielt, waren sie ja gewohnt, auch mit Schülern zu tun zu haben, deren Lernerfolge sich trotz größter Bemühungen in Grenzen hielten.
Doch letztendlich erfasste auch sie der Frust. Nicht nur wegen der Schüler mit begrenzten Lernerfolgen. Sie verzweifelten auch an der deutschen Sprache. „Die deutsche Sprache ist so schwierig, dass sie bestens als Mittel der Ausgrenzung funktioniert“, konstatierte die amerikanische Redakteurin und Autorin Elvia Wilk 2015 in der ZEIT und bescheinigt dem Deutschen eine Komplexität, die „eine fantastische Grundlage dafür (bildet), diejenigen auszugrenzen, die sie nicht beherrschen.“ Auch mir schwante nach und nach: Es muss auch etwas mit meiner Muttersprache zu tun haben.
Ein Beispiel, liebe Leser und Leserinnen:
Das Wörtchen das(s).
Harmlos, schlicht und einfach auszusprechen. Aber dann sind solche Sätze möglich: Das(s) er das(s) Haus, das(s) er gekauft hat, bezahlen kann, ohne das(s) er hohe Schulden macht, das(s) glaube ich nicht.
Das harmlose Wörtchen das(s) kann nämlich Artikel, Demonstrativpronomen, Relativpronomen oder Konjunktion sein. Und wenn Sie, lieber Leser, liebe Leserin, nun den Unterschied nicht auf Anhieb erklären können, wie muss es dann einem passabel Englisch sprechenden Afrikaner ergehen? Der würde einfach sagen: That he could pay for the house he has bought without having high debts, this I cannot believe. Einwandfrei und klar wird unterschieden: That, the und this. Im Englischen kommt man sogar ohne das Relativpronomen aus.
Das(s) wäre alles nicht dramatisch, wenn man immer wüsste, wann das(s) mit einem s und wann mit Doppel-s geschrieben wird. Schauen Sie sich mal Ihre E-Mails, Ihre SMS- und WhatsApp-Messages an – Ihre eigenen und die Ihrer deutschen Kommunikationspartner. Sind Sie wirklich sicher, das(s) Sie und andere gebildete Leute immer das richtige das(s) treffen? Können Sie guten Gewissens sagen: Ich weiß, dass das so richtig ist. Oder eher: Das dass so ist, dass wissen wir nicht gewiss. Und sind Sie sicher, das(s) hier alles stimmt: „Dass dasselbe und das Gleiche nicht dasselbe ist, das sieht man schon daran, dass dasselbe zusammen und das Gleiche auseinander geschrieben wird.“?
Und noch so ein Wort: sie.
Es kommt ganz unscheinbar daher. Aussprache? Simpel! Im Amharischen, im Arabischen, in Mandinka und in Farsi gibt es die Laute s und i. Also von daher kein Problem.
Wenn Sie sie heute sehen, dann sagen Sie … ihr oder ihnen(?), dass sie heute nicht kommen . Oder: dass Sie heute nicht kommen. Oder etwa: dass sie heute nicht kommt .
Blicken SIE da noch durch? Und wissen SIE, ob es eine Person ist oder mehrere, die ihnen oder ihr etwas mitteilen soll(en)? Aber ein junger Afghane, aufgewachsen im Bergland von Paktia, einer Provinz im Südwesten an der Grenze zu Pakistan, der dort das Vieh der Familie gehütet hat, nie eine Schule besuchen konnte, der erlebt hat, wie der Onkel von den Taliban erschossen und die ganze Familie mit dem Tod bedroht worden war, und der fast zwei Jahre auf der Flucht war, der soll das verstehen.
Sprachlos
Es wäre allerdings durchaus wünschenswert, dass er es verstehen könnte. Denn wie es ist, wenn Syrer, Irakerinnen, Schwarzafrikaner, Georgier, Pakistani und Afghaninnen wild zusammengewürfelt werden, keiner ein Wort Deutsch spricht und man auch sonst keine gemeinsame Sprache findet, das haben all diejenigen der hochmotivierten Helfer erlebt, die sozusagen erste Hilfe bei den Neuankömmlingen leisteten. Wie haben wir die Babylonier verflucht, die mit ihrem bescheuerten Turmbau zu Babel den lieben Gott so erzürnten, dass er die sprichwörtliche babylonische Sprachenverwirrung über die Menschheit hereinbrechen ließ und damit das Chaos auslöste, das heute noch auf manchen Baustellen herrscht.
Man hatte in unserer Stadt eilig ein Containerdorf hochgezogen und darin in kürzester Zeit 350 Menschen untergebracht. Betten und Spinde waren da. Aber nichts zu essen. Geld hatten die Neuankömmlinge noch keines. Also konnten sie auch nichts einkaufen, aber hungrig und erschöpft waren sie. Nur wenige der Kinder weinten. Sie taten das, was sie seit Wochen und Monaten gelernt hatten: Sie verhielten sich so ruhig und genügsam wie möglich und klammerten sich an die Eltern. Doch die Erwachsenen machten Handzeichen. Die Leute hatten Durst. Sie brauchten wenigstens etwas zu trinken.
In aller Eile besorgten die Leute aus unserem Helferkreis Getränke und belegte Brötchen und verteilten sie. Ein Mann schaute misstrauisch die Brötchen an und fragte etwas. Kein Mensch außer seinen Landsleuten verstand ihn. Und die nickten heftig zu seinen Äußerungen. Was sie wollten, blieb uns ein Rätsel. In einer unbekannten Sprache redete eine Frau auf Gisela ein. Es muss etwas Wichtiges gewesen sein. Bis heute weiß Gisela nicht, was die Frau von ihr wollte. Die Campleitung teilte die Leute so gut es ging nach Ethnien auf die Drei-Personen-Kabuffs der Wohncontainer auf. Wünsche, die von den Flüchtlingen geäußert wurden, konnten nicht als solche verstanden werden. Was sich später oftmals als fatal erwies, weil man als gutwilliger deutscher Sozialarbeiter einfach nicht wusste, dass man eine Iranerin nicht unbedingt mit einer Araberin ins gleiche Zimmer stecken konnte, weil die Iranerin – aus welchem Grund auch immer – Araber hasste. Oder dass ein Afghane nicht gleich Afghane ist. Wie sollte man die wortreichen Proteste eines Paschtunen verstehen, inhaltlich und sprachlich, der sich partout weigerte, mit einem Angehörigen der Ethnie Hazara zusammen einen Raum zu bewohnen, einem Volk, das ebenso wie das der Paschtunen im Herzen Afghanistans beheimatet ist. Der Ärger war vorprogrammiert. Streit ist auch ohne gemeinsame Sprache möglich. Da reichen Blicke und böse Taten. Zum Glück verstand man die Schimpfwörter der Gegenseite nicht immer – was sich später ändern sollte, als man sich auf deutsche Beleidigungen einigte.
Mit den Afrikanern glückte die Verständigung noch am einfachsten, weil viele von ihnen ganz gut oder zumindest ein paar Brocken die Sprache ihrer ehemaligen Kolonialmächte beherrschten. So kam man immerhin bei ihnen mit Englisch und Französisch ein bisschen weiter. Wobei die Illusionen gerade bei ihnen groß waren.
Denn Ghebrai aus Eritrea, Ebrima und Lamin aus Gambia und auch Mohsen, der in seinem Heimatland Iran etliche Jahre Englischunterricht hatte, fragten deutsche Passanten ungeniert auf Englisch nach dem Weg zum Bahnhof, zur Bank oder zum Landratsamt. Alle gingen sie selbstverständlich davon aus, dass sie sich in Deutschland problemlos mit Englisch verständigen könnten. Schließlich ist Deutschland ein Land mit einer hohen Kultur und einer hervorragenden Bildung. Was für ein Irrtum!
Ghebrai, schon seit vier Jahren in Deutschland, ist immer noch fest davon überzeugt, dass die Deutschen auf Englisch antworten könnten, aber nicht wollen. Mohsen aus dem Iran musste mehrere Anläufe machen, nachdem er mit einem überfüllten Bus von der österreichischen Grenze in eine große deutsche Stadt gekarrt worden war, bevor er auf seine englisch gestellte Frage hin erfuhr, dass er in München gelandet war. Von hier aus fuhr er weiter nach Frankfurt, weil er dort die Adresse von Landsleuten hatte. Auch hier wollte niemand seine englischen Fragen beantworten, bis endlich ein junger Mann auf den Zettel schaute, auf Deutsch etwas erklärte, was Mohsen nicht verstand, schließlich sein Handy zückte, eine deutsch-persische Übersetzungs-App aufrief, etwas eintippte und Mohsen die persische Übersetzung zu lesen gab: „Folge mir!“
Ebrima und Lamin, die beide recht gut und verständlich Englisch sprechen, versuchten verzweifelt, sich zu Fuß durch die Stadt vom Bahnhof zum Landratsamt durchzuschlagen und bekamen überhaupt keine Antwort auf ihre Fragen. Zum Landratsamt musste man aber unbedingt, und möglichst bevor es zumachte, damit man registriert wurde und überhaupt eine Unterkunft bekam. Die beiden wissen bis heute nicht, wie sie es geschafft haben, das Amt nach stundenlangem Herumirren zu finden. Mag sein, dass hier auch die Hautfarbe eine Rolle spielte. Aber, liebe Leserin, lieber Leser, machen Sie doch selbst einmal das Experiment: Sprechen Sie in deutschen Städten mal ein Dutzend Passanten an und fragen Sie auf Englisch nach dem Weg. Wie viele werden Ihnen auf Anhieb englisch antworten?
Doch viele der Neuankömmlinge konnten außer ihrer Muttersprache keine andere. Dolmetscher waren auch noch lange, lange nach der Ankunft der Gestrandeten ein frommer Wunschgedanke. Was also tun, wenn eine junge schwangere Frau aus Afghanistan plötzlich Schmerzen bekommt? Der Helferkreis hatte einen Notdienst eingerichtet, sogar am Wochenende. Einer derjenigen, die fast immer und fast rund um die Uhr bereitstanden, war Herbert, ein älterer deutscher Herr mit grauem Vollbart. Er war zur Stelle und brachte sie ins Krankenhaus.
Dort stellt der Arzt Fragen, die die junge Frau nicht versteht. Was sie wiederum äußert, löst lediglich fragende Blicke aus. Den Anamnese-Bogen versuchen Herbert und die junge Frau mit dem Google-Übersetzer Deutsch-Farsi auszufüllen. Da stellt der Arzt sich stur. Ohne Dolmetscher behandelt er nicht. Er hat wohl seine Gründe, denn seinem Aussehen nach hat er selbst einen Migrationshintergrund und weiß vielleicht, was dabei herauskommt, wenn man den Anamnesebogen vom Google-Translator ins Türkische übersetzen lässt:
Welche Methode verwenden Sie zur Schwangerschaftsverhütung und seit wann?
Rückübersetzung aus dem Türkischen: Welche Methode verwenden Sie zur Empfängnisverhütung und seitdem?
Mit wieviel Jahren hatten Sie zum ersten Mal Ihre Regelblutung?
Rückübersetzung aus dem Türkischen: Wie viele Jahre haben Sie ihre Periode zum ersten Mal gemacht?
Wenn Spirale, wie lange liegt sie schon?
Wenn es eine Spirale ist, wie lange hat es gedauert?
Oder – was eigentlich ja funktionieren müsste – Übersetzungen ins Englische: Wann war Ihre letzte Regelblutung? When was her last bloody rule?
Aber der Arzt braucht Antworten auf diese Fragen.