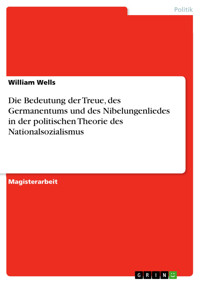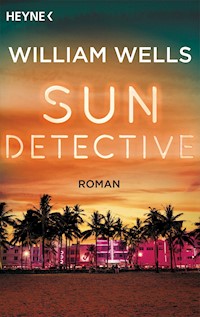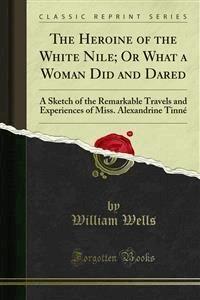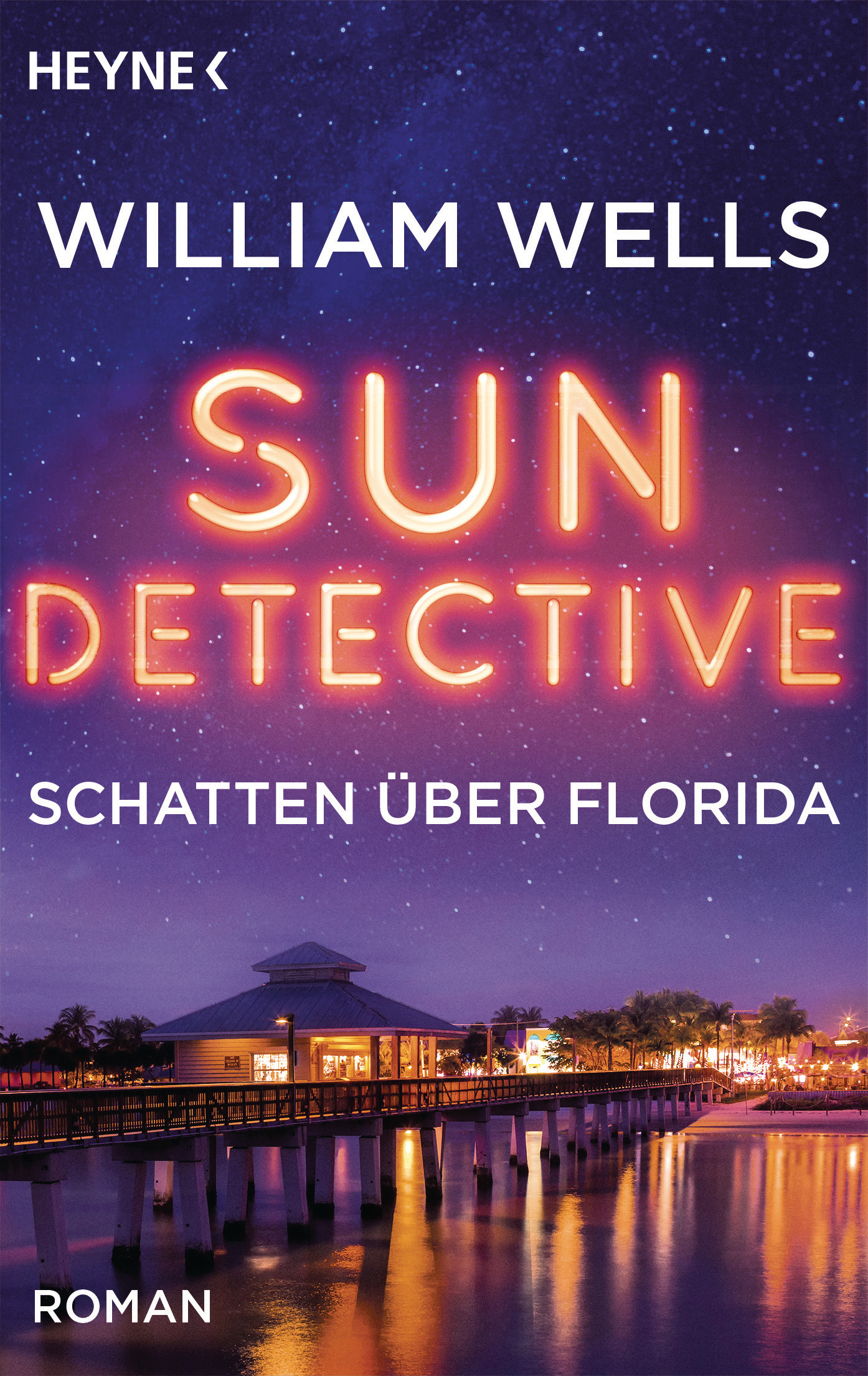
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Sun-Detective-Serie
- Sprache: Deutsch
Cooler Crime im Sunshine State: der zweite Fall des Sun Detective!
Der Ruhestand von Ex-Cop Jack Starkey ist ein Traum: Sein Hausboot „Phoenix“ liegt am Fort Myers Beach in Florida und seine Kneipe „Drunken Parrot“ ist eine Institution. Doch irgendwie will sich die Gelassenheit nicht einstellen. Als die Küstenwache ein Segelboot mit den Leichen eines Banker-Ehepaares an Bord aufgreift, bittet ihn sein Freund, der überforderte Police Chief, um Hilfe. Als Starkey zu ermitteln beginnt, wird er in einen brandheißen Fall von Offshore-Bohrungen, korrupten Politikern und einem russischen Oligarchen hineingezogen, der ihn sogar zu seinen Hochzeiten als Cop den Kopf gekostet hätte. Doch seine besten Jahre liegen weit hinter ihm…
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 283
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Das Buch
»Die Küstenwache hat zwei Leichen auf einem Segelboot entdeckt, das im Pine Island Sound vor sich hin trieb. Ein Mann und eine Frau. Beide mit Kopfschuss.«
»Wo ist das Boot jetzt?«, frage ich.
»Die Küstenwache hat es zu ihrem Stützpunkt auf San Carlos Island geschleppt.«
»Bist du schon auf dem Boot gewesen?«
»Bin gerade auf dem Weg dahin. Ich möchte, dass du einen Blick auf den Tatort wirfst. Bei uns im Revier hat keiner so viel Erfahrung mit Mordfällen wie du.«
»Klar, ich helfe gern«, sage ich.
Ich weiß nicht wer den Spruch »Keine gute Tat bleibt ungestraft« erfunden hat. Aber wer es auch war, er hatte recht, wie ich schon bald feststellen sollte – und zwar verdammt recht.
Der Ruhestand von Ex-Cop Jack Starkey ist ein Traum: Sein Hausboot »Phoenix« liegt am Fort Myers Beach in Florida und seine Kneipe »Drunken Parrot« ist eine Institution. Doch irgendwie will sich die Gelassenheit nicht einstellen. Als die Küstenwache ein Segelboot mit den Leichen eines Banker-Ehepaares an Bord aufgreift, bittet ihn sein Freund, der überforderte Police Chief, um Hilfe. Als Starkey zu ermitteln beginnt, wird er in einen brandheißen Fall von Offshore-Bohrungen, korrupten Politikern und einem russischen Oligarchen hineingezogen, der ihn sogar zu seinen Hochzeiten als Cop den Kopf gekostet hätte. Doch seine besten Jahre liegen weit hinter ihm…
Der Autor
William Wells wurde in Detroit, Michigan, geboren. Er hat Englische Literatur studiert, auf einem Navy Schiff gedient, als Journalist gearbeitet, Reden für Politiker geschrieben und einen Corporate Publishing Verlag gegründet. Zusammen mit seiner Frau lebt er an der Südwestküste von Florida.
William Wells
Sun Detective
Schatten über Florida
Roman
Aus dem Amerikanischen von Wolfgang Müller
WILHELM HEYNE VERLAG MÜNCHEN
Die Originalausgabe erschien 2018 unter dem Titel THE DOLLAR-A-YEAR DETECTIVE bei The Permanent Press
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Vollständige deutsche Erstausgabe 06/2020
Copyright © 2018 by Permanent Press
Copyright © 2020 dieser Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Heiko Arntz
Umschlaggestaltung: DAS ILLUSTRAT, München,
unter Verwendung eines Motivs von Nadezda Murmakova / Shutterstock
Satz und E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN: 978-3-641-23640-3V001
www.heyne.de
Für Mary, wie immer
»Wie oft habe ich Ihnen schon gesagt, dass nach der Eliminierung des Unmöglichen immer die Wahrheit übrig bleibt – so unwahrscheinlich sie auch sein mag.«
Sir Arthur Conan Doyles Sherlock Holmes
Enterkommando
Die plötzliche Flaute im Pine Island Sound bewirkte, dass das Segelboot – eine zwölf Meter lange Catalina-Schaluppe namens Joie de Vivre, die nach Backbord geneigt auf Raumwindkurs dahingesegelt war – allmählich langsamer wurde, sich schließlich aufrichtete und nur noch im Wasser trieb.
Der Märzabend war warm und schwül, und ohne den Wind, der die weißen Segel gebläht und das Boot vorwärtsgetrieben hatte, kam es dem Mann und der Frau auf Deck so vor, als wäre die Temperatur um zehn Grad gestiegen.
Der Mann schaute hinauf in den nächtlichen Sternenhimmel, als könne ihm ein uralter Seemannsinstinkt sagen, ob bald wieder mit Wind zu rechnen sei. Er strich sich übers Kinn und sagte zu seiner Frau: »Wir können den Motor anwerfen und gleich nach Fort Myers zurückfahren, oder wir warten ab, ob der Wind noch mal auffrischt.«
Während sie darüber nachdachten, hörten sie das unverwechselbare Tuckern eines Außenbordmotors, das sich ihnen vom Ufer her näherte. Der Mann und die Frau drehten sich um und sahen im Schein des Dreiviertelmonds, der von keiner Wolke getrübt wurde, ein kleines weißes Boot mit roten und grünen Positionslichtern auf sie zuhalten.
Ein Boston Whaler, dachte der Mann. Die Silhouette war unverkennbar. Der Motor wurde gedrosselt, der Bug neigte sich, und die zwei Delfine, die dem Boot im Kielwasser gefolgt waren, tauchten unter.
»Ahoi!«, rief eine männliche Stimme. »Darf ich längsseits kommen?«
Der Mann schaute seine Frau an, zuckte mit den Schultern und wandte sich wieder dem Boot zu. Er formte die Hände vor dem Mund zu einem Trichter und rief: »Wer sind Sie?« Als ob er den Mann – was immer er auch antworten würde – daran hindern könne, längsseits zu kommen.
Wie ein Politiker in einer Talkshow wechselte der Fremde das Thema und rief: »Hab Sie da dümpeln sehen und mir gedacht, ich könnte Sie in Schlepp nehmen.«
Der Whaler war jetzt noch gut fünf Meter von der Steuerbordseite des Segelschiffs entfernt. Das Gesicht des Fremden war im Mondlicht deutlich zu erkennen. Er war etwa Ende dreißig, Anfang vierzig und trug Jeans und ein schwarzes T-Shirt.
Der Mann sagte zu dem Fremden: »Danke, aber wir kommen zurecht.« Lautes Rufen war jetzt überflüssig, das Boot lag inzwischen längsseits, und der 150-PS-Yamaha-Außenborder stotterte im Leerlauf. »Wir haben einen Motor.«
Das Abschleppangebot war seltsam, dachte der Mann. Segelboote von der Größe der Joie waren selbstverständlich motorisiert, und wenn er tatsächlich hätte abgeschleppt werden wollen, hätte er die Küstenwache gerufen. Vielleicht ein Tourist, der den Whaler gemietet hatte und sich mit solchen Dingen nicht auskannte. Jede Menge Touristen schipperten hier herum. Mit ihrer Ahnungslosigkeit sorgten sie immer wieder für Ärger. Erst im letzten Jahr hatten er und seine Frau eine Familie gerettet – Mann, Frau, halbwüchsige Tochter, schwarzer Labrador. Sie hatten versehentlich die Fahrrinne zwischen Fort Myers Beach und Sanibel Island verlassen und waren mit ihrem gemieteten Pontonboot auf eine Sandbank gelaufen. Nun ja, gerettet ist übertrieben, das Boot konnte ja nicht sinken. Ein Akt der Hilfsbereitschaft. Die Wassertiefe in den Küstengewässern des Golfs von Mexiko war trügerisch. Wenn man nicht in der Fahrrinne blieb, konnte man leicht in Untiefen von einem halben Meter Tiefe oder weniger geraten, und wenn man es merkte, war es in der Regel zu spät. Jedenfalls hatten die Schiffe vom Sea-Tow-Pannendienst und die Küstenwache genug zu tun.
Außerdem fragte sich der Mann, wie der Fremde ihr Segelboot, selbst mit den Positionslichtern und dem Topplicht, aus so großer Entfernung hatte sehen können, geschweige denn erkennen, dass es in einer Flaute dahintrieb. Sonderbar …
»Okay«, sagte der Fremde. »Ich bin gerade am Angeln. Was dagegen, wenn ich mal kurz Ihre Toilette benutze?« Er stand mit einer zusammengerollten Leine da und wartete auf die Erlaubnis, sie an Bord werfen zu können.
Nachtangeln war nichts Ungewöhnliches. Natürlich hätte der Fremde einfach über Bord pinkeln können. Aber der Mann und die Frau respektierten als erfahrene Segler die traditionelle Höflichkeit auf See. »Klar, kein Problem«, sagte der Mann. Warum sich unnötig den Kopf zerbrechen.
Der Fremde warf die Leine herüber, die neben die Füße des Mannes auf das Bootsdeck fiel. Er hob sie auf und machte sie mit einem Kopfschlag an einer Klampe fest.
»Danke«, sagte der Fremde. »Hatte wohl ein paar Bierchen zu viel.«
Das Ein-Mann-Enterkommando stieg auf das Segelboot und ging zu dem Paar, das in der Plicht stand. Einen Meter vor ihnen blieb er stehen, zog eine schwarze Pistole aus dem Gürtel seiner Jeans, schob eine Patrone in die Kammer, richtete die Waffe auf das Paar und sagte: »Kennen Sie mich noch?«
Doch selbst wenn sie ihn erkannt hätten – er stand jetzt so dicht vor ihnen, dass sie nur die Pistole anstarrten.
»Macht nichts«, sagte der Fremde und lächelte. »Gehen wir nach unten und unterhalten uns ein bisschen.«
1.
Seinen Traum leben
Meiner Erfahrung nach träumen viele Polizisten den gleichen Traum vom Ruhestand: Sie leben auf einem Boot in tropischen Gefilden, wie Sonny Crockett in Miami Vice, besitzen vielleicht noch eine Strandbar samt strohgedeckten Tiki-Hütten und Wet-T-Shirt-Contests, und sind – falls geschieden wie die meisten Polizisten (Berufsrisiko) – mit einer wunderschönen Frau liiert, die seine Fehler toleriert und seine Qualitäten zu schätzen weiß, so verborgen sie auch sein mögen.
Ich rede von männlichen Polizisten. Über die Ruhestandsträume von weiblichen Polizisten weiß ich nichts. Wenn schon Freud – wie er bekanntermaßen selbst erklärte – keinen Schimmer hatte, was Frauen wollen, wie sollte dann ein Kerl wie ich auch nur die leiseste Ahnung davon haben? Mein dringender Rat lautet: Wenn einem eine Frau sehr präzise schildert, was sie will, und sollte man die Beziehung über dieses Gespräch hinaus fortführen wollen, dann ist man gut beraten, genau zuzuhören.
Mein Name ist Jack Starkey, und ich lebe meinen Traum. Seit meiner Pensionierung als Detective des Morddezernats von Chicago vor ein paar Jahren lebe ich in Fort Myers Beach im Süden von Floridas Golfküste. Ich wohne auf einem Hausboot namens Phoenix, besitze eine Bar namens The Drunken Parrot und bin mit einer entzückenden, aus Kuba stammenden Frau namens Marisa Fernandez de Lopez liiert, die ein sehr gut gehendes Maklerbüro betreibt. »Im Leben von Amerikanern gibt es keinen zweiten Akt«, schrieb F. Scott Fitzgerald. Er lag falsch.
Die meiste Zeit des Jahres leben die 6300 ständigen Bewohner von Fort Myers Beach, die Urlaubsgäste und die Tagestouristen halbwegs friedlich zusammen. Aber jeden März zum Spring Break stürzen sich Schwärme feierwütiger Teenager auf die Stadt wie die Geier auf eine Wagenladung Innereien.
Ich schwelge gern in vergangenen Zeiten und schaue mir alte Filme und Fernsehsendungen an. Zum Beispiel Where the Boys Are aus dem Jahr 1960 mit Connie Francis und George Hamilton als College-Studenten, die dem verschneiten Campus im Norden entfliehen, um es im Süden richtig krachen zu lassen. Vielleicht war es diese Rolle, die George die immerwährende Sonnenbräune bescherte. Der Film handelte vom Spring Break in Fort Lauderdale, hätte aber genauso gut in Fort Myers Beach spielen können.
Die Meinungen über den Spring Break gehen auseinander. Wenn du eine Bar, ein Restaurant, einen Schnapsladen, ein Tattoo-Studio, ein billiges Hotel oder ein Geschäft betreibst, das Mopeds, Fahrräder, Surfbretter, Paddelbretter oder Jet-Skis vermietet, wirst du nicht klagen. Wenn du Ruhe und freie Parkplätze schätzt und nicht nonstop Partys feiern willst, die den Bacchanalen des antiken Roms ähneln, nur dass statt Wein Bier und Tequila fließen, nun, dann sieht die Sache schon anders aus.
Ich falle unter beide Kategorien. Meine wilden Partyzeiten sind zwar lange vorbei, aber etwa zwanzig Prozent des Jahresumsatzes meiner Bar bestreiten die jungen Männer und Frauen, die bei mir einfallen auf der Suche nach Suff, Sand, Sonne und Sex. Das Parrot sorgt für den Suff; Sonne und Sand gibt es direkt vor der Tür; den Sex müssen sie selbst machen – solange es nicht auf dem Klo des Parrot passiert. (Ist schon vorgekommen. Jetzt haben wir ein Schild mit der Aufschrift no tener sexo – gleich neben dem lave las manos-Schild für die Angestellten).
Es ist Mittwochabend in der zweiten Märzwoche. Der Drunken Parrot ist rammelvoll mit Zechern, deren Ausweise belegen, dass sie mindestens einundzwanzig Jahre alt sind. Mit Sicherheit sind einige dieser Ausweise gefälscht, aber mein Barkeeper, ein Seminole namens Sam Longtree, hat ein gutes Auge für Bluffer. Er bietet ihnen ein nichtalkoholisches Getränk an oder weist ihnen die Tür.
Sams Name passt zu ihm. Er ist so groß wie ein Riesenmammutbaum, und sein Vorschlag, sich zu benehmen oder zu gehen, wird in der Regel ohne Widerspruch befolgt. Bei denen, die seinen Weisungen nicht nachkommen, wird Sam so handgreiflich wie erforderlich. Hinter der Bar bewahrt er einen Baseballschläger und eine Schrotflinte für den Fall auf, dass … nun ja, nur für den Fall.
Es ist zehn Uhr, und die Kasse summt und singt glücklich vor sich hin, begleitet von Buddy Guys bluesigen Gitarrenriffs, die aus den Lautsprechern dröhnen. Sicher würden unsere jungen Gäste lieber Jay Z, Rihanna, Adele oder Adam Levine hören, aber schließlich gehört der Laden mir. Die Musik der Chicagoer Bluesveteranen ist die Musik, die mir gefällt. Das nehmen die Kunden entweder hin, oder sie können sich ein anderes Etablissement suchen.
Ich bin in der Küche und plaudere mit meiner Köchin Alice Rosewater. Sie hat früher als Sergeant beim Marine Corps im Casino gearbeitet, aber inzwischen gelernt, ihre Infanterie-Bataillon-Mengen auf meine Kundschaft zurückzustutzen. Einmal hat Alice einen unserer Lieferanten bei einer überhöhten Abrechnung erwischt, worauf sie gedroht hat, ihm »den Kopf abzureißen und in den Hals zu scheißen«, wenn er den Fehlbetrag nicht sofort zurückzahle. Was er getan hat. Ich war auch beim Marine Corps, ich bin die plastische Ausdrucksweise also gewohnt.
Sam kommt in die Küche und sagt, Cubby Cullen sei da und wolle mich sprechen. Clarence »Cubby« Cullen ist der Polizeichef von Fort Myers Beach. Bei seinem Spitznamen muss ich immer an meine Lieblings-Baseballmannschaft, die Chicago Cubs, denken. Er ist klein und gedrungen wie ein Feuerhydrant, hat einen grauweißen Bürstenschnitt und einen stattlichen Bierbauch.
Cubby war früher stellvertretender Polizeichef in Toledo. Nach seiner Pensionierung kauften er und seine Frau Millie sich einen gemütlichen kleinen Bungalow auf einem Golfplatz in Fort Myers. Cubby verbrachte seine Tage mit Angeln und Golfen, Millie kümmerte sich um den Garten und spielte in einem Damenkränzchen Bridge. Das war die Art Ruhestand, den sie sich immer vorgestellt hatten. Cubby hatte weiterhin seine Abonnements verschiedener Polizeimagazine. Als er die Stellenanzeige für den Job des Polizeichefs im fünfundzwanzig Kilometer entfernten Fort Myers Beach las, wurde ihm klar, wie sehr er das Polizistenleben vermisste. Mit Millies Segen bewarb er sich, bekam den Job und leitete das Revier schon acht Jahre, als wir uns bei einer Pokerpartie im Veteranen-Club kennenlernten (Cubby war als junger Mann Militärpolizist bei der Armee gewesen).
Ich entdecke Cubby, der am Ende des Tresens steht und einem jungen Mann mit Dreitagebart und Oakley-Sonnenbrille im Haar dabei zuschaut, wie er Bier aus seinem Glas auf die Brust eines hübschen blonden Mädchens kippt, dessen inzwischen durchsichtiges Iowa-State-T-Shirt offenbart, dass sie ihren BH wohl in Iowa vergessen hat.
Sonnenbrillen im Haar halte ich für eine alberne Manieriertheit, die mich aus irgendeinem Grund aufregt, besonders nachts, wenn Sonnenbrillen ein ausschließlich modisches Accessoire sind.
Sam kommt um den Tresen herum, gibt dem Mädchen ein Drunken-Parrot-T-Shirt und lässt ihr die Wahl zwischen Kleider- und Lokalwechsel. Sie steuert die Damentoilette an, und Sam geleitet den jungen Mann mit einer Hand im Nacken zur Tür. Ich höre, wie Sam den Burschen fragt, ob er selber fährt oder ein Taxi benötigt (Uber hat es noch nicht bis Fort Myers Beach geschafft). Er sagt nein, bis zu seinem Hotel könne er laufen, verschwindet und steuert höchstwahrscheinlich die nächste Bar an.
Cubby trägt ein T-Shirt der Toledo Mud Hens (die Mud Hens sind die Triple-A-Amateurmannschaft der Detroit Tigers) und Jeans, keine Polizeiuniform. Seine Ankunft hat also nicht bewirkt, dass die minderjährigen Kunden fliehen wie illegale Einwanderer bei einer Kontrolle der Ausländerbehörde.
»Wie wär’s mit einem Bier, Cubby?«, frage ich.
»Nicht heute Abend, bin im Dienst«, sagt er.
Er trinkt am liebsten Blue Moon Ale mit einer Orangenscheibe, ich halte mich inzwischen an das in Chicago gebraute Berghoff Root Beer. Ich bin seit neun Jahren trocken. Nach einer Schussverletzung in der linken Schulter habe ich mich von der Chicagoer Polizei verabschiedet. Die Sauferei und der Stress des Polizistenlebens ruinierten meine Ehe, führten zur Scheidung, zu einem Aufenthalt in einer Entzugsklinik in Minnesota und schließlich zu meinem Umzug in den Sunshine State. Ich war auf der Suche nach einem neuen Wohnsitz, nach einem neuen Kapitel im Leben von Jack Starkey. Bis jetzt hat es geklappt.
»Machst du etwa Spätschicht?«, frage ich.
»Ich war zu Hause, schaue im Fernsehen gerade Blue Bloods, da ruft der Wachhabende vom Revier an. Die Küstenwache hat zwei Leichen auf einem Segelboot entdeckt, das im Pine Island Sound vor sich hin trieb. Ein Mann und eine Frau. Beide mit Kopfschuss.«
»Wo ist das Boot jetzt?«
»Die Küstenwache hat es zu ihrem Stützpunkt auf San Carlos Island geschleppt.«
»Bist du schon auf dem Boot gewesen?«
»Bin gerade auf dem Weg dahin. Ich möchte, dass du einen Blick auf den Tatort wirfst. Bei uns im Revier hat keiner so viel Erfahrung mit Mordfällen wie du.«
»Klar, ich helfe gern«, sage ich.
Ich weiß nicht wer den Spruch »Keine gute Tat bleibt ungestraft« erfunden hat. Aber wer es auch war, er hatte recht, wie ich schon bald feststellen sollte – und zwar verdammt recht.
2.
Ein Tatort zu viel
Wir fahren mit Cubbys weißem Polizei-SUV auf der Dammstraße San Carlos Boulevard Richtung Norden zum Stützpunkt der Küstenwache auf San Carlos Island. Das Gelände ist gut einen Hektar groß und von einem fünf Meter hohen Maschendrahtzaun mit Stacheldraht umgeben. Wir halten vor dem Tor, vor dem ein Unteroffizier in blauer Uniform Wache steht. Der Mann, der eine Dienstwaffe trägt, fragt Cubby nach seinem Ausweis. Cubby zeigt seine Marke, dann schaut der Mann mich an und fragt: »Und wer sind Sie?« Cubby sagt, ich sei ein Berater in einer polizeilichen Ermittlung. Der Wachmann winkt uns durch.
Wir fahren an einem zweistöckigen, schmucklosen Bau vorbei, vor dem ein Flaggenmast steht. Oben hängt die amerikanische Flagge, die von drei rund um den Mast in den Betonboden eingelassenen Scheinwerfern beleuchtet wird, darunter die Flagge der Küstenwache. Aus meiner Zeit beim Marine Corps weiß ich, dass es Vorschrift ist, die amerikanische Flagge nach Sonnenuntergang entweder einzuholen oder anzustrahlen.
Cubby parkt vor einem langen Betonpier – neben einem Streifenwagen der Polizei von Fort Myers Beach, einem zivilen Ford Crown Victoria, einem Van der Spurensicherung und einem Rettungswagen. Der braune Crown Vic gehört einem von Cubbys Detectives. Ich frage mich jedes Mal, warum die Polizei glaubt, irgendjemand könne braune Limousinen mit Schwarzwandreifen und Peitschenantennen für Zivilfahrzeuge halten. Aber das Flottenmanagement der Polizeiverwaltung fällt nicht in meine Gehaltsklasse. Das FBI hat eine Schwäche für schwarze Kombis, die geradezu schreien: »Hier kommt das FBI!« Wenn ein Ganove so dämlich ist, sich von einem der beiden Fahrzeuge täuschen zu lassen, wird er verdientermaßen geschnappt.
Cubby und ich steigen aus und gehen hinaus auf den Pier. Als ich nach Florida kam, kannte ich nicht den Unterschied zwischen einem Pier und einer Mole. Samuel Lewandowski, der Besitzer des Jachthafens »Salty Sam’s Marina« an der Estero Bay, wo mein Hausboot liegt, erklärte mir, dass ein Pier eine Mole ist, die groß genug ist, um mit einem Auto darauf zu fahren. Sollte diese Frage jemals bei einem Quiz auftauchen, schnappe ich mir den Punkt wie Ernie Banks einen Fastball durch die Mitte.
An einer Seite des Piers ist der sechsundzwanzig Meter lange Kutter Valiant festgemacht. Traditionell nennt die Küstenwache ihre Schiffe »Kutter.« Auf der anderen Seite liegt ein großes Segelboot mit blauem Rumpf und dahinter ein »SAFE Boat« der Küstenwache – das ist ein kleines Aluminiumboot mit einer Kabine und einem 350-PS-starken Mercury-Zwillingsaußenborder. Wahrscheinlich wurde damit das Segelboot in den Stützpunkt geschleppt.
Der Schriftzug am Heck des Seglers lautet Joie de Vivre. Welche Ironie, dass ein Boot mit Namen »Lebensfreude« zwei Leichen an Bord hat.
Ein Streifenpolizist und eine Sanitäterin in weißem Overall stehen vor dem Boot auf dem Pier. Beide sind Stammgäste in meiner Bar. Der Uniformierte ist Brad Jennings, ein großer Mann Ende zwanzig mit schwarzem Haar und kantigem Kinn. Die Sanitäterin heißt Caroline Jackson, eine Afroamerikanerin in den Dreißigern.
Ich begrüße sie mit Namen. Cubby und ich betreten das Deck des Segelboots. In diesem Augenblick taucht aus dem Niedergang zur Kajüte Harlan Boyd auf, ein altgedienter Detective des Reviers in Fort Myers Beach. Boyd ist in den Fünfzigern, korpulent, hat schütteres braunes Haar und, als der Ex-Boxer, der er ist, eine krumme Nase und unter den Augen vernarbte Haut. Außerdem hat er den rötlichen Teint eines Mannes, der weiß, was ein starker Drink ist, den er des Öfteren in meiner Bar zu sich nimmt. Für Beamte im Polizeidienst wie auch für Angestellte des Militärs, aktiv oder im Ruhestand, gibt es bei uns Rabatt. Ein älterer Herr, ein Stammgast, gehörte im Zweiten Weltkrieg zu den Landetruppen am Omaha Beach. Er trinkt umsonst.
Boyd trägt Anzug und weiße Gummihandschuhe. Sein Gesichtsausdruck ist finster.
»Hi, Harlan«, sage ich.
Er nickt mir zu und sagt: »Jack.« Dann schaut er zu Cubby, schüttelt den Kopf und sagt: »Üble Geschichte, Chief.«
Wenn ein altgedienter Detective üble Geschichte sagt, dann ist sie übel.
Boyd zieht ein Taschentuch aus der Gesäßtasche und wischt sich den Schweiß von der Stirn. Es ist ein warmer Abend, aber doch nicht warm genug, um so zu schwitzen – außer man hat etwas gesehen, das man lieber nicht gesehen hätte.
Auf dem Weg hatte Cubby mir versichert, dass er Boyd gesagt habe, ich würde mitkommen, und dass Boyd nichts dagegen habe, wenn ich mir seinen Tatort anschaue. Bei einigen Detectives sind die territorialen Ansprüche sehr ausgeprägt, bei anderen weniger. In meiner Zeit als Detective im Morddezernat von Chicago fiel ich unter die Kategorie »sehr«.
Boyd wuchtet seine Körpermasse auf den Pier, holt eine Schachtel Zigaretten aus der Innentasche seiner Jacke und klopft eine Camel ohne Filter heraus. Er zündet sie mit einem Zippo an, nimmt einen langen Zug und bläst den krebserregenden Rauch in dünnen weißen Streifen durch die Nasenlöcher aus.
»Die von der Spurensicherung sind schon wieder weg«, sagt er. »Linda ist jetzt unten.« Er meint Linda Evans, die Kriminaltechnikerin von der Gerichtsmedizin.
»Warum muss dieses Scheißboot ausgerechnet in meinen Zutändigkeitsbereich treiben?«, fragt Boyd. »Ein paar Kilometer weiter nördlich, und Cape Coral könnte sich jetzt damit rumschlagen. Ein paar Kilometer südlich, und Bonita Springs hätte den Fall an der Backe.«
Als Detective in Fort Myers Beach wäre ich froh gewesen für die Gelegenheit, mein Können zu beweisen. Harlan Boyd ist es offensichtlich nicht.
Cubby und ich gehen die drei Stufen hinunter in die Kajüte, mit ein paar Schritten durch den Salon und in die Kombüse. Die Joie de Vivre ist eine Luxusjacht. Gut ausgestattet, alles Messing und Mahagoni. Durchgehend erste Sahne. Damit verglichen ist mein Hausboot ein Müllkahn. Aber es ist mein Müllkahn.
Linda Evans hat kurze braune Haare und trägt eine runde Brille mit Drahtgestell, die ihr ein eulenhaftes, gelehrtes Aussehen verleiht. Sie stieß vor einem Jahr, nach ihrem Master in Forensik an der Florida Gulf Coast University, zur Polizei von Fort Myers Beach. Davor war sie Polizistin in Bradenton gewesen.
Auf dem Rücken von Lindas blauem Overall steht in weißen Buchstaben »Kriminaltechnik«. Sie hockt auf dem Boden und bindet einen Plastikbeutel zu, in dem die rechte Hand eines auf dem Rücken liegenden Mannes steckt. Der Mann ist – oder war – attraktiv, Mitte bis Ende vierzig und hat braune Haare. Aufrecht stehend, was nicht mehr passieren wird, schätze ich ihn auf etwa eins achtzig. Er trägt ein blauweiß gestreiftes T-Shirt, hellbraune Leinenshorts und Bootsschuhe – typisches Segler-Outfit. Die Schussverletzung in seiner Stirn stammt nach der Größe der Eintrittswunde zu schließen von einer kleinkalibrigen Pistole. Augen und Mund sind geöffnet, was ihm den Gesichtsausdruck eines Mannes verleiht, der von irgendetwas überrascht wurde – wahrscheinlich von dem Umstand, dass man ihm in die Stirn geschossen hatte.
»Sie kennen Jack Starkey«, sagt Cubby zu Linda. »Er wird uns bei diesem Fall als Berater zur Seite stehen.«
Berater. Ach ja? Ich dachte, ich sollte bloß mal einen Blick draufwerfen. Darüber müssen Cubby und ich uns noch mal unterhalten.
Linda schaut zu mir hoch, nickt, beendet das Eintüten der toten Hand, wiederholt den Vorgang an der anderen Hand und steht auf. Unter den Fingernägeln des Toten können sich DNA-Spuren des Mörders befinden, was allerdings unwahrscheinlich ist, da es keine Anzeichen eines Kampfes gibt. Sollte der Schütze auch nur ein Fünkchen Verstand haben, ist er dem Opfer nicht nahe gekommen. Deshalb benutzt man ja eine Pistole.
Betten auf Schiffen werden Kojen genannt. Küchen sind Kombüsen. Böden sind Decks und Wände Schotten. Türen sind Luken. Ein Seil ist eine Leine. Das vordere Ende eines Boots ist der Bug, das hintere das Heck. Die rechte Seite heißt Steuerbord, die linke Backbord. Das weiß ich alles von Salty Sam Lewandowski, der meinte, ich solle die nautischen Begriffe kennen – »falls du dir mal ein richtiges Boot kaufst«. Ha, ha.
Sam war dreißig Jahre bei der Handelsmarine, bevor er den Jachthafen aufmachte, wo mein Hausboot dauerhaft vor Anker liegt (»Seetüchtigkeit« gehörte nicht zu den Vorzügen des Boots, die der Vorbesitzer aufgelistet hatte). Ich habe das Boot Phoenix getauft, nach dem Vogel aus der griechischen Mythologie, der sich aus der eigenen Asche erhebt, wie ich es auch von mir erhoffte beim Start meines neuen Lebens in Florida.
Die Frau, die in der Koje der Kapitänskajüte liegt, sieht jünger als der Mann aus. Sie ist vielleicht in den Dreißigern, hat kurze dunkle Haare und leere blaue Augen. Sie liegt mit dem Rücken auf der Bettdecke und hat eine Schusswunde in der Stirn, die der des Mannes ähnelt. Sie trägt ein schwarzes Bikinioberteil und weiße Shorts.
»Okay, das reicht wohl«, sagt Cubby mehr zu sich selbst als zu mir, seinem »Berater«.
Wir klettern zurück auf den Pier. Harlan zieht zum letzten Mal an seiner Zigarette und schnippt sie dann ins Wasser. Ein Fisch steigt auf, stupst die Kippe an und taucht wieder ab. Nicht seine Marke.
Wir stehen unter einem klaren Himmel mit einem leuchtenden Dreiviertelmond. Jenseits der zwanzig Kilometer Golf von Mexiko kann man die Lichter von Sanibel Island sehen. Eine herrliche Nacht – für die Lebenden, nicht für die Opfer auf dem Boot.
Boyd fährt sich mit den Fingern durchs Haar, schaut die Joie de Vivre an, die sich von einer Vergnügungsjacht in einen Tatort verwandelt hat, und fragt mich: »Sind Sie deshalb in Rente gegangen, Jack? Weil Sie dauernd mit solchen Sachen zu tun hatten?«
»Vor allem, weil man mich angeschossen hat, Harlan.«
»Mich hat noch nie einer erwischt«, sagt er. »Man hat schon auf mich geschossen, aber nie getroffen. Bis jetzt.«
»Dann weiter viel Glück. Das kann einem echt den Tag versauen.«
»Was sagt die Küstenwache?«, fragt Cubby Boyd.
»Ein Fischer hat heute Abend um sieben gemeldet, dass ein Segelboot im Pine Island Sound treibt. Die Küstenwache hat ein Boot mit zwei Männern rausgeschickt, das SAFE Boat da. Sie haben das Segelboot lokalisiert und versucht, Kontakt aufzunehmen. Erst per Funk, dann mit dem Megafon. Keine Antwort.«
Er zieht ein Notizbuch aus der Innentasche seiner Sportjacke, klappt es auf, studiert einen Moment die Notizen und fährt fort: »Petty Officer Second Class Robert Michaels geht an Bord des Segelboots, Master Chief John Pulaski bleibt auf dem SAFE Boat. Michaels befestigt eine Schlepptrosse, geht dann in die Kajüte und findet die Leichen. Er übergibt sich in der Kombüse ins Waschbecken, geht wieder an Bord des SAFE Boat und berichtet Pulsaski, der sich per Funk beim Stützpunkt meldet. Er wird angewiesen, die Position zu notieren und das Segelboot abzuschleppen.«
Er schaut noch einmal auf seine Notizen. »Michaels hat keine Handschuhe getragen, aber er sagt, dass er nichts angefasst hat. Der wachhabende Offizier der Küstenwache, ein Lieutenant Jeffrey O’Neill, ruft um 21.42 Uhr im Revier an. Streifenpolizist Tom Breckinridge ist von seinem Team am nächsten dran und trifft um 21.50 Uhr hier ein. Ich bin um 22.10 Uhr da. Was den Opfern natürlich auch nichts mehr nützt.« Er klappt das Notizbuch zu. »Das ist so weit alles.«
»Habt ihr schon Namen?«, fragt Cubby.
»Laut den in Florida ausgestellten Führerscheinen heißt der Mann Lawrence Henderson und die Frau, vermutlich seine Ehefrau, Marion Henderson. Die Adresse ist 2010 Royal Palm Circle in Cape Coral. Die Namen der nächsten Angehörigen bekommen wir morgen früh. Das Boot ist auf Lawrence Henderson registriert. Ich habe ihn gegoogelt. Er ist der Präsident der Manatee National Bank in Fort Myers.«
Boyd holt die Camels aus der Innentasche seiner Jacke, klopft sich wieder eine Zigarette aus der Schachtel und zündet sie mit dem Zippo an. Er nimmt einen langen Zug und deutet mit dem Kopf zu dem Boot. »Wer um Himmels willen macht so was?«
»Das ist das, was wir herausfinden müssen, Harlan«, sagt Cubby.
»Raubüberfall war es nicht«, sagt Harlan. »Es fehlen keine Wertsachen. War wahrscheinlich jemand, der die Hendersons kannte, der wusste, dass sie auf dem Boot waren und wo sie wann sein würden. Ich versuche mal herauskriegen, wo sie das Boot liegen hatten, vielleicht hat sie ja jemand gesehen, bevor sie in See gestochen sind.«
Harlan Boyd versteht jedenfalls sein Handwerk. Ich frage mich, warum Cubby glaubt, dass er den Fall nicht allein lösen kann – wenn er nicht vorher an einem Emphysem oder Lungenkrebs stirbt.
»Mein Bruder Frank hat oben in Jacksonville eine Versicherungsagentur«, sagt Boyd. »Leben, Auto, Immobilien. Läuft richtig gut. Nettes Haus, nettes Auto, nette Familie …« Er schüttelt den Kopf. »Bei so einer Geschichte komme ich ins Grübeln, ob ich nicht in Franks Agentur einsteigen soll. Er sagt, jederzeit. Wann ich will. Eigentlich wollte ich das ja erst in ein paar Jahren. Aber vielleicht bin ich schon jetzt reif dafür.«
Er zieht wieder an der Camel, schnippt sie dann ins Wasser – diesmal kein Interesse seitens der Fische – und fährt fort: »Wisst ihr, was das Beste am Versicherungsgeschäft ist? Außer im Bestattungsinstitut hat Frank noch nie einen Toten gesehen. Anders als bei uns.«
»Schon klar«, sage ich.
Die meisten Polizisten sind irgendwann ausgebrannt. Die einen trifft es früher, die anderen später. Erstere sind vielleicht die, die zu sehr Anteil nehmen. Das Verbrechen auf dem Boot ist übel, kommt aber an das Übelste, was ich gesehen habe, nicht annähernd heran.
Wie auch immer, Detective Harlan Boyd hat offensichtlich genug gesehen.
Ich gehe noch einmal an Bord, um mir den Tatort genauer anzuschauen.
3.
Einmal Detective, immer Detective
Cubby und ich fahren schweigend zum Drunken Parrot. Ich habe schon einige Zeit keine Leiche mehr mit einer Einschusswunde gesehen. Ich muss über Waffen und die andauernde Debatte im Land über den Zweiten Verfassungszusatz nachdenken.
Eine Waffe an sich ist ein unbelebter Gegenstand, ein mechanischer Apparat, eine Maschine aus Stahl, Plastik und Verbundwerkstoffen. Schlitten und Hebel, Kammern, Kaliber und Federn, ein komplexes Werkzeug, um eine kontrollierte Explosion hervorzurufen, die ein Projektil mit Überschallgeschwindigkeit zu einem Ziel befördert. Manchmal ist das Ziel unbelebt: eine Zielscheibe aus Pappe auf einem Schießstand oder eine Flasche auf einem Zaun. Manchmal ist es ein lebendiges Ziel, ein Mensch oder ein Tier.
Aber eine Waffe an sich kann die Aufgabe, für die sie gemacht wurde, nicht ausführen. Dafür braucht sie einen Menschen, der sie bedient. Ob eine Handfeuerwaffe oder ein Gewehr, ein altertümliches Geschütz oder eine riesige Kanone auf einem Kriegsschiff, ein Panzer oder eine Feldhaubitze, eine Waffe fühlt weder Zorn noch Angst, verspürt keine Rachegelüste oder die Notwendigkeit zur Selbstverteidigung. Nur ein Mensch ist zu Emotionen fähig und kann dann den Abzug betätigen, um die tödliche Gewalt zu entfesseln.
Kriminelle finden immer einen Weg, um in den Besitz einer Waffe zu gelangen, und Detectives werden immer gerufen, um die Schützen zu verfolgen, und solange die Kriminellen Waffen haben, will ich auch eine haben. Ob die Beschränkung des Zugangs zu Waffen die Waffengewalt reduziert oder nicht, ist eine heiß diskutierte Frage. In Ländern wie England, Japan und Australien, wo der Waffenbesitz streng reguliert ist, ist die Waffengewalt sehr niedrig. In den USA, wo Waffen leicht erhältlich sind, liegt die Mordrate durch Schusswaffen fünfundzwanzigmal höher als in anderen wohlhabenden Ländern.
Also: Verringert die Beschränkung des Waffenbesitzes die Wahrscheinlichkeit, dass irgendein Verrückter in eine Grundschule marschiert, das Feuer eröffnet und ein schreckliches Blutbad anrichtet? Oder sollte man ausgewählte Angestellte der Schule ausbilden und bewaffnen, in der Annahme, dass Psychopathen immer einen Weg finden werden, sich illegal Waffen zu beschaffen?
Ich weiß es nicht. Aber irgendwer hat sich irgendwo eine Waffe besorgt und damit Lawrence und Marion Henderson ermordet. Und mich hat man gefragt, ob ich bei der Suche nach dem Mörder helfen kann. Die Debatte um die angemessene Interpretation des Zweiten Verfassungszusatzes ist bei dem vorliegenden Fall irrelevant. Das überlasse ich den Lobbyisten und Politikern, den Talkshow-Experten und Richtern am Obersten Gerichtshof. Das ist so ziemlich das Philosophischste, was ich zu dem Thema beitragen kann. Der Rest fällt – wie das erwähnte Flottenmanagement der Polizeiverwaltung – nicht in meine Gehaltsklasse.
Cubby parkt vor dem Drunken Parrot und schaut mich an. »Ich brauche dich bei dem Fall, Jack. Der Präsident einer Bank und seine Frau wurden ermordet. Mehr Publicity für einen Fall hier in der Gegend geht nicht. Und falls es dir nicht aufgefallen ist: Harlan hat die Schnauze gestrichen voll. Ich hab das schon mal erlebt, damals in Toledo. Wenn einer erst mal so weit ist, dann ist das für ihn nicht gut und für das Revier auch nicht. Außerdem sitzt ihm seine Frau im Nacken, sich einen anderen Job zu suchen, so oft wie in letzter Zeit Polizisten erschossen werden. Ich rechne jeden Tag damit, dass er das Handtuch wirft.«
»Du hast noch zwei andere Detectives, Cubby.«
»Ja, Ronnie Patterson und Nick Montez. Beides gute Jungs – wenn dir einer das Auto klaut oder das Boot demoliert oder so was. Nick hat vor einem halben Jahr ein Drogenlabor hochgehen lassen. Große Sache. Wir hatten einen Tipp damals. Aber das hier, die Burschen, die das gemacht haben … Null Chance, vergiss es. Das ist was für deine Liga.«
»Als du mich das letzte Mal in einen Fall reingezogen hast, wäre ich fast dabei draufgegangen.«
Cubby schaut mich vielsagend an. »Gib’s zu, Jack. Du hattest einen Höllenspaß dabei. Einmal Detective, immer Detective.«
Cubby hatte mich vor einiger Zeit einem Freund vorgestellt, dem früheren Polizeichef von Naples. Naples ist eine kleine Stadt knapp fünfzig Kilometer südlich von Fort Myers Beach, einer der Spielplätze für die Superreichen. Zu der Zeit, als viele der heutigen Einwohner, wenn nicht die meisten, sich in Naples niederließen, hatten diese ihre Jugend und ihre mittleren Jahre schon lange hinter sich. Naples, hieß es, sei eine Stadt für ältere Menschen und ihre Eltern. Auch damals hatte mein Job in beratender Funktion begonnen. Aber schon bald leitete ich eine Ermittlung, in dem es um einen falschen russischen Grafen ging, der Verbindungen zur Mafia hatte und einen nach einer gesunkenen spanischen Schatzgaleone benannten Hedgefonds betrieb, sowie um drei reiche, von ihrem Ruhestand angeödete Männer, die sich die »Old White Men« nannten. Die spielten Menschen, die ihnen nicht passten, böse Streiche und heuerten schließlich einen Auftragsmörder aus Miami an, der ihnen diese Menschen aus dem Weg räumen sollte. Mich eingeschlossen. Das ist jetzt zwei Jahre her. Zugegeben, ich habe den Adrenalinrausch der Jagd genossen.
»Also, was ist dein erster Eindruck?«, fragt Cubby, als ich die Beifahrertür des SUV öffne.
Ich lehne mich auf meinem Sitz zurück. »Boyd hat es auf den Punkt gebracht. Ist genau meine Meinung.«