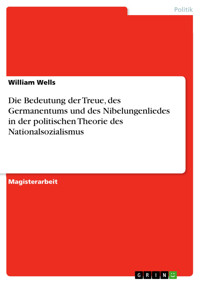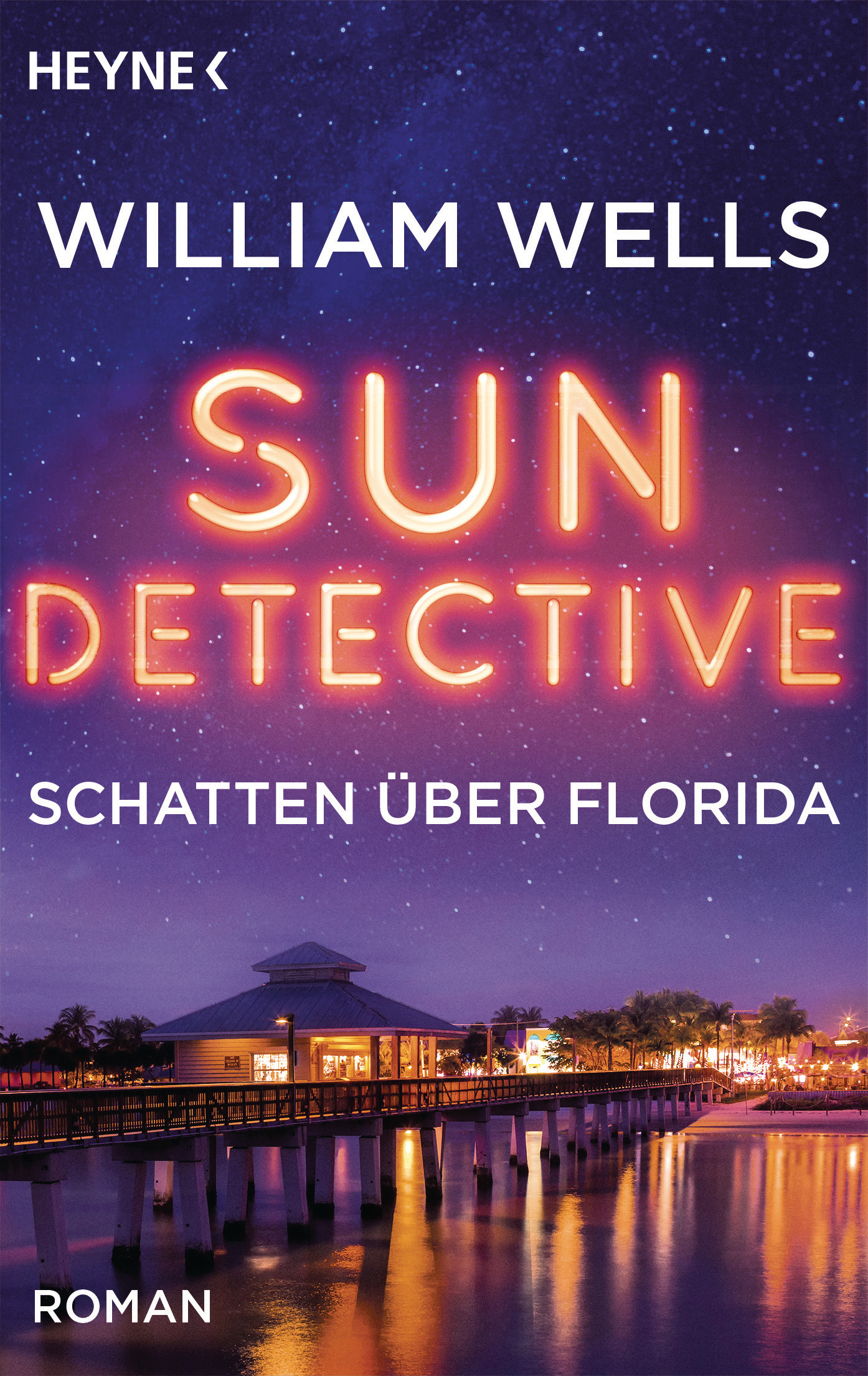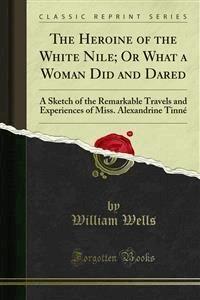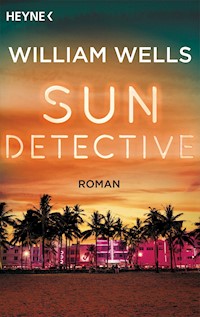
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Sun-Detective-Serie
- Sprache: Deutsch
Nach kalten Jahre in Chicago hat Ex-Cop Jack Starkey alles hingeschmissen und sich in einem Paradies auf Erden eingerichtet: Fort Myers im Sunshine-State Florida. Starkeys Kneipe „Drunken Parrot“ ist mittlerweile eine Institution. Ansonsten genießt er die Sonne am liebsten auf seinem Hausboot, vor allem, wenn Marisa an Bord kommt, seine schlagfertige kubanische Freundin ... So ganz hat er die Dienstmarke allerdings nicht weggeschlossen. Und das ist gut so, denn sein Kumpel Police Chief Hansen ist meist überfordert - vor allem, als eine Mordserie ihren Schatten auf Fort Myers wirft. Zeit für Starkey, wieder Detective zu spielen ... Sun Detective!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 361
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Das Buch
Gestatten Sie, dass ich mich vorstelle. Ich bin Mr. Klischee höchstpersönlich, alias Detective Sergeant Jack Starkey (im Ruhestand) vom Morddezernat der Chicagoer Polizei.
Nachdem ich zum dritten Mal angeschossen worden war – einmal als Marine bei einer inoffiziellen Auslandsoperation, zwei weitere Male als Angestellter der Stadt Chicago -, zog ich mich als dauerhaft arbeitsunfähig in die kleine Stadt Fort Myers Beach im Süden von Floridas Golfküste zurück, wo ich eine Bar besitze und auf einem Boot lebe. Ich lebe den Traum eines Cops, und es ist herrlich. Und zwar ohne Schmiergeld. Ach ja, und ab und zu kläre ich ein Verbrechen auf. Alte Gewohnheit.
Der Autor
William Wells weiß, worüber er schreibt. Wie sein Romanheld Jack Starkey lebte er zunächst in Chicago, bevor es ihn an die südwestliche Floridaküste verschlug. Wells schrieb Reden für Politiker (unter anderem für den Gouverneur von Michigan), gründete einen Corporate-Publishing-Verlag und verbringt seine Freizeit vor allem damit, die Sonne Floridas zu genießen und Bücher zu schreiben.
WILLIAM WELLS
ROMAN
Aus dem Amerikanischen von Wolfgang Müller
WILHELM HEYNE VERLAGMÜNCHEN
Für Eddie und Lucy
»Die idealen Weggefährten haben nie weniger als vier Beine.«
»Im Zweifel lass einfach einen Mann mit einer Pistole durch die Tür kommen.« Raymond Chandler
1
Der Detective
Ende Oktober trieben die kalten Winde einer Gewitterfront einen kalten Regen vom Lake Michigan durch die Wolkenkratzerschluchten von Chicago. Er überzog die Stadtlandschaft mit einem feucht glänzenden Film und ließ die alte Stadt wie neu erstrahlen – zumindest eine Zeit lang.
Die Stadt zog ihre breiten Schultern ein und dachte: Wenigstens kein Schnee, noch nicht.
Ein Blitz zerriss den Abendhimmel und beleuchtete die Gestalt eines Mannes, der an einer Straßenecke auf der South Side unter einer Laterne stand, deren Glühlampe wie die meisten in dem Viertel schon lange zerbrochen war.
Der böige Wind durchnässte den Mann – Detective Lieutenant Jack Stoney, um genau zu sein –, als sei er eine geschlachtete Rinderhälfte in einer Autowaschanlage. Er trug keinen Hut, sodass ihm das Wasser von seinem schwarzen Haar in den Nacken lief.
Zitternd schlug Stoney den Kragen seines abgetragenen Burberry-Trenchcoats hoch und griff instinktiv in die Innentasche nach seinen Lucky Strikes ohne Filter. Er rauchte schon seit einem Jahr nicht mehr, seit ihm der Quacksalber beim jährlichen Gesundheitscheck des Dezernats ein Glas mit einer grauen, kranken, in Chloroform eingelegten Lunge gezeigt hatte.
In der Tasche befand sich nur eine Packung Juicy Fruit und ein alter Lottoschein der Illinois-Lotterie. Kein Gewinn, sonst würde Stoney hier nicht stehen, nicht in dem Viertel, vielleicht nicht mal in der Stadt, jetzt, da der Winter im Anmarsch war.
Tja, dachte Stoney, wenigstens habe ich noch Mr. Jack Daniel’s, der mir in Zeiten der Not Trost spenden kann – das heißt, bis mir der Doc eine kaputte eingelegte Leber zeigt und die Party vollends verdirbt.
In der Dachrinne des baufälligen Vierfamilienhauses, das Stoney observierte, löste sich ein Klumpen Laub, schoss als ein morastig dreckiger Niagarafall das Regenrohr hinunter und ergoss sich über seine Schuhe und Hosenaufschläge.
Schon seit unserm drittletzten Bürgermeister bin ich für so einen Scheißjob zu alt, dachte er, als er sich das Regenwasser vom Mantel und den Blättermatsch von den Schuhen schüttelte wie ein Jagdhund, der einem Sumpf entstiegen war.
Er schaute zu den Fenstern der beiden Wohnungen im ersten Stock hoch. Das Licht brannte in beiden, aber Rollos versperrten den Blick ins Innere. Ich habe die Wahl, dachte Stoney:
A, wie ein Vollidiot im Regen stehen bleiben.
B, im Revier anrufen. Soll doch dasSWAT-Team den schwierigen Teil erledigen, ich fahre nach Hause, setze mich vor die Glotze und schaue mir mit einem Glas Black Jack on the rocks die Bulls gegen die Lakers an.
Oder C, rein und hoch in den ersten Stock, wenn nötig, beide Wohnungstüren eintreten und dann einen gewissen Marcus Lamont, wenn der Flachwichser überhaupt da oben ist, davon überzeugen, dass man die Gesetze der Stadt Chicago nicht auf die leichte Schulter nehmen sollte.
Eigentlich hatte Stoney geplant, sich heute Abend in der Baby Doll Polka Lounge auf der West Cermack einen zu genehmigen. Er mochte das Baby Doll, weil sie dort großzügig einschenkten, und wegen seiner Krakauer-mit-Kraut-Sandwiches. Und wegen der altmodischen Wurlitzer-Jukebox, deren Neonröhren in allen Regenbogenfarben blinkten und die mit 45er-Vinylscheiben der Chicagoer Bluesveteranen Muddy Waters, Howlin’ Wolf, Willie Dixon und Buddy Guy bestückt war.
Stoney hatte an der Bar im Baby Doll gesessen, an einem Black Jack pur genippt und eine Kellnerin namens Doris bequatscht, als ein Spitzel, den er als Jake The Snake kannte, auf den Hocker neben ihm rutschte. Jake hatte zwar wie jeder andere auch einen Nachnamen, aber er wurde jetzt schon so lange The Snake genannt, dass er den vielleicht selbst schon vergessen hatte.
The Snake bot Stoney die Adresse von Marcus Lamonts Versteck an – für sein übliches Honorar: einen Four Roses mit einem Bier zum Nachspülen plus ein gutes Wort für den Fall, dass er in Schwierigkeiten geriete, was früher oder später der Fall sein würde. Gewöhnlich früher.
Lamont hatte vor zwei Wochen den Jewel Supermarket an der Ecke Division und Clark überfallen. Das allein war noch kein hinreichender Grund, in einer ekligen Nacht die gastliche Wärme des Baby Doll zu verlassen. Beamte des Morddezernats jagten keine Räuber. Aber Lamont hatte einen Cop erschossen, der in seinem Nebenjob als Wachmann im Jewel gearbeitet hatte. Und das, mein Freund, ist absolut tabu.
Stoney kannte den Cop: Lenny Wadkins, anständiger Bursche, Frau und drei Kinder, Medal of Valor, acht Monate vor der Pensionierung und dem Umzug nach Vero Beach zum Angeln und Golfen. Dafür musste Lamont zahlen. Auf seinem Steckbrief stand »Tot oder lebendig« – nicht wörtlich, aber sinngemäß.
Bis zu dem Tipp von The Snake hatte es keine Hinweise auf seinen Aufenthaltsort gegeben.
»Ich kenne da einen Burschen, der kennt jemanden, der mir erzählt hat, dass Lamont in diesem Augenblick in der Wohnung seiner Freundin ist«, hatte der Spitzel gesagt. »Sie heißt Lucinda. Stripperin im Funky Money. Wohnt Ecke Saginaw und Dreiundneunzigste. In einer von den zwei Wohnungen im oberen Stock. Weiß aber nicht, in welcher.«
Das reichte. Stoney nahm einen Zwanzig-Dollar-Schein aus seiner Brieftasche und klatschte ihn vor dem Spitzel auf die Theke.
»Danke, Mann«, sagte The Snake und ließ den Schein mit der Fingerfertigkeit eines Taschenspielers verschwinden.
Für seine eigenen Drinks legte Stoney einen zweiten Zwanziger auf den Tresen, nahm den Trenchcoat vom Haken neben der Tür und ging nach draußen. Er war mit seinem Cabrio da, einer 63er Corvette Stingray, klassisch rot, und nicht mit dem braunen Zivilfahrzeug seines Dezernats, einem Ford Taurus, in dessen Kofferraum seine Schrotflinte und Kevlarweste lagen.
Ins Baby Doll ging man mit Geld für die Drinks und Tabletten gegen Sodbrennen und mit der Dienstwaffe, aber nicht mit Kevlarweste und Schrotflinte. Den ersten und letzten Versuch, die Happy Hour im Baby Doll zu stören, hatte ein Arschloch mit einer abgesägten Schrotflinte unter dem Mantel unternommen. Er war hereinspaziert und hatte das Geld in der Kasse und den Inhalt aller Taschen der Gäste verlangt. Das war ihm nicht bekommen.
Der Wirt, Leon Kramarczyk, ein ehemaliger Fallschirmjäger in der polnischen Armee, hatte dem Trottel mit einer Vis-Pistole 9 mm, die er neben der Kasse liegen hatte, in den Hals geschossen. Es sprach sich herum in der Nachbarschaft, dass es einfachere Methoden gab, seinen Lebensunterhalt zu bestreiten als mit einem Überfall auf die Baby Doll Polka Lounge.
Stoney schaute wieder zum ersten Stock hinauf. Die Dienstvorschrift verlangte nach B: Verstärkung rufen. Warum den Helden spielen? Wenn einen der Job ausgebrannt hatte, wenn man geschieden und im mittleren Alter war, wenn man zweimal angeschossen worden war, dann war genug endgültig genug. Die Bürger, die zu schützen und denen zu dienen seine Pflicht war, wie es an den Seiten der Streifenwagen der Chicagoer Polizei stand, wussten nichts vom Alltag eines Cops, oder er war ihnen egal. Zumindest glaubte das Stoney. Statt Dankbarkeit bekam man eine Marke, eine Dienstwaffe und ein Gehalt, das, wie es bei den Marines hieß, für drei Mahlzeiten und eine Matratze reichte. Aber nicht für mehr. Es sei denn, man zählte die gelegentlichen Adrenalin-Highs mit, die einem der Job bescherte, wenn man mal wieder sein Leben aufs Spiel setzte.
Falls man den Dreck in den Straßen und die unausweichlichen internen Ermittlungen überstand, dann bekam man auch noch eine Pension. Vielleicht hatte man dann genug auf der Seite, um dem Standardtraum eines Cops hinterherzujagen, nämlich dorthin zu ziehen, wo das ganze Jahr die Sonne schien und man sicher war vor The Hawk, wie Lou Rawls in einem Song einst den schneidenden Wind vom See genannt hatte.
Stoney kannte einen Cop, der eine Bar in Reno besaß, aber der hatte sich schmieren lassen und seine Zusatzeinnahmen in steuerfreie Kommunalobligationen gesteckt.
Das war nichts für Jack Stoney. Ehrlich und arm, das war sein Schicksal, das hatte er schon früh entschieden. Er wusste, dass er es mit seinem Gehalt vom Staat nie zu Reichtum bringen würde, aber zum Teufel damit, es machte einfach Spaß, mit einer Marke und einer Pistole durch die Straßen der Stadt zu ziehen.
Stoney griff unter seinen Mantel und berührte die Smith & Wesson Distinguished Combat, 357 Magnum, die in dem Lederholster an seinem Gürtel steckte. Vom Dezernat hatte er die übliche Sig Sauer 9 mm bekommen, die er exakt ein einziges Mal benutzt und dann in die Waffenkammer zurückgebracht hatte. In einer Seitengasse der West Madison war ein übler, mit Crack zugedröhnter Bursche auf ihn zugestürmt, den er auch mit einem Schuss durch den Oberschenkel nicht hatte aufhalten können.
Anscheinend war das zentrale Nervensystem des Angreifers durch die Droge so betäubt gewesen, dass er erst den zweiten Schuss in die Brust überhaupt bemerkt hatte. Das stoppte ihn schließlich. Dem Tod geweiht, sah er überrascht auf seine Brust, sah den roten Fleck, der sich auf seinem weißen T-Shirt ausbreitete, fiel auf die Knie, sagte »Gottverdammte Scheiße«, kippte nach vorn und war tot, noch bevor sein Kopf auf das Pflaster schlug.
Nachdem er den Einsatzbericht ausgefüllt und die Befragung durch die Beamten von der Internen überstanden hatte, war er nach Hause gegangen und hatte die in Ölpapier eingewickelte Smith & Wesson hervorgeholt, die in seiner alten Marines-Truhe unter den stolzen Uniformen seiner Jugend lag.
Die S & W war nur ein Sechsschüsser, während in der Kammer der halb automatischen Sig siebzehn Patronen steckten. Aber die großkalibrigen Kugeln erledigten immer ihren Job, egal ob der Penner stoned war oder nüchtern. Sie rissen eine so große Austrittswunde, da passte ein Ford F-150 Pick-up mit Monstertruck-Reifen durch.
Stoney schaute hoch und sah einen Schatten, der sich an einem der Fenster der vorderen Wohnung vorbeibewegte und für eine Frau zu groß war. Möglich, dass es nicht Lamont war, aber The Snake hatte ihm immer gute Informationen geliefert. Er ist da oben, dachte Stoney, und hat es warm und trocken und lässt es sich von einer Schlampe mit schlechtem Geschmack und übler Pechsträhne besorgen, während ich mir in dem gottverdammten Regen meinen traurigen Arsch abfriere.
Er entschied sich für B: Die harten Knochen vomSWAT-Team sollen das erledigen. In diesem Fall lag die Dienstvorschrift richtig. Er zog sein Handy aus der Tasche. Doch dann hielt er inne, seufzte und steckte es wieder weg. Zum Henker, dachte er, jetzt bin ich schon mal da und hab mich durchweichen lassen, und dieser verfickte Schwanzlutscher Lamont hat einen Cop auf dem Gewissen und hat sich vielleicht schon wieder verpisst, bis die Jungs vomSWAT-Team hier aufkreuzen.
Also dann, sichern und laden. C.
Er ging die drei Zementstufen zur Tür des alten Mietsgebäudes hinauf. Ein Schild auf dem Ziegelgemäuer neben der Tür verkündete der Welt, dass es sich um die Lakeview Apartments handelte, obwohl der See nirgends zu sehen war.
Die Tür war verschlossen. Er drückte sie mit einem Schulterstoß ein, was angesichts des verrosteten Schlosses und des morschen Holzrahmens nicht allzu schwer war.
Er betrat das Treppenhaus: an den Wänden abblätternde kotzgrüne Farbe, auf dem Boden abgewetztes braunes Linoleum, unter der niedrigen Decke eine nackte Glühbirne. Türen links und rechts zu den Wohnungen 1A und 1B, die Treppe in den ersten Stock zu den Wohnungen 2A und 2B.
Stoney ließ die Haustür weit offen – für den Fall, dass er das Gebäude schnell verlassen musste. Dann ging er die knarzende Holztreppe hinauf, wobei er mit gespreizten Beinen außen auf die Stufen trat, um so wenig Lärm wie möglich zu machen. Das gehörte zum Handwerk, das ein Cop lernen musste, wenn er es zu einer Bar und einem Boot im Süden schaffen wollte.
Im Flur des ersten Stocks blieb er kurz stehen und drehte die Glühbirne aus der Wandfassung, damit er nicht von hinten angeleuchtet wurde. Er zog die S & W und hielt sie sich mit dem Lauf nach unten ans rechte Bein.
Er berührte unter seinem Mantel, wo eigentlich die Kevlarweste sein sollte, das dünne Gewebe seines schwarzen T-Shirts. Tja, nutzt ja alles nix, da musst du jetzt durch, sinnierte er, was ziemlich genau seine Lebeneinstellung zusammenfasste.
The Snake hatte nicht gewusst, welche Wohnung im ersten Stock. Hopp oder topp: 2A oder 2B? Wenn Stoney falschlag, dann würde jetzt eine Familie beim Abendessen eine verdammt unangenehme Überraschung erleben.
Stoney warf im Geist eine Münze, wandte sich dann 2B zu und verpasste der Tür mit seinen von Hand verzierten Cowboystiefeln Größe12 einen so gewaltigen Cop-Tritt, als sei er der Pizzabote aus der Hölle:
Wer von euch Wichsern kriegt die Große mit Salami und Champignons?
Die Tür flog nach innen auf. Zur Begrüßung zerriss der Schuss aus einer Schrotflinte die Luft, zerfetzte das Holz des Türrahmens und verschaffte Stoney die Gewissheit, dass er richtig gelegen hatte.
Flacher als er klebte auch die Farbe nicht an der Wand des Flurs. Mit dem Handrücken seiner Linken fuhr er sich über die rechte Backe. Die Finger waren blutverschmiert. Nur eine Fleischwunde, wahrscheinlich von den herumfliegenden Holzsplittern, nicht den Schrotkugeln. Würde beim Rasieren trotzdem höllisch brennen.
Also gut, dachte Jack Stoney. Du hast es tatsächlich geschafft, Lamont. Jetzt hab ich echt miese Laune.
Er hob die S & W, ging in die Hocke und rollte sich dann schießend in die Wohnung …
2
Ein Schuss und ich blute
Spoileralarm: Jack Stoney wird die Schießerei überleben, weil er ein fiktiver Detective ist und weil er in den Fortsetzungen des Romans, aus dem Sie gerade einen Ausschnitt gelesen haben, noch gebraucht wird. Eine Figur aus Papier und Tinte stirbt erst dann, wenn der Autor will, dass sie stirbt.
Aber ich blute, wenn ich angeschossen werde, und das ist mir auch mehr als einmal passiert. Anders als Detective Stoney würde ich also nicht wie der Lone Ranger in die Wohnung 2B stürmen. Ich würde ein angriffslustiges SWAT-Team mit seinen Ganzkörperschutzanzügen, Blend- und Tränengasgranaten und Sturmgewehren rufen, während ich Abstand – ordentlich Abstand – halten und die Aufsicht führen würde.
Tatsächlich habe ich in einer ähnlichen Situation genau das getan. Bei der Observierung eines realen Mietshauses auf der South Side sah ich den Gangster, hinter dem ich her war, an einem Fenster vorbeigehen und griff zum Handy statt zum Revolver. Das halbe Revier kreuzte daraufhin auf, um den Polizistenmörder zu schnappen, der die Aktion, die dann im offiziellen Polizeibericht als »Festnahmeversuch« bezeichnet wurde, nicht überlebte. Im Grunde war es eine Hinrichtung gewesen. Wenn man sein verfassungsgemäßes Recht auf einen fairen Prozess gewahrt sehen will, sollte man keinen Polizeibeamten töten, zumindest nicht in Chicago.
Wegen solch schlauer Entscheidungen war ich noch am Leben, saß mit einem roten Filzstift am Kombüsentisch meines Hausboots in Fort Myers Beach, Florida, und las das Manuskript von Stoneys letztes Gefecht, dem neuen Jack-Stoney-Krimi von William Stevens.
Bill Stevens ist der altgediente Polizeireporter der Chicago Tribune. Er gibt mir seine Bestseller vor der Veröffentlichung zum Redigieren, damit ihm beim Thema Polizei keine Fehler unterlaufen. Für die Arbeit bekomme ich ein hübsches Honorar, aber ich würde es auch umsonst machen, denn ich habe ein persönliches Interesse daran. Die Geschichten basieren alle auf meiner eigenen Karriere als Detective im Morddezernat der Chicagoer Polizei.
Wenn Bill einen Fehler macht, wie es ein paarmal vorgekommen ist, bevor er mich um Hilfe bat, dann erreichen ihn unweigerlich Briefe von Lesern, die ihn zur Rede stellen. Zum Beispiel: Jack Stoneys Handfeuerwaffe, ein Model 1911, Kaliber 45, sei eine halb automatische Pistole, kein Revolver, schrieb ein Leser aus Minneapolis. Jack Stoney könne keinen 2012er Ford Crown Victoria mit der Polizeiausstattung gefahren haben, weil Ford die Produktion dieses Modells 2011 einstellte und zum Taurus als Dienstfahrzeug für den Polizeidienst wechselte, sagte ein pensionierter Polizist aus San Diego. Bei der Polizei in Chicago heiße es »Morddezernat« und nicht wie in einigen anderen Städten »Dezernat für Raub und Mord«, behauptete ein Mann aus Prag. Wie um alles in der Welt ein Mann aus der Tschechischen Republik etwas derart Obskures wissen konnte, ist mir schleierhaft, aber er hatte tatsächlich recht.
Ich überlegte, ob ich am Rand von Bills Manuskript kurz schildern sollte, wie diese Observierung auf der South Side tatsächlich abgelaufen war. Ich entschied mich dagegen. Jack Stoney musste die Tür natürlich eintreten und das alleine durchziehen. Niemand will etwas über einen Helden lesen, der auf Nummer sicher geht.
Die Cops in Kriminalromanen sind alle Klischees. Sie sind unweigerlich Zyniker, nach zu vielen Jahren im Job ausgebrannt. Trockene Alkoholiker, die sich abmühen, trocken zu bleiben, geschieden, weil ihre Ex-Frauen die Sauferei und den Stress des Polizistenlebens nicht mehr ertrugen, von ihren Kindern entfremdet, weil erst der Job kam und sie alle Schulaufführungen und Fußballspiele verpassten, Einzelgänger, dauernd im Clinch mit ihren Vorgesetzten/Polizeichefs/Bürgermeistern, aber (gerade noch) toleriert, weil sie die meisten gelösten Fälle in der Abteilung haben.
Gestatten Sie, dass ich mich vorstelle. Ich bin Mr. Klischee höchstpersönlich, alias Detective Sergeant Jack Starkey (im Ruhestand) vom Morddezernat der Chicagoer Polizei. Sie haben gerade meinen Lebenslauf gelesen.
Nachdem ich zum dritten Mal angeschossen worden war – einmal als Marine bei einer inoffiziellen Auslandsoperation, zwei weitere Male als Angestellter der Stadt Chicago –, zog ich mich als dauerhaft arbeitsunfähig in die kleine Stadt Fort Myers Beach im Süden von Floridas Golfküste zurück, wo ich eine Bar besitze und auf einem Boot lebe. Ich lebe den Traum eines Cops, und es ist herrlich. Und zwar ohne Schmiergeld. Bill Stevens scheffelt einen Haufen Geld mit seinen Romanen. Er ist mein Partner bei der Bar The Drunken Parrot. Er hat das Geld aufgetrieben, und ich schmeiße den Laden.
Bills andere Romane tragen Titel wie Stoneys Rache, Stoneys Ehre, Stoneys freier Tag oder Stoneys Todesschuss. Er macht aus meinem Alter Ego eine Legende. Jack Stoney ist größer (eins achtundachtzig, ich bin eins dreiundachtzig), mutiger (ihm wurden als Captain bei den Marines der Silver Star und von der Chicagoer Polizei drei ehrenvolle Erwähnungen für außergewöhnliche Leistungen zuteil, während ich als Lieutenant der Marines die üblichen Orden als Scharfschütze und für gute Führung plus ein Purple Heart erhielt und keine ehrenvollen Erwähnungen im Polizeidienst, weil, so meine Vermutung, die Häuptlinge meine Einzelgänger-Attitüde nicht gutheißen wollten) und fieser (Stoney glaubt an Selbstjustiz, weil er dem verrotteten Justizsystem nicht zutraut, die Gangster von den Straßen fernzuhalten, während so etwas für mich nur der letzte Ausweg war). Stoney ist Detective Lieutenant, ich war Detective Sergeant.
Stoney ist ein muskulöser, attraktiver Typ mit dichtem, grau meliertem Haar, stechenden grünen Augen und einem Killerlächeln, das die Herzen und den Widerstand der Damen, die seinen Weg kreuzen, schmelzen lässt. Auch in diesem Punkt hat Bill mein wahres Ich aufpoliert, auch wenn es mir an Damenbekanntschaften nie gemangelt hat.
Stoney ist der Typ für die schnelle Nummer, er mag seine Frauen ex und hopp. Einmal sagte er: »Nach einer Stunde mit der scharfen Blonden hätte ich mir für die Zugabe einen zweiten Johnny gewünscht.« So etwas würde ich nie sagen, obwohl die Vorstellung zugegebenermaßen verlockend ist.
Man hört ständig, dass wegen der elektronischen Reizüberflutung, denen die Menschen über ihre Fernseher, Smartphones, Tablets, Computer und jetzt auch noch Smartwatches ausgesetzt sind, immer weniger Bücher gelesen werden. Aber laut Bill gibt es unter denjenigen, die lesen, ein großes Bedürfnis nach knallharten Krimis, sei es auf Papier oder in Form von E-Books. Und die stillt er mit seinen Romanen. Alle sind Bestseller geworden.
Durch meine Beziehung zu Jack Stoney brachte ich es in meiner Heimatstadt zu einem gewissen Ruhm. Das bescherte mir jede Menge Frotzeleien auf dem Revier und in den Cop-Bars und machte mich bei den hohen Tieren nicht gerade beliebt. Ich schätze, Detective Stoneys Benehmen erinnerte sie daran, wie sehr ich ihnen auf den Geist gehen konnte.
Im Drunken Parrot halte ich immer eine Auswahl an Jack-Stoney-Büchern parat. Jeder Gast, der danach fragt, bekommt ein vom Autor und von mir signiertes Buch. Ich betrachte das als ein Marketinginstrument für die Bar. Manche kriegen auch eins, wenn sie nicht danach fragen, vor allem wenn sie weiblich und hübsch sind. Die Anmachfrage lautet: »Magst du zufällig Krimis?« Na ja, das war, bevor ich meine aktuelle Freundin kennenlernte. Jetzt bedanke ich mich einfach bei den Fans und gebe ihnen einen aus.
Bill schaut regelmäßig vorbei – um zu angeln und um zu sehen, ob seine Investition in die Bar noch etwas abwirft. Das Geschäft läuft gut – weil gut eingeschenkt wird, weil wir die besten Mini-Hamburger und scharf gewürzten Hähnchenflügel am Strand haben, die echten Hotdogs »Chicago Style« (ein Vienna-Beef-Fleischzipfel in einem Mohnbrötchen mit Senf, Zwiebeln, Tomatenscheiben, Gewürzgurke, hellgrünem Relish, Selleriesalz und kleinen Chilis) und eine Happy Hour, die von zehn Uhr, wenn ich den Laden aufmache, bis zur letzten Bestellung dauert, die immer dann fällig ist, wenn ich zumachen will.
Der Vorbesitzer des Drunken Parrot hatte einen Papagei namens Hector, der gerne auf der Bar hin und her spazierte, seinen Schnabel in die Biergläser der Gäste tunkte und dann herumtorkelte und täuschend echt rülpste. Zu den weiblichen Gästen sagte Hector Sachen wie: »Was macht eine abgetakelte Fregatte wie du in so einem Klasseladen?«, und zu den Männern: »Hey, Freundchen, du hast den Kanal aber gestrichen voll.« Außerdem konnte er die ersten Zeilen von »Danny Boy« singen.
Zu Hectors Ehren habe ich eine zwanzig mal dreißig Zentimeter große, gerahmte Fotografie von ihm an die Wand gehängt. Als ich die Bar vor drei Jahren gekauft habe, war Hector nicht im Preis inbegriffen gewesen, obwohl ich ihn gerne übernommen hätte. Aber sein Besitzer hatte sich ein Wohnmobil gekauft und wollte sich zusammen mit Hector als Beifahrer das Land anschauen. Vielleicht schreibt der Bursche ja ein Buch: Meine Reise mit Hector.
Ich dachte daran, die Bar in The Baby Doll Polka Lounge South umzutaufen. Das Baby Doll ist meine und auch Jack Stoneys Lieblingsbar in Chicago. Leon, der Besitzer, hätte nichts dagegen gehabt, aber meine Gäste hätten mit der Anspielung sowieso nichts anfangen können, und außerdem stellte der von Hector inspirierte Name einen gewissen Marktwert dar.
Man könnte sich fragen, ob es eine gute Idee ist, als trockener Alkoholiker eine Bar zu betreiben. Vielleicht nicht, aber ich schaffe es. Dieser Tage ist das Getränk meiner Wahl Berghoff Root Beer aus Chicago, ein in der »Windy City« von dem berühmten alten deutschen Restaurant gleichen Namens selbst gebrauter Softdrink. Mein Getränkehändler liefert es mir. Sollte ich jemals versucht sein, wieder auf Gentleman Jack zurückzukommen, reicht mir ein Blick in die Gesichter der in meine Bar torkelnden Hardcoretrinker, und das Verlangen verschwindet wieder. Ich helfe diesen armen Seelen nach Kräften mit Ratschlägen, die sie in der Regel gar nicht wollen, sowie mit Kaffee und warmen Mahlzeiten, die sie in der Regel schon eher wollen.
Fort Myers Beach ist eine von jenen Städten in Florida, in denen die Mädchen im Spring Break, der einwöchigen Semesterpause im Frühling, völlig ausrasten. Jahrelang bin ich mit drei Freunden, die ich seit meiner Zeit auf der Saint Leo’s Academy kenne, einer Jesuiten-Highschool in Chicago, hierher in die Ferien gefahren. Im Jachthafen »Salty Sam’s Marina« mieteten wir ein Boot, schipperten in die Seitenarme der Estero Bay und angelten Snooks, Red Snapper, Meerbrasse und Rotbarsch. Auf der Jagd nach Tarpunen fuhren wir manchmal nach Norden bis zum Boca Grande Pass. Abends fielen wir in die Bars auf dem Estero Boulevard ein, auch ins Drunken Parrot, und machten Jagd auf Mädchen. Mädchen, die mündig waren, wohlgemerkt, oder sich zumindest als volljährig ausweisen konnten (nicht, dass wir aus Versehen einer Minderjährigen einen Drink spendierten).
Der Drunken Parrot befindet sich in einem baufälligen, einstöckigen Gebäude mit einem grünen Blechdach und verwitterter, weißer Holzverschalung. Es steht direkt am Strand. Nach vorne raus gibt es Beachvolleyballnetze, nach hinten eine große Terrasse mit einer Tiki-Bar samt Strohdach. Im Spring Break veranstalten wir an den Wochenenden Wet-T-Shirt-Contests. Für etwaige antifeministische Vorkommnisse entschuldige ich mich tausendmal, aber die Mädchen machen freiwillig mit, und es ist gut fürs Geschäft. Einmal haben unsere Gäste einen Bullen von Footballspieler von der Iowa State University zum Sieger erkoren, was beweist, dass unser Wettbewerb nicht sexistisch ist. Drinnen gibt es eine lange geschwungene Mahagonitheke mit Messingreling, an den Wänden hängen Fanartikel von College- und Profisportteams, auf einer kleinen Bühne spielen am Wochenende Blues- und Jazzmusiker, und in der Tipp-Topp-Küche führt ein altgedienter Burgerbrater das Kommando. Außerdem sorge ich dafür, dass die Toiletten immer so blitzblank sind, als hätte sich das Marine Corps für einen Kontrollbesuch angemeldet.
Eines Abends, als ich mir mit meinen Kumpels aus Chicago im Drunken Parrot einen genehmigte, gab ich dem Besitzer des Ladens, einem pensionierten Unteroffizier der Navy, meine Detective-Visitenkarte und sagte ihm, wenn er verkaufen wolle, solle er mich anrufen. Der Cop-Traum – klar. Aber hauptsächlich sprach der Alkohol aus mir. Am nächsten Morgen hatte ich alles vergessen.
Aber der Besitzer rief mich an. Zu der Zeit erholte ich mich gerade in meiner Doppelhaushälfte in Wrigleyville von meiner dritten Schussverletzung. Eine Patrone Kaliber 380 hatte glatt meine Schulter durchschlagen und meine Bewegungsfreiheit so stark eingeschränkt, dass mich der Arzt des Dezernats für dienstuntauglich hielt – von den hohen Tieren hatte ich das schon häufiger zu hören bekommen, aber diesmal hatte es auschließlich körperliche Gründe.
Der Täter hatte eine Skimaske getragen, als er in der La Salle Street im West Loop aus einer Genossenschaftsbank gekommen war und mir direkt gegenüberstand. Er war genauso überrascht wie ich. Er schoss auf mich, und ich antwortete mit drei Schüssen aus meiner Smith & Wesson Distinguished Combat, 357 Magnum – die gleiche Waffe, die Bill Stevens Jack Stoney gegeben hat. Der Mann schlug aufs Pflaster wie eine Marionette mit gekappten Schnüren und verabschiedete sich damit aus der Branche des bewaffneten Raubüberfalls in den vorzeitigen Ruhestand.
Ich bin zur Zeit mit einer wunderbaren Frau namens Marisa Fernandez de Lopez liiert. Ihr Vater kam als Junge während der Mariel-Bootskrise aus Kuba nach Miami. Ihre Mutter ist Venezolanerin. Sie ist etwa zehn Jahre jünger als ich. Über Frauen weiß ich nicht viel, welcher Mann tut das schon, aber ich weiß genug, um sie nicht nach dem Alter zu fragen.
Marisa ist eine umwerfende Schönheit mit schwarz glänzenden, schulterlangen Haaren, funkelnden dunklen Augen und einem irren Körper, den sie mit Marathonläufen und Power-Yoga in Schuss hält. Sie betreibt ein kleines Maklerbüro in Fort Myers Beach und kommt wegen der astronomisch hohen Preise für Ufergrundstücke sehr gut zurecht. Keine Ahnung, was sie in mir sieht, und ich habe auch nicht vor, sie danach zu fragen – dann fragt sie sich das vielleicht selbst.
Marisa hat keinen der Jack-Stoney-Romane gelesen. Sie bevorzugt anspruchsvollere Sachen, Bücher wie Das Licht zwischen den Meeren von M. L. Stedman, das sie gerade fertig gelesen hat, oder Der Distelfink von Donna Tart, das sie gerade angefangen hat. »Warum sollte ich etwas über einen fiktiven Detective lesen, wenn ich einen echten zu Hause habe?«, sagte sie einmal zu mir. Wo sie recht hat, hat sie recht.
Ich selbst lese keine Romane, außer wenn ich an Bills Krimis arbeite. Einmal Cop, immer Cop. In meinem Regal stehen hauptsächlich Sachbücher. Mord – 100 Jahre Tötungsdelikte in Amerika von Gini Graham Scott, Barkeeping für Dummies von Ray Foley, Das große Handbuch der Feuerwaffen (Zerlegung, Reinigung, Pflege) von Robert A. Sadowski, Geschichte von Chicago von Robert G. Spinney sowie Die Bekenntnisse des Augustinus von ebendiesem Augustinus (ein Schulbuch von der Saint Leo’s Academy, das ich aus irgendeinem Grund aufgehoben habe). Und natürlich: Semper Fi – Die definitive illustrierte Geschichte der U.S. Marines.
Mein Zuhause ist ein vierzehn Meter langes Hausboot namens Phoenix. Im Allgemeinen hasse ich kitschige Namen für Schiffe wie Dad’s Dream, Layzy dayz, Nauti Girl und She Got The House – die Namen habe ich alle mit eigenen Augen gesehen. In die gleiche beklagenswerte Kategorie fallen manierierte Modenamen, die manche Eltern ihren Kindern geben. Aber Phoenix passt zu meinem neuen Zuhause. Mit meinem neuen Leben hoffe ich aus der Asche meiner früheren Jahre aufzusteigen wie der Vogel aus der griechischen Mythologie.
Ich habe die Phoenix gebraucht gekauft. Ihr ursprünglicher Name war Takin’ It E-Z. Bezahlt habe ich es mit dem Erlös meiner Doppelhaushälfte in Wrigleyville. Es liegt im »Salty Sam’s«-Jachthafen vor Anker, und »vor Anker« heißt, es ist am Pier festgeschraubt. Denn die Phoenix ist wahrscheinlich so seetüchtig wie der Drunken Parrot, was ich allerdings nicht vorhabe zu überprüfen.
Marisa habe ich kennengelernt, als ich auf der Suche nach einer Bleibe in ihr Maklerbüro marschiert bin, das sich in einem Block in der Miramar Street befindet. Sie fragte, was ich mir idealerweise vorstellte. »Ein Boot für wenig Geld«, sagte ich. Ihre Datenbank spuckte die Takin’ It E-Z aus, die nach einer Scheidung einer Frau aus Syracuse zugefallen war. Laut meiner Maklerin musste die Frau schnell verkaufen. Ich gab ein Angebot ab, es wurde akzeptiert, ich verließ meine vorübergehende Unterkunft, das Neon Flamingo, und zog auf das Boot.
Ich hatte die amüsante, aber nicht ernst gemeinte Idee, mir einen Hausalligator anzuschaffen, so wie Sonny Crocket einen hatte, auf seinem Segelboot St. Vitus’ Dance in der von mir geliebten alten Version der TV-Serie Miami Vice. Stattdessen entschied ich mich für eine Katze. Na ja, eigentlich entschied sich die Katze für mich. Eines Morgens, ich war seit etwa drei Monaten an Bord der Phoenix wohnhaft, wachte ich in meiner Koje mit dem Gefühl auf, dass mich jemand anstarrte. Der Jemand war eine sehr große Katze, ein dreifarbiger Kater mit vernarbten Ohren und dem Gesicht eines Straßenkämpfers – das hatten wir gemein. Vielleicht war das der Grund, warum er mir sofort sympathisch war.
»Willkommen an Bord.« Das war alles, was mir einfiel. Er schaute mich an und miaute. Vielleicht versuchte er mir zu sagen, dass von nun an er der Kapitän sei, wie der somalische Pirat in dem Film Captain Phillips.
Der Kater schien nicht vorzuhaben, in naher Zukunft an Land zu gehen, also ging ich in die Kombüse, öffnete eine Dose Thunfisch, kippte den Inhalt in eine Schale und stellte diese an Deck. Er aß ein paar Bissen, schaute mich dann an und miaute wieder, als wolle er sagen: »Nicht schlecht, aber Frischfisch ist mir lieber.« Während ich Kaffee aufsetzte, verspeiste er den Thunfisch, schlenderte dann in die Kajüte, sprang aufs Bett, rollte sich zusammen und schlief ein. Seitdem sind wir zusammen.
Auf dem Sofa meiner Tante, die sechs Katzen hatte, lag ein besticktes Kissen, auf dem stand: »Hunde haben Besitzer, Katzen Personal.« Schnell stellte ich fest, dass das stimmte. Trotzdem, es ist eine Beziehung, die für Joe und für mich passt. Ich nannte ihn nach meinem Bruder. Anscheinend hatte er beschlossen, dass es an der Zeit sei, sich dauerhaft niederzulassen, und sich aus welchem Grund auch immer mein Boot ausgesucht. Vielleicht wurde er leicht seekrank und schätzte die Tatsache, dass die Phoenix offenkundig nie auslaufen würde.
3
Die Reichen sind anders
Es war kurz nach halb zehn an einem lauen Winterabend. Lau hieß in Fort Myers Beach fünfundzwanzig Grad, während in Chicago minus fünfzehn herrschten, bei Schneeböen. Eine der Vergnügungen eines Umzugs aus nördlichen Breiten nach Florida ist der Vergleich der Wintertemperaturen in der alten und der neuen Heimat, was ich mittels einer App auf meinem Handy regelmäßig tue. In den Sommermonaten macht das weniger Spaß.
Nach einem guten Abendessen und einem leidenschaftlichen Liebesspiel lagen Marisa und ich entspannt im Bett der Phoenix. »Liebesspiel« ist ein hoffnungslos altmodischer Begriff, ich weiß, allerdings bin ich auch ein hoffnungslos altmodischer Typ. Ich habe nichts gegen Gelegenheitssex, aber ich mag Marisa sehr und betrachte mich als jenseits des Alters, wo man – wozu ich in meiner Jugend neigte – keine Gelegenheit für eine schnelle Nummer ausließ.
Marisa ist eine hervorragende Köchin. Ich bin gut in Imbiss-Bestellungen und kann darüber hinaus ein schmackhaftes Schüsselchen Cornflakes zubereiten. Bill Stevens macht aus Jack Stoney einen Gourmetkoch. Nach einem harten Tag der Verbrechensbekämpfung kehrt Stoney in seine Wohnung in Wrigleyville zurück und zaubert aus dem, was gerade im Kühlschrank ist, eine unfassbare Mahlzeit für sich und seine jeweilige Flamme.
In meinem Kühlschrank gibt es weder Trüffel noch Porrees (oder ging es um Sellerie?) und auch keinen frischen »Parmigiano Reggiano«, der bei Jack Stoney zu den Eiern ins Omelette wanderte, als er im letzten Roman nach einer Schießerei nach Hause kam. Wenn ich mich recht erinnere, hat er sogar etwas knuspriges Brot dazu gebacken und hatte genau den passenden Wein zur Hand. In meiner Speisekammer finden sich ein oder zwei Zwiebeln, ein paar Büchsen Thunfisch und etwas Katzentrockenfutter für Joe, eine Schachtel Frosties, ein Laib Wonder Bread und ein Block Velveta-Käse, der haltbarer ist als Holz, und außerdem dies und das in Dosen, Gläsern und Schachteln. Verfallsdaten sind, was mich betrifft, etwas für Weicheier. In meinem Weinkeller alias Kühlschrankfach lagert für Gäste ein Sechserpack Bier und für mich Berghoff Root Beer.
Heute Abend jedoch hat Marisa die Lebensmittel eingekauft und ein köstliches »Ropa vieja« (zerpflücktes Rindfleisch) mit schwarzen Bohnen, gelbem Reis, Kochbanenen und gebratenen Yucca zubereitet. Als Nachtisch gab es Karamellflan. Marisa wohnt in der Mango Street in einem rosa Bungalow im Key-West-Stil, und in ihrer Profiküche lässt sie es wirklich krachen.
Auf der Bose-Anlage, die ich auf dem Boot installiert hatte, lief Glenn Goulds legendäre Aufnahme der Goldberg-Variationen von 1955. Die CD gehörte Marisa. Mein Musikgeschmack tendierte eher zu den legendären Aufnahmen von Led Zeppelin, The Ramones, Bob Seger und The Dead sowie zu den Chicago-Klassikern, die auch Jack Stoney mag: Buddy Guy, Muddy Waters, Howlin’ Wolf, Freddy King, Arthur »Big Boy« Crudup, Sonny Boy Williamson (I und II) und anderen. Letztes Weihnachten hatte mir Marisa eine CD-Box mit dem Titel Best of Chicago Blues geschenkt.
Ich war ziemlich zufrieden. Nicht alles lief glatt auf unserem gebeutelten Planeten, aber hier, im Bett mit Marisa, hielt sich ein kleines Fleckchen von Mutter Erde ganz fabelhaft.
»Woran denkst du?«, fragte sie. Ihr Kopf lag auf meiner Brust und ihre Hand genau da, wohin sie zu legen ich sie gebeten hätte, wenn es nötig gewesen wäre, was es nicht war.
»Ich habe gerade an Pet Sounds von den Beach Boys gedacht«, sagte ich. »Das war eigentlich Brian Wilsons Projekt. Er hatte aufgehört, mit der Band auf Tour zu gehen, damit er sich aufs Komponieren konzentrieren konnte …«
»Und worin genau besteht da die Relevanz zum gegenwärtigen Augenblick?«
»Das ist doch klar. Auf Pet Sounds haben sie ein Cembalo eingesetzt, und Bach hat die Goldberg-Variationen für Cembalo geschrieben.« Letzteres hatte Marisa mir erzählt, woran ich mich seltsamerweise erinnerte.
Weil ich nie aufhören konnte, wenn ich vorne lag – ein Kennzeichen auch meines Pokerspiels –, fügte ich hinzu: »Die Beach Boys haben auf dem Album auch Fahrradklingeln und Hundepfeifen benutzt, die meiner Meinung nach einen hübschen Kontrapunkt zu den Hauptthemen bilden. Überrascht mich, dass Bach nicht daran gedacht hat.«
Jack Starkey, Klugscheißer von Weltformat.
Die Klugscheißerei war einer der Punkte auf der langen Liste meiner Persönlichkeitsmerkmale, die meine Ex-Frau so aufgeregt hatten. Genauso wie die Angewohnheiten, die Klobrille oben zu lassen, beim Essen zu rülpsen (mein Argument, dass das in China – oder war das Indien? – als Kompliment für den Koch galt, wurde nicht akzeptiert) und dass ich keinen Bierdeckel benutzte (damals soff ich noch, was ein weiterer Punkt auf ihrer Liste war).
Vielleicht legte Marisa im Geiste auch schon eine Mängelliste an. Wenn ja, dann behielt sie sie für sich. Gepriesen sei ihre heiße Latina-Seele.
»Definiere das Wesen des Kontrapunkts in einer Musikkomposition«, erwiderte sie.
Damit hatte sie mich am Wickel, und sie wusste es. Dem Beispiel überfragter Politiker folgend, wechselte ich einfach das Thema. »Was ist jetzt, gehst du mit zu den Cubs? Ich muss mich um die Karten kümmern.«
Zeit meines Lebens bin ich Fan der Chicago Cubs. Manche Menschen halten es mit den White Sox. Über (schlechten) Geschmack lässt sich nicht streiten.
Marisa interessiert sich nicht für Baseball, sie ist Fußballfan. Das ist das Spiel, in dem zweiundzwanzig Spieler in Shorts herumlaufen und gegen einen Ball treten, der fast nie im Tor landet. Vergleichen Sie das mal mit der intellektuell stimulierenden, atemberaubenden Action des großen amerikanischen Nationalsports, in dem jedes Spiel Eingang in die Statistikbücher findet. Sie können alles nachschlagen.
»Selber schuld. Warum frag ich dich immer wieder, was du denkst«, sagte sie.
Ich suchte noch nach einer cleveren Antwort, als ich hörte, wie jemand vom Pier aufs Deck der Phoenix trat. Ich erwartete keinen Besuch, also griff ich instinktiv in das Nachtschränkchen, wo die Zweitwaffe aus meinen aktiven Zeiten lag, eine 38er Smith & Wesson mit kurzem Lauf.
Joe schlief auf einer Steppdecke auf dem Boden, wie immer, wenn Marisa seinen Platz auf dem Bett belegte. Ich hatte ihm ein Katzenbett gekauft, das er aber ignorierte, sodass ich es in einem Müllcontainer am Ende des Piers entsorgte.
Marisa schaute mich an und sagte: »Ich koche, und du wehrst Kostgänger ab.« Dann zog sie sich die Bettdecke hoch bis unters Kinn.
Von draußen rief eine laute Stimme: »United States Coast Guard. Wir wissen, dass Sie da drin geschmuggelte kubanische Zigarren verstecken und mit einer Minderjährigen im Bett liegen.«
»Das Letztere nehme ich als Kompliment«, sagte Marisa.
Die Stimme gehörte Cubby Cullen. Clarence »Cubby« Cullen ist der Polizeichef von Fort Myers Beach. Er ist klein, untersetzt, weißhaarig, Bürstenschnitt, beträchtlicher Bierbauch. Wie Rod Steiger in In der Hitze der Nacht. Er war früher stellvertretender Polizeichef in Toledo gewesen und hatte sich als Rentner gelangweilt. Als der Job in Fort Myers Beach frei wurde und die Ausschreibung im Mitteilungsblatt des Berufsverbands der Polizisten erschien, bewarb er sich.
Kurz nachdem ich aus Chicago hergezogen war, fuhr ich ins Polizeirevier und stellte mich Cubby vor. Das war eine Höflichkeitsgeste unter Berufskollegen, von Cop zu Cop. Gleichzeitig beantragte ich die Genehmigung für das verdeckte Tragen einer Waffe in Florida. Als Cubby erfuhr, dass ich nicht trank, war er enttäuscht, trotzdem wurden wir Freunde, tauschten Kriegserlebnisse aus und fuhren mit seinem »Smoker Craft«-Boot zum Angeln in die Nebengewässer. Deshalb brauchte ich mir keine Gedanken wegen der örtlichen Sperrstundenregelung zu machen.
Ich hatte eine Kiste Cohibas an Bord. Cubby wusste das, er hatte sie mir geschenkt. Er hatte mehrere Kisten von einem Angelausflug nach Lake of the Woods in Kanada mitgebracht, einem Land, das sich des freien Handels mit Kuba erfreut. Ich erzählte ihm die Geschichte, dass JFK, kurz bevor er das Handelsembargo gegen Kuba unterzeichnete, seinen Pressesprecher Pierre Salinger nach Kuba geschickt hatte, um ihm einen großen Vorrat an Antonio y Cleopatras zu besorgen. Der Mann genoss zweifellos Privilegien. Ich hatte das in einem Buch über Kennedy gelesen. Man konnte nicht eine katholische Schule oder Uni besuchen und nicht jede Menge über den ersten katholischen Präsidenten des Landes erfahren.
»Ist nur Cubby«, sagte ich zu Marisa. »Bin gleich wieder da.«
Ich zog meine Khakishorts und ein Cubs-T-Shirt an und ging an Deck.
»Hoffe, ich störe nicht«, sagte Cubby.
»Kein Problem, Cubby. Gehen wir in die Kombüse.«
Er folgte mir unter Deck. Zum Schutz von Marisas Intimsphäre schloss ich die Tür der Kajüte. Dann holte ich ein »Blue Moon«-Ale aus dem Kühlschrank, Cubbys Lieblingsbier, und für mich ein Berghoff. Ich fand sogar eine Orange, schnitt eine Scheibe für Cubbys Blue Moon ab, goss das Getränk in ein hohes Glas und warf die Orangenscheibe hinein, was, wie jeder Barkeeper weiß, die einzig mögliche Art ist, dieses Bier zu servieren.
Wir setzten uns an den Kombüsentisch und tranken einen Schluck. »Vermisst du manchmal die Polizeiarbeit?«, fragte er.
Ich dachte kurz darüber nach und sagte dann: »Alle sechs Monate vielleicht. Aber dann lege ich mich hin, und die Anwandlung verschwindet wieder.«
Das war nicht ganz richtig. Manchmal vermisste ich den Job wirklich, besonders den Adrenalinschub in einer gefährlichen Situation. Wie bei Soldaten in der Schlacht. »Nichts ist so berauschend wie beschossen und nicht getroffen zu werden«, hatte Winston Churchill gesagt. Obwohl ich, wie schon berichtet, dreimal getroffen wurde. Aber sonst war es immer berauschend gewesen.
Cubby nahm einen tiefen Schluck von seinem Bier, stellte das Glas ab, wischte sich mit dem Handrücken den Schaum vom Mund und sagte: »Ich weiß, dass du ein guter Detective warst, Jack. Ich kenne Leute aus deinem Morddezernat in Chicago, die sagen, einer der besten. Was die Zahl deiner gelösten Fälle angeht, warst du ein Rockstar.«
Die Vergangenheitsform ließ mich innerlich zusammenzucken. Und Cubby wusste das. Es war klar, dass er nicht nur auf ein spätes Bier und ein bisschen Geplauder vorbeigekommen war. Er trank noch einen Schluck Blue Moon und sagte dann: »Also, der Polizeichef unten in Naples ist ein Freund von mir. Wade Hansen. Wir haben heute Mittag zusammen gegessen. Er hat mir gesagt, dass er bei einem schwierigen Fall Hilfe braucht. Ich habe bis eben gearbeitet und war gerade auf dem Weg nach Hause, da habe ich mir gedacht, ich schaue vorbei und erzähle dir die Geschichte.«
Bei den Worten »schwieriger Fall« schlug sofort mein Herz schneller. Wie ein altes Feuerwehrpferd, das die Glocke hört.
Naples ist eine kleine Stadt an Floridas Golfküste knapp fünfzig Kilometer südlich von Fort Myers Beach. Es ist einer der Orte, wo die Superreichen sich versammeln, um das woanders verdiente Geld wieder auszugeben. Marisa hat mir erzählt, dass Naples – anders als Palm Beach, zum Beispiel – die Heimat des »ruhigen Geldes« sei. Die Stadt beschäftige eine PR-Agentur aus New York, sagte sie, damit ihr Name nicht in den Nachrichten und vor allem nicht in den Hitlisten mit den »lebenswertesten Städten« auftaucht.
Ruhiges Geld? Das bedeutete wohl, dass sie Leute wie mich nicht am Revers packten und brüllten: »Ich bin reich und du nicht!« Wenn man jedoch ihre Penthouses und Strandvillen sieht, ihre Bentleys, Porsches, Maseratis und Ferraris, dann ist die Wirkung die gleiche. Vielleicht fürchteten die Einwohner, der Pöbel – sollte er von all dem anstößigen Überfluss erfahren – könnte sich zusammenrotten, mit bäuerlichen Arbeitsgeräten bewaffnen, die Eisenzäune der feudalen Eigenheime stürmen, um ihre Bewohner zu einer Guillotine in einem der Innenstadtparks zu treiben. Für einen Jungen aus Wrigleyville hätte Naples auch auf der Rückseite des Mondes liegen können. Als Marisa und ich das erste Mal in der Stadt zu Abend aßen, war ich in Sorge, der Oberkellner würde mich höhnisch von Kopf bis Fuß taxieren und sagen: »Dienstboten zum Hintereingang.«