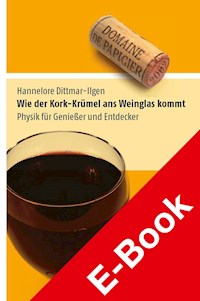3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Physikalische "Köstlichkeiten", was bitte, soll denn das sein? In diesem Buch stelle ich Ihnen meine ganz persönliche Auswahl an Entdeckungen. Experimenten und Effekten vor, die diese Wissenschaft entscheidend vorangetrieben haben. Ich habe sie einfach mal "Köstlichkeiten" genannt. Sie erfahren unter anderem mehr über schwebende Magnete, Schrödingers Katze, einen merkwürdigen quantenmechanischen Effekt sowie Einsteins einziges Experiment. Und zu allen "Köstlichkeiten" liefere ich natürlich eine eingängige und federleichte Erklärung, die nicht viel Vorwissen benötigt. Den Formelurwald (aus Ihrer Schulzeit) können Sie dabei getrost vergessen – Sie brauchen ihn garantiert nicht. Und nicht zuletzt werfe ich auch einen Blick in wichtige Anwendungen. Wer hätte gedacht, dass fast alle Köstlichkeiten uns im Alltag begegnen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 139
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Supraleitung, Tunneleffekt und Schrödingers Katze
20 physikalische Köstlichkeiten
BookRix GmbH & Co. KG80331 MünchenPhysikalische "Köstlichkeiten" - eine Einleitung
Physikalische "Köstlichkeiten", was bitte, soll denn das sein?
In diesem Buch stelle ich Ihnen meine ganz persönliche Auswahl an Entdeckungen. Experimenten und Effekten vor, die diese Wissenschaft entscheidend vorangetrieben haben. Ich habe sie einfach mal "Köstlichkeiten" genannt.
Sie erfahren unter anderem mehr über schwebende Magnete, Schrödingers Katze, einen merkwürdigen quantenmechanischen Effekt sowie Einsteins einziges Experiment.
Und zu allen "Köstlichkeiten" liefere ich natürlich eine eingängige und federleichte Erklärung, die nicht viel Vorwissen benötigt. Den Formelurwald (aus Ihrer Schulzeit) können Sie dabei getrost vergessen – Sie brauchen ihn garantiert nicht. Und nicht zuletzt werfe ich auch einen Blick in wichtige Anwendungen. Wer hätte gedacht, dass fast alle Köstlichkeiten uns im Alltag begegnen.
Also viel Spaß bei der „ganz großen Physik“. Eure Physikhexe
Noch ein Hinweis, das Kleingedruckte sozusagen: Alle Spielereien und Experimente habe ich selbst ausprobiert und teilweise mit Fotos dokumentiert. Da ich jedoch Ihre häuslichen Verhältnisse nicht kenne, kann ich keine Haftung übernehmen. Bleiben Sie vor allem dabei, wenn Sie mit Kindern experimentieren, auch dann, wenn alles völlig "ungefährlich" aussieht.
Die Supraleitung: Ein wissenschaftlicher Zufallstreffer
Der absolute Temperaturnullpunkt 0 K (sprich Kelvin; das sind -273,16 °C) hat Physiker nicht abgeschreckt, sondern im Gegenteil magisch angezogen (wie alle physikalischen Grenzen übrigens). Mit immer ausgeklügelteren Methoden versuchten sie, diesem näher zu kommen und stießen dabei auf spektakuläre und faszinierende Phänomene wie zum Beispiel die Supraleitung.
Kamerlingh Onnes wählt gezielt Quecksilber als Probe
Der niederländische Forscher Heike Kamerlingh Onnes begann 1882 an der Universität Leiden mit der Einrichtung eines Tieftemperatur-Labors. Ziel war die Verflüssigung von Gasen. 1908 gelang es ihm, das letzte Gas zu verflüssigen, das bis dahin allen Bemühungen erfolgreich widerstanden hatte: das Edelgas Helium, das bei 4,2 K siedet. Durch Verdunstung von flüssigem Helium gelang es Onnes, die Schwelle von 1 K zu unterschreiten. Sein Labor besaß damit den kältesten Ort der Erde.
Damit schuf der Forscher zum ersten Mal die Möglichkeit, in Temperaturbereichen in der Nähe des absoluten Nullpunktes zu experimentieren und zu untersuchen, wie sich Materie bei diesen niedrigen Temperaturen verhält. Im Jahr 1911 wählte er für seine Experimente eine Glaskapillare mit hochreinen Quecksilberfäden. Dieses Element wählte er wohl, weil es schon bei Zimmertemperatur flüssig ist und sich durch mehrfache Destillation relativ leicht reinigen lässt. Schon geringe Spuren von Fremdmaterial verfälschen die Messungen, wie seine Experimente mit Platin- und Golddrähten ergeben hatten.
Bei 4 K wird Quecksilber supraleitend
Als er das Quecksilber abgekühlt hatte, machte er eine interessante und unerwartete Entdeckung: Der elektrische Widerstand des Quecksilbers sank unterhalb einer Temperatur um 4 K sprunghaft auf einen unmessbar kleinen Wert. Strom könnte in solch einem Material stundenlang ohne den geringsten Verlust fließen. Das Phänomen ist heute unter dem Begriff Supraleitung bekannt. Wenig später entdeckte Onnes Blei als weiteren Supraleiter und beobachtete in einem supraleitenden Ring diesen unentwegten Stromfluss über einen Zeitraum von 2.000 Stunden. Im Normalleiter wäre der Strom innerhalb kürzester Zeit erloschen.
Aber auch das flüssige Helium wies bei solchen Temperaturen Merkwürdigkeiten auf: Es stieg als dünner Film an Gefäßwänden hoch, hatte also seine Zähigkeit oder Viskosität verloren. Dieser Effekt wird Suprafluidität genannt. 1913 erhielt Kamerlingh Onnes den Nobelpreis für Physik, allerdings für seine Pionierarbeiten bei tiefen Temperaturen und nicht – wie man erwarten könnte – für die Entdeckung der Supraleitung, denn die Physiker bemerkten erst allmählich, welch eine phantastische Entdeckung der Niederländer gemacht hatte.
Die Jagd nach der höchsten Sprungtemperatur
Inzwischen ist bei den meisten Elementen des Periodensystems Supraleitung gefunden worden, allerdings nur bei Temperaturen nahe dem absoluten Nullpunkt. Die Sprungtemperaturen der reinen Metalle liegen zwischen rund 0,01 K für Wolfram und 9,2 K für Niob, chemische Verunreinigungen beeinflussen die Sprungtemperatur stark. Erstaunlicherweise werden Metalle wie Kupfer oder Silber, deren elektrische Leitfähigkeit bei Zimmertemperatur besonders groß ist, nicht supraleitend, ebenso wenig Ferromagneten wie Eisen oder Nickel. Einige Elemente werden erst bei hohem Druck supraleitend, auch etliche Verbindungen und Legierungen, deren Elemente allein keine Supraleitung zeigen, sind bekannt. Supraleitung ist auch nicht an den kristallinen Zustand gebunden, wie der amorphe Supraleiter Wismut zeigt. Bis Mitte der 1980er Jahre war die Niob-Germanium-Verbindung Nb3Ge der Supraleiter mit der höchsten Sprungtemperatur von etwa 23 K.
Hochtemperatur-Supraleiter werden entdeckt
Versuche zur Supraleitung erforderten daher teure Materialien und schwierig zu beschaffendes flüssiges Helium. Schulen konnten von solchen Vorführungen nur träumen. Doch 1986 entdeckten Johannes Bednorz und Karl Müller bei der exotischen Verbindung Lanthan-Barium-Kupferoxid eine Sprungtemperatur im Bereich von 30 K und erhielten, nachdem ihr Ergebnis von etlichen anderen Laboren bestätigt worden war, bereits 1987 dafür den Nobelpreis.
Dieser unerwartete Fund löste weltweit eine fieberhafte Suche nach weiteren Hochtemperatur-Supraleitern (HTSL), wie diese Verbindungen genannt wurden, mit noch höheren Sprungtemperaturen aus. Hochtemperatur-Supraleiter sind keine metallartigen Stoffe, sondern spezielle keramische Materialien, so genannte Metalloxid-Keramiken oder Kuprate. Ihnen allen ist gemeinsam, dass sie aus Ebenen von Kupfer- und Sauerstoffatomen bestehen, die als perfekte Leitungswege für die Elektronen dienen. Einige der neu gefundenen Verbindungen werden schon ab -140 °C supraleitend.
HTSL lassen sich in allen erdenklichen Formen und Größen herstellen und können durchweg mit dem leicht handhabbaren, flüssigen Stickstoff einfach und kostengünstig gekühlt werden Aber immer wieder stellte sich auch die Frage: Könnte es nicht auch Materialien geben, die bereits bei Zimmertemperatur ihren elektrischen Widerstand verlieren? Denn schon Kamerlingh Onnes hatte die Vision, dass supraleitende Kabel elektrischen Strom ohne Verluste über Hunderte von Kilometern transportieren könnten.
Supraleitende Spulen und SQUIDs
Mit der Entdeckung der Hochtemperatur-Supraleiter ergaben sich neue Anwendungsmöglichkeiten, auch wenn das Material spröde und von geringer Haltbarkeit ist. Die derzeit wohl wichtigste Anwendung ist die Erzeugung von großen Magnetfeldern mit supraleitenden Spulen. Diese benötigen keine Energie zum Aufrechterhalten der Ströme, allerdings wird Energie benötigt zur Abkühlung auf die Betriebstemperatur und zur Kompensation der thermischen Isolationsverluste. Mit vielen Legierungen und Draht aus unzähligen HTSL-Filamenten lassen sich hohe statische Magnetfelder bis zu 100 Tesla erreichen. Hochleistungsspulen für derartige Magnetfelder finden sich in den Experimentieranlagen der großen Forschungseinrichtungen, in denen Teilchenbeschleuniger, Speicherringe, Hochleistungselektronenmikroskope oder magnetisch eingeschlossene Plasmafallen betrieben werden. Auch Magnetresonanztomographen, die zur Erzeugung dreidimensionaler Bilder aus dem Körperinneren große Magnetfelder benötigen, enthalten supraleitende Spulen.
Hochtemperatur-Supraleiter werden auch in einem SQUID eingesetzt, die Abkürzung steht für supraleitender Quanten-Interferenz-Detektor. Die Geräte dienen als Magnetometer, sie werden zur hochpräzisen Ausmessung von winzigen magnetischen Feldern benutzt, die nur ein Milliardstel der Stärke des Erdmagnetfeldes betragen. Ein SQUID besteht aus einem supraleitenden Ring, der an einer oder zwei Stellen durch ein elektrisch isolierendes Material unterbrochen wird. Die Spalte sind so klein, dass elektrische Ladungen durch sie hindurchtunneln können und damit die Anwesenheit auch kleinster Magnetfelder anzeigen. Anwendung finden solche Geräte bei der Untersuchung biomagnetischer Felder beispielsweise im menschlichen Gehirn (Magnetoenzephalographie) oder Herz, aber auch bei archäologischen Prospektionen oder der Kartierung geomagnetischer Anomalien der Erde.
Schwebende Supraleiter: Der Meißner-Ochsenfeld-Effekt
Die Hochtemperatur-Supraleiter ermöglichten es auch, Schauexperimente zur Supraleitung preiswert durchzuführen, denn zur Kühlung wird statt flüssigem (und teurem) Helium leicht zu beschaffender flüssiger Stickstoff benötigt.
Abb. 1: Ein Supraleiter lernt das Schweben (© Julian Ilgen)
Ein Experiment mit magnetischer Kraft
Zunächst legt man einen Hochtemperatur-Supraleiter in flüssigen Stickstoff. Lässt man nun einen kleinen Stabmagneten an einem Faden über dem Supraleiter herab, so schwebt dieser in geringem Abstand frei über dem Supraleiter, der Faden ist schlaff. Alternativ kann man auch einen kleinen Neodym-Magneten aus geringer Höhe vorsichtig auf das gekühlte Material fallen lassen. Ist der supraleitende Zustand erreicht, so wird er das Material nicht berühren, sondern in geringer Höhe, wie von Zauberhand geführt, über dem Supraleiter schweben. Drückt man ihn leicht nach unten, spürt man eine abstoßende Kraft. Nach dem Loslassen steigt der Magnet wieder in die Höhe und stabilisiert sich. Der schwebende Magnet kann auch durch leichtes Anstoßen in schnelle Drehung gebracht werden, die etliche Minuten anhält.
Wie funktioniert der schwebende Magnet?
Im Versuch nähert sich ein Magnet einem elektrisch leitenden Material. Dabei werden in der Oberflächenschicht des Materials elektrische Ströme erzeugt, man spricht von Induktion. Solche Ströme entstehen in elektrischen Leitern, wenn sich in ihrer Nähe oder in ihrem Inneren ein Magnetfeld (zeitlich) ändert. Auf gleiche Weise funktionieren auch Fahrraddynamo und Generator, im einfachsten Fall rotieren Metallspulen in einer Anordnung aus Stabmagneten. Hat man einen guten Supraleiter, dann können die einmal angeworfenen Ströme jahrelang fließen und erzeugen ihrerseits ein Magnetfeld. Von seiner Polung her ist es dem Feld des kleinen Magneten aber entgegengesetzt und hält ihn auf Distanz. In einem normal leitenden Material werden durch das Annähern des Magneten ebenfalls Kreisströme erzeugt, der elektrische Widerstand verzehrt diese jedoch rasch: Der Magnet fällt aufs Material.
Der Meißner-Ochsenfeld-Effekt
Beim Meißner-Ochensefeld-Effekt handelt es sich um eine Abwandlung des eben beschriebenen Versuchs. Man legt bei normalen Temperaturen einen kleinen Hochtemperatur-Supraleiter auf einen Magneten und schüttet etwas flüssigen Stickstoff über die Anordnung. Doch plötzlich passiert etwas Unerwartetes: Der kleine Supraleiter hebt vom Material ab und schwebt darüber. Die Abb. 1 zeigt diesen Sachverhalt, der kleine Supraleiter besteht aus einem Kuprat und wurde vom Sohn der Autorin in einem Chemiepraktikum hergestellt. Das Ergebnis des Experiments scheint zunächst dem ersten Versuch ähnlich zu sein. Allerdings hat man in diesem Fall keinen Permanentmagneten genähert, der einen Strom induzierte, eigentlich wurden gar keine magnetischen Felder verändert.
Oder doch?
Diesen interessanten Effekt haben die beiden Physiker Fritz Meißner und Robert Ochsenfeld, die im Tieftemperaturlabor an der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt in Berlin arbeiteten und dort weitere supraleitende Metalle und Verbindungen fanden, im Jahr 1933 entdeckt. Heute dient er als Schaunachweis für das Eintreten von Supraleitung.
Die beiden Forscher untersuchten, wie sich Supraleiter in Magnetfeldern verhalten. Dazu prüften sie die Verteilung des magnetischen Feldes in der Umgebung eines Supraleiters mit Hilfe einer kleinen Induktionsspule und einem empfindlichen Messgerät, einem so genannten Galvanometer. Zunächst magnetisierten sie ihre Probe im Normalzustand und kühlten sie anschließend. Jedes Mal, wenn die Probe supraleitend wurde, konnten sie einen Ausschlag des Messinstruments beobachten.
Die Ergebnisse ließen sich damit erklären, dass auch mit dem Magnetfeld beim Eintritt in den supraleitenden Zustand irgendetwas passiert. Tatsächlich wird es vollständig aus dem Inneren des Supraleiters heraus gedrängt, die Feldlinien umströmen den Supraleiter wie ein Hindernis. Das Innere der Probe ist, bis auf einen winzigen Bereich am Rand, feldfrei. Der Supraleiter wird zum idealen Diamagneten, das heißt der Drehimpuls der Elektronen baut eine Magnetisierung auf, die dem äußeren Feld genau entgegengesetzt ist. Bei normalen Materialien ist der Diamagnetismus sehr klein, beim Supraleiter jedoch sehr stark ausgeprägt: Die innere magnetische Feldstärke verschwindet beim Übergang in den supraleitenden Zustand.
Genau gilt dies nur für konventionelle Supraleiter; bei den Hochtemperatur-Supraleitern verbleiben einige „Fäden“ des magnetischen Feldes im Material. Trotzdem schweben auch sie über einem Magneten. Tatsächlich lässt sich dieses bemerkenswerte Resultat nicht mit klassischen Vorstellungen erklären, die Feldfreiheit im Inneren eines Supraleiters hängt mit der Bildung von speziellen Elektronenpaaren im supraleitenden Zustand zusammen; mehr dazu im nächsten Kapitel.
Das eigenstabile Schweben eines tiefgekühlten Supraleiters in wabernden Stickstoffschwaden über einem Magneten ist einzigartig (und beeindruckend!). Der Effekt ist geradezu ein Sinnbild für Supraleitung, der beste Beweis für einen erfolgreichen Übergang eines Materials in diesen Zustand. Der Schwebezustand ist offenkundiger als das Verschwinden des elektrischen Widerstandes, das sich nur über die Anzeige von Messinstrumenten dokumentieren lässt.
Endlich eine Theorie: Die Cooper-Paare
Obwohl bei der Entdeckung der Supraleitung die Quantenmechanik noch neu war, nahm bereits Kamerlingh Onnes an, dass die Supraleitfähigkeit nur quantenmechanisch gedeutet werden könne. Er sollte Recht behalten! Aber erst im Jahr 1957 gelang des den Physikern John Bardeen, Leon Cooper und John Schrieffer, die Supraleitung theoretisch zu erklären, wofür ihnen 1972 der Nobelpreis für Physik verliehen wurde.
In ihrer BCS-Theorie – der Name leitet sich aus den Anfangsbuchstaben ihrer Begründer ab – gingen sie davon aus, dass es sich beim Übergang von der Normalleitung zur Supraleitung um einen Phasenübergang handeln musste, bei dem sich die Leitungselektronen neu ordnen. Sie mussten – irgendwie – in einen Zustand übergehen, in dem sie mit den Defekten des Kristalls und den Schwingungsbewegungen der Atome nichts mehr zu tun hatten. Es kommt zu einer kleinen anziehenden Kraft zwischen jeweils zwei Elektronen, die durch das Zusammenspiel zwischen Elektronen und den Schwingungsbewegungen der Atome erzeugt wird. Diese Kraft ist unterhalb der Sprungtemperatur größer als die elektrische Abstoßung zwischen den Elektronen, zwei Elektronen mit antiparallelem Spin (entgegen gesetztem Drehsinn) binden sich aneinander und bilden ein Cooper-Paar.
Das Paar nimmt einen nur quantenmechanisch erklärbaren niedrigeren Energiezustand ein. Eine gute Vorstellung ist, dass die Paare dann wie eine Flüssigkeit den Strom durch das Material leiten. Die thermischen Schwingungen der Atomkerne, die die Bewegung der Elektronen beeinflussen und für den elektrischen Widerstand verantwortlich sind, können diese Paarbildung unterhalb der kritischen Sprungtemperatur nicht aufbrechen: Der Strom fließt ungebremst und ohne Widerstand. Bei großer Energieeinwirkung von außen wie Wärmezufuhr oder Bestrahlung werden die Paare wieder aufgebrochen und das Metall geht in seinen normalleitenden Zustand über. Aber: Das Verhalten der Hochtemperatursupraleiter vermag diese Theorie nicht oder nur ansatzweise zu erklären.
Maiman macht den Anfang: Der Laser
Obwohl aus alltäglichen Anwendungen heute nicht mehr wegzudenken, feierte der Laser bereits seinen 50. Geburtstag: Im Jahr 1960 wurde die interessante Lichtquelle von einem wissenschaftlichen Außenseiter, dem Physiker Theodore Maiman, ausgetüftelt. Aber er gab seiner Erfindung keine große Zukunft - was sollte man damit schon anfangen?
Der Laser beruht auf stimulierter Emission von Photonen
"Laser" ist ein Akronym aus „Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation“, zu Deutsch „Lichtverstärkung durch angeregte Strahlungsemission“. Der Name verdeutlicht das Grundprinzip des Lasers: Die Erzeugung und Verstärkung des Lichts basiert auf stimulierter, das heißt induzierter Emission von (sichtbarer) Strahlung in speziell angeregten Systemen. Auch wenn die Laserstrahlung heute Bereiche umfasst, die im Infrarot, Ultraviolett, sogar im Röntgen liegen, wurde die Bezeichnung „Laser“ für nach diesem Prinzip erzeugte Strahlung beibehalten.
Das Phänomen der stimulierten oder induzierten Emission wurde zuerst von Albert Einstein 1917 im Rahmen seiner Arbeiten über das Plancksche Wirkungsquantum als Umkehrung der Aufnahme von Licht beschrieben: Befinden sich die Elektronen eines Atoms in einem energetisch höheren Zustand, so können sie unter dem Einfluss eines Lichtteilchens (Photon genannt) wieder zurück in ihren Grundzustand gehen. Voraussetzung ist allerdings eine passende Energie oder Farbe des Lichtteilchens. Dabei wird die Anregungsenergie in Form eines (weiteren) Lichtquants abgegeben. Dieses neue Photon hat identische Eigenschaften wie das auslösende Teilchen, vor allem stimmen Wellenlänge und Ausbreitungsrichtung überein. Das Strahlungsfeld wird bei induzierter Emission kohärent verstärkt.
Spontane und induzierte Emission am Beispiel „Apfelbaum“
Der Unterschied zwischen spontaner Emission und induzierter Emission lässt sich gut an einem Beispiel verdeutlichen: Wenn Sie unter einem Apfelbaum stehen, kann spontan ein Apfel herunterfallen (und Sie treffen). Wenn Sie jedoch einen Apfel gezielt in den Baum werfen, „schüttelt“ dieser weitere Äpfel herunter. Gewöhnliche Lichtquellen wie glühende Körper oder angeregte Gase zum Beispiel in Kerzen erzeugen inkohärente Strahlung: Die Lichtabgabe erfolgt in allen möglichen Farben des Spektrums und sowohl zeitlich als auch räumlich völlig regellos. Die Mitglieder eines Chors sind ein gutes Beispiel für das Verhalten der Lichtteilchen: Bei einer Kerze singen alle durcheinander, jeder was er will, wann er will und wie schnell er will. Beim Laser singen alle Chormitglieder ein- und dasselbe Lied, und der Dirigent sorgt dafür, dass nicht nur alle gleichzeitig anfangen, sondern auch mit gleicher Geschwindigkeit singen.
Das Laserprinzip: Besetzungsumkehr
Die stimulierte Emission galt viele Jahre als rein theoretisches Konzept. Unter normalen Bedingungen wird nämlich das eingestrahlte Lichtteilchen vom Atom einfach aufgenommen, die Absorption ist der dominante Prozess. Stimulierte Emission lässt sich nur mithilfe einer so genannten Besetzungsumkehr, bei der es mehr Atome in einem höheren Energiezustand als solche im Grundzustand gibt, erreichen. Solche angeregten Atome werden für die induzierte Emission benötigt. Zudem muss sich das Atom auch lange genug in diesem höheren Energiezustand aufhalten, damit das Elektron nicht von selbst, also spontan, in den Grundzustand zurückfällt.
Solche Besetzungsinversionen gibt es von Natur aus nicht, sie müssen künstlich erzeugt und aufrecht erhalten werden. Dass sich allerdings in einem geeigneten Material mit Hilfe technischer Tricks so etwas realisieren lässt, konnte Charles Townes bereits 1955, anhand des Masers, der Molekülschwingungen zur Grundlage hat, zeigen. Aber dieser Maser arbeitete mit Mikrowellen und nicht mit Licht, das eine viel kleinere Wellenlänge hat!
Elektronenpumpen als technischer Trick
Die Frage lag daher nahe, ob durch geschicktes „Elektronenpumpen“ eine Besetzungsumkehr in einem geeigneten System erreicht werden könnte, so dass durch stimulierte Emission auch eine Lichtverstärkung im sichtbaren Bereich möglich wäre. Gegen Ende der 1950er Jahre erschienen erste Arbeiten, in denen durch Licht angeregter Cäsium-Dampf bzw. ein durch Hochfrequenzeinstrahlung angeregtes Helium-Neon-Gasgemisch als Licht verstärkendes Medium diskutiert wurden, allerdings waren alle nur theoretischer Art. Umso mehr überraschte die Wissenschaftsgemeinde, als es 1960 einem wissenschaftlichen Außenseiter, dem bei dem kalifornischen Luftfahrt-Hersteller Hughes Research Laboratories tätigen Theodore Maiman zusammen mit seinem Assistenten Charles Asawa gelang, einen Lasereffekt in einem Rubinkristall zu erzeugen.
Maimans Rubinlaser