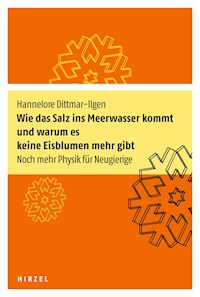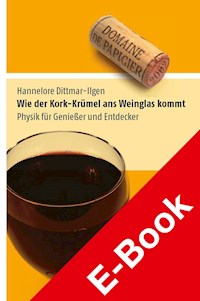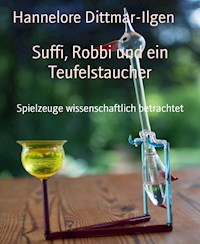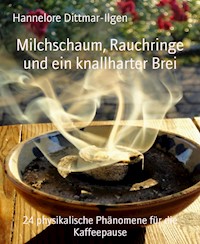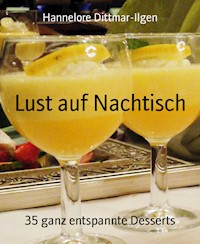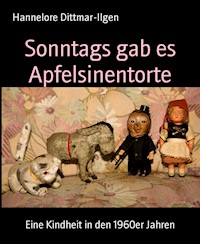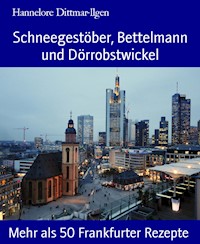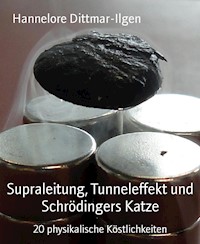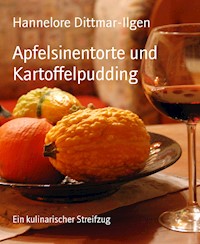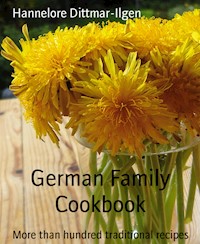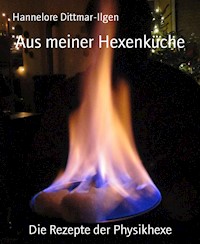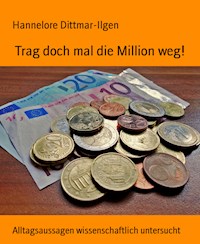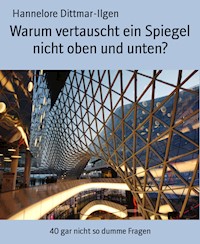
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Warum vertauscht ein Spiegel nur links und rechts … und nicht oben und unten? Kennen Sie solche Fragen? Sie begegnen uns ständig und das nicht nur aus Kindermund. Man wäre froh, eine kurze und verständliche Antwort zu bekommen. Einige solcher Fragen aus meinen Fachgebieten habe ich für Sie herausgesucht und – hoffentlich klug – beantwortet. Wenn ich die wissenschaftlichen Hintergründe beleuchtet habe, so geschah dies mit "leichter Feder" und ohne den üblichen Formeldschungel. Schlagen Sie irgendwo auf und lassen Sie sich zum Lesen "verführen".
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 100
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Warum vertauscht ein Spiegel nicht oben und unten?
40 gar nicht so dumme Fragen
BookRix GmbH & Co. KG80331 MünchenLinks, rechts, oben, unten... oder was?
Ja, wie ist das denn nun beim Spiegel? Diese und weitere Fragen begegnen uns ständig und das nicht nur aus Kindermund. Wir wären froh, eine kurze und verständliche Antwort zu bekommen. Einige solcher Fragen aus meinen Fachgebieten habe ich für Euch herausgesucht und – hoffentlich gut – beantwortet, die mit dem Spiegel gleich als Erstes. Wenn ich die wissenschaftlichen Hintergründe beleuchtet habe, so geschah dies mit „leichter Feder“ und ohne den üblichen Formeldschungel.
Ihr müsst das Buch übrigens nicht von vorne bis hinten lesen, denn die einzelnen Fragen sind völlig unabhängig voneinander. Schlagt irgendwo auf und lasst Euch zum Lesen „verführen“. Und übrigens: Dumme Fragen gibt es nicht. Allein die Tatsache, dass sie ständig gestellt werden, zeigt, dass wir Schreiberlinge hier Nachholbedarf haben.
Viel Vergnügen wünscht die Physikhexe
Noch schnell eine Bemerkung, sozusagen das Kleingedruckte: Alle Fragen und das dazugehörige Hintergrundwissen habe ich sorgfältig recherchiert und aufgeschrieben. Aber auch mir unterläuft einmal ein Fehler, für den ich nicht haften kann. Oft genügt jedoch gesunder Menschenverstand, um einen „Patzer“ zu erkennen.
(1) Warum vertauscht ein Spiegel nicht oben und unten?
Dann fangen wir doch mit dem Buchtitel gleich mal an. Dies ist eine oft gestellte Frage - vertauscht ein Spiegel doch augenscheinlich nur links und rechts. Früher habe ich mich der Antwort so genähert: Bewegen wir vor einem Spiegel den rechten Arm, so tut es unser Spiegelbild augenscheinlich mit dem linken. Aber stimmt das wirklich? Ein Spiegelbild entsteht, indem der Gegenstand, also unser Körper, senkrecht durch die Spiegelfläche hindurchgestülpt wird. Scheinbar ist das Spiegelbild genauso weit hinter dem Spiegel wie wir selbst davor. Unser Spiegelbild bewegt also folgerichtig den gleichen Arm wie wir. Versetzen wir uns jedoch in unser Spiegelbild, dann machen wir – gedanklich – eine Drehung. Sonst könnten wir uns ja gar nicht anschauen. Das sind jedoch – streng mathematisch gesehen – zwei verschiedene Bewegungen: Der Spiegel stülpt durch, aber wir drehen uns. Und bei dieser Drehung wird links und rechts vertauscht. Nicht der Spiegel vertauscht also links und rechts, sondern wir - in unseren Gedanken.
Ein zweifelhaftes Gesicht? Das kann ich gut verstehen, einfach ist es nämlich nicht. Heute ergänze ich die Frage ganz gerne mit einer Provokation: Der Spiegel vertauscht auch oben und unten – man muss es nur klug anstellen. Platzieren wir uns nicht vor einem Spiegel, sondern stellen wir uns einmal auf eine Spiegelfläche drauf. Beobachtet Euer Spiegelbild: Die Füße sind nun augenscheinlich oben und der Kopf ist unten, auch wenn der Spiegel natürlich nur wieder durchgestülpt hat. Auch wenn ein flaches Gewässer als Spiegel wirkt, können wir diesen Austausch von oben und unten sehen. Mein Foto aus Venedig bei Hochwasser zeigt es sehr anschaulich.
Und noch mehr: Das Vertauschen von oben und unten geht auch ganz „normal“. Wer sich je in einem Suppenlöffel angeschaut hat, weiß, dass – je nach Abstand – auch dort unser Gesicht umgedreht wird. Es gibt also durchaus Spiegel, in diesem Fall ein Hohlspiegel, die den Gegenstand beim Abbildungen kurzerhand auf den Kopf stellen. Der physikalische Grund ist hier übrigens die Reflexion der Lichtstrahlen, die je nach dem Ort des Auftreffens am Spiegel ein klein wenig anders ausfällt. Eindrucksvoll zeigt der große Hohlspiegel auf der spanischen Insel La Palma, dass auch dort die Welt auf dem Kopf stehen kann.
(2) Kann Blut in den Adern gefrieren?
Wer kennt nicht die Redewendung, dass einem das Blut in den Adern gefriert, die wir in großer Angst und Schrecken äußern? Aber kann Blut eigentlich gefrieren und bei welcher Temperatur passiert das? Zunächst einmal: Wie eine Forschergruppe herausgefunden hat, ist an dieser Redewendung tatsächlich etwas dran. Übergroße Angst kann nämlich das Blut in den Adern zwar nicht zum Gefrieren bringen, jedoch zum teilweisen Stocken - mit ernsten medizinischen Folgen.
Im Zusammenhang mit dieser Redewendung können wir uns natürlich die Frage stellen, ob Blut in den Adern (und überhaupt) gefrieren kann. Hier kann ich eindeutig Entwarnung geben. Rein theoretisch könnte man sich zwar vorstellen, dass Blut im Körper gefrieren könnte, wenn es draußen extrem kalt ist. Allerdings ist auch in diesem Fall die Körpertemperatur bedeutend höher, selbst wenn eine Person deutlich unterkühlt ist. Und wenn nicht schon der Tod durch Erfrieren eingetreten ist, so fließt das Blut auch weiterhin durch den Körper. Fließendes gefriert nicht so schnell, denkt an fließende Gewässer, die auch unter 0 Grad noch lange nicht gefroren sind.
Aber wie steht es mit dem Gefrieren von Blut außerhalb des Körpers, beispielsweise in einem Reagenzgläschen? Genau wie andere Flüssigkeiten auch hat Blut einen Gefrierpunkt. Als Flüssigkeitsgemisch mit einem hohen Wasseranteil wird man den Gefrierpunkt in der Nähe des Wassergefrierpunktes, also um 0 Grad suchen. Tatsächlich liegt er bei etwa -3 Grad, mit leichten Variationen, die von der Blutzusammensetzung abhängig sind. Kühlen wir Blut also auf Temperaturen unterhalb von -3 Grad, so wird des gefrieren, wenn ich meinen Recherchen hier mal Glauben schenke. Unwahrscheinlich ist dieser Temperaturbereich übrigens nicht, enthält Blut eben auch Salze und weitere gelöste Stoffe, die den Gefrierpunkt erniedrigen. Deshalb streut man ja Salz auf eisglatte Flächen.
Und noch was von der Forschungsfront: Da Blutkonserven nur etwa 35 Tage bei 4 Grad gelagert werden können (die roten Blutkörperchen verlieren dann ihre Fähigkeit, den Sauerstoff zu binden), gab und gibt es zahlreiche Versuche, Spenderblut durch Gefrieren zu konservieren. Als aussichtsreich hat sich dabei das Lagern in flüssigem Stickstoff bei -196 Grad erwiesen. Allerdings ist hierfür ein "Frostschutzmittel" für die Blutkörperchen nötig.
Das Gegenstück zu der bekannten Redewendung ist übrigens "das Blut kocht in den Adern". Hier ist jemand mehr als zornig, ja wütend. Und medizinisch kann es durchaus zu Wallungen kommen - auch gefährlich!
(3) Können wir im Vakuum einen Ton hören?
Diese (übrigens oft gestellte) Frage lässt sich leicht beantworten, wenn wir wissen, wie Schall entsteht und sich ausbreitet.
Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, Schall zu erzeugen, also verschiedene Schallquellen. So entsteht das typische Zirpen einer Grille durch die Bewegung ihrer Flügel. Bei einer Pauke, einem Lautsprecher oder auch einer Stimmgabel kann man mit etwas Geschick die Schwingungen beobachten, die die Töne erzeugen. Und auch bei der menschlichen Stimme spielen Schwingungen als Ursache für Schall die Hauptrolle: Wir können diese sogar fühlen, wenn wir unsere Finger beim Sprechen oder Singen an den Kehlkopf halten.
Schall ist also untrennbar mit der Erzeugung von Schwingungen verbunden. Je größer der maximale Ausschlag (die Amplitude) dieser Schwingungen, desto lauter können wir den erzeugten Ton hören. Je größer die Anzahl der Schwingungen pro Zeit (die Frequenz), desto höher ist der Ton. Tatsächlich überdeckt das menschliche Ohr jedoch nur einen kleinen Bereich möglicher Schallfrequenzen als Hörerlebnis. Typisch sind dies Frequenzen von 15 bis 20.000 Hz, je nach Alter. 1 Hz (sprich: Hertz) bedeutet hier eine Schwingung pro Sekunde. Darunter liegende Frequenzen bezeichnet man als Infraschall (wahrscheinlich verantwortlich für Halluzinationen), darüber liegende als Ultraschall (Medizin). Darauf komme ich später nochmal zurück.
Schall benötigt für seine Ausbreitung - im Gegensatz zu Licht oder Radiowellen - jedoch immer ein Medium. Dies kann ein Festkörper, eine Flüssigkeit oder auch ein Gas sein. Die Schwingungen des Schallerzeugers regen die Teilchen dieses Mediums ebenfalls zu Schwingungen an. Die Bewegung setzt sich fort, Nachbarteilchen werden angeregt, es entsteht eine Schallwelle. Doch im Gegensatz zu beispielsweise Wasserwellen können wir diese Schallwellen meist nicht sehen, sondern nur hören, falls diese unser Ohr treffen. Bei der Ausbreitung dieser Schallwellen wandern nämlich Verdickungen und Verdünnungen zum Beispiel der Luft von der Schallquelle zum Ohr. Auch in Festkörpern und Flüssigkeiten verläuft die Schallausbreitung ähnlich. Diesen Wellentyp bezeichnet man übrigens als longitudinal.
Ohne Schallträger ist also keine Schallwelle und damit auch keine Ausbreitung des Schalls möglich. Einen Ton können wir also im Vakuum nicht hören. In Wasser können Taucher allerdings Töne hören, und auch Tiere (Delfine zum Beispiel) verständigen sich auf diese Art, denn Wasser leitet Schallwellen.
Experimentell lässt sich dies belegen, viele haben diesen Versuch in der Schule schon einmal gemacht: Ein kleiner Lautsprecher wird an eine Glasröhre luftdicht angebracht. Schaltet man ihn ein, so kann man deutlich am anderen, geschlossenen Ende der Röhre einen Ton vernehmen. Nun evakuieren wir die Röhre, beispielsweise mit einer Pumpe. Die Schallstärke nimmt ab, bis wir schließlich keinen (oder kaum noch einen) Ton hören können. Trotz Schallerzeugung im Lautsprecher konnte die Schallwelle durch das Vakuum im Rohr nicht weitergeleitet werden. Bei diesem Versuch werden einige Personen trotzdem ein leises (vielleicht sogar mehr dumpfes) Geräusch hören. Dabei handelt es sich um sogenannten Körperschall, der vom Glas der Röhre weitergeleitet wird. Auch das menschliche Ohr arbeitet teilweise mit diesem Körperschall, nämlich einigen Knochen des Schädels.
Übrigens: Auch mit der Bezeichnung "Urknall" für die Entstehung des Weltalls ist das so eine Sache. Nicht nur, dass keiner da war, der diesen Knall hätte hören können. Sondern auch, dass er sich gar nicht hätte ausbreiten können. Wohin nämlich und vor allem womit? Die Bezeichnung war einfach nur scherzhaft gemeint - nämlich von vehementesten Gegner der Urknalltheorie, dem Physiker Fred Hoyle.
(4) Kann eine Flamme im Vakuum brennen?
Kann eine Flamme im Vakuum tatsächlich brennen? Die Frage (und auch die Antwort) ist der vorherigen ganz ähnlich, aber der physikalische Hintergrund ist hier anders. Nach der üblichen Vorstellung, dass beim Verbrennungsvorgang Sauerstoff verbraucht wird, geht das auf keinen Fall.
Kerzen und andere natürliche Flammen, wie sie beispielsweise bei Holzfeuer auftreten, benötigen Sauerstoff, um den Brennvorgang aufrecht zu erhalten. Dies zeigt schon ein bekanntes Schulexperiment: Stülpen wir ein Glas luftdicht über eine brennende Kerze, so verlöscht schon nach kurzer Zeit die Flamme - Sauerstoffmangel!
Unter Vakuum versteht man einen Raum, der von allen materiellen Dingen, also auch von der Luft, befreit ist (für Physiker: von Feldern und allen möglichen virtuellen Teilchen sei einmal abgesehen). Ein absolutes Vakuum lässt sich auf der Erde nicht erzeugen. Aber durch Abpumpen und weitere technische Tricks ist es möglich, einen abgeschlossenen Raum sehr luftleer zu bekommen. Unter anderem werden solche Räume für wissenschaftliche Untersuchungen, bei denen die Anwesenheit von Luft oder auch anderen Gasen stört, benötigt. In solch einem Vakuum kann eine Kerzenflamme natürlich keinesfalls brennen.
Viele Menschen verbinden mit Schwerelosigkeit ebenfalls ein Vakuum, was natürlich nicht der Fall ist. Ein Vakuum, also ein luftleerer Raum, kann durchaus der Schwerkraft der Erde unterliegen. Und Schwerelosigkeit, wie sie beispielsweise auf der internationalen Raumstation (nahezu) herrscht, bedeutet nicht, dass dort auch ein Vakuum ist. Aber: In der Schwerelosigkeit bilden sich tatsächlich andere Flammenformen aus, wie zahllose Experimente auf der ISS und auch im Bremer Fallturm zeigten. Da die verbrannten Gase der Kerzenflamme nicht nach oben abziehen, bleibt die Flamme mehr kugelrund und ist auch eher klein und mickrig. Verwechselt also bei der Fragestellung diese beiden Situationen nicht!
Übrigens: Eine einfache Möglichkeit, ein sehr gutes Vakuum zu erzeugen, ist folgender Trick. Wir befüllen ein dünnes Röhrchen (Tabletten oder aus der Chemie) randvoll mit Wasser. Nun halten wir den Daumen auf die Öffnung und drehen das Röhrchen um. Wenn wir darauf achten, dass das Wasser nicht ausläuft, bildet sich im oberen Teil dann ein kleines Vakuum. Leider kann man dort nicht experimentieren. Aber spannend ist es doch!
(5) Warum gefriert ein See nicht von unten?
Wie wir alle schon beobachtet haben, gefriert ein See, ein Teich und auch jede Pfütze zunächst an der Oberfläche zu. Diese Beobachtung mag erst bei näherem Nachdenken erstaunen, denn müssten Seen und Teiche nicht eigentlich von unten zufrieren, wo es doch am kältesten ist? Aber da folgt Wasser nicht den üblichen Spielregeln der Flüssigkeiten - es hat seine eigenen.
Gase wie Luft und auch Flüssigkeiten schichten sich im Allgemeinen so, dass sie unten die höchste Dichte (und damit die tiefste Temperatur) haben und diese mit größerer Höhe abnimmt. Warme Luft steigt hoch, kalte lagert sich unten ab - zumindest in Bodennähe ist das so. Für fast alle Stoffe - egal ob Gas, Flüssigkeit oder sogar Festkörper - gilt, dass die Dichte mit sinkender Temperatur zunimmt, die Moleküle nehmen einfach eine dichtere Packung zueinander an.