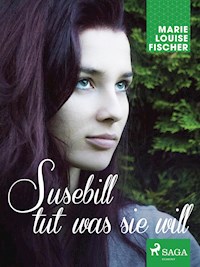
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Als Tante Bettina, die Freundin ihrer Mutter zu Besuch kommt, ist Susebill ganz aus dem Häuschen, sie kennenzulernen. Mit Ihrem Vater, dem Tierarzt Dr. Meixner, darf sie sie vom Flughafen abholen und begrüßt den Gast herzlich. "Wenn deine Töchter alle so entzückend sind wie Susebill, Hans, dann bist du wahrhaft zu beneiden." Aber ihr Vater ist gar nicht so beeindruckt und lacht nur. "Warte ab, Bettina, bis du sie näher kennengelernt hast. Susebill ist alles andere als ein Engel!" Mit dieser Antwort ist eigenwillige Susebill gar nicht einverstanden. Sie ist nur froh, dass niemand sieht, wie gekränkt sie sich fühlt.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 164
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Marie Louise Fischer
Susebill tut was sie will
SAGA Egmont
Susebill tut was sie will
Genehmigte eBook Ausgabe für Lindhardt og Ringhof Forlag A/S
Copyright © 2018 by Erbengemeinschaft Fischer-Kernmayr, (www.marielouisefischer.de)
represented by AVA international GmbH, Germany (www.ava-international.de)
Originally published 1963 by F. Schneider, Germany
Copyright © 1963, 2018 Marie Louise Fischer und Lindhardt og Ringhof Forlag A/S
All rights reserved
ISBN: 9788711719459
1. Ebook-Auflage, 2018
Format: EPUB 2.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach
Absprache mit Lindhardt og Ringhof gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com und Lindhardt og Ringhof www.lrforlag.dk – a part of Egmont www.egmont.com
Susebill hat Kleidersorgen
„Nein! Ich will nicht!“ rief Susebill böse. „Lieber gehe ich nackt. Ich denke gar nicht daran, diese alten Fetzen anzuziehen!“
„Nackt willst du gehen?“ fragte Stefanie, ihre ältere Schwester, ungerührt und blies sich eine Strähne ihres kurzgeschnittenen dunklen Haares aus der Stirn. „Da bin ich aber mal gespannt.“
„Ach du!“ fauchte Susebill zornig und funkelte Stefanie an. „Wenn du wenigstens besser mit deinen Sachen umgegangen wärst …“
„Bitte, Susebill!“ Frau Meixner, die Mutter, hob mahnend die Hand. „Nimm dich ein bißchen zusammen. Du weißt genau, daß ich nichts Unbilliges von dir verlange. Das habe ich nie getan. Es ist selbstverständlich, daß die Kleider wieder tipptopp hergerichtet werden, bevor du sie anziehst.“
„Alt und getragen bleiben sie trotzdem!“
„Ph!“ machte Stefanie. „Was ist schon dabei? Wir sollen ja damit zur Schule gehen und nicht zu einer Modenschau.“
„Stefanie hat ganz recht“, stimmte die Mutter zu, „also komm her, probier an. Ich bin sicher, wenn du dich erst mal hier in dem netten Blauen siehst …“ Sie hatte das Hleid aufgeknöpft und hielt es Susebill hin, damit sie hineinschlüpfen konnte.
Aber Susebill wich einen Schritt zurück. „Nein“, sagte sie energisch, „niemals. Kommt gar nicht in Frage!“
Frau Meixner seufzte. „Ich verstehe nicht, warum gerade du immer so unvernünftig sein mußt. Nimm dir doch ein Beispiel an deinen Schwestern. Andrea macht mir wegen ihrer Kleider niemals Ärger und …“
„Andrea! Das wäre auch noch schöner!“ rief Susebill wütend. „Andrea ist ja der Glückspilz in der Familie! Ach, was gäbe ich darum, wenn ich als Älteste auf die Welt gekommen wäre! Dann brauchte ich jetzt nicht die abgelegten Klamotten von den anderen zu tragen und bekäme so neue Sachen wie Andrea.“
„Wir haben alle ein neues Sonntagskleid bekommen“, sagte Stefanie, „oder ist dir das etwa auch nicht gut genug?“
„Was mir das schon nutzt! Ein neues Sonntagskleid …, daß ich nicht lache … und für die Schule fünf alte Fetzen, die schon Andrea und Stefanie vor mir getragen haben! Es ist direkt zum Heulen! Begreift ihr das denn nicht? Alle in der Klasse werden mich auslachen, wenn ich schon wieder mit dem alten Zeug ankomme. Jeder weiß doch, daß ich die Sachen von meinen Schwestern geerbt habe!“
Frau Meixner seufzte tief. „Ach, Susebill“, sagte sie, „du machst es mir wirklich schwer. Glaubst du nicht, daß ich dir nicht auch lieber schöne neue Sachen kaufen würde? Aber es geht nun einmal nicht, wir haben nicht genügend Geld. Laß dich nicht unterkriegen, mein Liebling, bestimmt meinen es die anderen nicht so, wenn sie ein bißchen spotten.“
Stefanie hatte sich auf den großen Tisch geschwungen und saß mit baumelnden Beinen zwischen Modeheften und Stoffresten. „Laß dir doch nichts vormachen, Mutter“, sagte sie, „kein Mensch lacht Susebill aus. Das will sie dir nur einreden, um dich weich zu machen.“
„Nun, vielleicht lachen sie nicht“, gab Susebill trotzig zu, „aber wie sie mich angucken … ganz schief von der Seite. Alle sind schicker angezogen als ich … alle!“ Vor lauter Selbstmitleid stiegen Susebill Tränen in die Augen. „Ich zähle ja doch bloß zur zweiten Garnitur.“
„Ob das nicht vielleicht auch an deinen sehr mittelmäßigen Schulleistungen liegen könnte?“ fragte Frau Meixner.
Susebill stieg das Blut zu Kopf. Sie öffnete den Mund, als ob sie etwas sagen wollte, aber sie brachte kein Wort hervor. Plötzlich drehte sie sich um, verbarg ihr Gesicht hinter dem Arm und brach in wildes Schluchzen aus. „Oh, ihr seid ja alle so gemein zu mir!“ stammelte sie.
Stefanie wollte etwas sagen, aber Frau Meixner ließ es nicht dazu kommen. „Laß uns allein“, bat sie mit einer Kopfbewegung zur Tür hin.
Stefanie ließ sich vom Tisch rutschen und verzog sich.
Susebill blieb mit ihrer Mutter allein. Frau Meixner wartete erst ab, bis das Mädchen sich ein wenig erholt hatte, bevor sie zu sprechen begann. In der Zwischenzeit machte sie sich daran, die Nähte eines leicht verschossenen grünen Leinenkleides aufzutrennen.
Erst als Susebills Schluchzen nur noch leise und in immer größeren Abständen zu hören war, sagte sie: „Na, was ist? Möchtest du dich nicht entschuldigen?“
Susebill warf mit einem energischen Ruck ihren dicken blonden Zopf über die Schulter zurück in den Nacken. „Ich wüßte nicht, für was!“ sagte sie trotzig. Ihre Nase war verschwollen, ihre Augen voll Tränen.
„Dann muß ich dir ein bißchen auf die Sprünge helfen. Du hast erklärt, daß wir alle … ich nehme an, du meintest damit Stefanie und mich … vielleicht sogar die ganze Familie … gemein zu dir wären. Wenn du dir die Mühe geben würdest, einmal vernünftig nachzudenken, würdest du daraufkommen, daß das gewiß nicht stimmt. Deine Schwestern und ich, deine Brüder und dein Vater, wir alle haben dich von Herzen lieb. Du kannst niemandem von uns die Schuld daran geben, daß wir nicht imstande sind, deine Wünsche zu erfüllen. Wir täten es, wenn wir es könnten. Oder zweifelst du daran?“
Susebill sah Frau Meixner an. Mehr als von den Worten der Mutter war sie von dem traurigen Ausdruck ihrer Augen betroffen. Sie merkte plötzlich, daß sie ihr das Herz schwer gemacht hatte. „Entschuldige, bitte“, sagte sie leise, „ich wollte nicht … ich habe es nicht so gemeint.“
„Ich möchte dich so gern glücklich sehen, mein Liebling …“
„Oh, Mutter!“ Susebill lief auf Frau Meixner zu, warf sich in ihre Arme und begann erneut zu schluchzen.
Frau Meixner hielt ihre kleine Tochter ganz fest, streichelte nur sachte das weiche blonde Haar.
Es dauerte eine ganze Weile, bis Susebill sich soweit gefaßt hatte, daß sie wieder sprechen konnte. „Ich weiß ja, du kannst nichts dafür, Mutter“, sagte sie, „und Andrea und Stefanie auch nicht … Aber warum haben wir bloß nicht so viel Geld wie andere Leute? Du hast keine Ahnung, wie schick die anderen in meiner Klasse angezogen sind. Gunhild Hopmann zum Beispiel sieht immer aus wie aus dem Modeheft geschnitten, dabei ist ihr Vater doch bloß …
Frau Meixner strich ihr über die heiße Stirn. „Gunhild ist das einzige Kind, aber ihr seid fünf, da liegt der Unterschied. Eine Familie mit fünf Kindern kann sich eben nicht so viel leisten wie andere … Dafür ist es bei uns aber auch viel lustiger als anderswo, findest du nicht? Oder würdest du auf eines von deinen Geschwistern verzichten wollen, wenn du dafür schönere Kleider kriegen könntest?“
„Nnnein“, sagte Susebill zögernd; es klang nicht gerade überzeugend.
Frau Meixner überhörte es. „Na, siehst du“, sagte sie lächelnd, „ich wußte, du würdest so denken. Vater und ich, wir haben uns immer gewünscht, eine große Familie zu haben, und wir finden es herrlich. Wir müssen uns dafür selber auch manche Einschränkungen auferlegen. Aber was macht das schon! Menschen, die man lieb hat, sind wichtiger als ein Fernsehapparat oder ein Pelzmantel, nicht wahr?“
„Fernsehen ist aber auch prima, Mutter“, sagte Susebill, „gestern nachmittag bei Gunhild Hopmann …“
„Kindskopf“, sagte Frau Meixner und lachte, „als ob sich so ein technisches Ding überhaupt mit etwas Lebendigem vergleichen ließe!“ Als sie Susebills unglückliches Gesicht sah, fügte sie rasch hinzu: „Warte nur, Kind … Wenn wir eines Tages so weit sind, daß wir uns einen Fernsehapparat leisten können, werde ich bestimmt nicht dagegen sein. Vielleicht ist es wirklich ganz nett. Aber vorläufig sind andere Dinge wichtiger. Zum Beispiel unser Haus. Wenn wir erst ein eigenes Haus haben, wird dir manches besser gefallen. Jeder von euch wird ein eigenes Zimmer haben … auch Thomas und Theo … Wir werden nicht mehr mitten in der lauten Stadt wohnen, sondern draußen, wo die Luft rein ist. Ihr werdet den ganzen Tag im Garten sein können, wenn die Sonne scheint … Ich werde Gemüse ziehen, Radieschen und Blumen … Ach, Susebill, es wird herrlich werden.“
„Werden wir dann auch in eine andere Schule kommen?“
„Ja, sicher. Jeden Tag in die Stadt zu fahren, wäre ja viel zu umständlich.“
„Das ist gut“, sagte Susebill mit einem Seufzer der Genugtuung. „Dann werden die in meiner neuen Klasse wenigstens eine Zeitlang nicht wissen, daß ich die abgelegten Kleider von meinen großen Schwestern tragen muß.“
„Sparen müssen ist keine Schande.“
„Nein, aber langweilig. Ach, Mutter, es muß phantastisch sein, viel Geld zu haben … Warum hast du bloß keinen reichen Mann geheiratet?“
Frau Meixner lachte. „Weil ich deinen Vater geliebt habe. Außerdem ist er gar nicht arm, sondern ein gut verdienender Tierarzt. Wir würden uns viel mehr gönnen können, wenn ihr nicht so teuer wäret.“
Susebill zog sich das abgelegte blaue Kleid von Stefanie über den Kopf. „Wenn ich erst erwachsen bin und verheiratet, wünsche ich mir bestimmt nur zwei Kinder. Dann ist Schluß.“
„Du meinst wohl, da hätten wir auch tun sollen, ja? Dann denk einmal nach. Du bist die vierte. Wenn wir uns nicht viele Kinder gewünscht hätten, schwämmst du jetzt noch in Abrahams Wurstkessel.“
Jetzt mußte auch Susebill lachen. „Na, da hätte ich wenigstens keine Kleidersorgen“, sagte sie und knöpfte das Kleid vorne zu. „Wird es mir stehen?“ fragte sie und drehte sich, daß der weite Rock wie eine blaue Glocke um ihre Beine schwang.
„Wunderbar, Mädel!“ Frau Meixner begann abzustekken. „In der Taille sollte es enger sein … Hier an den Schultern lasse ich ein wenig raus … Wenn ich einen großen Kragen draufsetze, wird kein Mensch merken, daß es nur umgearbeitet ist.“
„Hoffentlich nicht“, sagte Susebill. Aber sie betrachtete sich doch mit Wohlgefallen in dem hohen Spiegel. Das Kleid stand ihr viel besser als Stefanie und Andrea, fand sie insgeheim. Ich bin eben doch die Hübscheste, dachte sie, sprach es aber wohlweislich nicht aus.
Ihre Mutter hatte meist für dergleichen Feststellungen sehr wenig Verständnis.
Gemischte Gefühle
Die Praxis von Dr. Hans Meixner lag im selben Stockwerk des großen Mietshauses wie die Wohnung seiner Familie. Aber den Kindern war es nur ausnahmsweise erlaubt, den Vater während der Arbeit aufzusuchen. Eine Ausnahme machte Andrea, die Älteste. Sie besaß viel Geschick im Umgang mit kranken Tieren und durfte sogar manchmal helfen, wenn Fräulein Hülsner, die Sprechstundenhilfe, krank oder beim Friseur war. Andrea wollte später Tiermedizin studieren wie der Vater.
Sonst sahen die Kinder die vierbeinigen und geflügelten Patienten nur im Treppenhaus. Kranke Hunde, Katzen, Schildkröten, Eidechsen und Igel wurden zu Dr. Meixner gebracht, Goldhamster und Meerschweinchen, Kanarienvögel, Papageien, Wellensittiche, Raben und zahme Amseln, und einmal sogar ein kleiner Löwe. Manche Tiere wirkten ganz munter, aber den meisten sah man schon von weitem an, daß sie krank waren – Fell und Federn waren glanzlos, die Augen trübe, einige waren bandagiert oder hatten einen Ausschlag.
Als Susebill eines Mittags früher als gewöhnlich aus der Schule kam, traf sie unten im Haustor mit einer alten Dame zusammen, die sich vergeblich bemühte, ihren schönen grauen Scotchterrier an der Leine nach oben zu zerren. Der Hund wollte einfach nicht.
Susebill blieb stehen. „Hat er Angst?“ fragte sie interessiert.
Die alte Dame nickte. „Ja. Mecki hat Ohrenzwang. Sieh nur, wie er immerzu den Kopf schüttelt. Es tut furchtbar weh, sobald man nur in die Nähe des Ohres kommt, und der Tierarzt muß ihn doch berühren, sonst kann er ihn ja nicht behandeln.“
Susebill hockte sich in die Knie. „Nun hör mal gut zu, Mecki“, sagte sie schmeichelnd, „du bist doch ein großer vernünftiger Hund … Willst du denn krank sein? Nein, bestimmt nicht. Dann mußt du jetzt aber auch tapfer sein. Der Tierdoktor da oben ist mein Vater, weißt du, und der tut keinem Tier weh … Jedenfalls nicht mehr, als unbedingt notwendig ist. Also komm, Mecki … komm!“
Sie erhob sich und ging langsam voraus, und Mecki, wahrscheinlich angenehm beruhigt von dem freundlichen Ton ihrer Stimme, folgte ihr tatsächlich. Im zweiten Stock blieb Susebill stehen, machte einen Knicks und sagte zu der alten Dame: „So, da wären wir …“ Sie wies mit dem Kopf auf die Wohnungstür. „Ich muß jetzt hier rein …“
„Bitte, liebes Kind, bitte … könntest du uns nicht noch ins Wartezimmer begleiten?“ fragte die alte Dame. „Und könntest du nicht mit deinem Vater sprechen, daß er Mecki gleich drannimmt? Er wird sonst immer nervöser.“
Tatsächlich zerrte Mecki schon wieder heftig an seinem Halsband und schüttelte den Kopf in geradezu beängstigender Weise.
Susebill runzelte die Stirn. „Will mal sehen, was sich machen läßt“, sagte sie gnädig und öffnete die Tür zu dem kleinen Vorraum. „Gehen Sie bitte nicht ins Wartezimmer, ich will meinen Vater fragen …“ Sie zögerte einen Augenblick, dann drückte sie entschlossen die Klinke nieder und öffnete die Tür zum Behandlungszimmer.
„Du Rüpel! Du Rüpel! Scher dich hinaus!“ schrie eine grobe schnarrende Stimme.
Vor Schreck wäre Susebill wirklich beinahe wieder zurückgesprungen. Dann erkannte sie, daß die aufgebrachte Stimme keinem Menschen gehörte, sondern einem weißen Kakadu mit einem prächtigen blauen Schopf.
Dr. Meixner lachte, als er ihr Gesicht sah. „Geschieht dir ganz recht“, sagte er, „du weißt genau, daß ich Überfälle in meinen geheiligten Räumen nicht liebe!“
„Aber ich wollte doch nur …“, begann Susebill verdattert.
„Rüpel! Rüpel!“ schrie der Kakadu böse.
Ein älterer Herr, offensichtlich der Besitzer des komischen Vogels, warf ein großes wollenes Tuch über den goldglänzenden Käfig. „Ich fürchte, ich muß mich für Josefines Grobheit entschuldigen“, sagte er, „sie gebraucht immer diese schrecklichen Worte, wenn sie fremde Menschen sieht.“
„Kann sie auch andere? Ich meine, kann sie auch nett reden?“ fragte Susebill interessiert.
„O ja, natürlich!“ sagte ihr Besitzer stolz, lüftete das wollene Tuch und bat zärtlich: „Bitte, Josefine, sag mal was Liebes!“
„Süßer Liebling!“ schnarrte der Kakadu prompt, aber es klang genauso aufgebracht wie sein früheres „Rüpel“.
Susebill lachte, und Dr. Meixner gab dem älteren Herrn rasch ein Rezept, das er aufgeschrieben hatte. „Hier, davon geben Sie Josefine bitte täglich dreimal drei Tropfen, am besten auf Zucker, dann merkt sie kaum etwas davon … Sie schmecken nicht gerade glänzend, aber sie muß sie nehmen.“
„Danke, Herr Doktor, vielen Dank …“ Der ältere Herr verabschiedete sich.
„Und was hast du hier zu suchen?“ wandte Dr. Meixner sich an seine kleine Tochter.
Als Susebill den Mund aufmachte, schnitt er ihr das Wort ab: „Keine langatmigen Erklärungen bitte. Was du auch immer auf dem Herzen hast, ich bin sicher, es hätte Zeit gehabt bis zum Mittagessen.“
„Nein, Vater!“ rief Susebill. „Ganz bestimmt nicht … ich muß dich jetzt sprechen, jetzt sofort! Die alte Dame hat schrecklichen Ohrenzwang … Ich meine ihren Hund natürlich, Mecki heißt er, und deshalb … Ich habe sie draußen im Vorraum warten lassen, weil Mecki sonst immer nervöser wird …“
Dr. Meixner hob die Augenbrauen. „Bist du deshalb gekommen?“ fragte er.
„Ja natürlich, ich wollte doch nur … Bitte, könntest du Mecki nicht sofort drannehmen? Jetzt gleich? Ausnahmsweise?“
„Susebill“, sagte Dr. Meixner, „jetzt sieh mich mal an, ganz fest, nicht mit einem solchen Augenaufschlag, du weißt ja …“
Susebill schmunzelte. „Braune Augen sind nett, aber sehr kokett!“
„Schwindelst du mich nicht an?“
„Ich weiß gar nicht, was du meinst.“
„Es hat dir also nicht zufällig ein kleines Vögelchen etwas von einem Telegramm gezwitschert?“
„Telegramm?“ Susebill bekam vor Staunen den Mund nicht mehr zu.
„Ja, heute früh ist ein Telegramm von Tante Bettina durchgesagt worden, sie …“
„Sie kommt?“ schrie Susebill und tanzte von einem Bein auf das andere. „Sie kommt, Väterchen?“
„Ja. Übermorgen. Und du bist wirklich nicht gekommen, um dich darüber zu vergewissern?“
Susebill flog ihrem Vater in die Arme. „Nein, nein, nein! Ich wußte es nicht! Ich hab es nicht geahnt! Oh, wie fabelhaft! Tante Bettina kommt!“ Sie sauste zur Tür, drehte sich dann ganz plötzlich doch noch einmal um. „Aber du nimmst den armen Mecki jetzt doch gleich dran, ja?“ Und dann wirbelte sie aus dem Zimmer.
Dr. Meixner sah ihr kopfschüttelnd nach. Dann wandte er sich an Fräulein Hülsner, die die ganze Zeit stumm am Fenstertisch gesessen und die Blutprobe einer kranken Siamkatze analysiert hatte. „Was sagen Sie dazu?“ fragte er.
„Keine Sorge, Herr Doktor, sie wird sich schon noch mausern!“
Fräulein Hülsner stand auf und ließ den kranken Scotch und seine Herrin ein.
Beim Mittagessen wurde heftig über Tante Bettinas angekündigten Besuch diskutiert. Susebill und Theo, das Nesthäkchen, freuten sich unbändig. Andrea, die Große, etwas gedämpfter, während Stefanie und Thomas über die Aussicht, sich in ihren besten Kleidern und von ihrer besten Seite präsentieren zu müssen, alles andere als glücklich waren.
Eigentlich war Frau Bettina Gütler gar keine wirkliche Tante, sondern Mutters Schulfreundin. Sie hatte einen sehr reichen Mann geheiratet und war immer hochelegant. Frau Meixner versuchte niemals, ihr etwas vorzumachen, dennoch legte sie natürlich Wert darauf, sich von der Freundin nicht beschämen zu lassen. Sie wollte gerne ihre Kinder und ihre Wohnung im besten Licht zeigen, und das war für die Wildfänge Thomas und Stefanie durchaus nicht angenehm.
„Ausgerechnet Samstag“, maulte Thomas, „wo ich mit ein paar aus meiner Klasse Fußballspielen gehen wollte …“
„Und ich!“ rief Stefanie. „Ich wollte zum Himbeerenpflücken fahren – und nun …“ Sie schluckte.
„Was … nun?“ fragte Dr. Meixner.
„Alles Essig“, sagte Thomas, „wir müssen zu Hause bleiben und feine Leute spielen!“
„Thomas!“ sagte die Mutter böse. „Bitte! Was sind das für ungezogene Redensarten …“
„Laß ihn nur, Hilde, wahrscheinlich meint er es so, wie er sagt …“
„Na klar! Was denn sonst?“
„Trotzdem möchte ich dich bitten, mich erst aussprechen zu lassen, Thomas, das dürfte wohl das wenigste sein. Also, bitte herhören! Was ich jetzt sage, gilt für alle … Wer von euch keinen Wert darauf legt, zur Begrüßung von Tante Bettina zu Hause zu bleiben, der kann es lassen. Gezwungen wird niemand.“
Einen Augenblick schwiegen alle verblüfft.
„Soll das heißen“, fragte Thomas dann ein wenig unsicher, „soll das heißen, Vater, daß ich trotzdem zum Fußballspielen gehen kann?“
„Sicher!“
„Und ich zum Himbeerpflücken?“ fragte Stefanie.
„Wohin du willst.“
Stefanie und Thomas sahen sich an.
„Das ist aber wirklich sehr großzügig von dir, Vater“, sagte der Junge dann, „vielen Dank.“
„Nichts zu danken, mein Sohn. Das ist doch wirklich ganz selbstverständlich. Ich setze natürlich voraus, daß ihr auch bereit seid, auf Tante Bettinas Mitbringsel zu verzichten.“
Susebill lachte schallend, und Thomas und Stefanie zogen lange Gesichter.
„Wer bekommt denn dann die Geschenke?“ fragte Stefanie.
„Wer zu Hause bleibt natürlich!“ rief Susebill.
„Irrtum“, sagte der Vater, „Mitbringsel, für die sich kein Empfänger einstellt, werden dem Waisenhaus gestiftet. Bitte, versucht mir jetzt nicht einzureden, daß ihr erst die Geschenke entgegennehmen und dann noch fortgehen könnt oder umgekehrt … Es ist unanständig, nur deshalb nett zu einem Menschen zu sein, weil man etwas von ihm haben will. Ansonsten scheint euch beiden, Stefanie und Thomas, jedenfalls nichts an Tante Bettina zu liegen … Ich bin wirklich sehr gespannt, ob ihr soviel Charakter habt, zu eurer Überzeugung zu stehen.“
Nachher, als die drei Mädchen auf ihr Zimmer gegangen waren, um Schularbeiten zu machen, sagte Susebill: „Ich weiß gar nicht, was du hast, Stefanie! Ich finde Tante Bettina fabelhaft … sie selber, nicht nur ihre Geschenke.“
„Sie ist so fein, daß man gar nicht wagt, sie anzurühren.“
„Wozu auch? Bloß die kleinen Kinder müssen alles anfassen …“
„Sie lebt in einer ganz anderen Welt als wir. Wenn man ihr etwas erzählt, dann tut sie wohl so, als ob sie zuhört, sie lächelt auch dabei, aber in Wirklichkeit begreift sie gar nichts.“
„Das kommt daher, weil sie so reich und so verwöhnt ist.“
„Nein“, sagte Andrea überraschend, „das kommt, weil sie sehr unglücklich ist.“
„Unglücklich?“ Susebill riß Mund und Ohren auf. „Tante Bettina? Andrea, du spinnst wohl! So verwöhnt, wie Tante Bettina ist, und dann unglücklich? Nein, das ist ganz ausgeschlossen.“





























