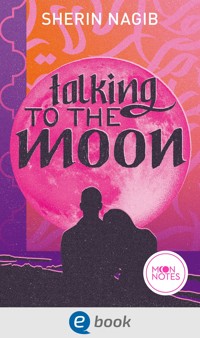
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Moon Notes
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Meine Stimme: Female Empowerment voller Musik. »Mit jeder Zeile meines Songs verliere ich mein Herz mehr an dich ...« Judy ist Feuer und Flamme, als an ihrer Uni ein Wettbewerb um einen Vertrag bei einer Plattenfirma ausgeschrieben wird. Eine Karriere als Songwriterin ist schon lange ihr Traum. Noch bevor sie überhaupt zum Wettbewerb zugelassen werden kann, schafft ein rassistischer Dozent es, in ihr Zweifel an ihrem Talent zu wecken. Doch dann trifft sie auf Jaad, der selbst Musiker ist und dem sie sich anvertraut. Auch er steht aufgrund seiner Herkunft vor großen Herausforderungen. Bei Kaffee-Dates unter der kalifornischen Sonne und bei abendlichen Musikproben entsteht zwischen Jaad & Judy mehr als nur berührende Liebeslieder. Doch ist Jaad wirklich da, wenn Judy ihn am meisten braucht? Talking to the Moon: Own-Voice Lovestory zwischen College, Songwriting und Coffee. - Die zugleich empowernde wie romantische Own-Voice-Story einer Hidschabi. - Freu dich auf den modernen Contemporary College-Roman unter der Sonne Kaliforniens. - Autorin und Sensitivity Readerin Sherin Nagib, geboren 1991 als Tochter einer Deutschen und eines Ägypters, bloggt auf Instagram für und über rassismuskritisches Lesen. - Behandelt wichtige Themen wie Antirassismus und Identität. - Eine cozy New Adult Lovestory voller Bauchkribbeln und Musik.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Über dieses Buch
MUSIC IS LIFE.
THAT’S WHY OUR
HEARTS HAVE BEATS.
Judy ist Feuer und Flamme, als an ihrer Uni ein Wettbewerb um einen Vertrag bei einer Plattenfirma ausgeschrieben wird. Eine Karriere als Songwriterin ist schon lange ihr Traum, und sie würde so ziemlich alles dafür geben. Noch bevor sie überhaupt zum Wettbewerb zugelassen werden kann, schafft ein rassistischer Dozent es, in ihr Zweifel an ihrem Talent zu wecken.
Doch dann trifft sie auf Jaad, der selbst Musiker ist und dem sie sich anvertraut. Auch er steht aufgrund seiner Herkunft vor großen Herausforderungen. Bei Kaffee-Dates unter der kalifornischen Sonne und bei abendlichen Musikproben entsteht zwischen Jaad & Judy mehr als nur berührende Liebeslieder. Doch ist Jaad wirklich da, wenn Judy ihn am meisten braucht?
Für alle, die in der Liebe ein Zuhause suchen.
Aussprache
Jaad: ʒad
جاد
Judy: ’ʒuːdɪ
جودي
1thanks for the french kiss
- JUDY –
Wie Zuckerwatte sahen die Wolken aus, die an mir vorbeizogen, während ich die hölzerne Treppe hinunterstieg, die eine Steilklippe entlangführte. Weit unten lag der Strand. Die Luft schmeckte salzig. Wellen brachen sich an den Felsen, die aus dem Meer ragten. Es war Ende März, der Wind war noch frisch, doch wenn die Sonne im Zenit stand, konnte man sich einbilden, es sei schon Sommer.
Am Fuß der Treppe angekommen, schaute ich mich suchend um. Roxy hatte mich heute Nachmittag an dem neuen Coffee-Spot treffen wollen, von dem wir so viel gehört hatten. Doch jetzt war weit und breit keine Spur meiner Freundin und Mitbewohnerin zu sehen. Ich hielt nach dem Café Ausschau, um dort auf sie zu warten. Doch bis auf einen schwarzen Truck, der mitten auf dem Strand parkte und in der Sonne glänzte, war nichts zu sehen. Neben mir am Treppengeländer verkündete ein Schild den Namen des Strandes.
Ich war richtig. Cameo Shores Beach. Raue Klippen grenzten an den Strand und ragten schroff in die Höhe. Sie waren grün bewachsen und einige majestätisch hohe Bäume wachten auf ihren Plateaus.
Frustriert atmete ich aus und suchte erneut den Strand angestrengt nach meiner Freundin ab. Aus den Augenwinkeln sah ich gerade noch, wie etwas Schwarzes auf mich zuraste, da traf mich auch schon etwas Hartes. Dumpfer Schmerz fuhr in meinen Brustkorb, die Luft blieb mir weg, und ich wurde zu Boden gerissen. Verwirrt setzte ich mich wieder auf, füllte meine Lungen mit Sauerstoff und blinzelte heftig, um die aufgewirbelten Sandkörner aus meinen Augen zu vertreiben.
Ein dunkler Schemen hing über mir, den ich in meiner Panik nicht näher bestimmen konnte.
Erst nach wenigen Schrecksekunden erkannte ich, was mich umgerissen hatte: Aus braunen Kulleraugen blickte mich ein junger schwarzer Hund an. Es musste ein Labrador Retriever sein. Sein kurzes Fell glänzte in der Sonne, der Schwanz wedelte hin und her, während er den Kopf schief legte und mich neugierig musterte. Ganz so, als würde er überlegen, woher er mich noch mal kannte. Dabei sah er dermaßen süß aus, dass ich unfreiwillig loslachte. Als wäre das eine Aufforderung, kam der Hund ein Stück näher, und bevor ich es verhindern konnte, wanderte eine große, warme Zunge über mein amüsiertes Gesicht, die sich anfühlte wie Schleifpapier. Der Hund schleckte und schleckte, und ich schüttelte den Kopf.
Zungenkuss von einem Hund? Check. Das konnte ich definitiv von meiner Bucketlist streichen.
Von Weitem ertönte ein Pfiff. Der Labrador ließ von mir ab, machte einen Hüpfer und wandte den Blick in Richtung des Trucks. Ein Typ kam von dort aus auf uns zugerannt, groß und breitschultrig. Seine welligen, halblangen braunen Haare tanzten auf und ab und wurden vom Wind vor sein Gesicht geweht. Erst als er fast bei mir ankam, konnte ich hinter seiner Mähne mehr erkennen. Markante Züge, helle, leicht gebräunte Haut, graue Augen, glatt rasiert. Er trug eine schwarze Jeans im Used-Look mit zerrissenen Knien und dazu ein verwaschenes graues Shirt, auf dem Respect the Locals stand. Unter der Schrift war ein Hai aufgedruckt, der sein Maul aufgerissen hatte. Ihm fehlten nur noch Lederjacke und Motorrad, und der Look eines Möchtegern-Bad-Boys wäre komplett gewesen.
»Oh shit! Sorry, sorry, sorry. Alles okay?« Er fuhr sich durch die Haare, zog die Brauen zusammen. »Mist, das tut mir so leid. Lass mich dir helfen.«
Okay, doch kein Möchtegern-Bad-Boy?
Eine sonnengebräunte Hand erschien in meinem Blickfeld. Ich räusperte mich, griff nach ihr und ließ mich nach oben ziehen. Als ich vor dem Fremden zum Stehen kam, überragte er mich um zwei Köpfe, was aber bei meiner kleinen Statur kein Kunststück war. Er wirkte kaum älter als ich.
Für einige Sekunden bewegten wir uns nicht, starrten einander an und verharrten in peinlicher Stille, die durch das Tosen der Wellen und das Kreischen der Möwen irgendwie noch lauter wirkte. Ich für meinen Teil war vertieft in die Farbe seiner Augen. Sie erinnerten mich an den Mond, wenn ich ihn durch mein Teleskop betrachtete. Kleine Krater, umgeben von silbrigem Licht. Er hingegen blieb mit seinem Blick für meinen Geschmack einen Moment zu lang an meinem Hijab hängen.
Ich fasste mir in den Stoff, ging sicher, dass ich auch die richtige Farbe trug. Ja, ein kräftiges Fuchsia, das einen Kontrast zu meiner restlichen Kleidung bildete. Ein weißes Appa-Shirt und hellblaue Cargojeans. Trotzdem fing mein Herz an, zu pochen. Nicht auf die gute Art und Weise.
Der Hund erlöste mich, indem er bellte und sich zwischen uns drängte. Ich ließ die Hand des Typen fallen, nachdem ich bemerkte, dass ich sie immer noch festhielt.
»Bro, wieso?!«, fragte er seinen Hund und schüttelte dabei den Kopf. Seine Stimme war tief und warm. Schuldbewusst legte sich der Vierbeiner auf den Bauch und schaute sein Herrchen mit dem herzerwärmendsten Hundeblick an, den ich je gesehen hatte. Die Art, wie die beiden miteinander kommunizierten, ließ mich schmunzeln, und das ungute Gefühl von eben trat in den Hintergrund.
»Entschuldige dich, Kingston«, sagte er streng und verschränkte die Arme vor der Brust. Seine Bizepse spannten sich dabei an.
Kingston stupste mit seinem Kopf gegen mein Bein und schaute mich erwartungsvoll an.
»Entschuldigung angenommen«, erklärte ich feierlich, kniete mich nieder und kraulte ihn hinter den Ohren.
»Kaffee?«, fragte der Typ, zog die Brauen zusammen und die Nase kraus, so als würden ihm seine eigenen Worte peinlich sein. »Äh, darf ich dir als Entschädigung einen Kaffee anbieten?«, verbesserte er sich. Seine Gesichtszüge hatten sich entspannt, und erneut überraschte mich der klare Blick seiner grauen Augen.
Ein Lächeln stahl sich auf mein Gesicht, während ich entschuldigend die Hände hob und mich umschaute.
»Ich bin verabredet. Meine Freundin ist aber offensichtlich zu spät. Wir wollten uns am neuen Café hier am Strand treffen, doch …«
»Du meinst den Coffee-Truck hier?« Er grinste und zeigte mit dem Daumen hinter seine Schulter auf den Wagen, der drüben stand. Dabei grub sich ein tiefes Grübchen auf seine linke Wange.
»Das ist meiner«, erklärte er, und ich konnte nicht verhindern, dass mein Mund ein stummes Oh formte. Erneut streckte er mir seine Hand entgegen.
»Ich bin Jaad.«
»Judy«, gab ich zurück und legte meine noch sandigen Finger in seine.
»Schön, dich kennenzulernen, Judy. Kingston, das DROPOUT und ich laden dich ein, mit uns den besten Kaffee der gesamten Westküste zu trinken.« Bei den Worten strahlte er übers ganze Gesicht.
»Wow, du stapelst wirklich nicht tief.«
»Warum sollte ich?«, fragte er.
»Ich weiß nicht. Es könnte sonst so wirken, als wärst du selbst dein größter Fan.«
»Und wäre das schlecht? Wenn ich mich selbst nicht anfeuere, wer dann?« Er verschränkte erneut die Arme vor der Brust und trat einen Schritt zurück, um mich zu mustern. Dabei bedeckten seine Arme den Aufdruck seines Shirts so, dass nur noch das Wort Respect zu lesen war.
Nein, definitiv kein Bad Boy. Etwas an dieser Feststellung erleichterte mich. War ich doch in der Vergangenheit einmal zu viel auf Typen von diesem Schlag hereingefallen.
Ich imitierte seine Armhaltung, während ich überlegte. Roxy war immer noch nicht da. Jaads lockere, bodenständige Art und seine niedliche Begleitung hatten mein anfänglich ungutes Gefühl längst verpuffen lassen. Es machte nicht den Anschein, als müsste ich mich vor ihm in Acht nehmen. Außerdem war ich nun schon mal hier und hatte für den Tag nichts Besseres zu tun. Das neue Semester startete erst morgen, und vielleicht würde Roxy ja noch auftauchen. Es sah ihr nicht ähnlich, mich einfach zu versetzen. Kurz checkte ich mein Smartphone, um zu sehen, ob sie mir eine Nachricht geschrieben hatte, fand jedoch keine vor.
»Der beste Kaffee der gesamten Westküste also?«, wiederholte ich seine Worte langsam.
Er nickte selbstbewusst.
»Davon würde ich mich tatsächlich gern selbst überzeugen.«
Ein schiefes Lächeln erschien auf seinem Gesicht. Jaad machte eine schwungvolle Bewegung mit dem rechten Arm und deutete Richtung Truck.
»Dann bitte hier entlang.« Er wartete, bis ich mich in Bewegung setzte. Dann gingen wir die paar restlichen Schritte bis zum DROPOUT gemeinsam.
Das DROPOUT war ein Coffee-Truck, der zu einer Seite hin eine Ausgabe hatte, die von einer Markise geschützt war, und der mit bunten Lichterketten geschmückt war. Er stand mittig zwischen Felswand und nicht weit entfernt vom aufgewühlten Meer, nur ein paar Hundert Meter vom Fuß der Treppe entfernt. In der Brandung ragten drei kleine Felsen heraus. Die Sitzgelegenheiten, die zum Café zu gehören schienen, verteilten sich vom Truck bis hin zum Wasser. Flache, schwer aussehende Sitzkissen sowie Liegestühle und sogar ein paar Hängematten verteilten sich über die gesamte Fläche, die ungefähr einen Radius von einhundert Metern einnahm. Inmitten jeder Gruppierung von Sitzmöglichkeiten befanden sich kleine Kaffeetische, manche davon alte Holzkisten, die einen edgy Look hergaben, andere filigran gearbeitete kleine Holzbänke. Strandfackeln, die jetzt nicht entzündet waren, steckten das Gebiet des Cafés ab und bildeten einen Kreis.
Ich konnte mir gut vorstellen, wie atmosphärisch es hier aussehen musste, wenn die Feuer am Abend erleuchtet waren. Hinter dem Truck befanden sich vier große schwarze Kisten, die aussahen, als würden darin Dinge gelagert werden. Direkt vor dem Coffee-Truck steckte ein altes, schwarz lackiertes Surfbrett im Sand. Darauf stand in großen, fetten Lettern DROPOUT. Der Schriftzug glänzte golden. Es war so bearbeitet, dass es aussah, als wäre die Spitze von einem Hai abgebissen worden. Darauf war das Kaffee-Menü zu lesen.
Ich las die Getränkenamen leise vor mich hin und erkannte, dass es sich dabei um Namen verschiedener Musikgenres handelte: Reggaeton, Disco Pop, Hunnu Rock, Rainbow Rock, Death Rock, K-Pop, Classic …
»Hmm«, machte ich. »Ich probiere den Classic? Mit Milch und Zucker?«
»Ist das eine Frage oder deine Bestellung?« Er zwinkerte.
»Ein Classic mit Milch und Zucker«, wiederholte ich mit fester Stimme und zwinkerte zurück. Kingston bestätigte meine Worte mit einem Bellen.
Jaad verschwand im Truck und machte sich an die Arbeit, während ich auf einem der Hocker Platz nahm, die vor der Ausgabe standen. Es war erst elf Uhr vormittags, und außer mir hatte sich noch kaum jemand an den Strand verirrt. Ich fragte mich, ob Roxy sich vielleicht vertan hatte, denn ich konnte mir kaum vorstellen, dass das der heißeste neue Treffpunkt für Studierende und Surfende war, so leer, wie es hier gerade aussah.
Von meinem Sitzplatz aus konnte ich Jaad im Inneren des Wagens beobachten. In völliger Ruhe befüllte er einen bronzefarbenen Wasserkessel und stellte ihn auf das Kochfeld. Aus einem Oberschrank holte er eine Kaffeekaraffe und legte ein Filterpapier hinein. Schon bald ertönte lautes Blubbern aus dem Kessel. Mit dem eben erhitzten Wasser spülte er das Filterpapier aus, leerte den Behälter wieder und fügte den frisch gemahlenen Kaffee hinzu. Kreisförmig goss er etwas Wasser hinein. Ich stellte mir vor, wie sich schaumige Bläschen bildeten. Ein nussig-kräftiger Duft strömte zu mir herüber, und das Wasser lief mir im Mund zusammen.
»Bitte schön!« Er stellte das Getränk, das er in ein hohes Glas gefüllt hatte, vor mir auf den Tresen.
»Kaffee im Glas?« Ich hob eine Braue und ließ zwei Zuckerstücke in die schwarze Flüssigkeit plumpsen. Das kannte ich nur von meinem Vater, der seinen Mokka gerne in einem kurzen Glas trank. Ich goss die Milch nach, woraufhin sich weiße Wolken bildeten, die immer weiter wuchsen, bis sie sich gänzlich mit dem Kaffee homogenisierten.
»Aus Prinzip«, antwortete er und drehte mir wieder den Rücken zu. Ich hörte, wie Eiswürfel gegen Glas klirrten. Etwas plätscherte. Dann schraubte er einen Siebträger an eine Maschine. Von meiner Position aus konnte ich sehen, wie daraus schwarz-braune Flüssigkeit in ein Glas tropfte, immer dicker und heller wurde, bis sie aussah wie flüssiges Gold.
Jaad drehte sich so abrupt zu mir um, dass ich erschrak und Kaffee aus meinem Glas schwappte. Ich hielt es noch immer in der Hand, hatte es bisher aber nicht an den Mund geführt. Er tat so, als hätte er nichts bemerkt, und stellte das Glas mit den Eiswürfeln auf den Tresen. Darin befand sich etwas, das ich nicht identifizieren konnte.
»Orangensaft«, erklärte er, ohne aufzublicken. »Und jetzt …« Dabei schaute er mich an, und das Flackern in seinen Augen entfachte meine Neugierde auf das, was als Nächstes passieren würde. »… Espresso!«, rief Jaad absolut theatralisch und enthüllte ein kleines Tässchen in seiner anderen Hand.
Mir entfuhr ein lautes Lachen, das er mit einem breiten Grinsen quittierte. Ehe ich michs versah, kippte er die dampfende dunkle Flüssigkeit über den eiskalten Saft. Gelb und Braun vermischten sich, bis das Getränk beige war wie mein Classic.
»Was?« Ich schlug mir ebenso theatralisch die Hand auf die Brust. »Müsste der Kaffee-Papst dich dafür nicht steinigen?« Jaad lachte auf und fuhr sich mit beiden Händen durch die Haare.
»Dann würde er sich im Nachhinein sicher in den Arsch beißen. Einen Moment.« Er hob beide Hände, dann bückte er sich, kramte nach etwas und tauchte wieder auf. In seiner Hand hielt er einen knallig orangefarbenen kringeligen Strohhalm aus Metall. Er steckte den Strohhalm in das Glas und schob es mir herüber.
Langsam teilte sich der Espresso wieder von dem Orangensaft und trieb nach oben. Dazwischen schimmerten die großen Eiswürfel. Der Kontrast und der Verlauf zwischen den beiden Farben erinnerten mich an einen umgedrehten Sonnenuntergang.
»Das geht natürlich aufs Haus. Ich würde mich freuen, einen neuen Fan zu gewinnen, der ein gutes Wort für mich beim Papst einlegen kann.«
»Aber …«
»Glaub mir, das willst du nicht verpassen«, sagte er mit Nachdruck.
Ich nahm das Getränk entgegen und bemerkte, dass es in meinem Bauch leicht flatterte, als ich Jaad über den Rand hinweg anschaute. Warum schenkte er mir so viel Aufmerksamkeit?
Vielleicht war es einfach seine Art und Weise, neue Kundinnen anzulocken. Wahrscheinlich lief der Coffee-Spot doch nicht so gut, wie Roxy glaubte, sodass er alles für jeden einzelnen Gast gab.
Ich nippte. Und trank. Und trank. Und nippte.
»Oh. Mein. Gott.«
Jaad schlug mit der Faust triumphierend in die Luft. Ich versuchte, die Geschmacksexplosion, die ich gerade erlebt hatte, irgendwie in Worte zu fassen, konnte aber selbst kaum begreifen, was da gerade in meinem Mund passierte. Es war wie eine Party auf meiner Zunge.
»Es schmeckt himmlisch! Zuerst ist es schaumig, süß und fruchtig, und dann ist da diese nussige, würzige Note, die einfach überhaupt gar nicht dazu passt. Es schmeckt irgendwie verboten, aber – irgendwie auch richtig gut!« Fasziniert starrte ich auf die orange-braune Flüssigkeit. »Vergiss alles, was ich über den Kaffee-Papst gesagt habe. Er würde sich wirklich in den Arsch beißen.«
Als ich wieder aufblickte, merkte ich, dass ich wild mit den Händen rumgefuchtelt hatte und meine Stimme viel zu aufgeregt klang. Schnell nahm ich die Hände wieder runter und räusperte mich.
»Es ist wirklich lecker«, sagte ich ruhiger. »Und wie heißt diese Kreation?«
Jaad nickte zufrieden und griff nach einem herumliegenden Geschirrtuch. »Beatles«, erklärte er, während er die Enden des Tuches fein säuberlich aufeinanderlegte.
Ich presste eine Serviette auf meinen Mund, um nicht loszuprusten. »Das ist aber keine Musikrichtung wie die anderen!«
»Sagt wer?« Er verschränkte die Arme vor der Brust und verzog den Mund zu einer gespielt-beleidigten Schnute. Dabei fiel mir auf, wie voll seine Lippen waren. Er konnte einen richtigen Schmollmund machen. Im Gegensatz zu mir.
»Die Beatles sind eine Band! Sie haben die Musikrichtungen vollkommen durchgemixt – zugegeben teilweise ziemlich cool. Aber sie bleiben eine Band und sind kein Genre!«
Er bedachte mich für einen Moment mit einem nachdenklichen Blick, zückte dann einen Block und einen Stift aus seiner hinteren Hosentasche und notierte sich etwas darauf. »Beatles ziemlich cool, aber kein Genre«, murmelte er, während sein Mund ein schelmisches Lächeln formte.
Ich schüttelte den Kopf über sein Gehabe.
»Und was befugt dich, die Namenswahl meiner Getränke so hart zu kritisieren?« Er fasste sich ans Herz, als hätten meine Worte ihn getroffen. Auch wenn er sich so albern verhielt, kam es mir vor, als schien er seinen Spaß an dieser Diskussion zu haben. Genauso wie ich. Genüsslich trank ich einen weiteren Schluck.
Ich fuhr mir mit der Zunge über die Zähne und lehnte mich vor, beobachtete ihn durch verengte Augen. Ich hätte ihm erklären können, dass ich gerade meinen Master in Musikwissenschaften und seit Jahren selbst Musik machte, mehrere Instrumente spielte, darunter Piano, Violine und Schlagzeug, und schon in der Highschool Grundschülern Musik beigebracht hatte. Doch noch bevor ich das Feuer eröffnen konnte, ertönte eine vertraute Stimme, die sich mir von der Seite aus näherte.
»Wenn du so guckst, siehst du aus wie ein Wiesel.« Ein schallendes Lachen folgte, das ich inmitten von Tausenden Menschen immer wiedererkennen würde. Roxy! Ich drehte mich zu ihr.
»Pass bloß auf, sonst kriegst du gleich ein Getränk namens Weasel vor die Nase gesetzt«, antwortete ich mit einem Seitenblick auf Jaad, der sich jetzt ein Glas Wasser an den Mund führte und dahinter grinste. Ich knuffte meine Freundin in die Seite. Diese schüttelte ihren Kopf mit den kurzen schwarzen Haaren, die von zwei dicken und weißen Strähnen durchzogen waren, und verdrehte die blauen Augen.
»Okay … Was habe ich verpasst?« Roxy schaute zwischen mir und Jaad hin und her.
»Jaad, das ist Roxy – meine Freundin, die seit einer halben Stunde hier sein sollte. Roxy, das ist Jaad, ihm gehört das DROPOUT.«
Roxy quittierte diese Vorstellungsrunde mit einem anerkennenden Nicken.
»Was darf’s sein, Roxy?«, fragte Jaad höflich und stellte sein noch halb volles Wasserglas zurück ins Innere des Trucks.
Roxy scannte das Menü.
»Death Rock on Ice«, antwortete sie und zog mich dann vom Barhocker Richtung Meer. »Wir warten dort drüben«, rief sie ihm beim Gehen zu.
Entschuldigend hob ich die Schultern und lächelte in Jaads Richtung. Dann steuerten wir gemeinsam auf die Sitzgelegenheiten im Sand zu.
»Wow!«, stieß Roxy aus und ließ sich in eine Hängematte fallen.
»Wo warst du? Ich hab ewig auf dich gewartet.«
»Nicht ewig, nur eine halbe Stunde. Außerdem hast du nicht gewartet, sondern geflirtet.« Ihre Stimme war rau und gleichzeitig hoch und passte perfekt zu dem Rest ihres Äußeren. Sie war klein und zierlich und ihr Gesicht markant und kantig. Sie trug eine smaragdgrüne Leggings mit Metallic-Effekt, darüber einen türkisen Body, der glitzerte. Über ihre Schultern hatte sie eine Vintage-Trainingsjacke mit pastelligen Farbblöcken geworfen. Roxy sah aus, als wäre sie einem Eighties-Aerobic-Video entsprungen. Es fehlte nur noch ein weißes Stirnband.
»W-was?«
»Ich hab dich gesehen. War schon ein bisschen länger da. Aber als ich diesen Hottie bei dir entdeckt hab, dachte ich mir, ich gönne dir etwas Spaß. Immerhin war das Ziel des Tages, dich heute auf andere Gedanken zu bringen.«
»Hmm, das hat geklappt.« Ich warf einen Blick zurück zu Jaad. Ein paar Kunden hatten sich vor dem Truck eingefunden, und er war zu ihnen hinausgetreten, um ihnen das musikalische Kaffeeboard zu erklären. Langsam schien sich der Spot doch zu füllen.
»Stellst du ihn dir gerade nackt vor?«
Ertappt sah ich auf. »Natürlich nicht, Roxy.« Eine leichte Brise kam auf und wehte ein Stück meines Hijabs in mein Gesicht. Ich genoss das Gefühl des durchsichtigen fuchsiafarbenen Chiffons auf meiner Haut und schloss kurz die Augen.
Ich hatte ihn mir nicht nackt vorgestellt! Definitiv nicht. Aber vielleicht, ganz vielleicht, oben ohne. Mit Hose und Barista-Schürze.
»Wirklich nicht, Judy?«, äffte meine Freundin mich nach. Der Wind ließ nach, und ich strich mir den Stoff wieder aus dem Gesicht. Roxy wackelte mit den Brauen. »Ich nämlich schon«, sagte sie und lehnte den Kopf zurück in die Hängematte.
»Ms Kaepernick!« Gespielt entsetzt schlug ich mir die Hand vor den Mund. »Psst. Pass jetzt auf. Er kommt rüber«, raunte ich ihr anschließend zu, woraufhin Roxy nur mit den Schultern zuckte.
Jaad war fast bei uns und trug den kräftigen Duft von frisch gemahlenem Espresso mit sich. Ich sog ihn ein, und ein wohliges Gefühl machte sich in meinem Magen breit, als er sich hinunterbeugte, um das Getränk auf dem kleinen Kaffeetisch abzustellen.
»Einmal Death Rock on Ice für dich.«
Roxy blies sich eine weiße Strähne aus der Stirn. Bei Gelegenheit sollte ich ihr eins dieser Eighties-Stirnbänder kaufen, dachte ich mir. Jaad wandte sich mir zu, wobei er gegen das Sonnenlicht anblinzeln musste.
»Möchtest du noch etwas haben, Judy?«
Der Klang meines Namens aus seinem vollen Mund ließ mich erschaudern. Seine Stimme war so tief, vibrierte und verursachte ein Prickeln auf meiner Haut.
Jaad wartete auf meine Antwort, sein Blick ruhig auf mir. Er hatte keine Ahnung, welches Konzert sich gerade in meinem Kopf abspielte. Ich räusperte mich, schüttelte den Kopf und wandte mich schnell wieder an Roxy. Er wartete ein paar Sekunden, bis er sich höflich verabschiedete und wieder zum Truck ging.
»Sag mal, stehst du unter Strom?«, platzte Roxy heraus, sobald er außer Hörweite war. Schon wieder konnte sie sich ihr Lachen kaum verkneifen.
Fragend sah ich sie an.
»Du stehst vielleicht auf der Leitung. Ich bin nicht an ihm interessiert, okay?« Die Worte kamen impulsiver aus mir heraus als beabsichtigt. Und woher kam eigentlich dieses Kribbeln in meiner Bauchgegend?
Roxy biss sich auf die Lippe, dann schwang sie sich aus der Hängematte, plumpste ungeschickt in den Sand und zog an meinen Füßen, die aus meiner Matte herausragten.
»Komm, wir holen uns ’ne Abkühlung!«
Ich gehorchte, stieg aus und krempelte meine Hosenbeine hoch. Die Sandalen zog ich von meinen Füßen und warf sie achtlos in den Sand.
Kurz darauf umspülten schaumige Wellen meine Knöchel, matschiger Sand grub sich zwischen meine Zehen und quoll dazwischen hervor. Trotz der tosenden Brandung konnte ich Jaad hören, wie er gerade zwei fertige Getränke ausrief. Diese Stimme. Aus diesem Mund. Weich und tief und warm. Und so sexy.
Ich schloss die Lider, um den Klang zu genießen, und stellte mir vor, wie Jaad inmitten eines tausendfachen Publikums auf der Bühne stand. In meinem Kopf gesellten sich dröhnende Bassklänge, kreischende elektrische Gitarren und ein wummerndes Schlagzeug dazu. Der Sound in meinem Kopf wurde von der Musik überlagert, die nun aus den Lautsprechern auf dem Dach des Trucks schallte. Lässige Lounge-Klänge, typisch kalifornisch.
Plötzlich spritzte mir Salzwasser ins Gesicht.
»Nicht einschlafen!«, rief Roxy, und ich riss die Augen auf. Sie strahlte wie ein Honigkuchenpferd, und ich war dankbar, dass es sie gab.
Es fühlte sich gut an. Diese Freundschaft. Dieser Ort. Der Kaffeeduft von Jaads Truck und die Art, wie er meinen Namen aussprach. Die Art, wie er Musik in meinem Kopf spielen ließ. Es war gut, für kurze Zeit den Ernst des Lebens zu vergessen. Nicht über das Ende meines Studiums und danach hoffentlich den Start meiner Karriere als Songwriterin nachdenken zu müssen.
Fraglich, wie weit jemand wie ich es in Kalifornien bringen würde: weiblich, muslimisch, mit Hijab auf dem Kopf und einer Menge Lyrics darin. Es klang selbst für mich fast unerreichbar. Doch das war es, was ich in meinem Leben haben wollte. Musik, Musik und noch mehr Musik.
2sharks in the dark
- JAAD –
Inzwischen lagen mehrere Kundinnen und Kunden in den Liegestühlen am Strand, studierten das Menü oder standen in kleinen Gruppen herum. Bald würde die Sonne im Ozean versinken. Judy und ihre Freundin waren schon seit Stunden hier. Immer wieder wanderten sie den Strandabschnitt entlang, rannten durchs Wasser, spielten mit Kingston und holten sich neue Getränke. Gerade inspizierte ich die Lichterketten, die den Truck schmückten, und bereitete die Strandfackeln vor, die zwischen den Liegestühlen im Sand steckten.
Kingston tollte neben mir her. Er entdeckte eine Möwe, der er hinterherjagte, schlug aber sofort einen Haken, als sie nach ihm schnappte, und rannte weg, quer über den Strand.
Judys Lachen drang zu mir herüber. Sie stand neben Roxy im Wasser, die Hosenbeine leicht hochgekrempelt. Ihr Blick war weich, ihre dunklen Augen leuchteten. Sie grinste mich an. Offenbar hatte sie Kingston bei seinem Feldzug gegen die Möwe und seiner sofortigen Flucht beobachtet. Ich grinste zurück.
Wie gern hätte ich unser Gespräch einfach weitergeführt. Als ihre Freundin aufgetaucht war, hatte ich mich zwar gefreut, dass sie nicht von ihr sitzen gelassen wurde. Insgeheim fuhr mir aber zugleich ein kleiner Stich des Neids in meine Brust, weil sie jetzt Judys Aufmerksamkeit für sich beanspruchte.
Klar, ich hatte Judy erst fünf Minuten zuvor kennengelernt, doch das Gespräch mit ihr und die kleinen Neckereien zwischen uns hatten mir gefallen. Überhaupt gefiel mir vieles an ihr. Sie trug locker sitzende hellblaue Cargojeans, die die geschwungenen Linien ihrer muskulösen Oberschenkel betonten. Im Kontrast dazu stand obenrum ein oversized T-Shirt, auf dem ein weißer fliegender Bison mit einem Pfeil auf dem Kopf zu sehen war. Unter ihrem Shirt trug sie noch ein weißes Longsleeve, das ihre Arme vollständig bedeckte. Wirkte ihr Outfit durch die Kleidung relaxt, gab die knallige Farbe ihres Hijabs dem Ganzen einen wilden Touch, und sie betonte ihr Gesicht. Ihr Gesicht, mit dem sie sich immer wieder zu mir wandte. Es hatte eine rundliche Form, und ihre Lippen waren eher schmal. Dafür hatte sie umso größere tiefbraune Augen, die fett mit schwarzem Kajal umrandet waren, der ein wenig im Inneren ihres Augenlids verlaufen war. Sie sah edgy aus.
Zudem zierten ihre linke Schläfe eine Reihe an Muttermalen, die so nah beieinanderstanden, dass sie ein bisschen aussahen wie eine kleine Galaxie aus Sternen. Ein weiteres entdeckte ich auf ihrem Nasenflügel, an der Stelle, wo andere sich ein Piercing stachen. In einer Form, die ich auf die Schnelle nicht identifizieren konnte.
Kingston war inzwischen wieder bei mir angekommen und bremste abrupt ab, im Maul ein Stück Treibgut. Er legte es vor meinen Füßen ab und hechelte laut mit herausbaumelnder Zunge. Ich hob das Stück Holz auf und spürte sofort Kingstons vorfreudige Ungeduld, warf es jedoch noch nicht den Strand entlang.
»Erst wenn du mir sagst, was du von ihr hältst.« Kingston hechelte weiter. »Komm schon!«
»Führst du wieder Selbstgespräche?« Flurry erschien in meinem Sichtfeld. Er trug ein abgewetztes T-Shirt mit dem Namen unserer Band darauf: Sharks in the Dark. Er reichte mir seine Hand und zog mich in eine Umarmung.
»Was hast du denn hier verloren?«, fragte ich scherzhaft, während wir uns voneinander lösten.
»Glaubst du mir, wenn ich dir sage, dass ich dich vermisst habe?«, antwortete er. Das war Flurry, wie er leibte und lebte. Mit seinem weichen Gesicht und der langen schmalen Nase, auf der seine eckige randlose Brille fast unsichtbar thronte. Dahinter blinzelten mir seine Augen klein und liebevoll entgegen. Seine Haare waren straßenköterblond und standen in alle Richtungen, so als hätte er sie heute Früh nicht gekämmt. Nur, dass sie immer so aussahen.
Er war mein Bandmitglied und neben Kingston mein bester Freund. Loyal, nah am Wasser gebaut und immer bereit, Neues auszuprobieren. Egal, ob es eine außergewöhnliche Kaffeekreation von mir oder ein neues Instrument für unsere Gigs war.
Wir bewegten uns zurück zum Truck, wo sich in meiner Abwesenheit bereits eine kleine Traube von Personen gebildet hatte, die bestellen wollten.
»Nein, ich glaube dir nicht«, entgegnete ich und stieß ihn mit dem Ellenbogen an. Dann trat ich in den Truck ein und wandte mich an meine Kundschaft. Flurry blieb am Seiteneingang stehen, bis ich ihm bedeutete, hereinzukommen. Doch jetzt trat er neben mir von einem Bein auf das andere. Offensichtlich hatte er Gesprächsbedarf, doch das würde noch kurz warten müssen.
»Gib mir mal eine neue Packung Milch«, wandte ich mich an meinen Freund. »Im Kühlschrank, direkt hinter der Schokosoße.«
Flurry wiederholte meine Anweisungen, während ich die letzte Milch bereits aufschäumte.
»Flurry, die Milch bitte.« Mein Ton war schärfer als beabsichtigt.
»Im Kühlschrank, direkt hinter der Schokosoße. Hier ist sie nicht!«
»Flurry, das ist nicht die Schokosoße, das ist der Kakao«, raunte ich ihm über die Schulter zu. Mit einem schnellen Griff schob ich seine Hand in die richtige Richtung.
»Oh. Hier.« Mit geröteten Wangen überreichte er mir die Milch und stellte sich neben mich an den Tresen.
»Heeeey, Sharks in the Dark! Ist das nicht die Band, die diesen coolen Song vor ein paar Jahren hatte?« Der Kunde fing an, energisch Luft-Schlagzeug zu spielen, während er scheinbar versuchte, sich an die Melodie zu erinnern. Ich half ihm auf die Sprünge, indem ich die Anfangszeile unseres allerersten Songs und seitdem einzigen Hits Undress Me anstimmte. Eine Indie-Version von Barbie Girl. Sein Gesicht leuchtete auf.
»Jaaa! Ja, Mann. Das ist es! Alter, das war mein absolutes Lieblingslied! Schade, dass es die Band nicht mehr gibt. Die hätten es noch echt weit gebracht!«
Ich verschluckte mich fast an meiner Spucke.
»Und ob es die Band noch gibt!«, konterte Flurry.
»Wirklich? Nie wieder was von denen gehört.« Der Kunde zuckte mit den Schultern, und ich schob ihm schnell sein Getränk über den Tresen, bevor er Flurrys Gefühle noch mehr verletzen konnte.
Sobald er außer Sichtweite war, explodierte mein Freund: »WIESOHASTDUNICHTSGESAGT?«
»Was hätte ich denn sagen sollen? Er kennt und liebt unseren Hit. Das ist doch super.«
»Super? Er denkt, unsere Band ist tot!« Flurry raufte sich die Haare.
»Wir wissen aber beide, dass sie das nicht ist«, beschwichtigte ich ihn, doch er sah nicht überzeugt aus, also legte ich nach: »Flurry, ich liebe unsere Band über alles – genauso wie du. Außerdem bin ich mir sicher, dass wir den nächsten Hit raushauen werden. Bald. Ganz bestimmt. Hab Geduld.«
»Ich habe aber keine. Verdammt noch mal, wir sind eine Band. Wir sollten Stadien füllen und Gitarren zerschlagen. Stattdessen spielen wir in winzigen Clubs, und selbst das seit einiger Zeit nicht mehr. Niemand kennt uns noch.« Die letzten Worte presste Flurry hervor.
Eine Gruppe von Frauen war zwischenzeitlich an den Verkaufstresen herangetreten. Ich nahm ihre Bestellungen entgegen und versprach, die Getränke gleich zum Strand zu bringen.
»Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir lebendig sind. Willst du einen Beweis?«, wandte ich mich wieder an meinen Freund. Ich nahm mein Handy und suchte unseren Song raus. Den einen Hit, den wir in zehn Jahren Bandgeschichte hervorgebracht hatten. Dann verband ich mein Telefon mit den Lautsprechern, die am Dach des Trucks angebracht waren, und drückte auf Play.
Eine rockige Drumroll ertönte und fegte über den Strand. Ein paar Yeahs und Heys dauerte es, bis die Leute langsam die Melodie des einstigen Hits erkannten. Dann setzte die kratzige Stimme unseres ehemaligen Bandmitglieds Isao ein.
Ich arbeitete weiter, doch Flurry stürmte aus dem Truck und beobachtete, wie ein paar Menschen mitsangen und zu den bekannten Klängen tanzten.
»Na, wie gefällt dir unser Publikum?«, fragte ich ihn, als er wieder hereintrat. Mit einem Augenzwinkern drückte ich ihm einen noch orangefarbigen Beatle in die Hand.
Flurrys Unterlippe bebte leicht, bevor er sie an seinen Strohhalm setzte und nippte.
»Wir werden es wieder schaffen. Schau uns an. Wir sind lebendig. Und unsere Musik pulsiert noch immer durch die Adern der Menschen.« Ich klopfte ihm locker auf die Schulter, woraufhin Flurry tapfer nickte. Seit wir unsere Band in der Highschool gegründet hatten, hatten wir schon einige Höhen und Tiefen gemeinsam durchlebt.
»Komm nicht zu spät heute«, ermahnte er mich und saugte die Flüssigkeit geräuschvoll durch seinen Strohhalm.
»Klar«, versprach ich.
»Gut. Ich muss wieder, geh mich nur kurz von Kingston verabschieden«, sagte er, drückte mir das leere Glas entgegen und trat aus dem Truck. Draußen warf er Kingston ein paarmal Stöckchen. Noch immer sangen einige Kundinnen und Kunden unseren Song mit.
Ich fragte mich, ob Judy ihn auch kannte. Doch sie war verschwunden. An der Stelle, an der sie zuletzt gestanden hatte, brandete nur noch tosend das Meer an den Strand.
3pipe dreams
- JUDY –
Roxy hatte recht gehabt. Ein Tag am Strand war genau das Richtige gewesen, bevor mein letztes Semester starten würde.
Als ich heute Morgen aufwachte, fühlte ich mich erholt und ausgeglichen, auch wenn ich leichte Periodenschmerzen hatte.
Ich streckte mich zufrieden und war mir sicher, dass dieses letzte Semester an der University of California in Irvine eines der besten werden würde. Mein Notendurchschnitt stand bei A minus, was wirklich ordentlich war, und ich hatte nur noch zwei Kurse zu absolvieren. Einer wurde von einem Dozenten am musikwissenschaftlichen Seminar geleitet, den ich noch nicht kannte. Der andere war bei meiner absoluten Lieblingsdozentin Ms Vasquez, bei der ich auch meine Masterarbeit schreiben wollte.
Ich hatte mir ein Thema überlegt, Quellen rausgesucht, eine These formuliert und eine erste Gliederung erstellt. Heute wollte ich Ms Vasquez alles vorstellen und es von ihr absegnen lassen. Vielleicht war ich etwas übereifrig, vielleicht brannte ich aber auch einfach für mein Studium.
Ich verließ mein Wohnhaus namens Misty Mountains, das zu dem Middle-Earth-Komplex des Campus gehörte. Zwar erinnerte hier nichts an Orks, Hobbits oder Elfen. Trotzdem zog ich meinen imaginären Hut vor dem kreativen Kopf, der die Idee hatte, ein Unigebäude nach einer Welt aus einem Fantasy-Epos zu benennen und so ein wenig Fantasie in die Köpfe der Studierenden streute.
Hier gab es vor allem kleine zweigeschossige Häuschen, durch die sich breite Fußwege bahnten. Am Ende des Komplexes wachten die Middle-Earth-Towers über die Gebäude. Die Türme waren im Gegensatz zu meinem Wohnhaus verglaste Hochhäuser. Mein Weg führte mich am Phoenix-Food-Court vorbei und direkt durch den riesigen Aldrich Park, auf dessen anderer Seite sich das Media-and-Music-Building befand, in dem meine Veranstaltungen stattfanden.
Nachdem ich im richtigen Raum angekommen war und der Unterricht losging, wollte die Zeit einfach nicht vergehen. Seit über einer Stunde saß ich bereits im Seminar für Musikethnologie. Ich schielte immer wieder auf die Uhr, damit ich endlich zu Ms Vasquez nach vorne stürmen könnte, um mit ihr über meine Masterarbeit zu reden. Als die letzte Minute des Kurses anbrach, sammelten meine Kommilitoninnen und Kommilitonen bereits ihre Sachen zusammen.
Ms Vasquez’ Stimme übertönte die eintretende Unruhe. »Und denken Sie daran: Wenn der Song, den Sie hören, etwas mit Ihnen macht – Ihnen Gänsehaut bereitet, das Herz schwer werden lässt, Sie in den Kummer erster Liebe versetzt, auch wenn Sie vielleicht noch nie verliebt waren. Dann ist es ein guter Song, dann ist es gute Musik. Und dann ist es auch ganz egal, welcher Sprache, welcher Tonlage oder welchem Land diese Musik entstammt.«
Als würde noch die Schulklingel das Ende des Unterrichts ankündigen, sprangen alle zeitgleich auf und strömten auf den Ausgang zu. Nur ich blieb sitzen und beteiligte mich nicht am allgemeinen Gemurmel und Gelächter im Saal. Stattdessen schob ich mich in entgegengesetzter Richtung durch die Masse hindurch und kämpfte mich die Treppe, so schnell es eben ging, hinunter.
»Ms Vasquez!«, rief ich, während sie gerade ihr Federmäppchen zuzog.
Sie bewegte ihren Kopf ruckartig in meine Richtung, wobei ihre schulterlangen weißen Haare leicht nach vorn wippten. Sie erinnerten mich immer an Watte. Überhaupt erinnerte mich alles an ihr an Watte. Ihr Wesen war so angenehm, ihr Blick so weich, ihr Gesicht so freundlich. Wie unsere Nachbarin in Santa Monica, die wir in Ermangelung von nahen Verwandten »Granny« genannt hatten. Das war etwas, das meiner Zwillingsschwester und mir immer gefehlt hatte. Außer unseren Eltern und deren Bekannten- und Freundeskreis hatten wir nur uns beide. Keine Omas und Opas, die einen zu den ’Id-Festen mit Geld und Süßigkeiten versorgten. Aber an heißen Sommertagen hatte unsere Ersatz-Granny uns Kindern immer selbst gemachte Limonade auf der Veranda serviert.
»Ms Haleem!« Sie war eine der wenigen Lehrenden, die sich die Mühe machten, die Namen ihrer Studierenden zu kennen. Auf ihrer Ledermappe, die vermutlich ihre Unterrichtsmaterialien enthielt, stand in fetten Lettern ihr akademischer Titel sowie ihr Name: Prof. Dr. phil Consuelo Vasquez. Sie bestand jedoch darauf, dass wir sie nicht mit vollem Titel ansprachen.
»Ich habe mir ein Thema für meine Masterarbeit überlegt.«
»Da sind Sie ja wirklich früh dran.« Sie klatschte erfreut in die Hände.
»Danke«, antwortete ich, obwohl sie mir gar kein Kompliment gemacht hatte.
»Und worüber werden Sie schreiben?«
»Über populäre Musik außerhalb des globalen Westens mit Fokus auf das Phänomen K-Pop«, ratterte ich atemlos herunter.
»Das klingt tatsächlich sehr interessant und schon ziemlich spezifisch. Erstellen Sie doch eine Gliederung, und besuchen Sie die Tage meine Sprechstunde, dann können wir gerne alles Weitere besprechen«, bat sie mich.
»Ich habe schon eine!«, sagte ich aufgeregt.
»Judy!« Ms Vasquez’ Augen weiteten sich in Erstaunen.
Ein Grinsen breitete sich auf meinem Gesicht aus, denn mir entging nicht, dass sie mich bei meinem Vornamen genannt hatte. Sie tätschelte meine Schulter, lächelte mit ihren schmalen rosa Lippen und betrachtete mich für einen Moment.
»Ich nehme an, Sie planen immer noch, so schnell wie möglich nach den Klausuren mit der Uni fertig zu werden und zu arbeiten?«
Ich nickte.
»Gut. Auch wenn ich finde, dass eine Pause nach den ganzen Jahren des Lernens nicht schlecht wäre, aber das ist natürlich Ihre Entscheidung. Wie sieht es mit dem Agenten aus, mit dem Sie bereits Kontakt hatten?«
»Leider noch keine Antwort«, erklärte ich schulterzuckend. Ms Vasquez zog die Brauen zusammen.
Vor fast zwei Monaten hatte ich mich bei einer Musikagentur mit meinen Arbeitsproben beworben. Ich hatte erarbeitete Unistoffe wie Kompositionen und Analysen sowie eine ganze Menge Songtexte aus meinem Notizbuch eingereicht. Daraufhin wurde ich zu einem Video-Meeting eingeladen, das meiner Meinung nach ziemlich gut gelaufen war. Doch eine endgültige Zu- oder Absage ließ immer noch auf sich warten. Ich nahm mir für den Abend vor, nach mehr interessanten Stellen zu suchen.
Ein lautes Rrrring riss mich aus meinen Gedanken. Ms Vasquez’ Gesichtszüge entglitten für einen Moment, dann kramte sie hektisch in ihrer riesigen Kroko-Handtasche herum. Nach und nach landete der Inhalt auf ihrem Tisch: ihr Schlüssel, dunkelroter Lippenstift, altrosa Lippenstift und glitzernder Lipgloss.
Nicht umsonst war Ms Vasquez meine Lieblingsdozentin. Es gab keine Zweite wie sie: Sie liebte die Oper und Rapkonzerte gleichermaßen, trug Strickjacken und geblümte Blusen, peppte ihren Look dann aber mit großen Creolen und Glitzerlipgloss auf. Außerdem schaffte sie es immer wieder, uns Studierenden unsere Vorurteile innerhalb der Musik und darüber hinaus vor Augen zu führen. Ms Vasquez war eine unendliche Inspirationsquelle für mich.
»Huberto?! Ich habe gesagt, du sollst mich nicht anrufen, wenn ich unterrichte … Jaja, ich bringe Schlagsahne und drei Kilo Tomaten mit.« Sie hielt die Hand kurz auf den Spracheingang des Telefons und wandte sich zu mir: »Seien Sie so lieb und werfen Sie mir Ihre Gliederung in meinen Briefkasten am Büro.«
Sie hielt inne, hob einen Zeigefinger ans Kinn und wühlte noch mal in ihrer Tasche. Kurz darauf hielt sie mir einen Anhänger, an dem ein einzelner Schlüssel baumelte, entgegen.
»Oder gehen Sie doch gleich in mein Büro, wenn es Ihnen nichts ausmacht. Sie könnten mir einen Gefallen tun, meinen riesigen Ordner direkt mitnehmen und Ihre Unterlagen ganz oben auflegen. Ich sehe alles bei der nächsten Möglichkeit durch. Wir sprechen dann nächste Woche darüber. Den Schlüssel können Sie in den Briefkasten werfen, wenn Sie das Büro wieder abgeschlossen haben.« Ich nahm den Schlüssel entgegen und hob den wuchtigen Ordner auf.
»Danke, Sie sind ein Schatz.« Damit wandte sie sich wieder dem Telefongespräch zu. »Huberto, ja. Ich mach mich gleich auf den Weg.«
Ein Grinsen unterdrückend, winkte ich, verließ den Vorlesungssaal durch die Seitentür und machte mich auf den Weg zum Aufzug.
Das Seminar für Musikwissenschaft befand sich im fünften Stockwerk des Gebäudes, in dem ich auch gerade die Vorlesung gehabt hatte. In meinen ersten zwei Semestern hatte ich bereits als wissenschaftliche Hilfskraft für Ms Vasquez gearbeitet und kannte mich deswegen bestens in den verwinkelten Gängen und ihrem Büro aus.
Ich drückte auf den Knopf für den Fahrstuhl und war geschmeichelt davon, wie sehr meine Dozentin mir vertraute. Die Zahlen auf der Anzeige rasten nach unten, und ich tappte dazu ungeduldig mit dem Fuß auf den Linoleumboden.
Neben meinen Vans im Schachbrett-Look erschien ein Paar glänzender schwarzer Lackschuhe, die mit aufwendigen Mustern verziert waren. Mein Blick wanderte von der perfekt gebügelten grauen Bundfaltenhose nach oben zu einem passenden Jackett und schließlich zu dem Gesicht der dazugehörigen Person. Entgegen meiner Erwartung blickte mir jedoch niemand im gehobenen Alter entgegen, sondern ein Mann, der nicht älter als Mitte dreißig sein konnte. Unter seinem Arm klemmte eine große Ledermappe, wie sie einige Dozenten besaßen, weshalb ich annahm, dass er hier lehrte, und ihm höflich zunickte.
Ohne mein Nicken zu erwidern, wandte er den Blick ab. Sein rechter Nasenflügel zuckte, während er den Blick stur auf die Türen des Aufzuges heftete. Endlich ertönte ein Pling, und ich stieg ein. Doch anstatt sich zu mir zu gesellen, starrte er mich an, bis sich die Aufzugtüren schlossen und er vor meinen Augen verschwand.
Oben angekommen schüttelte ich unwillkürlich den Kopf über diese eigenartige Begegnung. Dann suchte ich Ms Vasquez’ Büro auf, lud ihren Ordner ab und legte meine Gliederung wie gewünscht obenauf.
Ich atmete zufrieden aus. Bald würde ich meinen Master bestehen, hoffentlich mit Bravour, und von einer Agentur unter Vertrag genommen werden. Endlich würde ich meine Songtexte im Radio hören, interpretiert von den größten Künstlern und Künstlerinnen unserer Zeit.
Endlich war ich wieder in meinem Wohnheimzimmer. Es war ein eher länglicher Raum, an dessen Ende ein großes Fenster für Licht sorgte. An der rechten und linken Wand standen sich die Betten von mir und Roxy gegenüber, daneben hatte jede von uns ihr kleines Nachtschränkchen. Während auf meinem Kopfhörer und mein mit Sternen verziertes Notizbuch lagen, waren auf ihrem ein paar dicke Jura-Wälzer und verschiedene Post-its verteilt. Unsere Schreibtische befanden sich in der Nähe der Tür, was das Lernen manchmal ungemütlich gestaltete. Daher bevorzugten wir meist den Besuch der Bibliothek. Direkt neben den Schreibtischen vor der Eingangstür grenzte ein kleines Bad an. Eine Küche gab es keine, dafür hatten wir ja die Mensa.
Ich pfefferte die Schuhe in eine Zimmerecke und streifte meinen Hijab ab. Danach entledigte ich mich meines BHs und schlüpfte in meine Wassermelonen-Pyjamahose und ein gelbes Tanktop. Ich ließ mich vornüber aufs Bett fallen, vergrub das Gesicht ins Kissen und schob wie automatisch das Smartphone darunter.
Der leichte Druck, den die Bauchlage verursachte, war angenehm und ich spürte, wie der Periodenschmerz langsam nachließ. Wohligkeit breitete sich in mir aus, und ich erlaubte mir, meine Augen für eine Weile zu schließen. Nur ganz kurz das Licht ausknipsen …
Ich schrak auf. Laut stöhnend kramte ich mein Smartphone hervor, dass nervtötend unter meinem Gesicht durch das Kissen hindurch vibrierte. Eine Push-Benachrichtigung wurde auf meinem Display angezeigt.
Neue Ergebnisse für Ihre Jobsuche mit den Kriterien: Songwriter in Kalifornien.
Gefolgt von einer weiteren Nachricht:
Neue Ergebnisse für Ihre Jobsuche mit den Kriterien: Songwriter in den USA.
Für ein paar Sekunden schwebte mein Finger über dem Alert. Ich blinzelte mehrmals.
Noch konnte ich mir nicht vorstellen, so weit weg von allen, die mir lieb waren, zu wohnen und zu arbeiten. Die Trennung von meiner Zwillingsschwester Reham war damals schon ein großer Schritt gewesen, als ich Santa Monica verlassen hatte, um in Irvine zu studieren. Als Nächstes stand mir der Abschied von Roxy bevor. Sie plante, nach Europa zu gehen und dort als Juristin für Internationales Recht zu arbeiten.
Also tippte ich erst mal auf die Ergebnisse für Kalifornien und schnaubte. Alle Stellen, die halbwegs interessant waren, befanden sich doch außerhalb von Kalifornien. Wozu gab es dann diese verdammten Filter?
Ich warf das Handy aufs Bett und starrte in die Luft. Vielleicht würde es noch mit der Agentur aus San Francisco klappen. Aber warum hatte mir der Agent noch nicht geantwortet?
Ms Vasquez sagte immer, in der Musik sei es wichtiger, sich selbst treu zu bleiben. Karriere wäre nicht alles. Aber was, wenn ich Karriere machen und mir selbst treu bleiben wollte? In der Nähe meiner Familie, meiner Freundinnen, Freunde und meiner Stadt?
Ein Schmerz fuhr in meine Schläfen. Waren meine Träume unrealistisch – Songwriterin in Kalifornien? Ich rieb mir über das Gesicht. Dann stand ich auf.
Ich brauchte frische Luft. Irgendeine Ablenkung, bevor meine Gedanken noch weitere Runden im Karussell drehten. Das Gekreische von Möwen ertönte in meinem Kopf. Eine Hundeschnauze schob sich gegen meine Hand. Muskeln spannten sich unter Jaads Shirt, während er Siebträger austauschte. Die Erinnerung an nussig-würzigen Espressoduft kitzelte meine Nase.
Nein, nein, nein. Der Strand und das DROPOUT waren keine gute Idee, wenn ich einen klaren Kopf kriegen wollte. Ich würde einfach eine Runde über den Campus spazieren.





























