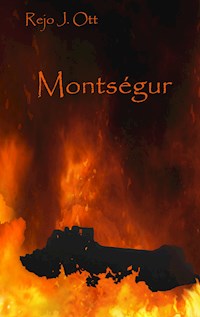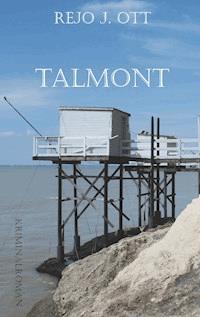
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Der letzte Fischer von Talmont wird ermordet. Kommissar Claude Frehel muss feststellen, dass dieser Mord weite Kreise zieht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 386
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Zum Autor:
Rejo J. Ott ist das Synonym, unter dem der Autor seine Romane veröffentlicht.
Der Autor wurde im Jahr 1949 in Bayern geboren und hat nach seinem Abschluss zum Diplom-Bauingenieur bis zu seinem Rentenbeginn im Bereich Wasserwirtschaft gearbeitet.
Seine Begeisterung für Kriminalromane und ein längerer Urlaub im Südwesten Frankreichs waren der Anlass zu dem vorliegenden Kriminalroman.
Titel der bisher vom Autor veröffentlichten Romane:
- Montségur
Für Wolfgang
Der Flügelschlag des Falken verlor sich in der Düsternis der Unendlichkeit.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Vorwort
Es gibt Menschen, die erst mit dem Erscheinen der Bücher über die Abenteuer von Asterix und Obelix erfahren haben, dass die Römer Gallien besetzt hatten. Zugegeben, die Bücher über die Abenteuer dieser beiden gallischen Helden dienen dazu das normale französische Leben auf die Schippe zu nehmen und Missstände in Frankreich, nach Ansicht der Autoren, aufzuzeigen. Trotzdem kann man daraus einiges über das Leben in Frankreich, besser gesagt im damaligen Gallien zur Zeit der Römer, erfahren.
Unumstritten und auch historisch belegt ist, dass ein gewisser Gaius Julius Cäsar in Rom Langeweile hatte, sich mit einem Leben als unbedeutender Beamter nicht zufrieden geben wollte und deshalb beschloss, sein zukünftiges Dasein eigentlich lieber als Politiker, Feldherr und Herrscher zu verbringen.
Abstammend aus einer untergeordneten Patrizierfamilie und dadurch ausgestattet mit nur einer geringen Menge Kleingeld, tat er sich mit dem reichen Marcus Crassus und dem erfolgreichen Feldherrn Pompeius zu einem Triumvirat zusammen und wurde in Rom Consul.
Er wollte jedoch mehr: Reichtum, Ansehen und Macht.
Vor allem aber wollte er sich zuerst einmal den Folgen seiner zahllosen Rechtsbrüche als Consul entziehen. Also reiste er in den Süden Frankreichs, in die damals kleine römische Provinz Gallia Transalpina am Mittelmeer. Von hier aus begann er ab dem Jahr 58 vor Christi Geburt diese römische Provinz mit Waffengewalt und Krieg auszudehnen. Es gelang ihm das damalige Gallien, soweit er es so bezeichnete, nördlich der Pyrenäen bis an den Rhein zu unterwerfen. Nichts hinderte ihn zigtausende Menschen verschiedenster Völker, auch germanischer Stämme, niedermetzeln zu lassen. Er führte Strafexpeditionen gegen die Germanen durch und in Britannien gegen die Briten, zog sich aber von dort schnell wieder über den Ärmelkanal zurück.
Dem gallischen Führer Vercingetorix gelang es das Heer Cäsars bei Gergovia zu schlagen, aber in der Schlacht von Alesia siegte Cäsar endgültig. Vercingetorix wurde nach Cäsars Triumphzug in Rom hingerichtet.
Der Drill, die Ausbildung und die spezielle, für die damalige Zeit fast geniale Kampftechnik der römischen Streitkräfte waren für den endgültigen Sieg entscheidend.
Als besonderes persönliches Merkmal Cäsars wurde in den Abenteuern von Asterix und Obelix dessen kolossale, hakenförmige Nase hervorgehoben, die eine gewisse Ähnlichkeit mit vorhandenen Statuen zeigt und die allgemein als Synonym klassischer römischer Nasen gilt.
In dem Buch „Der Gallische Krieg“ hat er seinen Eroberungsfeldzug und viele Details aus dem besetzten Land niedergeschrieben, selbstverständlich schöngefärbt nach seinem Gusto. In diesem Buch stellte er die Gallier als primitive Barbaren dar, denen die Römer weit überlegen waren.
Demgegenüber beweisen die ausgedehnten Ausgrabungen der vergangenen Jahrzehnte, dass die Gallier ein weit entwickeltes Gemeinwesen hatten und über hohe handwerkliche, technische und künstlerische Fähigkeiten verfügten, die sich auch die Römer zu Nutze machten und wovon sie auch profitierten.
Das Buch diente ihm sowohl zur Rechtfertigung seiner Feldzüge als auch zur Beweihräucherung seiner eigenen Person. Und ganz bestimmt auch dazu, ihn in den Augen der römischen Frauen interessant zu machen.
Mit seinen Legionen aus Gallien im Rücken übernahm er später als Alleinherrscher die Macht in Rom.
In den folgenden Jahrzehnten und Jahrhunderten übernahmen die Gallier nur zu gern die dekadente Lebensweise der Römer.
Diese begannen im eroberten Gallien, unter anderem an den Flussmündungen, Häfen anzulegen, um Waren aller Art aus Gallien nach Rom zu verschiffen und die vorhandenen Rohstoffe des eroberten Landes auszubeuten, wie dies die westlichen Industrienationen ab dem Mittelalter mit den Kolonien bzw. ehemaligen Kolonien bis heute praktizieren.
Um diese Häfen entstand zwangsläufig die entsprechende Infrastruktur mit Villen, Wohngebäuden, Vergnügungsvierteln, Handelshäusern, Gebäuden für Beamte und Soldaten, sowie auch öffentlichen Gebäuden wie Badehäuser und Amphitheater. Und diese Häfen mussten überwacht und unterhalten werden. Außerdem waren die Steuern einzutreiben und nach Rom weiterzuleiten.
Mit dem Untergang des römischen Reiches verfielen viele dieser Hafenstädte und die Materialien der Gebäude wurden anderweitig verwendet. Manche dieser Städte wurden von den Bewohnern verlassen und unter dem Erdboden vergessen.
Bis die Archäologen der heutigen Zeit begannen, diese Städte wieder auszugraben.
Prolog
> Martinus Callweitus, du bist ein sogenannter Ingenieur ohne jegliches Fachwissen, ein unfähiger Verwalter, ein Betrüger, ein Verbrecher und ein Schweinehund.
Du hast dir auf Kosten des römischen Reiches einen fetten Bauch angefressen. So fett, dass du nicht einmal sehen könntest, wenn dir jemand die Füße stiehlt.
Du hast das Holzgestell deines Bettes durch ein Gestell aus Steinen ersetzen lassen, weil dein altes Bett durch dein riesiges Gewicht schon dreimal zusammengebrochen ist.
Wenn du dir eine neue Toga schneidern lässt, ist zweimal so viel Stoff wie für eine normale Toga erforderlich.
Die filigranen, geschwungenen Stühle, die mir und meinen Freundinnen immer so gut gefallen haben, hast du durch klobige Exemplare ersetzt, auf die man zwei Ochsen auf einmal setzen könnte.
Die Türöffnungen unseres Hauses sind schon breit, aber du kannst dich nur mit Mühe hindurchquetschen. Und nun müssen wir auch noch das Haus umbauen und alle Türen verbreitern lassen. Wenn ich nicht im überdachten Eingangsbereich unseres Hauses ein zweites Bett für dich hätte aufstellen lassen, müsstest du jede Nacht vor dem Haus auf der Erde schlafen, weil dich niemand ins Haus tragen kann.
Du lässt dir jeden Abend in den Tavernen von deinen Speichelleckern den Wein bezahlen und musst fast jeden Abend mit einem Fuhrwerk hierher zu unserem Haus gebracht werden, weil du regelmäßig nicht mehr in der Lage bist deine eigenen Füße zu benutzen.
Von den Steuern, die die Kapitäne und Eigner der einlaufenden und auslaufenden Schiffe und die Händler zu entrichten haben, hast du den Großteil in deinen eigenen Beutel gesteckt.
Von den Abgaben, die die Pächter der Lagerhäuser am Hafen entrichten, gelangt nicht eine einzige Sesterze nach Rom, und das schon seit vielen Jahren. Diese Lagerhäuser sind in einem fürchterlich heruntergekommenen Zustand, weil du als Hafenverwalter nicht bereit und zu geizig bist, um Handwerker für die erforderlichen Reparaturen zu bezahlen.
Der Hafen versandet immer mehr und du denkst überhaupt nicht daran, Maßnahmen dagegen zu ergreifen. Die beiden alten und erfahrenen Kapitäne der zwei Galeeren, die hier stationiert sind, haben dir schon mehrmals im Detail erläutert welche Maßnahmen durchgeführt werden können, um die Versandung des Hafens zu stoppen und sogar rückgängig zu machen.
Zum Dank für die Hilfe, die diese beiden dir angeboten haben, hast du dem einen, Gaius Flavius, nachts ein Messer in den Rücken jagen lassen. Den anderen, Titus Tulla, hast du für diesen Mord verurteilen lassen und ihn trotz seines Alters und trotz seiner Ergebenheit zu dir auf eine Galeere im Mittelmeer verbannt.
Und warum?
Weil du von diesen Ingenieurmaßnahmen absolut keine Ahnung hast, und das, obwohl du dich überall, auch in Rom, als der große Könner darstellst.
Und nun forderst du auch mich noch auf, meine Sachen zu packen und mit unseren Kindern zu verschwinden. Ich soll verschwunden sein, wenn du von deiner bevorstehenden Inspektionsreise entlang der Küste nach Norden zurückkommst? Es sind auch deine Kinder, die ich dir geschenkt habe, ebenso wie ich dir zwanzig Jahre meines Lebens geschenkt habe.
Glaubst du etwa, dass die hässliche Tochter des Senators Lucius Cato dir ebenfalls Kinder schenken wird? Dass der Senator dir in Rom ein hohes Amt verschaffen wird, wenn du seine Tochter heiratest, die niemand auch nur ansieht?
Sie ist spindeldürr, hat eine Nase wie ein Geier, eine Haut wie ein Reibeisen, voller brauner Flecken, krumme Beine, kaum noch Haare auf dem Kopf, jede Menge Warzen im Gesicht und keift den ganzen Tag nur herum. Selbst die Löwen im Kolosseum in Rom würden einen großen Bogen um sie machen.
Und du willst diese Eule, die so aussieht wie ihr Vater, wirklich gegen mich eintauschen? <
Pecunia redete sich immer mehr in Rage. Ihr Gesicht war purpurrot angelaufen. Sie fing an, das Obst aus den auf den beiden Tischen stehenden Schalen nach Martinus zu werfen.
Martinus ließ es ohne Gegenwehr geschehen. Wegen seiner Fettleibigkeit war er auch gar nicht in der Lage, den Wurfgeschossen auszuweichen oder sie abzuwehren.
Er ließ sich in einen seiner klobigen Stühle plumpsen und genoss den Wutausbruch seiner Lebensgefährtin.
Schließlich richtete er seinen Oberkörper auf und deutete mit dem fetten Zeigefinger seiner rechten Hand auf Pecunia.
> Um ein für alle Mal Klarheit zu schaffen. Du bist keine Römerin. Du bist zwar die Tochter eines gallischen Stammesführers, nur eines ganz kleinen, unbedeutenden Stammesführers, aber du bist keine Römerin.
Nun, ich muss zugeben, du bist sehr hübsch, hast die richtigen Rundungen an den richtigen Stellen und du hast mir in den ersten Jahren viel Spaß bereitet, weil du sehr sinnlich bist.
Die Kinder? Sie sehen dir ähnlich, aber nicht mir. Ich bin mir sicher, dass du dich während meiner alljährlichen Inspektionsreisen anderweitig vergnügt hast. Und nun sollen es meine Kinder sein?
Ich habe euch all die Jahre durchgefüttert, aber damit ist jetzt Schluss, ein für alle Mal Schluss. Ich werde nach Rom zurückkehren und ich habe dort keine Verwendung für eine Gallierin, nicht einmal als Sklavin. Du wirst mich bei einer Beförderung nur behindern.
Und ich will befördert werden, ich will Karriere machen.
Was den ermordeten Kapitän betrifft, so kann ich jederzeit behaupten, dass du für den Mord verantwortlich bist und dafür aus deinem Stamm jemanden angeheuert hast. Wem wird man glauben? Einem Römer oder einer Gallierin?
Außerdem wirtschaftet jeder in seine eigene Tasche. Und ich muss für mein Alter und für die hohen Lebenshaltungskosten in Rom vorsorgen.
Wie ich dir schon gesagt habe, ich werde morgen zu der Inspektionsreise aufbrechen, die etwa einen Monat dauern wird. Bei meiner Rückkehr wirst du mit deinen Kindern verschwunden sein.
Es gibt genug Männer, die für ein paar Sesterzen einen Dolch für dich bereithalten.
Oder soll ich deine Kinder in die Sklaverei verkaufen?
Also schweig und verschwinde. <
Pecunia kochte vor Wut, sah aber ein, dass sie gegen Martinus immer den Kürzeren ziehen würde. Vor allem musste sie an ihre Kinder denken.
Trotzig warf sie den Kopf zurück. Ihre langen dunklen Haare schwangen um ihr Gesicht, und sie verließ den Raum um nach ihren Kindern zu sehen.
Am nächsten Morgen, weit nach Tagesanbruch, verließ der römische Beamte Martinus Callweitus das Haus um sich auf eine der Galeeren zu begeben und brach nach Norden zu seiner Inspektionsreise auf.
Als erstes schickte Pecunia die drei Frauen weg, die bisher alle Arbeiten in Haus und Garten erledigt hatten. Sie bat die jüngste der drei Frauen, die sie Jahre zuvor aus ihrem eigenen Stamm hatte kommen lassen, ihre Kinder zu ihrem Vater mitzunehmen.
Dann schüttete sie den Großteil des Weines aus, den Martinus für eine horrende Summe aus Rom hatte liefern lassen. Damit war ihr erster Zorn verraucht.
Sie setzte sich auf einen dieser monströsen Stühle, lehnte sich an, aß genüsslich einen Apfel und überlegte, was sie noch tun könnte um Martinus seine Gemeinheit heimzuzahlen.
Dann hatte sie eine Idee. Sie war nun allein im Haus und hatte etwa vier Wochen Zeit.
Es war ein leichtes für sie das Schloss zu dem Raum zu öffnen, in dem Martinus die vier Truhen mit seinen Kleidern stehen hatte und den sie nie hatte betreten dürfen.
So viele Truhen für so wenige Kleider?
Sie öffnete die Truhen, warf die Kleider achtlos auf einen Haufen und entdeckte, was sie schon lange geahnt hatte. Alle Truhen, bis auf eine, in der nur alte, abgetragene und inzwischen zu klein gewordene Tuniken und wollene Umhänge lagen, waren unter einer dünnen Lage Kleider mit Sesterzen, Gold- und Silberbarren, goldenen Schalen und Kelchen sowie Edelsteinen gefüllt. Sie konnte die Truhen nur mit Mühe anheben, tragen konnte sie sie nicht.
Sie schloss die Deckel der Truhen wieder und begab sich durch den Innenhof des Hauses in den Garten, der auf beiden Seiten von Nebengebäuden begrenzt wurde. Der Garten wurde nach hinten von einer hohen Mauer abgeschlossen, in die eine kleine Pforte eingelassen war.
Aus einem dieser Nebengebäude holte sie einen Spaten und begann in der Längsseite des Gartens, unmittelbar am Ende der Mauer des rechten Nebengebäudes entlang des Fundamentes, ein langes und tiefes Loch zu graben, das bis zur Unterkante der Fundamente reichte.
Am Abend des dritten Tages war sie ganz erschöpft, blickte aber mit gehässiger Zufriedenheit im Herzen auf ihr geleistetes Werk.
Am nächsten Tag begann sie in der Umgebung des Hauses Steine, große und kleine, einzusammeln und durch die kleine Pforte hinter das Haus an den Anfang des Gartens zu tragen, wobei sie darauf achtete nicht gesehen zu werden.
Auf die Sohle des ausgehobenen Loches, hochgeklappt bis über die Seitenwände, legte sie drei Lagen grobes Leintuch. Truhe für Truhe leerte sie, trug den Inhalt in einer Tonschale in das Loch im Garten und versenkte dort den Reichtum. Sie musste den Weg oftmals gehen.
Die Truhen füllte sie mit den gesammelten Steinen und einem Teil des Sandes aus dem gegrabenen Loch auf, legte darüber jeweils ein grob gewebtes Tuch und darauf warf sie achtlos einen Teil der abgetragenen Kleider. Anschließend prüfte sie, ob das jetzige Gewicht der Truhen in etwa dem vorigen Gewicht entsprach.
Über den von Martinus zusammengerafften und nun von ihr heimlich vergrabenen Reichtum legte sie ein fein gewebtes Wolltuch, darüber den Großteil der Tuniken aus der nur mit alten Kleidern gefüllten Truhe, klappte die drei Lagen Leintuch darüber und legte darauf zusätzlich in mehreren Schichten grob gewebtes Leintuch.
Anschließend füllte sie den Rest der ausgehobenen Erde darauf, trampelte sie fest und pflanzte dann die Rosen wieder darüber, die sie vorher ausgegraben hatte und die Martinus aus Rom hatte liefern lassen. Den Rest der Erde verteilte sie sorgfältig im Garten.
Nur sie wusste jetzt, wo der ganze Reichtum vergraben war und sie konnte sich jederzeit, notfalls heimlich, davon holen.
Von der schweren Arbeit körperlich erschöpft, setzte sie sich in die Küche. Wenigstens hier standen noch zwei der von ihr so geliebten, filigranen Stühle und sie begann ihr Abendessen einzunehmen.
> Pecunia, hallo Pecunia, wo steckst du? <
Es war die Stimme von Lucilla, ihrer besten Freundin, die unverhofft bei ihr vorbeischaute.
> Hier in der Küche bin ich, komm herein. Ich bin gerade beim Essen. Willst du mitessen? Noch sind genug Lebensmittel da. <
> Was heißt, noch sind genug Lebensmittel da? Hast du vergessen deine Dienstboten auf den Markt zu schicken? <
Lucilla baute sich in der Küche auf. Sie war ziemlich klein, dafür aber genauso breit. Ihr sonniges Gemüt und ihre Warmherzigkeit waren mehr als ein Ausgleich für ihre unförmige, fassartige Figur.
> Nein, ich habe alle meine Dienstboten weggeschickt und meine Kinder habe ich zu meinem Vater bringen lassen.
Martinus hat mich rausgeworfen, nach zwanzig Jahren, einfach rausgeworfen, rücksichtslos rausgeworfen. Wenn er von seiner Inspektionsreise zurück sein wird, soll ich mit den Kindern verschwunden sein. Deshalb habe ich nur noch wenige Lebensmittel im Haus. In zehn Tagen werde ich zu meinem alten Vater zurückkehren. <
> Ist denn Martinus total verrückt geworden? Eine Frau wie dich wird er nie wieder finden. <
> Das interessiert ihn nicht. Er wird in mehreren Wochen nach Rom zurückkehren und will dort Karriere machen, mit der Heirat einer dürren Eule, die zufällig die Tochter eines Senators ist. So fett wie er ist, wird sich ohnehin keine andere Frau mehr für ihn interessieren. Er kann mit ihnen auch nichts mehr anfangen, dazu ist er zu fett geworden.
Du kannst mich, wenn du willst, jederzeit bei meinem Vater besuchen.
Für mich ist hier Schluss, endgültig Schluss. <
Lucilla schlug vor Entsetzen die Hände vors Gesicht und brach in Tränen aus.
> Hör auf zu jammern, das ändert auch nichts mehr. Ich habe bereits einen Schlussstrich gezogen. Ich werde dich in den nächsten Tagen besuchen, noch vor meiner Abreise. Dann können wir uns voneinander verabschieden. <
Lucilla drehte sich vor Entsetzen wortlos und weinend um und verließ das Haus.
Der Regen, der in den nächsten Tagen lang und andauernd fiel, verwischte alle Spuren, die Pecunia im Garten hinterlassen hatte.
Am nächsten Tag fing sie an alle Gegenstände aus dem Haus, die einigen Wert hatten, zu verkaufen und beabsichtigte, in den kommenden Tagen alle im Haus noch vorhandenen Nahrungsmittel zu verbrauchen. Den Rest wollte sie mit Hundekot ungenießbar machen.
An diesem nächsten Abend betrank sie sich, zufrieden mit ihrer bisherigen kraftraubenden Arbeit und mit einem Gefühl tiefster Befriedigung, Hass und Schadenfreude im Bauch, mit dem Rest des Weines und schlief mitten im Haus auf dem Fußboden ein.
> Marius, ich sage dir, dieser Martinus Callweitus hat in seinem Haus jede Menge Gold, Silber und Sesterzen gehortet. Jeder in den Tavernen erzählt davon, er hat oft genug im Suff damit geprahlt.
Er ist zurzeit mit einer Galeere unterwegs und wird noch mindestens eine Woche wegbleiben. Seine Frau Pecunia ist allein im Haus, sie hat ihre Kinder und die Dienstboten weggeschickt.
Wir werden sie heute Nacht besuchen und uns so viel von dem Reichtum holen wie wir tragen können. Du kannst dir mit ihr noch ein wenig Spaß gönnen, sie ist ein Mordsweib. Mir hat schon vor Jahren ein Speerstich leider alle Lust auf Frauen genommen.
Anschließend verschwinden wir nach Süden, bis über die Berge und niemand wird uns finden. <
> Einverstanden, Lucius, ich werde bis heute Abend einige Ledersäcke auftreiben, ein Maultier mit Tragsattel stehlen und Proviant für einige Tage besorgen. Damit müssen wir in den nächsten Tagen in keinem Dorf Nahrung einkaufen und können unsere Spuren besser verwischen. <
In der kommenden Nacht war der Himmel bewölkt, aber es regnete nicht. Marius und Lucius, zwei grobschlächtige Männer mit narbigen Gesichtern, hatten als ehemalige Soldaten keinerlei Skrupel. Sie schlichen sich von der Rückseite an das Anwesen und brachen die kleine Pforte auf. Durch den Garten und vorbei an den Nebengebäuden bewegten sie sich leise auf das Haus zu.
Im Haus fiel nur ein dürftiger Lichtschein aus einem kleinen Kupferbecken mit glimmender Holzkohle, das eine geringe Wärme ausstrahlte .
Als ihre Augen sich an das diffuse Licht gewöhnt hatten, sahen sie die Frau auf dem Boden liegen. Der Geruch nach Wein war nicht zu verkennen.
Marius beugte sich sofort über die Frau, drehte sie vorsichtig auf den Rücken und bewunderte ihre frauliche Figur. Dann fing er an, ihr die Kleider vom Leib zu reißen.
Pecunia erwachte aus ihrem weinseligen Schlaf, sah den Mann über sich und fing an zu schreien. Marius legte ihr sofort seine schwielige linke Hand auf den Mund, konnte den Schrei aber nicht ganz unterdrücken. Sie biss ihn heftig in die Hand, worauf er seine Hand zurückzog und ihr mit der anderen Hand einen kräftigen Schlag an den Kopf versetzte.
Pecunia fing an gellend zu schreien. Marius drückte ihr mit seiner linken Hand die Kehle zu, zog seinen Dolch und stach ihr mehrmals in Herz und Oberkörper.
Plötzlich füllte sich der Raum mit Soldaten. Als sie die zwei Männer, einen davon mit einem blutigen Dolch in der Hand, und die tote Frau mit blutdurchtränkten Kleidern in einer Blutlache auf dem Boden liegen sahen, zogen sie ihre Schwerter.
Die beiden Männer wehrten sich mit ihren Dolchen. Gegen die Übermacht der nächtlichen Patrouille hatten sie keine Chance. Sie starben unter den Schwerthieben der Soldaten.
Ihre Leichen wurden am nächsten Morgen am Rand der kleinen Stadt von den Soldaten verscharrt, die ihnen vorher noch die Taschen leerten und alles andere Verwertbare abnahmen.
Die Galeere mit Martinus Callweitus segelte in verschiedenen Tagesetappen, mit mehreren Inspektionsaufenthalten an verschiedenen Häfen, bei gutem Wind nach Norden zur westlichen Spitze von Aremorica, als wie aus dem Nichts dichter Nebel aufstieg. Der Kapitän schaffte es nicht mehr eine geschützte Bucht anzulaufen um zu ankern.
Mit lautem Knirschen und einem heftigen Stoß lief das Schiff auf ein Riff auf und riss sich ein großes Loch in den Rumpf. Durch das eindringende Wasser legte sich die Galeere schnell auf die Seite. Innerhalb von nur wenigen Minuten sank sie.
Die angeketteten Sträflinge, die Soldaten, die Besatzung und Martinus Callweitus versanken in der tückischen Strömung zwischen den Riffen. Niemand hörte ihr Schreien, niemand kam ihnen zu Hilfe.
1
Pierre Monard betrat seine Stammkneipe am Hafen und ging quer durch den Gastraum zu seinem Stammplatz an der hinteren Wand. Er lehnte sich auf seinem Stuhl zurück an die Wand und sah sich um.
Wie so oft am späten Nachmittag war er der einzige Gast. Die anderen würden erst in ein, zwei Stunden eintrudeln.
Auch an den wenigen kleinen Tischen vor der Kneipe, es waren jeweils zwei rechts und links des Eingangs mit je zwei weiß gestrichenen, stählernen Stühlen auf dem schmalen Gehweg, saß niemand. Für die Touristen war es schon zu spät für die Mittagszeit und zu früh für den Abend, für die anderen Stammgäste noch zu früh.
Die Tische auf dem Gehweg vor der Kneipe zwangen die Passanten auf die Straße auszuweichen. Daran störte sich jedoch niemand, denn die Kneipe lag in einer Sackgasse, die hinter dem Gebäude ohnehin zu Ende war.
Nur ein sandiger Fußweg führte weiter, an der Abbruchkante der Felsen am Fluss entlang. Pierre kannte ihn gut, denn nach jedem Kneipenbesuch benutzte er ihn, um nach Hause zu seinem kleinen Fischerhäuschen zu gelangen, zu Fuß nur wenige Minuten entfernt.
Pierre war ein Mann mittlerer Größe im Alter von achtundvierzig Jahren, einen Meter sechsundsiebzig groß. Aufgrund seiner genügsamen Lebensart und seiner täglichen harten Arbeit war er schlank geblieben. Seine dunkelbraune Haarpracht wurde von Monat zu Monat dünner, war jedoch ohne graue Haare. Aber seine blauen Augen blitzten wie in seiner Jugend in einem gebräunten, hageren Gesicht. Seine Muskeln waren hart und elastisch und seine Hände voller Schwielen.
Er trug Jeans, die teilweise fadenscheinig, aber sauber waren, ein langärmeliges, kariertes Hemd und klobige Arbeitsschuhe mit Stahlkappen. Er trug immer nur diese Art Schuhe, die er bei seiner täglichen Arbeit benötigte. Dadurch kam er nie in die Verlegenheit schicke und teure Lederschuhe bei seiner Arbeit auf dem Fischerboot zu tragen, weil er vielleicht zufällig vergessen hatte die Schuhe zu wechseln und damit die teuren Schuhe zu ruinieren.
Jacques Fillou, der Wirt, lümmelte wie immer hinter der Theke und putzte hingebungsvoll seine Gläser. Er war nachlässig, um nicht zu sagen schlampig, gekleidet, mit alten, verwaschenen Cordhosen, die vor langer Zeit einmal braun gewesen waren und einem etwas zerschlissenen, einfarbig grünen Hemd, das seinen schon erheblichen Bauch etwas kaschierte und von dem ihm wie immer ein Zipfel aus der Hose hing.
Er war etwa so groß wie Pierre, hatte aber einen schon sehr breiten Mittelscheitel, den er täglich eincremte und als Denkerstirn stolz zur Schau stellte. Der verbliebene Rest seiner Haare war fettig, das war für jeden sofort, klar und deutlich zu erkennen.
Sein Aussehen war ihm völlig egal, es war sein Leben. Seine Stammgäste kamen trotzdem immer wieder und auch die Touristen waren gerne bei ihm zu Gast. Er war stets nett, freundlich und hilfsbereit und hatte für jeden von ihnen einen besonderen Tipp zu einer Sehenswürdigkeit oder zu einem ausgezeichneten und preiswerten Restaurant.
Zudem kochte seine Frau jeden Abend drei Stunden lang für vorhandene Stammgäste und für angemeldete Gäste. Aber nur drei Stunden lang, maximal drei Stunden, nie länger.
Sein Monatsverdienst hielt sich in Grenzen, aber er war mit seinem Leben durchaus glücklich. Er wollte es nicht anders. Jeden Tag seinen Hintern auf einem Bürostuhl breitdrücken? Niemals. Er war sein eigener Herr und er konnte gemütlich leben. Seine Frau teilte sein Leben und war ebenfalls glücklich damit.
Jacques hatte nur wenige Bedürfnisse und deswegen konnte sie sich gelegentlich etwas Besonderes gönnen, was ihr Mann jedes Mal mit Interesse und Zustimmung zur Kenntnis nahm. Kurzum, sie waren beide glücklich.
Seine Kneipe war sein Leben. Obwohl er nicht besonders auf sein Äußeres achtete, seine Frau musste ihn immer wieder zusammenstauchen sich zu waschen, behandelte er seine Kneipe besser als sich selbst. Sie war sein Lebensinhalt. Außer seiner Frau natürlich.
Sie hatten keine Kinder bekommen, was vielleicht der einzige Schatten in ihrem Leben war. Sie hatten es akzeptiert, mittlerweile hatten sie es akzeptiert.
Daran dachte auch Pierre und seine Gedanken schweiften in die Vergangenheit. Er schloss die Augen.
Er hatte nicht so viel Glück gehabt. Er war Fischer, inzwischen der letzte Fischer in Talmont-sur-Gironde. Auch er war im Grunde zufrieden mit seinem Leben, inzwischen war er zufrieden.
Die Ausbeute seiner Arbeit war in den vergangen zwanzig Jahren stetig zurückgegangen. Weil aber die Zahl seiner Kollegen ebenfalls stetig abgenommen hatte, konnte er seine Fische trotzdem gut verkaufen. Besonders in der Touristensaison, wenn ihm die frisch gefangenen Fische aus den Händen gerissen wurden und er die Preise erhöhen konnte.
Gerade in den Sommermonaten fing er viele Adlerfische. Zugegeben, auch diese waren in den letzten Jahren immer kleiner geworden, aber die Anzahl war etwa gleich geblieben. Die Adlerfische waren bei den Touristen wegen ihres guten Geschmacks zum Grillen sehr beliebt. Er hatte ja inzwischen auch keine Konkurrenten mehr.
Er hatte sich bis vor etwas mehr als drei Jahren einiges an Geld zurücklegen können. Er benötigte damals wieder ein neues Netz und auch sein Boot, vor allem der Motor, musste überholt werden. Dann hatte er etwa eine Woche lang keine Einnahmen gehabt.
In dieser Zeit hatte er auch seinen beiden Kindern, seinem Sohn und seiner etwas jüngeren Tochter kein Geld schicken können um sie bei ihrem Studium in Bordeaux zu unterstützen. Er hatte sie darüber informiert und sie mussten eben noch mehr neben dem Studium arbeiten gehen, um über die Runden zu kommen. Aber er wusste, dass sie dafür Verständnis hatten. Sie waren beide intelligent und kamen in ihrem jeweiligen Studium gut voran.
Die Intelligenz hatten sie nicht von ihm geerbt, das wusste er. Und auch nicht von seiner geschiedenen Frau.
Er war als junger Mann ganz verrückt nach ihr gewesen. Sie war überaus hübsch gewesen, schlank, kokett, mit einer ganz tollen Figur. Nachts hatte er sogar regelmäßig von ihr geträumt. Er hatte es damals gar nicht fassen können, dass sie bereit gewesen war ihn zu heiraten. Die ersten Jahre waren wunderbar gewesen. Sie hatten zwei Kinder bekommen, die er total vergötterte.
Zum Fischen war er, wie jetzt immer noch, stets nachts unterwegs gewesen. Damals war er auch oft auf das Meer hinaus gefahren, sein Boot war zur damaligen Zeit noch in einem guten Zustand gewesen.
Aber vier Jahre nach ihrer Hochzeit war er mitten in der Nacht nach Hause gekommen, weil der Motor seines Fischerbootes den Geist aufgegeben hatte. Ein Kollege hatte ihn in den Hafen geschleppt.
Nur wenige Meter neben seinem Haus hatte ein großer BMW geparkt. Er war ins Haus geschlichen, um niemanden seiner Familie zu wecken und hatte aus seinem Schlafzimmer eine Männerstimme gehört. Das Blut hatte in seinen Adern gestockt. Kein Zweifel, es war eine Männerstimme.
Er hatte aus der Küche ein Messer geholt, leise die Klinke der Schlafzimmertür heruntergedrückt und auf Zehenspitzen das Zimmer betreten. Ein Mann hatte bei seiner Frau im Bett gelegen, über sie gebeugt, mit dem Rücken zu ihm. Mit seiner linken Hand hatte Pierre diesen Kerl grob an den langen Haaren gepackt und ihm mit der Rechten das Messer an die Kehle gehalten.
Seine Frau hatte nur einen erstickten Schrei ausstoßen können.
Er hatte diesen Mann aus seinem Bett gezwungen, aus dem Schlafzimmer, aus dem Haus und auf die Straße. Splitternackt.
Auf der Straße hatte er ihm einen kräftigen Stoß in den Rücken gegeben. Als der Lustmolch sich umgedreht hatte, hatte er ihm mit einem seiner schweren Schuhe mit aller Kraft in die Eier getreten und, als der Kerl sich zusammenkrümmte, hatte er ihm mit großem Vergnügen noch einen Tritt seitlich an den Kopf verpasst. Der Typ war zusammengeklappt und hatte sich nicht mehr geregt.
Er war zurück ins Haus gegangen, ins Schlafzimmer, und hatte seine Frau nur angesehen. Sie hatte das Deckbett bis zum Hals hochgezogen und war kreidebleich. Noch voller Wut und ohne zu überlegen hatte er damals nur gesagt:
> Verschwinde, auf der Stelle! <
Sie war aufgestanden, hatte sich angezogen und das Haus verlassen. Stillschweigend und für immer.
Die Scheidung war nur eine Formsache gewesen.
Für die Kinder hatte sie sich nie mehr interessiert. Er hatte sie allein aufgezogen, anfangs mit Hilfe seiner damals noch lebenden Eltern, nach deren frühem Tod allein.
Nach ihrer Pubertät war ihm aufgefallen, dass die Kinder keine Ähnlichkeit mit ihm hatten, eine gewisse Ähnlichkeit mit ihrer Mutter, aber nicht mit ihm. Irgendwann hatte er mit seinem Arzt darüber gesprochen. Dieser hatte die Blutgruppen von ihnen dreien aus seinen Unterlagen verglichen. Es war eindeutig: er war nicht der leibliche Vater.
In dieser Nacht war er hinausgefahren, hatte aber kein Netz ausgeworfen. Er hatte irgendwo geankert und in sich hinein gehorcht, in sein Herz, in seine Seele, in seinen Kopf.
Am Morgen war ihm klar geworden, dass es die Kinder seines Herzens waren. Er hatte sie aufgezogen. Er hatte sich erinnert, wie er jedes Mal laut aufgelacht hatte als jedes der Kinder, als Baby, nackt auf seinem Bauch gelegen und ihn angepinkelt hatte.
Er hatte sie aufwachsen sehen, sie hatten mit ihm gelacht, er hatte sie getröstet, wenn sie geweint hatten, und sie hatten ihn immer wieder umarmt und geküsst. Er konnte sie nicht aus seinem Herzen reißen.
Er hatte mit ihnen darüber geredet. Sie hatten ein Anrecht auf die Wahrheit. Sie waren beide schockiert gewesen.
Dann hatten sie ihn umarmt und wollten ihn gar nicht mehr loslassen. Sie waren seine Kinder und sie würden seine Kinder bleiben, bis über seinen Tod hinaus.
Es war ihm sehr schwer gefallen als sie nacheinander nach Bordeaux gezogen waren um dort ihr Studium aufzunehmen. Beide hatten sehr schnell eine gut bezahlte Teilzeitarbeit gefunden, die ihnen neben der Arbeit ausreichend Zeit für ihr Studium ließ. Und wann immer er etwas Geld auf die Seite legen konnte, schickte er es ihnen.
Dreimal, viermal im Jahr fanden sie eine günstige Mitfahrgelegenheit um ihn zu besuchen. Ein Auto besaßen sie nicht und mit öffentlichen Verkehrsmitteln von Bordeaux nach Talmont zu fahren war fast wie eine Weltreise.
Das waren die schönsten Tage in seinem Jahresrhythmus. Sein Sohn fuhr dann mit ihm zum Fischen und seine Tochter brachte wieder Ordnung in seinen Haushalt. Er konnte sich in diesen wenigen Tagen gar nicht an ihnen sattsehen und ihre Gegenwart genießen.
In diesen Tagen war er glücklich.
Er hatte sich nie wieder für eine andere Frau interessiert.
Aber ansonsten war er zufrieden mit seinem Leben.
Er öffnete kurz die Augen und blickte auf, als der Wirt ihm wortlos sein Glas Rouge auf den Tisch stellte und dann wieder hinter die Theke zurückschlurfte um weiter seine Gläser zu polieren.
Einmal im Monat gönnte er sich einen freien Tag, besser gesagt eine freie Nacht. Dann führte er tagsüber an seinem Haus oder an seinem Boot dringende Arbeiten oder andere Besorgungen durch.
Die Zeit tagsüber, die ihm ansonsten nach dem Verkauf der Fische und einigen Stunden Schlaf blieb, reichten für die wenige Hausarbeit und die geringen Einkäufe und Erledigungen aus.
Nachts, nach dem Ausbringen der Netze und der langen Angelschnüre, ankerte er am rechten Ufer der Gironde in Ufernähe, weit außerhalb der Fahrrinne der Frachtschiffe, die Bordeaux ansteuerten, und konnte sich dort ebenfalls einige Stunden Schlaf gönnen. Er hatte sich an diesen Rhythmus gewöhnt.
Im kommenden Monat würde er sich diese Nacht als Auszeit ebenfalls wieder gönnen, aber dann würde er mit seinen Freunden und ehemaligen Kollegen, die schon in Rente waren, seinen Geburtstag feiern.
Als die Eingangstür ging, öffnete er wieder die Augen und hob den Kopf. Er sah, dass der erste seiner ehemaligen Kollegen zur Tür hereinkam und quer durch die Kneipe auf ihn zuging.
Simon Bréac war schon fast achtzig Jahre alt, aber immer noch rüstig. Mit seinen grauen Haaren, von denen er anscheinend noch kein einziges verloren hatte, wirkte er gerade wie fünfzig. Er mochte ihn, denn Simon hatte ihm als jungem Kerl viel über das Fischen beigebracht, sein eigener Vater war wegen einer heimtückischen Krankheit viel zu früh arbeitsunfähig geworden und auch viel zu früh gestorben, seine Mutter war ihm kurz darauf gefolgt.
Simon begrüßte ihn und ließ sich gemächlich auf einen Stuhl sinken.
> Hey, Jacques, hör auf deine Gläser kaputt zu polieren und bring Simon einen Roten auf meine Rechnung. <
Jacques ließ sich bei seiner Beschäftigung nicht stören. In aller Gemütsruhe polierte er die letzten drei Gläser fertig und stellte zwei in den Schrank hinter sich, bevor er das dritte mit Rotwein füllte.
Er stellte es vor Simon auf den Tisch, beugte sich halb über ihn und legte ihm dann die Hand auf die Schulter.
> Geht es dir gut? <
Simon Bréac nickte.
> Das freut mich. Du warst seit Monaten nicht mehr hier. Ich hatte schon befürchtet, dass du deine letzte Bootsfahrt unternommen hättest. <
> Nein, ich bin noch fit und gesund. Ich habe mir in Saintes einen Platz in einem Seniorenheim gesucht, nahe bei meinen Kindern. Die haben zwar nicht viel Zeit für mich, aber ich kann wenigstens einige Zeit mit meinen Enkelkindern genießen. Das tut meiner alten Seele gut. Wer weiß wie lange noch.
Aber ich wollte meine alten Kumpels hier wieder mal sehen und mit ihnen quatschen. <
In diesem Moment betrat Jean Vaselle die Kneipe.
> Die alte Runde der Fischer ist wieder komplett, zumindest die, die noch übrig sind. <
Jacques trottete hinter seine Theke um ein weiteres der gerade polierten Gläser mit Rotwein zu füllen.
> Pierre, zufrieden mit dem Fang? Wie geht es den Kindern? <, erkundigte sich Simon.
> Danke, nach dem letzten Telefongespräch ist bei Louis und Simone alles in Ordnung. Sie haben zwar nichts gesagt, aber ich nehme an, dass sie nächsten Monat zu meinem Geburtstag hierher kommen werden.
Ich lade euch hiermit zu meinem Geburtstag ein, am siebzehnten. Ich werde einen ausgeben. Jacques` Frau hat mir versprochen für uns alle ein gutes Essen aufzutischen. Und dass sie eine hervorragende Köchin ist, wisst ihr ja.
Was die Arbeit betrifft, ich brauche wieder mal ein neues Netz. Es ist fürchterlich, was die Gironde alles anschwemmt, das dann meine Netze ruiniert. Es wird von Jahr zu Jahr immer schlimmer. Der Motor meines Bootes muss auch wieder mal überholt werden. Während dieser Arbeiten werde ich einige Schäden beseitigen und das Boot wieder abdichten und neu streichen. Es muss noch lange halten.
Und wie steht es mit euch Rentnern? Alles in Ordnung, spielt die Gesundheit noch mit? <
Sie unterhielten sich noch lange, über dieses und jenes und der Abend wurde lang.
Dennoch trank Pierre nur zwei Gläser Roten. Es war schon fast Mitternacht als sie sich trennten.
Pierre wandte sich nach dem Verlassen der Kneipe nach rechts und nahm im Licht des vollen Mondes den Trampelpfad in Richtung seines Hauses. Der Pfad führte ein Stück an der Abbruchkante der Felsen entlang bevor er vor einer grün gestrichenen Bank, die sich hinter einigen Büschen verbarg, vor einigen schicken Häusern nach rechts zur parallel zum Fluss verlaufenden Straße abbog. Diese Häuser gehörten wohlhabenden Leuten aus der „Stadt“, die auch die alten darunter liegenden Höhlen in der Felswand, ehemalige Schmugglerhöhlen, zu komfortablen Wohnräumen ausgebaut hatten.
Er setzte sich auf die Bank und sein Blick richtete sich auf die Lichter am anderen Ufer der Gironde. Ein großes Containerschiff fuhr die Gironde flussaufwärts Richtung Bordeaux. Das Schiff war hell beleuchtet und für jeden Beobachter gut zu erkennen.
Seine Gedanken schweiften drei Jahre zurück an den Abend seines damaligen Geburtstages.
Den Termin für die Überarbeitung seines Bootsmotors hatte er auf drei Tage vor seinem Geburtstag vereinbart.
Wie erwartet, kamen seine Kinder um einige Tage zu bleiben. Den Abend mit seinen ehemaligen Kollegen verbrachte er ohne sie. Seine Kinder wollten an diesem Abend ihre Freunde besuchen und auch bei ihnen übernachten.
Es wurde spät, sehr spät. Jacques hatte gegen zehn Uhr seine Kneipe abgeschlossen, Touristen waren um diese Zeit ohnehin keine mehr da. Seine Frau hatte ein hervorragendes Menü aufgetischt und jeder aus der Festrunde war darüber voll des Lobes. Ihr Gelächter ließ die Kneipe erzittern.
Die nächsten Nachbarn, die sich hätten beschweren können, wohnten ein ganzes Stück entfernt.
Pierre hielt sich trotz seines Festtages mit alkoholischen Getränken zurück. Das war einfach seine Gewohnheit. Er konnte auch ohne Rausch lustig sein.
Irgendwann bat Jacques ein Ende zu machen. Niemand protestierte.
Pierre verabschiedete sich von seinen Freunden und ehemaligen Kollegen, um den Trampelpfad nach Hause einzuschlagen. Das Licht von Mond und Sternen war ausreichend hell, sodass er auf dem holprigen Weg nicht ein einziges Mal stolperte.
Ganz unerwartet hatte sich von der Bank ein Mann erhoben. Ein einzelner Mann, mitten in der Nacht, an diesem abgeschiedenen Ort. Pierre kannte ihn nicht und war auf einmal hellwach. Beim Schein des Mondes hatte er den Mann gut erkennen können.
Der Mann war groß gewachsen, etwa einen Meter neunzig oder noch größer und von schlanker Statur. Er war dunkel gekleidet, einen dunklen Hut hatte er tief in die Stirn gezogen. Trotz der sommerlichen Temperaturen hatte er sich einen dunklen Seidenschal um den Hals geschlungen, der die untere Hälfte seines Gesichtes verdeckte. Pierre hatte nur die Wangenknochen, die Nase und die Augen erkennen können.
Er war verwirrt gewesen, trotzdem neugierig geworden und war stehengeblieben. Der Unbekannte hatte seine rechte Hand erhoben und ihm die offene Handfläche gezeigt.
> Haben Sie einige Minuten Zeit für mich? <
Pierre sah ihn zuerst wortlos an, dann nickte er.
> Setzen Sie sich bitte. <
Pierre hatte am Ende der Bank Platz genommen, bereit jederzeit aufzuspringen.
> Sie sind Pierre Monard, Fischer. Sie haben zwei Kinder und lassen gerade Ihr Boot überholen. Finanziell kommen Sie gerade so über die Runden und wenn es Ihnen möglich ist, unterstützen Sie Ihre Kinder mit kleinen Geldbeträgen. <
Er hatte eine Pause gemacht. Pierre war neugierig gewesen, aber auch ein wenig wütend.
Was wollte dieser Typ von ihm? Er war kein Penner und auch kein Schlägertyp. Ganz im Gegenteil, der Mann hatte ein angenehmes Äußeres, eine gepflegte Aussprache und war nicht aggressiv. Er wusste einiges über ihn, aber das wusste eigentlich jeder im Dorf.
Pierre hatte erst einmal geschwiegen und abgewartet.
> Ich möchte Ihnen ein Angebot unterbreiten. Sie können für mich drei oder vier Mal pro Jahr eine Kleinigkeit erledigen. Es ist nicht gefährlich und dauert auch nicht lange. Nach jeder Erledigung werde ich Sie gut bezahlen, sodass Sie ihre Kinder besser unterstützen können und diese sich intensiver ihrem Studium widmen können. Sie könnten sich auch Geld für ein neues Boot zurücklegen.
Es ist eine für mich überaus wichtige Tätigkeit und ich muss mich absolut auf Sie verlassen können. Ich verlange aber absolute Diskretion, kein Wort, kein einziges Wort über die Tätigkeit, an niemanden. Für jede einzelne Erledigung denke ich an eine Bezahlung in Höhe von zehntausend Euro. <
Er hatte wieder eine Pause gemacht und Pierre stillschweigend angesehen.
> Sie brauchen mir nicht sofort eine Antwort zu geben. Denken Sie über das Angebot nach. Ich werde Sie in einigen Tagen noch einmal fragen. Jetzt können Sie weiter nach Hause gehen. <
Pierre war aufgestanden und in Richtung seines Hauses weitergegangen.
Er hatte sich kein einziges Mal nach dem Unbekannten umgedreht. Aber seine Gedanken hatten gerast.
Was waren das für Erledigungen? War es etwas Gesetzwidriges? Einen derart hohen Betrag für die Erledigung einer Kleinigkeit? Würde er sich in Gefahr begeben oder vielleicht sogar seine Kinder in Gefahr bringen?
Der Unbekannte hatte eine mögliche Gefahr verneint. Andererseits könnte er das angebotene Geld sehr gut gebrauchen.
Er benötigte wirklich bald ein neues Boot, das alte würde trotz derzeitiger Überarbeitung nicht mehr lange zu verwenden sein. Außerdem hatte es wenig Sinn ständig Geld in ein altes und morsches Boot zu investieren, besser doch ein neues kaufen, das bis zum Ende seines Berufslebens halten würde und das er danach sogar noch verkaufen könnte.
Er hatte sein Haus erreicht, die Haustür aufgeschlossen, das Fenster seines Schlafzimmers geöffnet und war zu Bett gegangen. Seltsamerweise hatte er sofort einschlafen können, der Unbekannte hatte nicht in seinem Kopf herumgespukt.
Aber als er am nächsten Tag fortfuhr mit seinem Sohn den Rumpf seines Bootes von Muscheln, Seepocken und anderen Ablagerungen zu reinigen und abzuschleifen, um bald mit den Abdichtungsarbeiten und dem Anstrich beginnen zu können, kreisten seine Gedanken ununterbrochen um den nächtlichen Unbekannten und dessen Angebot.
Sein Sohn bemerkte seine geistige Abwesenheit und sprach ihn darauf an. Er begründete seine Gedankenlosigkeit mit seinen Überlegungen über das fortgeschrittene Alter und den Zustand des Bootes und mit seinem Vorsatz ein neues Boot zu kaufen. Sein Sohn akzeptierte diese Begründung und fragte nicht weiter nach.
Er erzählte ihm, dass er in Bordeaux ein nettes und hübsches Mädchen kennen gelernt hätte. Vielleicht würde er sie bei seinem nächsten Besuch mitbringen. Sie unterhielten sich über das Mädchen bis Pierres` Tochter das Mittagessen brachte. Sie setzten sich alle drei zum Essen an die Mole.
Danach arbeitete er mit seinem Sohn bis zum Anbruch der Dunkelheit. Gemeinsam kehrten sie dann zum Haus zurück.
Sein Sohn und seine Tochter informierten ihn, dass sie schon am nächsten Tag eine Rückfahrgelegenheit hätten. Er war traurig darüber, wieder allein zu sein und schloss beide in die Arme.
Am nächsten Morgen umarmte er sie und wollte sie nicht mehr loslassen bis ein bunt lackierter 2CV vor ihnen anhielt und beide einstiegen. Er sah ihnen nach, mit einer qualvollen Leere im Herzen. Anschließend arbeitete er an seinem Boot weiter.
Einige Tage später ging er wieder seiner Arbeit auf dem Fluss nach.
Er hatte den seltsamen Besucher schon fast vergessen, als dieser an seinem nächsten freien Abend wieder an der Bank auf ihn wartete.
Der Unbekannte trug diesmal verwaschene, aber saubere Jeans, keinen Hut und keinen Schal. Er hatte einen schwarzen Vollbart, der etwas seltsam und unnatürlich aussah und lange schwarze Haare, die überhaupt nicht zu dem schmalen Gesicht und seiner Gesichtsfarbe passten. Die Haare sahen aus wie die einer billigen Perücke und der Bart sah aus wie angeklebt, aber ganz ungeschickt. Das spielte aber keine Rolle.
> Setzen Sie sich bitte. Ich bin Ihnen noch einige nähere Erläuterungen schuldig. <
Er sah Pierre ein Weilchen durchdringend an. Dann nickte Pierre.
Sie unterhielten sich noch eine Weile und Pierre wurde immer unsicherer. Er erbat sich noch einige Tage Bedenkzeit, aber der Unbekannte bestand auf einer sofortigen Entscheidung.
Pierre stimmte schließlich zu. Trotzdem hatte er in den nächsten Tagen ein mulmiges Gefühl im Bauch.
2
Der dunkelgrüne Range Rover fuhr langsam bei strahlendem Sonnenschein von Bayonne aus die D 932 nach Süden. Der Fahrer hielt sich gewissenhaft an die Verkehrsregeln und vor allem an die Geschwindigkeitsbegrenzungen.
Er wechselte hinter Cambo-les-Bains auf die D 918, an der sich das Flüsschen Nive entlangschlängelte. Zeitweilig wurde die Straße von einer Eisenbahnlinie begleitet. Zweimal passierte der Fahrer einen Zug, einmal in seiner Fahrtrichtung, einmal entgegen seiner Fahrtrichtung. In St. Jean-Pied-de-Port bog er auf die D 933, Richtung Spanien ab.
Die Berge im Pyrenäenvorland wurden langsam höher. In dem Dorf Arnéguy überquerte er die Grenze nach Spanien. Grenzkontrollen gab es keine mehr, kein Grenzbeamter hielt ihn an und kontrollierte ihn.
Nach fast zwei Kilometern passierte er eine rechts der Straße stehende kleine Kapelle, bog nur wenige Meter dahinter nach rechts ab und folgte dem Hinweisschild „Mendimotz“.
Dreihundert Meter weiter bog er nach links, Richtung Süden, auf einen schmalen Waldweg ab, der in ein enges Tal führte, durch das ein kleiner, glasklarer Bach floss und das auf beiden Seiten von steil aufragenden Felswänden flankiert wurde.
Der lang andauernde Regen der vergangenen Tage hatte die Schlaglöcher auf dem Weg mit Wasser gefüllt und abschnittsweise tiefen Schlamm, vermischt mit Laub, Zweigen und Rindenstücken auf dem Weg hinterlassen. Die rechts und links des Weges stehenden hohen Bäume verhinderten, dass die inzwischen wieder scheinende Sonne das Wasser auf dem Weg schnell verdunsten ließ.
Der Weg stieg nur geringfügig an, so dass das Wasser auf dem Weg nur langsam abfließen konnte. Immer wieder konnte der Fahrer Reifenspuren im Schlamm entdecken, auf weicheren, sandigen und laubfreien Stellen, sowohl am rechten als auch am linken Wegrand.
Er musste den Allradantrieb zuschalten um eine kleine Lawine aus Schlamm und Geröll überqueren zu können, die den Weg gequert und sich teilweise darauf abgelagert hatte.
Insgeheim beglückwünschte sich der Fahrer, dass er seinen Geländewagen und nicht sein Cabriolet genommen hatte.
Dann begann der Weg langsam aber deutlich erkennbar anzusteigen, die Felswände rückten näher heran. Nur vereinzelt standen noch Kiefern, Lärchen oder Tannen und wenige Sträucher zwischen dem Weg und den Felswänden. Langsam fuhr er weiter.
Als er rechts neben dem Weg einige große Sommersteinpilze entdeckte, konnte er sich ein Lächeln nicht verkneifen. Er nahm sich vor auf dem Rückweg anzuhalten und die Pilze für eine Ergänzung seines Abendessens mitzunehmen.
Nach weiteren zwanzig Minuten langsamer Fahrt traten die Felswände plötzlich zurück und öffneten den Blick auf einen kleinen, vielleicht zweihundert Meter breiten und etwa achthundert Meter langen, ringsum bewaldeten Talkessel. Er hielt an.
Der kleine, längliche See, die grünen Wiesen und das Panorama der Berge, die sich auf der wellenlosen Oberfläche des Sees spiegelten, boten einen idyllischen Anblick. Dazu fügte sich auch das aus Naturstein erbaute, baufällig wirkende und trotzdem romantisch aussehende und mit Steinplatten gedeckte Haus ein, das an der Nordseite des Talkessels stand und an dem eine Abzweigung des Weges endete.
Der Weg selbst führte weiter in das Tal hinein.
Direkt hinter dem Haus plätscherte ein kleiner Bach, der sich am oberen Ende des Tales in den See ergoss.
Er legte wieder einen Gang ein und fuhr auf das Haus zu.
Die hölzernen Fensterläden an der Vorderfront waren alle geschlossen. Dort angekommen, fand er zwischen Haus und Bach eine kleine ebene Fläche, auf der bereits drei Autos parkten. Alle drei waren schmale, kurze Geländefahrzeuge, Fabrikat Suzuki, mit ihrem Allradantrieb bestens geeignet für die schmalen und steilen Wege im Gebirge.
Er stellte sein Auto direkt neben der Außenwand des Hauses ab und stieg aus. Ausgiebig reckte er sich, holte aus dem Kofferraum seines Autos einen übergroßen schwarzen Aktenkoffer und schloss sein Auto ab.
Langsam ging er auf die Eingangstür an der Vorderseite zu, in weitem Bogen von mehr als fünf Metern, wohl wissend, dass er durch die Schlitze in einem der geschlossenen Fensterläden beobachtet wurde.
Mit der rechten Faust klopfte er fünfmal kräftig an die rissige, hölzerne Eingangstür, wartete einen kleinen Moment und klopfte noch zweimal.
Rechts von ihm öffnete sich ganz kurz die Hälfte eines Fensterladens. Ein dunkler, im Schatten liegender Kopf erschien, musterte ihn für einen Moment und verschwand wieder. Der Fensterladen wurde geräuschlos geschlossen und verriegelt, das Geräusch des Riegels war jedoch klar zu vernehmen.