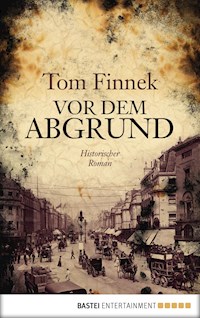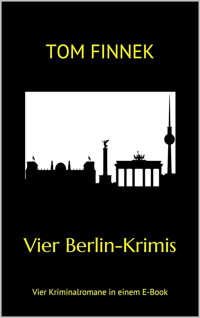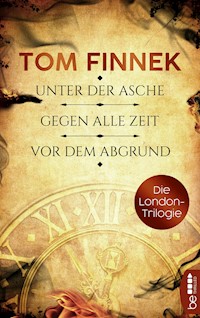3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Wir schreiben das Jahr 1535. Der Bischof von Münster hat die Stadt von den Wiedertäufern zurückerobert, und auch das Moordorf Ahlbeck, wo der Bauernsohn Ambros Vortkamp mit seinem Vater lebt, ist von dem Aufruhr nicht unberührt geblieben. Ein verwundeter Müller erscheint im Dorf und will die Wassermühle wieder aufbauen, die vor Jahren durch ein Feuer zerstört wurde. Während der junge Pfarrer die Gemeinde durch ketzerische Predigten gegen sich aufbringt und der Dorfschulze die Ankunft des Müllers mit Argwohn betrachtet, entdeckt Ambros ein fürchterliches Geheimnis, das die Geschichte der Mühle betrifft, über der angeblich ein Fluch liegt … Jahrhunderte später, im Jahr 1876, kommt der Altertumsforscher Hermann Vortkamp, ein Nachfahre des kleinen Ambros, nach Ahlbeck, um steinzeitliche Hügelgräber auszugraben. Als er der hübschen Schulzentochter Lisbeth begegnet, verliebt er sich Hals über Kopf und schlägt die Warnungen seines eigenwilligen Großonkels, des Geistersehers Johann, in den Wind. Die Gräber an der Kolkmühle und eine Krypta unter der Kirche warten mit Überraschungen und unerwarteten Leichen auf, und manche Spur führt zurück in die Zeit der Wiedertäufer ... - "Der Leser wird von der ersten Seite an in den Bann der Handlung gezogen. Der Spannungsbogen, der sich durch die Rahmenhandlung und die beiden Handlungsstränge bildet, wird bis zum Schluss gehalten. Das Buch ist an keiner Stelle langweilig oder langatmig, sondern sehr gute Unterhaltung." - Histo-Couch
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Tom Finnek
Teufelsmühle
Historischer Roman
Vom Fluch einer Mühle und der Feindschaft zweier Familien.Inhaltsverzeichnis
Die wichtigsten handelnden Personen
Prolog – Der braune Koffer
Erster Teil – Die Mühle am Kolk
Zweiter Teil – Der Spökenkieker
Dritter Teil – Der Blutanger
Vierter Teil – Die Moorhochzeit
Fünfter Teil – Der Täufer von Ahlbeck
Epilog – Der braune Koffer
Anmerkungen und Übersetzungen
Impressum
Die wichtigsten handelnden Personen
–
Im 16. Jahrhundert
- Ambros Vortkamp, Köttersohn und Schäferjunge
- Geert Vortkamp, sein Vater, ehemaliger Kolkmüller, »Molenkötter«
- Euphemia Vortkamp, geb. Sudema, Geerts Frau
- Lubbert Gerwing, Schulze und Landwehrmann, »Brookbauer«
- Josefa Gerwing, seine Frau
- Ludger Gerwing, der lallende Ludger, jüngster Schulzensohn
- Maria Johannvater, geb. Gerwing, Schulzentochter, »Johannvaterin«
- Hermann & Josef Gerwing, Schulzensöhne
- Guus ter Haer, niederländischer Müller, »Haermöller«
- Annelies ter Haer, geb. Gerwing, Guus’ Frau, Schwester des Schulzen
- Heinrich Vernholt, der neue Kolkmüller
- Johannes Boeckbinder, Pfarrer der Gemeinde »St. Katharina« zu Ahlbeck
- Simeon, Trödlerjude und Wucherer
- Antonius Dennekamp & Henk Schabbinck, ehemalige Kolkmüller
–
Im 19. Jahrhundert
- Hermann Vortkamp, Altertumsforscher
- Johann Vortkamp, sein Großonkel, Molenkötter und Spökenkieker
- Antonius Gerwing, Schulzenbauer, »Lanvermann«
- Elisabeth Gerwing, Lisbeth, jüngste von drei Schulzentöchtern
- Henk van Weyck, Lisbeths Verlobter
- Leo van Weyck, Henks Vater, holländischer Textilfabrikant
- Matthias Uppenkamp, Pastor der Gemeinde »St. Katharina«
- Jeremias Vogelsang, »Magisterbauer«
- Margret, Magd im Gasthof »Zur alten Linde«
- Jaap Netenkam, Hermanns Freund in Amsterdam
Prolog – Der braune Koffer
–
Vor etwas mehr als dreißig Jahren, im Sommer 1974, musste das alte Bauernhaus meiner Großeltern, Heinrich und Anna Vortkamp, dem Neubau einer Landstraße zwischen der münsterländischen Kreisstadt Altheim und dem niederländischen Enschede weichen. Das winzige und windschiefe Häuschen, das von allen im Dorf nur Molenkotten? genannt wurde, hatte mehrere hundert Jahre an dieser Stelle im Ahlbecker Bruch gestanden. Einige Heimatkundler behaupteten gar, bei dem Kotten handele es sich neben der gotischen Dorfkirche und der an der holländischen Grenze gelegenen Wassermühle um das älteste Gebäude des Dorfes. Alle Proteste, Petitionen und Leserbriefe an die lokalen Zeitungen nützten jedoch nichts. Das uralte backsteinerne Kötterhaus mit dem niedrigen Schindeldach, der kleinen Holzscheune nebenan und dem verrotteten Brunnen vor der Tür wurde niedergerissen und dem Erdboden gleichgemacht, ebenso wie das umliegende Moor trockengelegt und die Feuchtwiesen dräniert wurden. Nur eine knorrige alte Eiche neben der Landstraße, direkt am Abzweig zum Dorf Ahlbeck, deutet heute darauf hin, wo einst der Molenkotten zu finden war.
Meine Großeltern zogen in die nahe gelegene, in den fünfziger Jahren für die Vertriebenen gebaute Hölderlinsiedlung, wo sie jedoch wenig später, in kurzem Abstand zueinander, verstarben. Obwohl ich damals erst sechs Jahre alt war, habe ich noch sehr genaue Erinnerungen an den Bauernhof mit seinen niedrigen Decken, winzigen Butzenscheiben und rußgeschwärzten Wänden, und diese Erinnerungen sind unauslöschlich mit einem Koffer aus braunem Leder verbunden.
Heinrich Vortkamp, ein runzelhäutiger und gebückt gehender Mann von über achtzig Jahren, war ein begnadeter Geschichtenerzähler und ich ein ebenso fleißiger Zuhörer. Wenn ich sah, dass Opa Heinrich den braunen Handkoffer aus dem Schrank im Wohnzimmer holte und hinüber zu seinem Sessel schlurfte, dann setzte ich mich zu seinen Füßen auf den Boden und wartete gespannt. Der Koffer war randvoll gefüllt mit Papieren, Büchern und Bildern jeglicher Art, doch nie las mein Großvater aus den Aufzeichnungen vor und nicht ein einziges Mal gab er mir die Bilder in die Hand. Es schien eher, als benötigte er den braunen Koffer, um sich erinnern zu können. Er öffnete den Deckel, betrachtete den Inhalt wie einen geheimnisvollen Schatz, strich gedankenverloren und wehmütig mit den Fingern über die Fotografien und Zeichnungen und begann zu erzählen. Von der verfluchten Mühle und wie sie unsere Familie zerstört hat, von mörderischen Kolkmüllern und verbrecherischen Pfahlbürgern, von der vermaledeiten Landwehr und dem Landwehrmann, von den Geistern und Teufeln, die nicht ruhten und im Moor herumirrten, vom Schafottfeld und dem Galgenbülten.
Meine Mutter sah es gar nicht gern, wenn ihr Schwiegervater solch blutrünstige und unheimliche Geschichten vortrug, und protestierte: »Jetzt hör schon auf mit den alten Schauermärchen! Michael ist viel zu jung dafür.«
Doch Opa Heinrich ließ sich nicht beirren und antwortete: »Oh, nein, der Kleine versteht das schon, immerhin ist er ist ein Vortkamp. Nicht wahr, Michael?«
Ich hatte keine Ahnung, was ich verstand oder verstehen sollte, aber dass ich ein Vortkamp war, stand außer Frage. Und ich wusste, dass ich um nichts in der Welt auf Opas spannende Geschichten verzichten wollte, und so nickte ich eifrig. Dass ich anschließend schlaflose Nächte hatte und von Albträumen geplagt wurde, hielt mich nicht davon ab, beim nächsten Besuch auf dem Molenkotten meinen Opa anzuflehen: »Bitte erzähl von der Mühle am Kolk!«
Nach dem zwangsweisen Umzug meiner Großeltern in die Hölderlinsiedlung habe ich den braunen Handkoffer nicht wiedergesehen, an seinem üblichen Platz im Wohnzimmerschrank war er jedenfalls nicht, und mein Großvater hat nie wieder von der Mühle erzählt. Er verstummte, zog sich zurück, saß regungslos in seinem Lehnstuhl und vergreiste zusehends. Nur ein halbes Jahr später starb er an einer Lungenentzündung. Es schien beinahe so, als hätte man ihn wie einen alten Baum samt Wurzeln aus der Erde gerissen und in einen viel zu kleinen Topf gepflanzt, wo er augenblicklich verdorrt war. Opa Heinrich war mit dem Molenkotten und der umgebenden Scholle, wie er es nannte, auf eine heute kaum noch begreifliche Weise verbunden gewesen. Er war in dem Häuschen geboren worden und hatte hier sterben wollen, doch nach seiner Umsiedlung lebte er als Vertriebener unter Vertriebenen, wie er seufzend sagte. »Das Schicksal der Vortkamps!«, murmelte er immer wieder und nickte bedächtig. »Der Fluch der Familie.«
Oma Anna konnte oder wollte nach Opas Tod über den Verbleib des Koffers nichts berichten, schüttelte lediglich den Kopf, wenn ich sie danach fragte, und starb ein Jahr nach ihrem Mann an einer eigentlich harmlosen Blutvergiftung. Beide liegen auf dem Ahlbecker Friedhof begraben, umgeben von einigen der Namen, die mir aus Opas Erzählungen so vertraut sind. Von seinen gruseligen Geschichten ist mir das meiste in der Zwischenzeit entfallen oder hat nur als schemenhafte Erinnerung in meinem Kopf überlebt. Dass ich nun dennoch in der Lage bin, die Geschichte der Kolkmühle im vorliegenden Buch zu erzählen, verdanke ich einem bloßen Zufall. Opa Heinrich hätte es vermutlich Schicksal oder Bestimmung genannt.
Vor zwei Jahren, am Karsamstag, unternahm ich mit meinem Vater eine Radtour durch die Gegend. Es war der erste sonnige Tag nach wochenlangem Regenwetter, und wir beschlossen, auf einen Kaffee in die Kolkmühle einzukehren, die inzwischen zum Ausflugslokal samt Mühlenmuseum umgebaut worden war. Da der Ahlbach Hochwasser führte und an einigen Stellen bereits über die Ufer getreten war, hatte der Pächter der Mühle die Umflutschleusen geöffnet, um das Mühlenwehr vor dem enormen Druck des Wassers zu schützen. Als wir die Mühle verließen und über das Wehr fuhren, schaute ich gebannt auf die Wassermassen, die aus den Schleusen schossen, auf das große eiserne Rad, das sich ächzend drehte und im Inneren der frisch renovierten Mühle einen modernen Stromgenerator antrieb. Und plötzlich hatte ich den Einfall, den Molenkotten zu besuchen.
»Den Molenkotten?«, wunderte sich mein Vater.
»Ich war seit Jahren nicht mehr da«, antwortete ich.
»Aber da gibt es nichts zu sehen.«
»Es ist kein großer Umweg«, sagte ich und trat in die Pedale.
Das war es tatsächlich nicht, nur etwa zwei Kilometer radelten wir über Wirtschafts- und Feldwege, passierten den ehemaligen Hessenweg, ließen den Galgenbülten, der vom Ahlbecker Heimatverein vor kurzem wieder an Ort und Stelle aufgebaut worden war, links liegen, sahen zur Rechten den heute eher unscheinbaren Hof des ehemaligen Landwehrmanns und standen kurze Zeit später an dem Landstraßenabzweig mit der alten Eiche. Mein Vater hatte recht, nichts erinnerte an den Kotten. Das ehemals leicht hügelige Gebiet war eingeebnet worden und wurde heute als Weideland benutzt. Dennoch stieg ich vom Rad und ging in Richtung der Eiche.
»Was machst du denn, Michael?«, rief mein Vater hinter mir. »Das Land ist mistnass. Du versaust dir nur die Kleider.«
Auch damit hatte er recht. Der Boden hatte sich wie ein Schwamm voll gesogen, an einigen Stellen hatten sich regelrechte Lachen auf dem morastigen Untergrund gebildet. Die Trockenlegung der Moore, die in den Siebzigern als Fortschritt gefeiert worden war, hatte sich inzwischen als bedauerlicher Fehler entpuppt und war zum Teil rückgängig gemacht worden. Zwar würde es im Ahlbecker Bruch nie wieder das unwegsame Hochmoor von einst geben, aber zumindest entstanden abermals Feuchtwiesen und dienten den Brachvögeln, Sumpfschnepfen und Kiebitzen als Brutstätten.
Ich hatte inzwischen die knorrige Eiche erreicht, versuchte mich zu orientieren und schaute zu der Stelle, an der früher der Kotten meiner Großeltern gestanden hatte, als ich eine seltsame Mulde in der Erde entdeckte. Etwa zehn Meter von der Eiche entfernt war eine Stelle des Bodens nicht mit Gras bewachsen, der prasselnde Regen der letzten Wochen hatte offensichtlich etwas freigelegt, was mit Mutterboden bedeckt gewesen war.
»Der alte Brunnen«, sagte mein Vater, der nun doch vom Rad gestiegen war und sich zu mir gesellt hatte. »Das muss der Brunnen sein.«
Wie wir feststellten, hatte man sich vor dreißig Jahren nicht die Mühe gemacht, den Brunnen komplett abzubauen und zuzuschütten, sondern hatte lediglich das Mauerwerk oberhalb der Erde abgerissen, das Loch im Boden mit einer Metallplatte verschlossen und diese mit Mutterboden bedeckt. Nun aber lag die Platte frei, der Boden hatte sich ringsum abgesenkt, und an einer Stelle war das übrig gebliebene Mauerwerk des Brunnens zu sehen. Ohne lange darüber nachzudenken, stapfte ich zu dem Brunnen, versank bis über die Knöchel im Schlamm und zerrte an der Eisenplatte. Zwar bewegte sie sich und war nicht mit einem Schloss versehen, aber allein war ich nicht in der Lage, sie anzuheben.
»Nun hilf mir schon!«, rief ich meinem Vater zu.
»Mutter wird schimpfen«, murmelte er, krempelte sich die Hosenbeine hoch und fasste mit an.
Tatsächlich konnten wir die schwere Metallplatte hochheben und zur Seite schieben, und als wir in den Brunnen sahen, erlebten wir eine Überraschung. Da das Grundwasser so hoch stand, war der Brunnenschacht, dessen Mauerwerk noch völlig intakt zu sein schien, bis zum Rand gefüllt. Und auf dem braunen, schlammigen Wasser schwamm eine blaue Mülltüte.
»Oh, mein Gott!«, rief mein Vater, der Böses ahnte.
Ich bückte mich hinunter und zog die Tüte heraus. Sie war nicht besonders schwer und dem Anschein nach kaum mit Wasser voll gelaufen. Als wir die doppelt verknotete Tüte öffneten, fanden wir darin eine weitere, ebenfalls sorgsam verschlossene Plastiktüte. Diese war aus schwerer, schwarzer Plane, wie man sie zum Abdichten eines Fischteichs benutzt, und in der Tüte fanden wir schließlich den seit dreißig Jahren verschollenen braunen Handkoffer meines Großvaters.
Oft habe ich mich seitdem gefragt, wieso Opa Heinrich den Koffer in den Brunnen geworfen hat und ob er es womöglich selbst gewesen war, der den Brunnen auf beschriebene Weise »versteckt« hatte. Der Koffer war sein Allerheiligstes, sein Gedächtnis, die Geschichte seiner Familie. Warum hatte er ihn nicht seinem ältestem Sohn vermacht oder seinem kleinen Enkelkind, das so gespannt den Geschichten aus vergangenen Zeiten gelauscht hatte? Vielleicht glaubte er, mit dem Abriss des Molenkottens sei auch die Geschichte der Familie Vortkamp beendet. Wenn er schon nicht selbst auf der Scholle beerdigt werden konnte, so sollte wenigstens sein Vermächtnis dort ruhen. Womöglich handelte es sich aber auch nur die unvernünftige Laune eines schrulligen alten Mannes, der sich von der Welt und seinen Angehörigen verraten und verkauft fühlte.
Wie dem auch sei, der Koffer war auf wundersame Weise wieder aufgetaucht und zum ersten Mal hatte ich die Gelegenheit, in den Papieren zu stöbern und mir die Bilder anzuschauen. Einige Fotografien zeigten meinen Großvater und seine Frau als junge Kötterbauern, auf Schützenfesten oder am heimischen Herd. Auf anderen Fotos war Heinrich Vortkamp als kleiner Junge mit seinem Vater und den Geschwistern vor dem Kotten zu sehen. Ein sehr altes, leicht unscharfes Porträt zeigte eine mir unbekannte junge Frau mit schwarzen Locken und sommersprossigem Gesicht. »Für meinen lieben Freund Hermann«, stand in altdeutscher Handschrift auf dem unteren rechten Rand geschrieben. Darunter der Buchstabe »L«. Dieses Foto war mittels einer Schleife mit einem alten Glasnegativ verbunden, wie man es in den ersten Jahren der Fotografie benutzte. Darauf war ein junger Mann zu sehen, der vor einem Steinhügel posierte und eine Art Forke in der Hand hielt. Neben den Bildern befanden sich auch zahlreiche Briefe in dem Koffer, sie waren allesamt mit dem Namen Hermann Vortkamp unterzeichnet und stammten aus den siebziger Jahren des neunzehnten Jahrhunderts. Verfasser der Briefe war offensichtlich mein Ur-Ur-Großvater, von dem auch eine Art Kladde vorhanden war, die er als Tage- und Notizbuch verwendet hatte. Rechnungen, Inventarlisten, Zeitungsartikel und Landkarten aus dieser Zeit befanden sich ebenfalls in dem Koffer.
Doch die Papiere und Aufzeichnungen reichten viel weiter in die Vergangenheit zurück. Ich fand Urkunden aus dem sechzehnten Jahrhundert, Gesindelisten und Stammbäume sowie lose, mit merkwürdigen Zeichen bekritzelte Zettel, die beinahe zu Staub zerfielen, wenn man sie berührte. Mehrmals las ich das Kürzel »DWWF« und verschiedene Zitate aus der Bibel. Außerdem Kohlezeichnungen und Kupferstiche mit Ansichten des Dorfes, der Kolkmühle und des Molenkottens, die laut Signatur mehr als vierhundert Jahre alt waren. Und zu guter Letzt stieß ich auf ein abgegriffenes, in Leder gebundenes Oktavbüchlein, das mit krakeligen, fast kindlich wirkenden Großbuchstaben beschrieben war und mit den Worten endete: »Ambros Vortkamp, Ahlbeck im Holzmonat des Jahres 1536«.
Schon beim ersten Betrachten des Kofferinhalts war mir klar, dass ich einen regelrechten Schatz gefunden hatte. Wie durch ein Wunder hatte das Wasser den Papieren nichts anhaben können, die anscheinend wasserdichte und säurefeste Plane hatte die Dokumente und Fotos vor der Zerstörung bewahrt. Einige der auf den Papieren beschriebenen Ereignisse, Geschichten und Personen kannte ich aus den Erzählungen meines Großvaters. Doch schon bald stellte sich heraus, dass Opa Heinrich nur einen Teil der Wahrheit in seinen unheimlichen Geschichten verarbeitet hatte, dass er einiges mit gutem Grund verschwiegen hatte. Manches war mir neu und vieles erschien mir beinahe unglaubwürdig. Ich stöberte in der Ahlbecker Pfarrchronik und blätterte in alten Kirchenfolianten, um das Bild, das sich aus den Aufzeichnungen ergab, abzurunden und fand in groben Zügen bestätigt, was ich im braunen Koffer entdeckt hatte.
Vieles ist schon über die Mühle am Kolk gesagt und geschrieben worden, Schauergeschichten und Spukmärchen wurden von Generation zu Generation weitergegeben, im Volksmund erhielt die Mühle Namen wie »Haarmühle« oder »Teufelsmühle«, ein ganzer Roman ist über den Überfall holländischer Räuber im Jahre 1814 geschrieben worden, doch die Ereignisse, die auf den folgenden Seiten zu lesen sein werden, sind bislang nicht erzählt worden. Dies ist nicht nur die Geschichte der Kolkmühle, sondern auch die der Familie Vortkamp und des Molenkottens. An einigen Stellen, an denen die Aufzeichnungen und Tagebücher nicht genügend oder nur vage Aufschluss über die tatsächlichen Ereignisse geben, habe ich die Lücken mit Mutmaßungen und Spekulationen gefüllt. Ich behaupte also nicht, dass alles genauso geschehen ist, wie ich es hier beschreibe, und in jedem Detail der Wahrheit entspricht, aber ich glaube, dass es sich so oder ähnlich zugetragen haben könnte.
Michael Vortkamp, im Mai 2006
Erster Teil – Die Mühle am Kolk
–
»Der Münsterländer ist überhaupt sehr abergläubisch, sein Aberglaube aber so harmlos wie er selber. Von Zauberkünsten weiß er nichts, von Hexen und bösen Geistern wenig, obwohl er sich sehr vor dem Teufel fürchtet.«
Annette von Droste-Hülshoff, »Bilder aus Westfalen«
–
Erstes Kapitel
Führt durchs Moor und zu den Überresten einer Mühle
Es war im Erntemonat des Jahres 1535, an einem lauen Sommerabend. Obwohl die Sonne tief und dunkelrot über dem Horizont stand und ein aufkommender Westwind über das Moorland und den nahe gelegenen Schwarzerlenwald wehte, war es immer noch angenehm warm im Ahlbecker Bruch. Vor einem kleinen, backsteinernen Kotten mit niedrigem, schindelgedeckten Dach saß ein Junge von etwa zehn Jahren im Schatten einer Eiche, schnitzte an einem Stück Wurzelholz und pfiff gedankenverloren eine monotone Melodie. Neben ihm lag ein schwarzer Holländerhund mit zotteligem Fell, das an der Schnauze bereits ergraut war.
Die Arbeit des Tages war getan, seit den frühen Morgenstunden war der Junge mit den Schafen in der Heide gewesen und hatte sie am Abend in der Hürde in der Nähe des Galgenbültens eingesperrt. Auch die Kuh war gemolken, und die beiden Schweine hatten ihr Futter erhalten. Der Vater war wie immer keine große Hilfe gewesen, er lag schnarchend im Alkoven neben dem Herd und schlief seinen Rausch aus. Das war auch besser so, dachte der Junge, denn wenn der Alte Wacholderschnaps getrunken hatte, war er unausstehlich, schrie wie besessen und schlug ohne Grund um sich. Eigentlich war er auch unausstehlich, wenn er keinen Schnaps getrunken hatte. Der Junge schloss die Augen und fuhr sich mit der Hand über das sonnengebräunte und sommersprossige Gesicht, als spürte er noch die Ohrfeigen auf seinen Wangen. Die flachsblonden Haare standen ihm wie struppige Borsten vom Kopf ab, seine spitze, mit Staub und Schweiß verschmierte Nase und die buschigen, dunkelblonden Augenbrauen gaben ihm ein keckes, beinahe wildes Aussehen. Gekleidet war der Junge in Hose und Hemd aus grobem Sackleinen, beides zerrissen und vor Dreck strotzend. Auch die nackten Füße waren fast schwarz und vermutlich seit Wochen nicht mit sauberem Wasser in Berührung gekommen.
Plötzlich schlug der Junge die Augen auf und schaute zum Sandweg, der sich unweit des Kottens durch Venn und Bruchwald schlängelte und in nordwestlicher Richtung zur holländischen Grenze führte. Es schien, als hätte er etwas gehört oder instinktiv gespürt. Auch der Hund hob den Kopf und knurrte leise. Der Junge blickte nach Süden, in Richtung Ahlbeck, und tatsächlich erkannte er einen Einspänner, einen kleinen Kutschwagen ohne Verdeck, der sich dem Kotten näherte. Der Junge schaute skeptisch und zog die Augenbrauen zusammen, was ihm ein noch wilderes Aussehen verlieh. Reisekutschen waren in dieser Gegend so gut wie nie zu sehen, zwar führte der Weg zur Grenze, endete aber an der Landwehr, die das Bistum Münster von der niederländischen Provinz Overijssel trennte. Der holprige und schmale Weg wurde nur von den umliegenden Bauern und Köttern benutzt, aber niemand von diesen besaß oder benutzte eine Reisekutsche. Diesen begegnete man nur auf dem Hessenweg, der alten Handelsstraße, die die Hansestadt Münster mit der holländischen Messestadt Deventer verband. Nur dort, unweit des Schulzenhofes, gab es einen Durchlass durch die Landwehr.
Der Wagen hatte sich inzwischen bis auf wenige Schritte genähert, und der Junge erkannte eine schwarze, männliche Gestalt auf dem Kutschbock. Der Mann war nach Patrizierart gekleidet, er trug eine Schaube, einen knielangen, weiten Mantelrock mit breitem Kragen und geschlitzten Öffnungen für die Arme, darunter ein steifes Wams und auf dem Kopf ein Barett, alles von schwarzer oder dunkelbrauner Farbe, ohne jegliche Verzierung oder Ausschmückung und für die heiße Jahreszeit gänzlich unpassend.
»Heda, Bursche!«, rief der Mann und winkte den Jungen zu sich.
Dieser reckte zwar den Kopf, bewegte sich jedoch nicht von der Stelle.
»Wie komme ich zur Ahlbecker Mühle?«, fragte der Fremde.
»Da seid Ihr hier falsch, Herr«, antwortete der Junge.
»Das habe ich mir bereits gedacht. Deswegen frage ich ja. Kannst du mir den Weg weisen? Kennst du die Wassermühle?«
Statt einer Antwort fing der Junge krächzend an zu lachen, es klang nicht wirklich belustigt, eher bitter und zugleich überrascht.
»Was gibt’s denn da zu lachen?«, erboste sich der Schwarzgekleidete.
»Das ist eine lange Geschichte, Herr«, antwortete der Junge mürrisch.
Der Mann wartete vergeblich auf eine Erklärung, sprang schließlich vom Kutschbock und ging zum Kotten. Er baute sich vor dem Jungen auf, stemmte die rechte Hand in die Seite und wiederholte seine Frage.
Der Hund knurrte.
»Aus!«, befahl der Junge, der nun aufgestanden war und den Fremden misstrauisch beäugte. Der Mann war etwa vierzig Jahre alt, recht groß und hatte dunkelbraunes Haar, das ein für die Sommerzeit viel zu bleiches Gesicht umrahmte und bis zu den Schultern reichte. Außerdem fiel dem Jungen auf, dass der Mann den linken Arm unter der Schaube versteckt hielt, nur der rechte ragte aus der seitlichen Öffnung.
»Die Mühle ist vor Jahren abgebrannt«, sagte der Junge schließlich. »Es ist bloß eine Ruine übrig. Alles verkohlt.«
»Ich weiß«, erwiderte der Mann. »Deswegen bin ich hier.«
Die hellblauen Augen des Jungen leuchteten neugierig, er reckte das Kinn vor, schwieg jedoch und nickte bedächtig.
»Wie ist dein Name?«, fragte der Mann.
»Ambros Vortkamp, Herr«, sagte der Junge.
»Ambros? Das ist ein seltener Name in der hiesigen Gegend.«
»Meine Mutter war keine Hiesige.«
»Kann ich sie sprechen?«
»Sie ist tot.«
Der Mann senkte den Kopf und fragte: »Und dein Vater?«
»Hm«, machte Ambros, fuhr sich über die geschwollene Wange und sagte: »Das ist keine gute Idee. Dann müsste ich ihn wecken.«
»Willst du dir einen Schilling verdienen?«
Erneut leuchteten die Augen des Jungen für einen kurzen Moment, doch sofort verzog er wieder die Schnute und schüttelte den Kopf. »Der Hof«, sagte er, »der Vater schläft. Das Vieh und so. Und der Hund natürlich. Wenn Ihr versteht, was ich meine.«
Der Mann schien die verworrenen Worte durchaus zu verstehen und erwiderte: »Zwei Schillinge.«
Ambros grinste unmerklich, zuckte mit den Schultern und sagte: »Der alte Trunkenbold wird schon noch ein paar Stunden schlafen. Also meinetwegen.«
»Du solltest nicht so abfällig über deinen Vater reden«, tadelte ihn der Mann. »Ehren sollst du Vater und Mutter, so steht es in der Heiligen Schrift.«
»Die Mutter ist tot, und der Vater macht’s auch nicht mehr lang«, antwortete der Junge. »Ich red, wie’s mir passt. Wenn es Euch nicht gefällt, könnt Ihr ja die Mühle auf eigene Faust suchen. Im Dunkeln wünsch ich Euch viel Spaß dabei. Ihr wärt nicht der erste, der aus dem Moor nicht mehr herausfindet.« Er ging an dem Mann vorbei und betrachtete den Wagen. Das rechte Rad saß schräg auf der Achse, außerdem fehlten zwei Speichen. Ambros runzelte die Stirn, stieg auf den Kutschbock und befahl dem Hund, der freudig aufgesprungen war: »Du bleibst hier, Müntzer!« Der Hund kniff den Schwanz ein und trollte sich.
»Müntzer?«, wunderte sich der Schwarzgekleidete, setzte sich neben den Jungen und nahm die Zügel. »Ein seltsamer Name für einen Hund.«
»Vater hat ihm den Namen gegeben. Nach dem Bauernführer. Er meint, das wird die Pfaffen ärgern.«
»Da mag er wohl recht haben«, murmelte der Fremde. Er rümpfte die Nase, als nähme er einen strengen Geruch wahr, und schaute den Jungen skeptisch an. »Stinkst du so?«
»Das sind die Schafe«, sagte Ambros und grinste. »Wenn’s Euch nicht passt, könnt Ihr …«
»Ja, ja«, unterbrach ihn der Fremde. »Also, wohin?«
»Eigentlich müsstet Ihr zurück ins Dorf und dort auf den Hessenweg, aber das dauert zu lange«, antwortete Ambros und hielt dem Mann die offene Handfläche fordernd unter die Nase. »Ich kenne eine Abkürzung. Wenn Ihr Euch beeilt, schaffen wir es vor Sonnenuntergang.«
Der Mann kramte an seinem Gürtel nach dem ledernen Geldbeutel, öffnete ihn umständlich mit der rechten Hand und holte einige Münzen heraus. Ambros erkannte große und wie neu glänzende Silbertaler. Wenn er sich nicht irrte, war auf der Vorderseite das Wappen des Bischofs zu sehen: ein achtzackiger Stern im Schild. Es waren die größten Silbermünzen, die der Junge bisher zu Gesicht bekommen hatte. Silbertaler waren sehr selten in der Gegend, üblicherweise wurde im Münsterland mit Gulden gerechnet und bezahlt. Schließlich hatte der Fremde die Kleinmünzen gefunden und gab dem Jungen die versprochenen Schillinge. Wieder fiel Ambros auf, dass der Mann die linke Hand nicht benutzte, und er fragte sich, ob der Mann vielleicht nur einen Arm hatte. Und ob er die viel zu warme Schaube womöglich nur trug, um seine Versehrtheit zu verbergen.
»Wie willst du anschließend zurückkommen?«, fragte der Fremde. »Hast du kein Pferd?«
Wieder lachte der Junge bitter, rieb sich die Nase, drehte den gefundenen Dreck zwischen zwei Fingern und raunzte: »Versoffen hat er den Gaul!« Er deutete mit der Hand nach Westen und sagte: »Da lang!«
»Bist du sicher?«, antwortete der Mann.
»Wenn nicht ich, dann niemand.« Ambros verschränkte die Arme vor der Brust und lächelte. »Kein Mensch kennt das Moor so gut wie ich«, fügte er prahlerisch hinzu, trat dem Pferd in die Flanke und rief: »Hü!«
Hinter ihnen bellte der Hund. Es klang ein wenig beleidigt.
Die Sonne berührte mittlerweile die Wipfel der Schwarzerlen. Die Kutsche fuhr auf dem sich merklich verengenden und zunehmend holprig werdenden Sandweg in Richtung Grenze. Links und rechts des Weges befand sich nichts als morastige Brache. Das von Torfmoosen und Wollgras bewachsene Hochmoor erstreckte sich über viele Morgen. Umgeben war das niedrig bewachsene und fast baumlose Moor vom Bruchwald, dem sie sich nun näherten und in dem das Grundwasser so hoch stand, dass sich zwischen den Erlen und Birken große Lachen bildeten. Weder der Junge noch der Fremde sprachen ein Wort, aus dem Wald erschallte das rollende Schnurren eines Ziegenmelkers, hin und wieder schlug Ambros nach den Mücken, die sich in riesigen Schwärmen auf sie stürzten. Dem Mann jedoch schienen die Blutsauger nichts auszumachen, oder er war nicht in der Lage, nach ihnen zu schlagen, da er genug damit zu tun hatte, mit nur einer Hand das Pferd und den Wagen auf dem Weg zu halten. Als sie nach einer Viertelstunde den etwa mannshohen und doppelten Wall der Landwehr einen Steinwurf weit entfernt ausmachten, rief Ambros plötzlich: »Har!«
»Har?«, wunderte sich der Mann.
»Nach links, Herr!«
»Ich weiß, was har bedeutet«, erwiderte der Fremde und schaute erstaunt zur Seite, wo der Bruchwald dicht und düster stand. »Aber hier gibt es keinen Weg.«
»Im Frühjahr hättet Ihr sicherlich recht«, antwortete der Junge. »Dann würden wir nach wenigen Schritten im Morast feststecken, aber im Sommer geht’s.«
»Das rechte Rad des Wagens ist lose«, sagte der Mann.
»Das hab ich schon bemerkt«, erwiderte Ambros, »aber es wird gehen, wenn Ihr vorsichtig fahrt.«
Der Mann zögerte kurz, lenkte dann den Wagen nach links und schlug dem sich sträubenden Pferd mit den Zügeln aufs Hinterteil. Der Rappe machte einen Satz nach vorn, die Kutsche schwankte, und dem Mann schlug der Ast einer Birke gegen die linke Seite. Schmerzerfüllt schrie er auf, ließ die Zügel fahren und hielt sich die Schulter.
»Seid Ihr verletzt, Herr?«, fragte Ambros.
»Das hat dich nicht zu kümmern!«, fauchte der Mann. Schweiß stand auf seiner Stirn, und mit gepresster Stimme fügte er hinzu: »Rotzlöffel!«
»Es kümmert mich nicht«, antwortete der Junge verstockt. »Aber vielleicht wäre es einfacher, Ihr würdet Euch nach hinten setzen und mir die Zügel geben. Ich bin ein guter Kutscher, und im Moor kennt sich niemand …«
»Meinetwegen«, knurrte der Fremde, reichte Ambros die Zügel und kletterte nach hinten. »Aber mach keine Dummheiten, Bengel!«
»Zu Befehl, Euer Gnaden!« Ambros grüßte militärisch, strahlte übers ganze Gesicht und legte die beiden Schillinge, die er die ganze Zeit in der Hand gehalten hatte, unter den Kutschbock. Einen Geldbeutel besaß er nicht, wozu auch? Dann rief er dem Pferd zu: »Hü, Alter! Braver Kerl!«
Mit erstaunlicher Geschicklichkeit und sichtbar guter Laune lenkte der Junge die Kutsche durch das Dickicht, machte Bögen um unsichtbare Schlammlöcher, redete dem Pferd gut zu, streichelte dessen Hinterteil und lenkte es mehr mit Worten und Händen als mit den Zügeln. Nicht ein einziges Mal scheute das Tier, auch als eine schwarze Kreuzotter sich zischelnd über den Weg schlängelte, wurde das Pferd nur kurz unruhig. Ambros kommentierte alles voll freudiger Erregung, unterhielt sich mit den trällernden Wiesenpiepern und Blaukehlchen, als könnten sie ihn verstehen. Nur der Mann hinter ihm schwieg beharrlich und starrte ins Nichts. Nach einer weiteren Viertelstunde hatten sie das Ende des Waldes und die ersten Ausläufer der Heide erreicht. Wieder änderte sich die Umgebung auffallend, der Boden wurde sandig und hügelig und war mit Rosmarinheide, Wacholder und Ginster bewachsen. Da die Sonne inzwischen untergegangen war, wirkten die üppigen Sträucher und Büsche wie schwarze Riesen, die sich ihnen in den Weg stellten. Doch das zunehmend dämmrige Licht schien Ambros nicht zu beunruhigen, vermutlich hätte er den Weg auch mit verbundenen Augen gefunden. Er fuhr in Schlangenlinien um die mehr als mannshohen Sanddünen herum, fand Durchlässe, wo das ungeübte Auge nur Dornengestrüpp und Heidedickicht sah, und drehte sich schließlich zu dem Mann in der Kutsche um.
»Gleich sind wir da«, sagte er und deutete nach links, »seht Ihr den Galgen?«
Der Mann schaute in die gewiesene Richtung, erkannte das Holzgerüst, das auf einem Hügel stand und den umliegenden Bruchwald überragte, und nickte.
»Dort ist der Hessenweg«, fuhr Ambros fort und klopfte dem Rappen aufs Hinterteil. »Und auf der anderen Seite führt ein Weg zur Mühle.«
Kurze Zeit später hatten sie den breiten und befestigten Handelsweg erreicht, und der Fremde atmete erleichtert auf. Er fuhr sich über die schweißnasse Stirn, was Ambros wunderte, denn die Hitze hatte merklich nachgelassen und der Wind zugenommen. Sie standen nun direkt an der Landwehr, die an dieser Stelle einen Durchlass bot, aber mit einem Schlagbaum versperrt war. Ein riesiges Vorhängeschloss sorgte dafür, dass kein Wagen die Grenze passieren konnte. Nur Fußgänger und einzelne Reiter konnten die Landwehr durch eine kleine Pforte passieren.
»Den Schlüssel hat der Landwehrmann«, erklärte Ambros, der mit seinen Augen dem Blick des Mannes gefolgt war. »Aber er öffnet die Schranke nur gegen eine Maut.«
»Wer ist der Landwehrmann?«
»Der Schulze.«
»Und wie heißt dieser Schulze?«
»Lubbert Gerwing«, antwortete der Junge, »sein Hof ist gleich dort drüben, hinter dem Galgenbülten. Im Dorf nennen Sie ihn ›Brookbauer‹, weil er mitten im Bruchwald wohnt. Wenn Ihr genau hinseht, Herr, könnt Ihr das Licht durch die Bäume sehen. Sein Hof ist der größte weit und breit.«
Wieder nickte der Mann, schaute jedoch nicht zum Schulzenhof, sondern befahl: »Weiter!« Seine Stimme klang nun leise und zittrig.
Auf halbem Wege zwischen Landwehr und Galgen führte ein schmaler, aber ebenfalls befestigter und von Buchen bestandener Pfad in südlicher Richtung zur Kolkmühle. Ihren Namen hatte die Mühle nach einem Moortümpel, dem so genannten Kolk, der unweit des Ahlbachs lag und dessen abgestandenes, fauliges Wasser schwarz wie Pechkohle war. Es war mittlerweile so dunkel, dass die Gebäude zwischen den Bäumen kaum auszumachen waren. Erst als die Kutsche das unversehrte Mühlenwehr oberhalb der Umflutschleuse überquerte, konnte Ambros die Ruine der Wassermühle und das verwahrloste Wohnhaus des Müllers im fahlen Licht des beinahe vollen Mondes erkennen. Wie oft hatte ihm sein Vater von der Mühle erzählt, aber da er meistens betrunken gewesen war, wusste Ambros nicht, ob er den Tiraden des Vaters glauben durfte. Dennoch lief ihm ein Schauer über den Rücken, und ein pochender Schmerz fuhr ihm in die Schläfen, wie jedes Mal, wenn er die Überreste der Kolkmühle sah. Denn dies war der Ort, an dem seine Mutter ums Leben gekommen war.
»Oh, Herr Jesus!«, rief der Fremde beim Anblick der rußgeschwärzten Mühle und stieg schwerfällig aus der Kutsche. »Was für eine Schande!« Er ging zu dem backsteinernen Gemäuer, das wie ein hohler Zahn aus dem Mühlwehr herausragte. Zwar war das Fundament, das aus großen Sandsteinquadern gemauert war, noch intakt, doch der Rest der Mühle war in sich zusammengesackt. Hinter den fenster- und türlosen Backsteinmauern, die auf dem Fundament ruhten, befand sich nichts als gähnende Leere, Moder und Asche. Das Dach und die hölzernen Decken waren eingestürzt, nur einige verkohlte Balken und die aus dem Schutt ragenden Mühlsteine auf dem Grund der Mühle deuteten darauf hin, dass hier einst mehrere Mahlgänge in Betrieb gewesen waren. Auch das große äußere Mühlrad war nicht mehr an Ort und Stelle, die eiserne Antriebswelle ragte wie ein Stumpf aus dem Keller der Mühle. Die Ruine war ein trostloser und gespenstischer Anblick. Da die Schleusen geöffnet waren und sich der Ahlbach somit nicht zum Mühlteich staute, wirkte das mächtige, weit aus dem Wasser ragende Mühlenwehr völlig deplatziert und überdimensioniert. Wie ein schlechter Scherz seines Erbauers.
»Warum fragst du eigentlich nicht, was du fragen willst?«, wandte sich der Fremde flüsternd an Ambros und nahm das Barett vom Kopf.
»Was, Herr?«, antwortete der Junge und glaubte im Mondlicht zu erkennen, dass die Haare des Mannes klitschnass waren. Und in dem fahlen Licht sah das Gesicht des Fremden noch blasser aus.
»Du wunderst dich, wer ich bin«, sagte der Mann, »und was ich an diesem garstigen Ort will, ist es nicht so?«
Ambros zuckte mit den Schultern.
»Mein Name ist Heinrich Vernholt. Ich bin der neue Pächter der Mühle.« Da der Junge nicht reagierte, setzte der Mann hinzu: »Der Bischof hat mich beauftragt, die Mühle zu reparieren und wieder in Betrieb zu nehmen.«
»Der neue Müller?«, entgegnete Ambros nach einer Weile und kratzte sich den Schädel. »So seht Ihr gar nicht aus. Ich hätte Euch eher für einen Amtmann oder Prediger gehalten. Kennt Ihr Bischof Franz persönlich?«
Der Fremde zuckte unmerklich zusammen, als hätte er wieder Schmerzen in der Schulter, doch bevor er auf die Bemerkung des Jungen eingehen konnte, wurde er durch ein seltsames, kratzendes Geräusch abgelenkt. Auch Ambros hatte es gehört und zunächst für den nächtlichen Lockruf eines Ziegenmelkers gehalten. Doch dann gewahrte er, dass das Geräusch aus dem unweit der Mühle gelegenen Müllerhaus kam. Es klang rasselnd und schnarrend und war viel zu laut für einen Vogel.
»Was ist das?«, fragte Vernholt.
»Vermutlich Wildschweine«, antwortete Ambros, nahm einen abgestorbenen Ast zur Hand und näherte sich dem Haus. »Wölfe und Luchse grunzen nicht.«
»Wölfe?«, erwiderte Vernholt und ging hinter der Kutsche in Deckung.
Und das will ein Müller sein?, dachte Ambros kopfschüttelnd. Bislang hatte er Männer dieses Berufes nur als verwegene, rauflustige und draufgängerische Kerle kennengelernt. Wie die letzten beiden Müller. Oder sein Vater vor ihnen. Früher einmal. Heinrich Vernholt jedoch erschien ihm beinahe weibisch in Gehabe und Aussehen. Er mochte der neue Pächter der Mühle sein, ein waschechter Müller war er nicht.
Ambros hatte sich dem Haus mittlerweile bis auf wenige Schritte genähert, das Geräusch hatte noch zugenommen, es kam aus dem links vom Eingang gelegenen Raum, der einst als Wohnstube gedient hatte. Der Junge schaute durch das Fenster, in dem schon lange weder Glas noch Rahmen waren, konnte jedoch in der Dunkelheit nichts erkennen. Keine Umrisse, keine Bewegung. Dennoch ließ er den Knüttel sinken und lächelte erleichtert. Er hatte erkannt, dass es sich bei dem Geräusch um menschliches Schnarchen handelte, und er wusste auch, von wem es stammte. »Aufwachen, Ludger, sonst sag ich’s deinem Vater!«, rief er und schlug mit dem Ast gegen die Wand. »Rauskommen, sonst setzt es was!«
Sofort verstummte das Schnarchen, ein kurzer krächzender Schrei folgte, dann völlige Stille. Nach wenigen Sekunden bewegte sich etwas, Stroh raschelte, eine Bohle knarrte, und im nächsten Moment schoss ein kleiner Junge wie ein Blitz zur Tür hinaus. Ambros, der mit diesem Verhalten gerechnet zu haben schien, stellte dem Jungen ein Bein, dass dieser kopfüber hinfiel, wie ein Käfer auf dem Rücken zu liegen kam, mit den Beinen strampelte, sich aber nur im Kreis drehte und nicht vom Fleck rührte. Der Junge, den Ambros mit Ludger angesprochen hatte, war einen Kopf kleiner als er und höchstens acht Jahre alt. Doch davon abgesehen glich er Ambros auffallend, er hatte die gleichen strubbeligen, verfilzten Haare, ein ähnlich dreckiges Gesicht, ebenso schwarze Füße und trug gleichfalls zerrissene Kleidung. Er hätte sein jüngerer Bruder sein können.
»Bist wieder ausgerissen, was?«, fragte Ambros und half dem Kleinen auf die Beine. »Oder hat der Alte dich vom Hof gejagt?«
»Lah, lah, lah«, machte der Junge und zog eine Grimasse.
Ludger Gerwing, »der lallende Ludger«, wie ihn die Ahlbecker wegen seines unverständlichen Gebrabbels nannten, war der jüngste Sohn des Brookbauern. Ein harmloser Schwachkopf, sagten die Leute und lachten über ihn. Eine Strafe Gottes nannte ihn sein Vater, der Schulze. Da es die Mühe nicht wert war, sich mit dem hirnlosen Idioten zu befassen, ließ der Brookbauer ihn wie einen Köter herumstreunen, gab ihm morgens und abends zu essen und prügelte ihn, wenn er der göttlichen Strafe überdrüssig war. Sonst jedoch konnte Ludger tun und lassen, was er wollte. Er ging wintertags nicht wie die anderen Söhne der Erbbauern in die Schule (er hätte ohnehin nichts begriffen), er half im Sommer nicht auf den Feldern (von Hilfe hätte man nicht reden können), er schlief auf dem Heuboden oder im Pferdestall und lungerte die übrige Zeit in der Gegend herum. Wie ein wildes Tier. Ambros sah ihn häufig in der Heide und ließ ihn sogar dann und wann neben sich Platz nehmen. Ludger verstand jedes Wort, und manchmal hatte Ambros den Eindruck, der Schwachkopf sei nicht ganz so verrückt, wie alle Leute glaubten. Er konnte nicht reden, weil seine Zunge ein winziger Stummel war. Deshalb gab er auch im Schlaf die seltsam rasselnden Geräusche von sich. Außerdem klaffte in seinem Oberkiefer eine Lücke, und die Oberlippe war doppelt gespalten, wie bei einem Hasen. Vielleicht war dies der Grund, warum sämtliche Hunde des Dorfes sich zähnefletschend auf ihn stürzten, sobald sie ihn sahen oder rochen. Nur Müntzer ließ ihn in Ruhe, denn der war lammfromm und ließ sich weder von Mensch noch Tier von seinen Pflichten als Schafhütehund ablenken.
»Ab nach Hause!«, befahl Ambros und gab Ludger einen freundschaftlichen Klaps auf den Rücken. »Alles in Ordnung, Meister Vernholt«, wandte er sich an den Müller, »es ist nur der lallende Ludger.« Doch der Schwarzgekleidete war verschwunden, zumindest stand er nicht mehr hinter der Kutsche. »Was für ein Feigling!«, lachte Ambros leise.
»Aah aah«, machte Ludger, scharrte mit den Füßen, zupfte an Ambros’ Ärmel und deutete zur Kutsche.
Jetzt sah auch Ambros, was den Jungen so erregt hatte. Der reglose Körper des Fremden lag neben der Kutsche auf dem Boden. Ambros lief zu dem Müller und stellte erstaunt fest, dass er in Ohnmacht gefallen war. Der Junge lachte zunächst, doch als er den Mann an den Schultern fasste, um ihn wachzurütteln, bemerkte er, dass die Schaube an der linken Schulter durchnässt war. Ambros betrachtete seine Hand im Mondlicht, roch daran und erkannte, dass sie blutverschmiert war.
»Jesses!«, rief er und horchte an der Brust des Müllers. Das Herz schlug, aber der Brustkorb hob und senkte sich nicht. Der Atem ging flach und kaum spürbar.
»Ist Maria zu Hause?«, rief er Ludger zu.
Der Junge antwortete mit einer verstörten Grimasse.
»Ja oder nein?!«
Ludger nickte und zuckte dann mit den Schultern.
»Los!«, befahl Ambros und packte den Müller am Oberkörper. »Nimm du die Beine. Wir legen ihn in den Wagen. Und dann bringen wir ihn zu deiner Schwester. Vielleicht kann die ihm helfen.«
Ludger schaute alarmierte drein, schüttelte den Kopf, half Ambros aber dennoch, den schweren Körper auf den Rücksitz der Kutsche zu hieven. Ambros sprang auf den Kutschbock und zog den sich vergebens wehrenden Ludger mit sich. Wenige Sekunden später war der Wagen auf dem Hessenweg, unterwegs zum Hof des Brookbauern.
–
Zweites Kapitel
Handelt von zwei gestohlenen Schillingen und einem geheimen Auftrag
Obwohl der Schulzenhof von dichtem Bruchwald umgeben war, überragte das Dach des Bauernhauses die Baumwipfel um etliche Klafter und war weithin sichtbar. Der gesamte Hof stand auf einer Warft, einem aufgeworfenen Erdhügel, und war mit einem Entwässerungsgraben umgeben. Eine breite hölzerne Brücke verband den Hof mit der Zufahrt zum Hessenweg. Der Bauernhof lag so einsam und abgeschieden, wie es sich nur denken ließ, ringsum nichts als Wald und Moor, die Grenze nicht weit, der Galgenbülten gleich nebenan. Ambros schauderte es, als er die Kutsche über den sich schlängelnden Pfad lenkte und nun an der Brücke anlangte. Die Lichter, die er noch vor einer halben Stunde von der Landwehr aus gesehen hatte, waren inzwischen erloschen. Nichts regte sich auf dem Hof, gespenstische Stille, die nur vom Ruf einer Eule und dem Knarren der Bohlen unter den Kutschenrädern gestört wurde. Ambros lenkte die Kutsche auf den zentralen Platz unter der alten Linde, die majestätisch in der Mitte thronte.
»Hol deine Schwester!«, befahl Ambros und stieß Ludger, der sich nicht vom Fleck rühren wollte, mit einem Fußtritt vom Kutschbock.
Der stumme Junge landete wie eine Katze auf den Füßen, rannte im Zickzack über den Platz und verschwand durch einen Nebeneingang im Haus des Bauern, einem typisch westfälischen Hallenhaus, unter dessen mächtigem Dach Mensch und Tier gemeinsam lebten. Das Haus war im Fachwerkstil errichtet, das reetgedeckte Dach reichte an den Seiten beinahe bis zum Boden, und das Tor an der Stirnseite des Gebäudes war so breit und hoch, dass eine fuderhohe Wagenladung spielend hindurchpasste. Umgeben war das Bauernhaus von kleineren Gebäuden, einem Stall für die Schweine, einem Häuschen für die Hühner und einer zusätzlichen Scheune für Futter und Gerätschaften. Der Hof des Schulzen war auch der einzige in Ahlbeck, der ein eigenes Gesindehaus hatte. Aus dem winzigen und windschiefen Häuschen, das sich direkt neben der Brücke befand, trat nun ein großer, stämmiger Mann und rief: »Heda, was gibt’s? Was wollt Ihr?« Der Mann kam schlurfend näher, gähnte mehrmals, erkannte den Jungen auf dem Bock und sagte: »Ach, du bist’s, Ambros. Was führt dich her? Was ist das für eine Kutsche?«
»Guten Abend, Bernhard«, antwortete Ambros, winkte dem Stallknecht zu und verkündete stolz: »Ich bringe einen Verwundeten.«
Im selben Moment war der Brookbauer mit seiner Tochter Maria aus dem Bauernhaus getreten, in der einen Hand hielt er eine rußende Fackel, mit der anderen zog er den sich sträubenden Ludger am Ohr hinter sich her. »Was ist das für ein Radau?«, rief er und wollte Maria, die nur mit einem Nachthemd und einem Mantel bekleidet war, zurück ins Haus schicken. Doch Maria hatte Ambros’ Worte gehört, kümmerte sich nicht um den tobenden Vater, lief zur Kutsche und kletterte in den Fond.
»Was fällt dir ein, hier mitten in der Nacht einen solchen Lärm zu machen?«, rief der Brookbauer und trat seinem Sohn ins Hinterteil. »Und du da!« Er fuchtelte mit der Fackel herum und deutete auf Ambros. »Scher dich zum Teufel!«
Ambros betrachtete den Bauern wie einen bösen Waldgeist. Lubbert Gerwing war ein riesiger Kerl, weit über sechs Fuß groß und von enormem Umfang. Seine Oberschenkel waren so dick wie Ambros’ Brustkorb, so kam es dem Jungen zumindest vor. Noch nie war er dem Schulzen so nah gewesen. Er kannte ihn aus der Kirche oder von den öffentlichen Gerichtsverhandlungen, die in unregelmäßigen Abständen auf dem Schulzenhof abgehalten wurden, aber stets hatte er ihn nur aus der Ferne und in vollem Ornat gesehen. Jetzt stand der Brookbauer direkt vor ihm, nur in Hose und Hemd, sein mächtiger Bart reichte ihm bis auf die Brust, das lichter werdende Haupthaar hatte er zum Zopf gebunden. In der Eile hatte der Bauer vergessen, eine Mütze aufzusetzen, und vielleicht war Ambros nur deshalb so perplex, weil er den Schulzen zum ersten Mal barhäuptig sah.
»Der Mann blutet stark«, sagte Maria, die sich inzwischen um den immer noch bewusstlosen Vernholt kümmerte. »Wir müssen ihn ins Haus schaffen. Hilf mir, Bernhard! Und du, setz den Kessel auf!«, wandte sie sich an ihren Bruder.
»Nichts da!«, polterte der Bauer und packte Ludger wie ein Kaninchen am Genick. »Ihr bringt mir kein Gesindel ins Haus. Weiß der Henker, was mit dem Kerl los ist. Geht uns auch nichts an. Der bleibt, wo er ist!«
»Er sieht nicht wie Gesindel aus«, erwiderte Maria.
»Der Mann heißt Vernholt, er ist der neue Pächter der Mühle«, sagte Ambros, die Augen immer noch starr auf den Schulzen gerichtet. »Der Bischof schickt ihn, die Kolkmühle wieder aufzubauen. Vernholt ist an der Mühle zusammengebrochen. Wie vom Teufel niedergestreckt.«
Gerwing zuckte einen Moment zusammen, ließ seinen Sohn los und deutete mit der Fackel auf die Kutsche. »Der Bischof?«, fragte er. »Bist du sicher?«
Ambros zuckte mit den Schultern und nickte dann.
»Was ist mit ihm geschehen? Warum blutet er?«
»Die Mühle ist verhext«, antwortete Ambros, stieg vom Kutschbock und nickte bedeutsam. »Sie bringt jedem Müller Unglück, weil sie verflucht ist. Das sagt Vater immer. Und der muss es ja wissen.«
»Dein Alter ist ein verdammter Säufer!«, schnauzte der Schulze, stieg in die Kutsche, reichte Maria die Fackel und nahm den Müller wie ein Kind auf beide Arme. »Was starrt ihr so?«, rief er und trug Vernholt zum Haus. »Der Mann braucht Hilfe. Bernhard, fach die Glut in der Lucht an! Und schaff Heu heran, damit wir ihn irgendwo hinlegen können! Was glotzt ihr denn wie die Ölgötzen?«
Maria sprang vom Wagen, lief zum Haus, öffnete ihrem Vater eine kleine Pforte neben dem Haupttor und ließ auch Bernhard und Ludger hinein. Da niemand ihn daran hinderte, betrat Ambros hinter ihnen das Haus. Obwohl die Tenne nur von der einen Fackel erleuchtet wurde, erkannte er die riesigen Ausmaße der seitlichen Stallungen und des Dreschplatzes in der Mitte. Mächtige Eichenbalken durchquerten die Tenne, mannsdicke Pfeiler warfen düstere Schatten, große steinerne Tröge standen vor den Holzverschlägen, in denen jedoch sommertags kein Vieh stand. Am Ende der Diele befand sich der vom Bauer und seiner Familie bewohnte Flett, und direkt davor, unter einer Öffnung in der Decke, sah Ambros die Lucht, eine Art Wohn- und Schlafstelle für das Hausgesinde, mit einem offenen Herd in der Mitte.
Zwei Männer hatten dort auf Strohsäcken neben einem alten, ausgedienten Bauernschrank gelegen, standen nun verschlafen vor dem niedrigen Seiteneingang, durch den Ludger vorhin das Haus betreten hatte, und warteten auf weitere Befehle des Bauern. Lubbert Gerwing bettete den Bewusstlosen auf einen der Strohsäcke, während Bernhard das Feuer anfachte, einer der Hausknechte Wasser holte und Maria dem Verwundeten die Schaube und das Wams mit einem Messer aufschnitt.
Die Schulzentochter war erst sechzehn Jahre alt und bereits Witwe. Vor zwei Jahren hatte sie den Altheimer Wundarzt Johannvater geheiratet, doch den hatte nur wenige Monate später der schwarze Tod geholt. Da die Verwandten des Medicus die junge Frau für den Tod verantwortlich machten und sie für eine Unglück bringende Kräuterhexe hielten, kehrte die Witwe nur ein halbes Jahr nach der Hochzeit auf den väterlichen Hof zurück. Ambros wusste nicht, ob sie während ihrer Ehe das wundheilende Handwerk gelernt hatte, aber da sie die Witwe eines Arztes war, hatte er an der Mühle sofort an die Johannvaterin gedacht. Schließlich war der Altheimer Arzt auch deshalb auf Maria aufmerksam geworden, weil diese in dem Ruf stand, ein Kräuterweib zu sein. Genau wie ihre vor Jahren verstorbene Mutter, die Brookbäuerin. Außerdem war Maria eine schöne Frau, die mit Abstand schönste Frau, die Ambros in seinem ganzen Leben gesehen hatte. Nur die andere Maria auf dem alten Gemälde, das er sonntags in der Ahlbecker Kirche immerzu anstarrte, war ähnlich schön. Aber das zählte vermutlich nicht, denn die war schließlich eine Heilige und die Mutter eines Gottes obendrein.
»Was suchst du hier?«, wurde der Junge aus seinen Gedanken gerissen. Der Brookbauer stand breitbeinig vor ihm, hatte die Arme in die Seite gestemmt und setzte knurrend hinzu: »Scher dich weg, Bengel!«
»Jawohl, Herr!«, rief Ambros erschrocken, duckte sich und rannte durch die Seitentür nach draußen. Beinahe wäre er mit dem Hausknecht zusammengestoßen, der mit einem Eimer Wasser zur Tür hereinkam. Durch ein kleines Fenster warf Ambros einen letzten Blick ins Innere und sah die Johannvaterin, die mit einem feuchten Lappen die Wunde an der Schulter des Müllers reinigte. Ambros zog den Rotz hoch, spuckte verächtlich auf den Boden und schlich sich an der Hauswand entlang zum Platz unter der Linde. Gerade als er den verwaisten Hof betreten wollte, trat der Schulze aus dem Haus und ging schnurstracks zur Kutsche. Er betrachtete das rechte Rad mit den fehlenden Speichen und wackelte daran. Dann schaute er unter die Sitze, durchsuchte die Gepäckablage und fand schließlich unter dem Kutschbock, was er gesucht hatte: die lederne Reisetasche des Fremden. Er öffnete sie, kramte darin herum, schien jedoch in dem fahlen Mondlicht nichts erkennen zu können und zog sie unter dem Sitz hervor. Er stutzte einen Augenblick, fasste erneut unter den Kutschbock, steckte etwas in seine Hosentasche und verschwand dann samt Reisetasche im Haus.
Ambros fuhr ein Schreck in die Glieder, er riss die Augen auf und hielt sich die Hand vor den Mund: die beiden Schillinge! Sie lagen immer noch unter dem Kutschbock, in all der Eile und Aufregung hatte er sie völlig vergessen. Er lief zur Kutsche, sprang auf den Bock und suchte nach den Münzen. Vergeblich. Sie waren nicht mehr da. Der Schulze hatte sie eingesteckt.
»Krr, krr«, machte ein Kolkrabe auf dem Reetdach.
Ambros hätte vor Wut und Enttäuschung weinen mögen. Er ballte die Faust, und tatsächlich lief ihm eine Träne über die verdreckte Wange.
»Krr, krr«, wiederholte der Rabe. Und dann: »Ksch, ksch.«
Ambros stutzte, drehte sich um und grinste. Der Kolkrabe hieß Ludger, und er saß nicht auf dem Dach, sondern stand in einer kleinen Tür im Vordergiebel des Hauses und deutete auf eine Leiter, die neben dem Haupttor an die Wand gelehnt war. Ambros verstand und nickte. Er wischte sich mit dem Ärmel über die Wange, rümpfte die Nase und lief zum Haus. Er stellte die Leiter unter die Giebelöffnung, vergewisserte sich, dass ihn niemand sah, und stieg hinauf. Als er oben angekommen war, zog ihn Ludger zu sich, schloss die Tür und legte den Zeigefinger auf Ambros’ Lippen. Dieser nickte erneut und schaute sich auf dem Dachboden um.
Der gesamte Balken war bis unters Dach mit Heu und dem vor wenigen Wochen geernteten Roggen gefüllt. An den kleinen Gängen und Tunneln, die sich durch Gras und Getreide zogen, erkannte Ambros, dass Ludger nicht zum ersten Mal hier oben war. Der Kleine deutete mit dem Finger zur Flettseite des Hauses und kroch voran. Obwohl Ambros nur unwesentlich größer als der Schulzensohn war, hatte er Schwierigkeiten, dem anderen durch die winzigen Löcher und Durchlässe zu folgen. Als Ludger sich das nächste Mal zu Ambros umdrehte und ihm mit der Hand »Halt!« gebot, befanden sich die beiden Jungen direkt über der Lucht. Durch die Öffnung im Boden konnte Ambros den verwundeten Müller auf seinem Lager erkennen. Die Johannvaterin beugte sich über den Kessel, rührte in dem köchelnden Sud und tunkte ein Leinentuch hinein, das sie anschließend dem Mann um die Schulter band. Den Schulzen konnte Ambros nicht sehen, aber er hörte das Rascheln von Papier und das missfällige Grummeln des Brookbauern.
»Der verdammte Lausebengel hat recht«, murmelte der Bauer und trat an die Herdstelle, sodass Ambros in seinem Versteck ihn beobachten konnte. In der Hand hielt er einen Siegelbrief, und einen kurzen Moment lang schien es, als wollte er das Papier ins Feuer werfen.
»Welcher Lausebengel?«, fragte Maria abwesend.
»Der Junge vom Molenkötter«, antwortete ihr Vater. »Er hat nicht gelogen. Der Mann heißt Heinrich Vernholt, und dieses Schreiben stammt von Franz von Waldeck und ist mit dem bischöflichen Siegel versehen.« Er hielt Maria das Papier unter die Nase, die jedoch nur mit den Schultern zuckte. Sie wischte dem Bewusstlosen mit einem Tuch über die schweißnasse Stirn.
»Aber verstehst du denn nicht?«, fauchte der Brookbauer. »Der Bischof schickt einen neuen Müller. Begreifst du nicht, was das heißt?«
»Durchaus«, erwiderte Maria, »irgendwann musste es wohl passieren. Es ist sein Land und seine Mühle. Warum sollte er es nicht nutzen? Nur weil er in den letzten Jahren keine Zeit hatte, sich darum zu kümmern?«
»Pah!«, stieß Gerwing ärgerlich hervor. »Wird der Kerl überleben?«
»Er hat viel Blut verloren, und die Wunde ist entzündet«, sagte Maria und säuberte ein Messer mit dem Sud aus dem Kessel. »Aber die Kräuter werden den Eiter herausziehen, und wenn ich ihn zur Ader gelassen habe und er eine Nacht geschlafen hat, dann wird er es schon schaffen.«
»Leg dich nicht zu sehr ins Zeug«, brummte der Vater und steckte das Schreiben hinters Hemd. »Tot nützt er uns mehr als lebendig.«
»Vater!«, empörte sich Maria und schnitt dem Müller mit dem Messer in die Armbeuge, dass das Blut in einem dicken Strom herausquoll. »Versündige dich nicht! So redet kein Christenmensch.«
»Ach was!«, knurrte der Schulze. »Was ist das überhaupt für eine Verletzung? Sah mir verdammt nach einer Schnittwunde aus.«
»Die Verletzung ist schon einige Wochen alt«, sagte die Tochter, ließ das Blut rinnen und band dann den blutenden Arm mit einem Seil ab. »Die Wunde ist sehr tief und nur teilweise verheilt. Sie scheint wieder aufgebrochen zu sein. Ich schätze, sie stammt von einem Messer oder einem Degenhieb. Außerdem sind zwei Rippen gebrochen. Vermutlich eine Kampfverletzung.«
»Ein Rad seines Wagens ist kaputt, vielleicht hatte er einen Unfall. Seltsamer Müller«, knurrte Gerwing kopfschüttelnd, machte plötzlich eine Kehrtwende und schritt aus Ambros’ Blickfeld. »Bernhard!«, schallte es über die Tenne. »Sattle das Pferd!«
»Das Pferd, Herr?«, hörte Ambros die erstaunte Stimme des Knechts.
»Hörst du schlecht? Den Schimmel, verdammt, aber hurtig!«
»Jawohl, Herr!«
Schritte entfernten sich, eine Tür quietschte in den Angeln. Dann knallte es laut. »Wer hat denn die verfluchte Leiter hier hingestellt?«, schimpfte Bernhard. Wieder schepperte es. »Weg damit!« Dann war es still.
Ambros wollte Ludger bereits bedeuten, dass die Leiter verschwunden war und sie nun in der Falle saßen, als plötzlich die Treppe knarrte, die zur Galerie über dem Flett führte. Dort, oberhalb der Wohnstube, befanden sich die Schlafkammern der Herrschaft, nur wenige Schritte von der Stelle entfernt, an der Ludger und Ambros im Heu lagen. Da es jedoch auf dem Dachboden finster war und der Schulze kein Licht bei sich hatte, konnte er die reglos daliegenden Jungen nicht in ihrem Versteck erkennen. Er kam schwerfällig die Treppe hinauf, ging die Galerie entlang, lehnte sich über das Geländer und schaute ein letztes Mal zu dem verletzten Müller auf dem Tennenboden. Mit einem unverständlichen Fluch verschwand er in einer der Kammern.
Ambros schaute sich Hilfe suchend auf dem Dachboden um, doch außer der kleinen Tür über dem Tennentor, der Öffnung über der Lucht und der Treppe zur Galerie gab es keinen weiteren Fluchtweg. Das dachte er zumindest, bis Ludger ihn am Ärmel zupfte und zur Seite deutete. Ambros sah in die gewiesene Richtung, gewahrte aber nichts als Heuballen und Getreidegarben. Ludger winkte ihm zu, schlüpfte durch ein unsichtbares Loch und war verschwunden. Ambros folgte ihm, kroch durchs Heu und erkannte, dass der Kleine eine Bohle im Boden zur Seite geschoben hatte und an einem Pfeiler nach unten geklettert war. Er befand sich nun in einem der seitlichen Kuhställe. Ambros sah außerdem, dass der Stützpfeiler mit winzigen angenagelten Sprossen versehen war, die auf den ersten Blick kaum auffielen. Und wieder dachte der Junge, dass der lallende Ludger bei weitem nicht so dumm sein konnte, wie die Leute glaubten. Ambros kletterte hinunter und schaute durch den Holzverschlag zur Tenne, wo der Schulze in diesem Moment in Joppe und Stiefeln erschien und sich einen breiten Schlapphut aufsetzte.
»Wo willst du hin?«, fragte Maria.
»Ich werde Guus Bescheid geben«, lautete die Antwort des Bauern. »Schließlich geht es um seine Mühle.«
»An der du nicht schlecht verdienst«, antwortete die Tochter.
»Wir sind immerhin eine Familie«, knurrte Gerwing und stapfte in großen Schritten über die Tenne. »Was treibt ihr euch denn da rum?«
Ambros zuckte zusammen, weil er glaubte, der Schulze habe ihn und Ludger entdeckt, doch die Frage galt den beiden Hausknechten, die beschäftigungslos auf der Tenne herumlungerten.
»Wo sollen wir schlafen?«, fragte einer der Knechte.
»Wo ihr immer schlaft.«
»Aber der Fremde.«
»Was ist mit ihm?«
»Er ist uns nicht geheuer, Herr.«
»Abergläubisches Pack!«, fauchte der Brookbauer. »Wie die Weibsbilder. Dann schert euch gefälligst ins Gesindehaus oder schlaft im Pferdestall! Morgen ist ein langer Tag!« Plötzlich wandte er sich zu seiner Tochter um und rief: »Und du! Leg dich schlafen, Maria! Man kann es mit der christlichen Nächstenliebe auch übertreiben.«
»Im Moment kann ich ohnehin nichts weiter tun«, antwortete sie.
Während ihr Vater wutschnaubend über die Tenne schritt und die beiden Hausknechte vor sich herscheuchte, schaute Maria nachdenklich zu dem Bewusstlosen, der im Fieber delirierte und leise stöhnende Geräusche von sich gab. Sie schüttelte unmerklich den Kopf und murmelte: »Heinrich Vernholt.« Dann schnaufte sie abfällig, wandte plötzlich den Kopf zur Seite und rief: »Und ihr beiden könnt auch herauskommen!«
Ambros schaute sich auf der Tenne um, aber außer ihm und Ludger war niemand mehr anwesend. Die beiden älteren Söhne des Schulzen schliefen in ihren Kammern oder trieben sich wie so häufig in der Heideschänke herum, und auch vom Gesinde war niemand zu sehen. Draußen waren die Hufschläge des Schimmels zu hören, der Schulze ritt galoppierend vom Hof.
»Na, wird’s bald, Ludger!«
»Kch, kch«, machte der Schulzensohn und kletterte über den Bretterverschlag.
Ambros folgte ihm und trat mit gesenktem Kopf auf die Tenne.
»Was soll das Versteckspiel, du Nichtsnutz?« Maria empfing ihren kleinen Bruder mit einer Maulschelle und holte bereits ein zweites Mal aus, um auch Ambros eine Backpfeife zu geben, als sie durch ein leises, kaum vernehmbares Flüstern unterbrochen wurde.
»Wo … bin … ich?«
Heinrich Vernholt war aus seiner Ohnmacht erwacht und tastete mit der rechten Hand um sich. Er versuchte, sich auf dem Ellbogen abzustützen, war aber zu schwach und blieb schließlich liegen. Wispernd wiederholte er seine Frage.
»Ihr seid beim Ahlbecker Schulzen«, sagte die Johannvaterin, beugte sich über den Mann, hob vorsichtig seinen Kopf und gab ihm aus einem Holzbecher Wasser zu trinken. »Ihr seid ohnmächtig geworden, der Molenköttersohn hat Euch gebracht. Könnt Ihr Euch erinnern, dass Ihr mit ihm an der Mühle wart?«
Vernholt nickte zaghaft und fragte: »Und Ihr?«
»Ich bin Maria, die Tochter des Schulzen.«
»Sie hat Eure Wunde verbunden«, mischte sich Ambros in das Gespräch ein.
»Danke, gute Frau«, sagte Vernholt schwach und hob abwehrend die Hand, als Maria ihm erneut den Becher an den Mund setzen wollte. Er atmete tief aus, blickte angestrengt zur Decke, als wollte er sich auf irgendetwas besinnen, und flüsterte dann: »Ich muss mit dem Jungen sprechen.«
»Ihr braucht Schlaf«, antwortete Maria.
»Ich muss mit Ambros sprechen«, wiederholte der Mann.
Die Schulzentochter schaute überrascht und, wie es Ambros schien, ein wenig beleidigt drein, zuckte mit den Schultern und trat zur Seite.
Ambros blieb an Ort und Stelle stehen und fragte: »Herr?«
»Näher«, murmelte Vernholt, hob die rechte Hand und krümmte den Zeigefinger. Ambros trat heran und kniete nieder, damit der Mann ihm ins Ohr flüstern konnte.
»Kann ich dir trauen?«, fragte Vernholt.
»Mir schon«, antwortete Ambros und zog die Stirn kraus.
»Und wem nicht?«
Der Junge schaute sich nach der mürrisch dreinschauenden Johannvaterin und dem lallenden Ludger um und hob die Achseln. Schließlich flüsterte er: »Nehmt Euch vor dem Vater in Acht.«
»Warum?«
»Er ist der Landwehrmann«, antwortete Ambros geheimnisvoll.
»Du bist ein seltsamer Bursche«, erwiderte der Mann.
Das sagte sein Vater auch immer, dachte Ambros, allerdings nicht in so harmlosen Worten. Und wenn selbst ein Wildfremder dies auf Anhieb erkannte, dann musste es wohl stimmen. Er sagte: »Ja, Herr.«
»Kennst du Pastor Boeckbinder?«
Diese Frage war so dumm, dass Ambros nicht glaubte, darauf antworten zu müssen. Er grinste nur.
Vernholt griff in eine Tasche, die außen an seinem Wams angebracht war, und holte eine kupferne Münze hervor, die er dem Jungen in die Hand drückte.
»Gib dies dem Pastor und sag ihm, was passiert ist!«
Ambros betrachtete die Kupfermünze und erkannte, dass weder Bild noch Wappen darauf zu sehen waren, nur Buchstaben auf beiden Seiten. Es war also kein Geldstück, sondern eine Art Medaille.
Vernholt hob warnend die Hand und sagte: »Du musst mir versprechen, es nicht zu lesen.«
Der Junge lachte. »Ich kann überhaupt nicht lesen«, rief er und verstaute die Medaille in seinem Hosenbund. Und wie einem eigenen Gedanken nachhängend, sagte er plötzlich: »Der Brookbauer hat die beiden Schillinge gestohlen.«
Vernholt lächelte und erwiderte: »Wenn du verlässlich bist, werde ich es dir in Silber lohnen. Aber zu keiner Menschenseele ein Wort!«
»Ihr könnt Euch auf mich verlassen, Meister. Soll ich gleich gehen?«
»Morgen in aller Frühe«, murmelte der Müller, seufzte tief, krümmte sich unter Schmerzen und schloss die Augen.
»Das reicht!«, fuhr die Johannvaterin dazwischen. »Der Mann braucht Ruhe. Es ist jetzt keine Zeit für Geheimniskrämerei.« Sie war sichtlich schlecht gelaunt, zog Ambros an den Ohren und scheuchte ihn fort: »Mach dich davon, Junge! Erst muss der Müller gesund werden, dann könnt ihr Sachen aushecken.« Dabei schaute sie auf Ambros’ Hosenbund.
Der Junge starrte sie lange an. So wütend und außer sich, wie sie momentan war, erschien Maria ihm noch schöner als sonst. Schöner sogar als die Mutter Gottes. Als sie jedoch erneut zu einer Ohrfeige ausholte, sprang er zur Seite und rannte wie ein Hase davon. Er lief durch die Seitentür hinaus, überquerte den Hof, stieß beinahe mit Bernhard zusammen, der neugierig die Kutsche des Müllers in Augenschein nahm, erreichte die Brücke und lief durch den Bruchwald. Erst als er den Hessenweg erreicht hatte, hielt er an, schaute sich um und vergewisserte sich, dass die Medaille noch im Hosenbund steckte.
»Morgen in aller Frühe«, wiederholte er die Worte des Müllers.
–
Drittes Kapitel
Stellt ein krummes Haus, einen strengen Priester und einen alten Griesgram vor