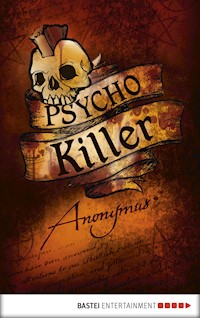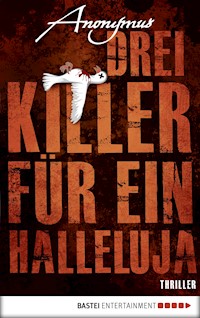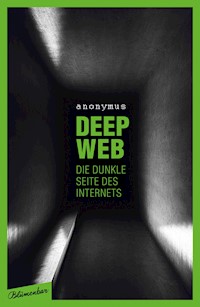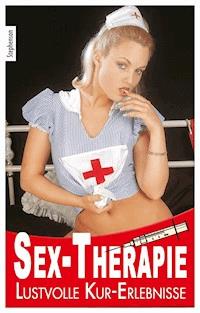4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Bourbon Kid
- Sprache: Deutsch
The Devil’s Graveyard - auf diesem gottverlassenen Fleck Wüste steht das Hotel Pasadena. Und hier wird ein Contest mit dem Motto "Zurück von den Toten" stattfinden: Die Teilnehmer imitieren längst verstorbene Rockstars. Der abgehalfterte Barkeeper Sanchez, der Kopfgeldjäger namens Elvis, ein Haufen schizophrene Musiker und eine Handvoll Zombies machen sich auf den Weg.
Keiner von ihnen ahnt, dass sie dem Tod näher sind, als ihnen lieb ist. Denn ein weiterer Gast steht auf der Liste: der wahnsinnige Killer Bourbon Kid ... Und so wird der Wettbewerb zur härtesten Talent-Show, die es je gegeben hat: Träume werden zerstört, Geschäfte werden gemacht und Blut wird vergossen. Jede Menge Blut.
"Eine sehr düstere, lustige und mörderische Geschichte - Tarantino trifft X-Factor" (Fresh Direction Magazine)
Der dritte Teil der SPIEGEL-Bestseller-Serie vom Autor ohne Namen - garantiert genauso blutig, rasant und adrenalingeladen wie die beiden Vorgänger!
Bourbon Kid metzelt auch in:
Band 1: Das Buch ohne Namen
Band 2: Das Buch ohne Staben
Band 4: Das Buch des Todes
eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 559
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Inhalt
Cover
Grußwort des Verlags
Über dieses Buch
Titel
Vorwort
Eins
Zwei
Drei
Vier
Fünf
Sechs
Sieben
Acht
Neun
Zehn
Elf
Zwölf
Dreizehn
Vierzehn
Fünfzehn
Sechzehn
Siebzehn
Achtzehn
Neunzehn
Zwanzig
Einundzwanzig
Zweiundzwanzig
Dreiundzwanzig
Vierundzwanzig
Fünfundzwanzig
Sechsundzwanzig
Siebenundzwanzig
Achtundzwanzig
Neunundzwanzig
Dreißig
Einunddreißig
Zweiunddreißig
Dreiunddreißig
Vierunddreißig
Fünfunddreißig
Sechsunddreißig
Siebenunddreißig
Achtunddreißig
Neununddreißig
Vierzig
Einundvierzig
Zweiundvierzig
Dreiundvierzig
Vierundvierzig
Fünfundvierzig
Sechsundvierzig
Siebenundvierzig
Achtundvierzig
Neunundvierzig
Fünfzig
Einundfünfzig
Zweiundfünfzig
Dreiundfünfzig
Vierundfünfzig
Fünfundfünfzig
Sechsundfünfzig
Siebenundfünfzig
Achtundfünfzig
Neunundfünfzig
Sechzig
Einundsechzig
Zweiundsechzig
Dreiundsechzig
Vierundsechzig
Fünfundsechzig
Über den Autor
Weitere Titel des Autors
Impressum
Liebe Leserin, lieber Leser,
vielen Dank, dass du dich für ein Buch von beTHRILLED entschieden hast. Damit du mit jedem unserer Krimis und Thriller spannende Lesestunden genießen kannst, haben wir die Bücher in unserem Programm sorgfältig ausgewählt und lektoriert.
Wir freuen uns, wenn du Teil der beTHRILLED-Community werden und dich mit uns und anderen Krimi-Fans austauschen möchtest. Du findest uns unter be-thrilled.de oder auf Instagram und Facebook.
Du möchtest nie wieder neue Bücher aus unserem Programm, Gewinnspiele und Preis-Aktionen verpassen? Dann melde dich auf be-thrilled.de/newsletter für unseren kostenlosen Newsletter an.
Spannende Lesestunden und viel Spaß beim Miträtseln!
Dein beTHRILLED-Team
Melde dich hier für unseren Newsletter an:
Über dieses Buch
The Devil’s Graveyard – auf diesem gottverlassenen Fleck Wüste steht das Hotel Pasadena. Und hier wird ein Contest mit dem Motto »Zurück von den Toten« stattfinden: Die Teilnehmer imitieren längst verstorbene Rockstars. Der abgehalfterte Barkeeper Sanchez, der Kopfgeldjäger namens Elvis, ein Haufen schizophrene Musiker und eine Handvoll Zombies machen sich auf den Weg.
Keiner von ihnen ahnt, dass sie dem Tod näher sind, als ihnen lieb ist. Denn ein weiterer Gast steht auf der Liste: der wahnsinnige Killer Bourbon Kid … Und so wird der Wettbewerb zur härtesten Talent-Show, die es je gegeben hat: Träume werden zerstört, Geschäfte werden gemacht und Blut wird vergossen. Jede Menge Blut.
Der dritte Teil der SPIEGEL-Bestseller-Serie vom Autor ohne Namen – garantiert genauso blutig, rasant und adrenalingeladen wie die beiden Vorgänger!
A N O N Y M U S
Band 3
Roman (schätzen wir)
Aus dem Englischen von Michael Kubiak
Lieber Leser,
es ist niemals ungefährlich, sich auf Annahmen zu verlassen.
Insbesondere ist es niemals ungefährlich, sich auf Annahmen bei Dingen zu verlassen, die ungefährlich erscheinen oder auch nicht.
So gut wie sicher sind sie es nicht.
Anonymus
EINS ♦
Scheiiiiiße! Es stimmte schon, es ging nichts über einen anständigen Hubraum. Die Maschine in diesem Schlitten hatte wirklich Power …
Für Johnny Parks ging endlich ein lebenslanger Traum in Erfüllung. Am frühen Morgen mit über hundertsechzig Sachen einen verlassenen Highway hinunterzurasen war aufregend. Dass er in einem Streifenwagen saß und einen berüchtigten Serienmörder in einem schwarzen Pontiac Firebird verfolgte, gab dem Ganzen einen zusätzlichen Kick.
Das Funkgerät erwachte knisternd und die Stimme des Chiefs erklang zum dritten Mal laut und deutlich während der letzten zwei Minuten.
»Ich wiederhole, alle Einheiten bleiben zurück. Der Flüchtige wird nicht bis auf den Devil’s Graveyard verfolgt! Ich erwarte Bestätigung – das ist ein verdammter Befehl!«
Johnnys Partner auf dem Beifahrersitz, Neil Silverman, griff nach unten und drehte am Lautstärkeknopf des Funkgeräts, bis nacheinander die Stimmen der anderen Beamten, die den Empfang der Meldung bestätigten, verstummten. Die beiden Cops grinsten und nickten. Währenddessen jagten sie an der riesigen Tafel am Straßenrand vorbei. Dort war zu lesen:
Willkommen auf Devil’s Graveyard
Johnny beobachtete im Rückspiegel, wie die Kette der anderen sieben Streifenwagen hinter ihm stoppte, kehrtmachte und sich entfernte. Feige Bande. Das war seine Stunde – nun ja, seine und Neils, dachte er. Normalerweise wäre keiner von ihnen beiden an einer solchen hochkarätigen Verfolgungsjagd beteiligt gewesen, aber an diesem Morgen waren so viele Beamte getötet worden, dass sie den Einsatzbefehl erhielten. Beide Männer waren Anfang zwanzig und hatten erst vor einem halben Jahr die Polizeiakademie absolviert. Neil war der beste Pistolenschütze seines Jahrgangs und hatte eine glänzende Karriere in der Truppe vor sich. Was Johnny betraf, so fand er es einfach nur aufregend, den Meisterschützen über den Highway zu fahren. Wenn überhaupt jemand den Fahrer des Firebird zur Strecke bringen würde, dann war es sein Kumpel Neil – was der Grund dafür war, dass Johnny so erpicht darauf war, die Jagd noch ein wenig fortzusetzen, obgleich es bedeutete, den Befehl des Chiefs zu missachten.
Während ihn die Wüstensonne mit ihrem grellen Licht blendete, bemühte sich Johnny, den Wagen unter Kontrolle zu behalten, während sie allmählich zu dem Firebird aufholten. Über den Highway mit seinen Sandverwehungen und Geröllpassagen zu navigieren, während er gleichzeitig versuchte, einen Wahnsinnigen aufzuhalten, der mindestens drei andere Fahrzeuge von der Straße gerammt hatte, erforderte sein ganzes Können.
Wenn Neil der beste Schütze in der Truppe war, dann betrachtete Johnny sich als den besten Fahrer. Als Teenager war er ein fanatischer Stockcar-Fahrer gewesen, hatte stundenlang auf einer eigens dafür angelegten Sandpiste auf der Farm seines Vaters trainiert und zahlreiche Rennen auf dem örtlichen Rundkurs gewonnen. Es waren seine Fahrkünste, die ihn bei seiner Verlobten Carrie-Anne, der Anführerin der Cheerleader-Truppe an seiner Highschool, hatten landen lassen. Sie erwarteten jeden Tag die Geburt ihres ersten Kindes. Wenn Johnny den Ruhm und die Vorteile einheimste, die ihm zuteilwürden, weil er Teil des Duos war, das den Bourbon Kid zur Strecke brachte, hätte sein zukünftiges Kind einen Vater, auf den es stolz sein konnte.
»Komm schon, Johnny! Ich kann von hier keinen genauen Schuss anbringen!«, brüllte Neil und zielte mit dem Revolver aus dem offenen Fenster. »Bring uns näher ran!«
Johnny rammte den Fuß aufs Gaspedal und versuchte, die Front ihres Streifenwagens auf gleiche Höhe mit dem Heck des Firebird zu bringen.
»Zielst du auf die Reifen?«, rief er über den Lärm des Motors und des Windes, der durch die offenen Fenster pfiff.
»Nee. Auf den Fahrer.«
»Solltest du nicht die Reifen aufs Korn nehmen?«
Neil löste den Blick von dem schwarzen Wagen vor ihnen und schaute kurz zu Johnny.
»Hör mal, wenn ich diesen Kerl erledige, dann sind wir verdammte Helden, Johnny. Stell dir doch nur mal vor – irgendwann kannst du deinem Jungen erzählen, dass du den schlimmsten Massenmörder der Geschichte zur Strecke gebracht hast!«
Während er mit einem Auge auf die Straße achtete, erwiderte Johnny das Grinsen seines Partners. »Yeah. Das wäre obercool.«
»Ich kann’s mir richtig vorstellen. Wir eröffnen Supermärkte, machen Werbung für Aftershave, das volle Programm.«
»Ich könnte ein neues Aftershave brauchen.«
»Nun, sieh du nur zu, dass du den Wagen ruhig hältst, dann sorge ich schon dafür.«
»Kannst du ihn nicht nur verwunden? Ginge das? Hä?«
Neil schüttelte ungehalten den Kopf. »So’n Scheiß, was erwartest du von mir? Soll ich ihm die Scheißnase wegblasen? Ich bin gut, aber so gut bin ich auch nicht. Das ist niemand.« Er lehnte sich weiter aus dem Fenster und fügte hinzu: »Vergiss nicht, dass diese Sau heute Morgen mindestens zehn von unseren Leuten gekillt hat. Gute Männer. Männer mit Familien. Fröhliches Halloween, der Boogeyman ist in der Stadt!«
Dass Halloween war, hatte Johnny nicht vergessen. Die Bewohner – das heißt, die wenigen, die es noch gab – setzten niemals einen Fuß auf Devil’s Graveyard, erst recht nicht an Halloween. In den Bars und Imbissrestaurants wurde ständig über das gemunkelt, was da draußen an jedem einunddreißigsten Oktober geschah. Es hieß, dass ganze Busladungen unschuldiger Trottel jedes Jahr reingefahren und nie wieder gesehen wurden. Die meisten Leute glaubten das. Das war das schmutzige kleine Geheimnis der Stadt. Johnny hatte bereits das Schild passiert, das anzeigte, dass sie sich auf tödlichem Territorium befanden. Es war schon dämlich genug, mit einem Streifenwagen hinter dem Serienmörder, den alle nur als Bourbon Kid kannten, herzurasen, aber diese Jagd bis auf Devil’s Graveyard fortzusetzen und das an Halloween … nun, das war in etwa genauso Idiotisch wie ein Bungeesprung ohne Seil.
»Okay, Neil, hab schon verstanden. Beeil dich nur, diesen Hurensohn zu erwischen. Und dann lass uns verdammt noch mal schnellstens von hier verschwinden.«
»Du sagst es, Kumpel.«
Die Straße dehnte sich vor ihnen endlos bis zum Horizont und schimmerte in der frühmorgendlichen Sonnenhitze wie eine Fata Morgana. So weit das Auge reichte, gab es keine Gebäude, keinen weiteren Verkehr. Abermals lehnte Neil sich aus seinem Fenster und zielte mit der Pistole auf das dunkel getönte Heckfenster des Firebird. Der Fahrtwind ließ sein normalerweise adrett gekämmtes blondes Haar wild um seinen Kopf flattern.
»Komm zu Daddy, du Schweinebacke«, flüsterte er.
Eine Millisekunde, bevor Neil feuerte, trat der Fahrer des Firebird auf die Bremse und brachte beide Wagen auf gleiche Höhe. Neil hatte bereits abgedrückt. Die Kugel verfehlte ihr Ziel und sirrte an der Front des anderen Wagens vorbei. Johnny bremste ebenfalls scharf, aber ehe er begriff, was geschah, senkte sich das Seitenfenster auf der Fahrerseite des Firebird. Die Zwillingsmündung einer Schrotflinte mit abgesägten Läufen erschien in der Öffnung. Sie zielten auf sie. Johnny riss den Mund auf, um Neil zuzurufen, er solle sich ducken, aber –
BOOM!
Es geschah so schnell, dass Johnny kaum Zeit hatte zu blinzeln, geschweige ein Wort über die Lippen zu bringen, um seinen Partner zu warnen. Die massive Schrotladung blies den größten Teil von Neils Kopf weg und spritzte ihn auf Johnnys Gesichtshälfte. Blut, Haare und Gehirnfetzen flogen ihm in den offenen Mund, und er quiekte ein gequältes »Oh, Scheiße!«. Der Schock ließ ihn die Kontrolle über den Wagen verlieren. Der Firebird schwenkte zu ihm herüber, und sein vorderer Kotflügel erwischte den Streifenwagen bei vollem Tempo. Johnny trat abermals auf die Bremse, aber es war viel zu spät. Seinen Händen war das Lenkrad bereits entglitten und drehte sich wild. Aus dem Augenwinkel sah er, wie der Firebird drei- oder viermal hin und her schlingerte, während sein Fahrer darum kämpfte, das Schleudern in den Griff zu kriegen, sich fing und den Highway hinunterraste. Mit kreischenden Reifen schlitterte der Streifenwagen von der Straße und auf das mit Steinen übersäte Wüstengelände daneben. Er prallte auf einen großen Felsklotz, drehte sich in der Luft und schleuderte dabei Neils leblosen Körper aus seinem Sitz.
Johnny fand sich kopfüber mitten in der Luft. Instinktiv krümmte er sich zur Seite und griff nach der Basis seines Sitzes und zog sich mit aller Kraft nach unten. Ihm war beigebracht worden, dass dies das Erste sei, das er tun solle, wenn sich sein Wagen während eines Rennens überschlug. Wenn das Dach des Wagens auf dem Boden aufschlug, müsste Johnny sich vor dem Aufprall schützen, indem er sich mit aller Kraft, komme was wolle, an seinem Sitz festhielt. Er hörte das Dach knirschen und knacken, als es auf dem Wüstenboden landete. Die Beulen im Blech verfehlten seinen Kopf nur um Zentimeter. Drei weitere Male drehte der Wagen sich um seine Längsachse und raubte Johnny jegliche Orientierung. Schließlich landete er auf der Seite, sodass Johnny gegen das Seitenfenster gepresst wurde und auf den sandigen Boden starrte. Der Wagen schaukelte noch ein paar Mal, ehe er endlich zur Ruhe kam.
Was von Neil übrig war, kippte auf ihn. Das verbliebene Auge seines toten Freundes starrte ihn leer an, und Blut tropfte auf ihn herab wie die Vorboten eines Regenschauers. Er hörte das Ticken des abkühlenden Metalls und nahm den beißenden Geruch ausströmenden Benzins wahr.
Eine Sekunde, ehe er das Bewusstsein verlor, nahm Johnny sich vor, den Polizeidienst zu quittieren.
ZWEI ♦
Der Halloweenmorgen verlief auf Devil’s Graveyard völlig anders als jeder andere Morgen. Wie jeden Tag öffnete Joe die Tankstelle um Punkt acht Uhr, aber alles andere an diesem Tag unterschied sich vom gewöhnlichen Ablauf. Er brauchte weniger als zehn Minuten in der frischen, kühlen Luft, um die Vorhängeschlösser an den beiden Tanksäulen zu entfernen und die Pumpen einzuschalten. Nicht einmal die Eidechsen, Schlangen und das diverse Ungeziefer, das ständig in der staubigen Einöde umherglitt und krabbelte, waren zu sehen. Falls das Getier einen Ort kannte, wo es für ein oder zwei Tage Winterschlaf ungestört war, konnte man darauf wetten, dass es sich dorthin zurückgezogen hatte.
Sleepy Joe’s Diner war die einzige Raststätte an dem verlassenen Highway, der zum Hotel Pasadena führte. Sie diente auch als Tankstelle, und da es im Umkreis von hundertfünfzig Kilometern keine weiteren Tankstellen gab, hielten die meisten Leute, die zum Hotel wollten, dort zum Auftanken an. Und an den Tagen kurz vor Halloween liefen die Geschäfte immer am besten.
Joe freute sich auf das Festival fast genauso wie ihm davor graute. Alle möglichen seltsamen Typen kamen vorbei, um ihre Benzintanks und Mägen zu füllen. Neunzig Prozent von ihnen waren totale Spinner; die anderen zehn Prozent konnte man, höflich ausgedrückt, als unbedarft bezeichnen. Bisher hatte in den zwölf Jahren, die er die Tankstelle und das Imbissrestaurant besaß, Halloween immer das gebracht, was er erwartet hatte. Dass es dieses Jahr anders wäre, war unwahrscheinlich.
Nachdem er sich vergewissert hatte, dass die Zapfsäulen einwandfrei funktionierten und betriebsbereit waren, kehrte er in den sicheren Schutz des Restaurants zurück. Er wusste nur zu gut, dass der Frieden und die Stille draußen lediglich die Ruhe vor dem Sturm waren. Er wusste aus Erfahrung, was auf ihn zukam, und war dankbar, dass, wenn die Dinge später am Tag eine grässliche Wendung nähmen – wie es sicher geschehen würde –, er über einen tornadosicheren Keller verfügte, in dem er sich verkriechen konnte.
In der Küche im hinteren Teil des Restaurants setzte er eine Kanne Kaffee für Jackos alljährlichen Besuch auf. Dann erledigte er seine morgendlichen Hausarbeiten, während das Wasser durchs Kaffeemehl und in die Kanne tropfte.
Gegen halb neun hielt draußen, wie jeden Morgen, ein Lieferwagen mit den Zeitungen. An den meisten Tagen tauschte Joe mit Pete, dem Fahrer, Nettigkeiten aus und schwatzte mit ihm über die örtlichen Neuigkeiten. An diesem Morgen jedoch stieg Pete nicht mal aus dem Lieferwagen aus. Er drehte lediglich das Fenster auf der Fahrerseite herunter und warf einen Stapel Zeitungen, die durch eine Schnur zusammengehalten wurden, auf den Vorplatz. Das Paket landete vor Joes Füßen und wirbelte eine kleine Wolke Sand und Staub hoch.
»’n Morgen, Pete«, sagte Joe und tippte gegen seinen Mützenschirm.
»Hey, Joe. Bin heute Morgen spät dran. Muss gleich weiter.«
»Kann ich dich mit einer Tasse Kaffee locken? Ich habe gerade eine Kanne aufgesetzt.«
»Nein, trotzdem vielen Dank. Hab heute noch eine Menge zu erledigen.«
»Nun, ich sollte eigentlich mal bei dir bezahlen. Ich schätze, ich bin eine Woche im Rückstand.«
Pete begann das Fenster wieder hochzukurbeln. Es war nicht schwer zu erkennen, dass er an diesem Morgen nicht die Absicht hatte, länger zu bleiben.
»Ist schon okay, Joe, ich weiß, dass du mich nicht bescheißt. Du kannst morgen bezahlen. Oder später in der Woche, ist nicht so schlimm.«
»Bist du ganz sicher? Ich kann das Geld aus der Kasse holen.« Aber das hätte er sich sparen können.
Das Fahrerfenster schloss sich und Pete lenkte den Wagen auf die Straße, wobei er Joe kurz zuwinkte. Bald war er nicht mehr zu sehen und unterwegs zum Hotel Pasadena.
An den meisten Tagen dauerte das Schwätzchen der beiden Männer an die fünf Minuten. Pete war normalerweise immer freundlich und dankbar für ein zwangloses Gespräch, aber an Halloween hatte er es immer eilig mit seinen Lieferungen. Auf dem Devil’s Graveyard gab es nur zwei Lieferadressen – Sleepy Joe’s Diner und das Hotel Pasadena –, daher nahm Joe es Pete nicht übel, dass er an diesem Morgen gleich weiterfuhr, auch wenn er ein wenig enttäuscht war.
Um Viertel vor neun hatte er den Imbiss offen und angeheizt und war bereit für die ersten Gäste. Entspannt und gelassen dem Tag ins Auge schauend, schenkte er sich den ersten Becher Kaffee ein und setzte sich an einen der runden Tische, um einen Blick in die Zeitungen zu werfen. In dem Imbiss standen nur acht Tische, jeder mit einer identischen rot-weiß karierten Tischdecke ausstaffiert. Für einen neuen Gast, der zum ersten Mal hereinkam, wäre es niemals offensichtlich gewesen, dass Joe der Inhaber war. Er trug jeden Tag dieselbe blaue Jeanslatzhose, die er nur einmal in der Woche wusch. Sein schütteres graues Haar versteckte sich jeden Tag unter einer fünfzehn Jahre alten roten Baseballmütze, bis auf ein paar Büschel, die an den Ohren drunter hervorschauten. Silbergraue Bartstoppeln glänzten wie winzige Stacheln in seinem schlaffen alten Gesicht, und er setzte immer eine Miene wie drei Tage Regenwetter auf, ganz gleich in welcher Stimmung er sich befand. Sogar als er noch ein junger Mann war, machte der Witz die Runde, dass er aussehe, als hätte ihn der Blitz getroffen, während er gerade an einem Wettkampf im Fratzenschneiden teilnahm.
Die Schlagzeile der ersten Zeitung, die er zu sich heranzog, lautete: »Gesucht: tot oder lebendig – Belohnung $100 000.« Unter der klotzigen Überschrift befand sich ein körniges Foto von einem Videoband irgendeiner örtlichen Überwachungskamera, das einen ganz in Schwarz gekleideten Mann mit fettigem schulterlangem Haar und einer dunklen Sonnenbrille zeigte. Laut dem Artikel, der zu der Schlagzeile gehörte, hatte der Mann eine Reihe bewaffneter Raubüberfälle in einer Kleinstadt in der Nähe verübt. Dabei hatte er einige örtliche Polizeibeamte sowie ein paar unschuldige Mitbürger getötet. Die Anzahl der Toten betrug mehr als dreißig, aber die Polizei erwartete, während der nächsten Tage weitere Leichen zu finden. Der Artikel wagte sogar anzudeuten, dass der Täter der legendäre Bourbon Kid sein könnte. Jeder wusste über den Bourbon Kid Bescheid. Aber sie neigten auch dazu, ihn mit Bigfoot und dem Ungeheuer von Loch Ness in eine Schublade zu stecken.
Joe las stillvergnügt die Zeitung und stellte sich dabei vor, wie es wohl wäre, wenn er die Belohnung für die Ergreifung des Bourbon Kid einheimsen würde. Würde er sich von dem Geld einen neuen Wagen kaufen? Oder vielleicht eine Urlaubsreise machen? Oder sogar in eine bessere Stadt umziehen? Die Antwort war ein entschiedenes Nein. Aber wie wäre es damit, ihn in den Rücken zu schießen, wenn sich die Gelegenheit ergab? Ja, das hatte was. Klar, es wäre feige, aber es geschähe im Interesse der Öffentlichkeit. Und die Öffentlichkeit wäre ihm auf ewig dankbar. Allein aus diesem Grund würde er, wenn er das Geld bekam, niemals in eine andere Stadt ziehen. Es wäre völliger Blödsinn, ein lokaler Held zu sein und nicht mitzukriegen, wie man gefeiert wurde.
Er trank einen Schluck schwarzen Kaffees aus seinem angeschlagenen weißen Lieblingsbecher, als, genau aufs Stichwort, Jacko, sein alljährlicher Besucher, eintraf. Während er jeden Gedanken daran, ein lokaler Held zu werden, in den hintersten Winkel seines Bewusstseins verdrängte, machte Joe sich klar, dass der Besuch Jackos ungefähr das Aufregendste war, das in seinem Leben je geschah.
Als der Neuankömmling hereinkam, klingelte die Glocke über der Tür leise und verkündete sein Eintreffen. Er war ein Schwarzer, Mitte bis Ende zwanzig. Und jedes Jahr kam er in den Imbiss, verkleidet als Michael Jackson wie damals in dem Thriller-Video. Bekleidet war er mit einer roten Lederjacke, einer dazu passenden roten Lederhose und einem blauen T-Shirt. Sein schwarzes Haar trug er kurz geschnitten und in einer betonfesten Dauerwelle.
Jedes Jahr verbrachte Jacko den ganzen Tag im Imbiss, schwatzte mit Joe, trank Kaffee in rauen Mengen und hoffte, dass jemand ihn mit seinem Wagen zum Back-From-The-Dead-Gesangswettbewerb im Hotel Pasadena mitnahm. Jedes Jahr wartete er vergeblich. Aber es schien ihm nichts auszumachen, denn, so sicher wie das Amen in der Kirche, kehrte er jedes Mal zu Halloween zurück, um sein Glück erneut zu versuchen.
Joe sah ihn hereinkommen und sich umschauen. Ihre Blicke trafen sich und beide Männer lächelten einander an. Jacko redete als Erster.
»Immer noch hier, Joe?«
»Immer noch. Willst du das Übliche?«
»Klar, Mister.« Er hielt inne und trat verlegen von einem Fuß auf den anderen, ehe er hinzufügte: »Du weißt, dass ich kein Geld habe, nicht wahr?«
»Ich weiß.«
Joes wackliger Holzstuhl knarrte laut, als er aufstand und zur Theke im hinteren Teil des Imbisses ging. An der Wand dahinter befand sich knapp unter Augenhöhe ein Regalbrett. Darauf stand eine Reihe weißer Porzellanbecher wie der, aus dem Joe getrunken hatte. Er nahm einen aus der Mitte der Reihe und stellte ihn auf die Theke. Dann griff er nach der Kaffeekanne auf einer Anrichte neben dem Durchgang zur Küche und begann, den Becher zu füllen. Als der Becher voll war, hatte Jacko sich auf Joes Stuhl niedergelassen. Und er las Joes Zeitung. Der ältere Mann verzog unwillkürlich das Gesicht zu einem ironischen Grinsen. Dieselbe Prozedur wie jedes Jahr.
»Wie läuft das Geschäft?«, rief Jacko, ohne von der Zeitung hochzuschauen.
»So wie immer.«
»Freut mich zu hören.«
Joe kam zum Tisch und stellte Jacko den Kaffeebecher neben die Zeitung. Er blieb hinter ihm stehen und sah zu, wie er die erste Seite las.
»Was glaubst du, wie dieses Jahr deine Chancen stehen?«, fragte er.
»Dieses Jahr habe ich ein richtig gutes Gefühl.«
»Tatsächlich? Nun, ich setze fünf Bucks, dass du auch diesmal keinen findest, der dich mitnimmt.«
Jacko sah schließlich hoch und zeigte ein perfektes Lächeln, ein Lächeln voller Optimismus und strahlend weißer Zähne, ein Lächeln, auf das ein junger Michael Jackson mit Recht stolz gewesen wäre.
»Du hast so wenig Vertrauen, Joe. Gott wird mir dieses Jahr jemanden schicken. Ich fühle es.«
Joe schüttelte den Kopf. »Wenn Gott irgendetwas hierherschicken sollte, dann ist es Verdruss, mein Freund. Wenn du hier in dieser Gegend zu jemandem in den Wagen steigst, dann bin ich ziemlich sicher, dass ich dich nächstes Jahr nicht wieder sehe.«
Jacko lachte. »Ich hab’s letzte Nacht geträumt. Ich hatte eine Vorahnung, dass Gott einen Mann schickt, der mich sicher durch diese Gegend bringt. Dies ist mein Schicksalstag.«
Joe seufzte. Jacko laberte eine solche Scheiße. Und er redete in einer Sprache, die man in dieser Gegend von niemandem hörte. Doch das machte ihn irgendwie liebenswert.
»Irgendeine Idee, wer dieser Typ ist, den Gott dir schickt?«
»Noch nicht.«
»Hast du irgendeinen Hinweis, wie er aussieht?«
»Nee. Nicht den geringsten.«
Joe streckte eine Hand aus und fuhr damit durch Jackos Dauerwelle. Dann lächelte er. »Na gut. Frühstück in fünf Minuten.«
»Vielen Dank, Sir«, sagte Jacko in einem Ton, der viel zu höflich war für ein Etablissement wie Sleepy Joe’s Diner, das für den Begriff »Scheißladen« hätte Pate stehen können.
Sein Inhaber verzog sich in die Küche und begann, Jackos Frühstück zuzubereiten. Er kannte es auswendig. Zwei Streifen Speck, zwei Würstchen, zwei Hash Browns und ein auf beiden Seiten gebratenes Spiegelei. Vier Scheiben Weizentoast waren bereits mit Butter bestrichen und servierfertig.
Nachdem er die Zutaten aus einem ramponierten alten Kühlschrank geholt hatte, stellte er eine Bratpfanne auf den Herd und warf einen Klumpen Bratfett hinein, gefolgt von den Speckstreifen und zwei fetten Würstchen. Nach einer Weile angelte er einen rostigen Metallpfannenwender aus einer Schublade unter der Spüle und begann, die Würstchen zu wenden. Das kalte Fleisch zischte, als es im heißen Fett landete, und der Bratenduft stieg Joe in die Nase. Als er ihn einatmete, wusste er, dass der Tag endgültig begonnen hatte. In gespannter Erwartung dessen, was kommen würde, rief er in den Gastraum: »Hierher sind jede Menge Fremde unterwegs, weißt du. Und wie in der Zeitung steht, könnte einer von ihnen der Serienmörder sein. Hast du schon mal was von diesem Bourbon Kid gehört? Sollte er hier reinschneien, empfehle ich dir, lieber nicht in seinen Wagen zu steigen.«
Jacko antwortete aus dem Imbiss. »Ich fahre mit jedem Wagen mit. Ich bin nicht pingelig.«
»Der Typ ist ein Killer, Jacko. Ich habe meine Zweifel, dass er von Gott gesandt ist.«
»Die Männer Gottes kommen in vielen verschiedenen Verkleidungen.«
»Etwa auch mit genügend Munition, um Mexiko in Schutt und Asche zu legen?«
»Schon möglich.«
»Na ja, dann ist er vielleicht dein Mann.«
Eine kurze Pause entstand, bis Jacko sich wieder zu Wort meldete. »Der Kaffee ist gut, Joe.«
»Ja. Ich weiß.«
Die beiden schwatzten gut eine Stunde lang, in der Jacko sein Gratisfrühstück verzehrte und dann die Zeitungslektüre fortsetzte, während Joe auf seinem Hocker hinter der Theke saß. Er hatte sich gerade seinen dritten Becher Kaffee eingeschenkt, als draußen ein Wagen vorfuhr. Joe hatte ihn vorher schon mit hohem Tempo vorbeifahren sehen. An einer Kreuzung knapp einen Kilometer die Straße hinunter stand ein Wegweiser, der auf das Hotel Pasadena hinwies, aber jedes Jahr zu Halloween verschwand das Schild und jeder Fahrer, der am Imbiss vorbeikam, kehrte ein paar Minuten später zurück, um nach dem Weg zu fragen.
Joe kannte das Spiel. Er musste den Ahnungslosen mimen, falls jemand hereinkam und sich nach dem Weg zum Hotel Pasadena erkundigte. Dadurch konnte Jacko seine Dienste als Führer anbieten, wenn der Betreffende ihn als Gegenleistung in seinem Wagen mitnahm.
Der Wagen war ein schnittiger schwarzer Schlitten mit langer Motorhaube. Aufgrund der Ausmaße der Haube konnte man mit ziemlicher Sicherheit annehmen, dass sich ein extrem starker Motor darunter befand. Der Motor war auch im Leerlauf ganz schön laut. Tatsächlich röhrte er auf eine Weise, die verriet, dass der Fahrer die Leerlaufdrehzahl absichtlich hoch hielt, damit niemand auf die Idee kam, der Wagen brauche einen Tankstellenservice. Es war ein starker Wagen, und zweifellos wollte der Fahrer, dass alle Leute das auch bemerkten. Nach einer vermutlich langen Fahrt durch die Wüste war der Wagen mit Sand und Staub bedeckt. Da Joe ein zynischer alter Knochen war, verriet er durch nichts, dass der Wagen irgendeinen Eindruck auf ihn machte. Er besaß einen armseligen alten Pick-up und verabscheute jeden, der etwas Besseres fuhr. In Wahrheit hätte er dem schwarzen Wagen nach Möglichkeit überhaupt keine Beachtung geschenkt, aber zu seinem Pech wollte Jacko einiges darüber wissen.
»Was für ein Wagentyp ist das eigentlich?«, fragte Jacko ihn. Joe, der so tat, als hätte er den Wagen noch gar nicht bemerkt, blickte übertrieben angestrengt durch das schmuddelige Fenster. Er erkannte das Modell sofort.
»Ein Pontiac Firebird«, knurrte er.
»Ein was?«
»Ein Pontiac Firebird.« Diesmal dehnte er jede Silbe: »Pontii-ack Fey-er-börd.«
»Was ist ein Pontiac Firebird? Von dem habe ich noch nie etwas gehört.«
»Ein Schlitten für ganz üble Typen.«
»Was meinst du mit …?« Jacko verschluckte den Rest seiner Frage, als die Türglocke erklang und verkündete, dass der Fahrer des Wagens den Imbiss betreten hatte.
Joe wusste auf Anhieb, dass seine Voraussage zutraf. Das war wirklich ein übler Typ. Das spürte man schon an der Aura, die ihn umgab. Der Mann hatte eine mächtige Ausstrahlung. Jeder hätte das schon von Weitem wahrgenommen. Außer Jacko wahrscheinlich.
Der Fremde trug eine schwarze Kampfhose über abgetragenen schwarzen Stiefeln, dazu eine schwere schwarze Lederjacke mit einer völlig unpassenden schwarzen Kapuze. Unter der Jacke spannte sich ein enges schwarzes T-Shirt. Die Augen waren hinter einer dunklen verspiegelten Sonnenbrille mit Stahlgestell verborgen und sein Haar war kräftig, dunkel und strähnig – eigentlich eher fettig. Es hing ihm bis auf die Schultern, war aber völlig ungekämmt. Der Kerl sah absolut cool aus, als schliefe er in seinen Klamotten und kümmerte sich einen Dreck darum.
Während er zur Theke schlenderte, höchstwahrscheinlich um Joe nach dem Weg zu fragen, schaute er zu Jacko und nickte ihm zu. Es bestand kein zweifel: Dies war der Typ auf dem Foto auf der ersten Zeitungsseite. Joe spürte, wie seine Handflächen feucht wurden. War dies ein Zeichen? Kurz vorher hatte er noch darüber nachgedacht, was er tun würde, wenn er jemals mit dem Serienkiller aus dem Zeitungsbericht zusammentreffen sollte. Und nun, als wollte er ihn testen, hatte Gott ihm ausgerechnet diesen Kerl geschickt. Joe dachte an die einhunderttausend Dollar Belohnung. Hätte er den Mut, seinen Plan auszuführen und diesen gesuchten Mörder niederzuschießen, wenn sich ihm die Gelegenheit dazu bot? Zweifellos war dies die einzige Gelegenheit in seinem Leben, an richtig viel Geld zu kommen. Während er noch die Risiken abwog, irgendetwas zu unternehmen, um in den Besitz dieser Geldsumme zu gelangen, begann der Mann zu reden. Seine Stimme war rau und hatte einen unangenehmen, ja bedrohlichen Unterton.
»Habt ihr in dieser Gegend noch nie etwas von Wegweisern gehört?«, fragte er.
Joe zuckte entschuldigend die Achseln. »Hier verkehren nur Einheimische, Mister. Die brauchen keine Wegweiser.«
»Sehe ich aus wie ein Einheimischer?«
»Nein, Sir.«
Wie aufs Stichwort nutzte Jacko, der links von dem Mann an seinem Tisch saß, die Gelegenheit, um sich einzumischen. »Ich kann dir den Weg zeigen, Mister.«
Der Mann wandte sich um, hob einen Finger, um seine Sonnenbrille ein wenig nach unten zu schieben, und musterte Jacko über ihren Rand hinweg von Kopf bis Fuß.
»Du siehst aber nicht so aus, als kämst du von hier.«
»Komme ich auch nicht. Aber ich war schon mal hier.«
»Und du weißt, wohin ich will?« Die Stimme knirschte wie kleine Kieselsteine, die von der Strömung in einem Flussbett herumgeschoben wurden.
Jacko grinste. »Zum Hotel Pasadena, denke ich. Wenn du mich mitnehmen würdest, könnte ich dir den Weg erklären.«
»Warum erklärst du ihn mir nicht jetzt gleich?«
Joe wurde wegen Jacko unruhig. Hatte er nicht erkannt, dass dieser Typ der Serienmörder war – und daher nicht unbedingt jemand, zu dem man freiwillig in den Wagen steigt?
»Na ja, ich will selbst zum Pasadena«, erklärte Jacko aufgeräumt. »Also, als Belohnung, dass ich dir den Weg erkläre, könntest du mich wirklich mitnehmen.«
»Erklär mir einfach, wie ich fahren muss.«
»Na ja, ich bin mir eigentlich nie ganz sicher, bis ich die entsprechende Straße vor mir sehe. Und ich möchte dich doch nicht in die falsche Richtung schicken.«
»Nein. Das willst du ganz gewiss nicht.«
»Und? Nimmst du mich mit?«
Der Mann schob seine Sonnenbrille ein Stück nach oben, sodass seine Augen wieder dahinter verschwanden. Er schien lange und intensiv in Jackos Augen zu starren. Währenddessen traf Joe eine Entscheidung.
Eine Belohnung von einhundert Riesen war einfach zu verlockend, um sie sich durch die Lappen gehen zu lassen.
Langsam, ohne eine sichtbare Bewegung, streckte er die Hand nach einer kleinen Schublade in Hüfthöhe unter der Theke aus. Er bewahrte dort einen kleinen vernickelten Revolver auf für den Fall, dass es Ärger gab. Er brauchte nichts anderes zu tun, als ihn herauszuholen und diesem neuen Gast damit in den Rücken zu schießen, während Jacko ihn ablenkte. Einhundert Riesen im Sack. Gute Arbeit. Vielen Dank. Mit einer für sein vorgerücktes Alter erstaunlich ruhigen Hand zog er die Schublade millimeterweise auf und griff hinein. Seine Finger berührten den kalten Stahl des Revolvers. Sein Herz hämmerte, als wollte es jeden Moment aus seiner Brust springen, aber er hatte Zeit. Der Typ an der Theke blickte immer noch in die andere Richtung und ließ sich offensichtlich Jackos Bitte, mitgenommen zu werden, durch den Kopf gehen. Schließlich, gerade als Joe den Griff der Pistole fest in der Hand hatte, reagierte der Fremde auf Jackos Vorschlag.
»Okay, ich nehme dich mit. Aber hol mir vorher noch zwei Flaschen Bourbon von der Theke.«
Joe sah, wie Jacko das Gesicht verzog, während er sich von seinem Stuhl erhob. »Äh, ich, na ja, ich habe kein Geld.«
Der Mann seufzte, dann griff er mit der rechten Hand in die linke Innentasche seiner Lederjacke. Er zog eine schwere graue Pistole heraus. Während er sich zur Theke umwandte, streckte er den Arm aus und richtete die Pistole auf Joes Hals. Joes Augen quollen hervor, aber er riss seine eigene Waffe so schnell er konnte aus der Schublade und zielte damit auf den Mann in Schwarz.
Was folgte, war ein lauter Knall, der bestimmt kilometerweit im Umkreis zu hören war. Die weißen Porzellanbecher auf dem Regalbrett hinter Joes Kopf waren plötzlich mit dem Blut bespritzt, das aus einem klaffenden Loch in seinem Nacken sprudelte.
Die Mordserie des Tages hatte begonnen.
DREI ♦
Sanchez hasste Fahrten mit dem Autobus. Um ganz ehrlich zu sein, er hatte für jede Art Reise so gut wie nichts übrig, aber eine allem Anschein nach niemals endende Busfahrt ohne offenkundiges Ziel stand auf der Liste der Dinge, die er niemals unternehmen wollte, fast an erster Stelle. Nur seine eigene Pisse zu trinken rangierte noch darüber. Diese spezielle Busfahrt hatte sich einem Drei-Stunden-Flug angeschlossen. Er war auch nicht gerade begeistert vom Fliegen. Tatsache war, dass er niemals in dem Bus gesessen hätte, wenn er nicht Gewinner eines zweiwöchigen Überraschungsurlaubs inklusive aller Nebenkosten gewesen wäre.
Sanchez war in seiner Heimatstadt Santa Mondega als Geizhals bekannt, daher hatte es niemanden verwundert, dass er den Vorteil des kostenlosen Erste-Klasse-Flugs und die Unterbringung in irgendeinem geheimnisvollen Fünfsternehotel irgendwo in Nordamerika genutzt hatte. Er konnte durchaus nach Detroit unterwegs sein oder zu irgendeinem anderen schrecklichen Ort, aber das war ihm egal. Es war einfach befreiend, dass die Reise ihn an Halloween aus Santa Mondega herausgeführt hatte, an einem Tag, an dem es in dem Ort noch schlimmer zuging als üblich. Und das wollte etwas heißen.
Es war dazu gekommen, weil er eine Weile zuvor eine Umfrage für einen Internet Dating Service ausgefüllt hatte, der den Urlaub als Preis für den interessantesten Single in jeder Stadt seiner Region verschenkt hatte. Doch zu Sanchez’ großer Enttäuschung hatte es bei der Auswahl des interessantesten Singles in Santa Mondega ein Unentschieden gegeben. Ärgerlicherweise war der andere Gewinner im Flugzeug direkt neben ihn gesetzt worden und saß auch jetzt im Bus neben ihm. Und es war jemand, der ihm unendlich auf die Nerven ging.
Annabel de Frugyn, oder die »Mystische Lady«, wie sie sich lieber nennen ließ, war die örtliche Spinnerin. Sie war Wahrsagerin von Beruf, und eine miserable dazu – zumindest nach Sanchez’ Meinung. Bereits eine Minute nach dem Start prophezeite sie, dass sie gegen einen Berg rasen würden. Dann identifizierte sie zwei Fluggäste einige Reihen weiter vorne als potenzielle Terroristen. Sie hatten gehört, was sie gesagt hatte, und von diesem Augenblick an war Sanchez überzeugt, dass sie es auf ihn abgesehen hatten, nur weil er neben ihr saß. Das Einzige, was sie richtig vorausgesagt hatte, war, dass sie sowohl im Flugzeug wie auch im Bus nebeneinandersitzen würden. Und nun prophezeite sie etwas, das Sanchez noch beängstigender fand.
»Die Geister sagen mir, dass Sie und ich während der nächsten Tage sehr viel Zeit miteinander verbringen werden«, sagte sie heiter. Sie schenkte ihm ihr scheußliches Zahnlückengrinsen und ein nervtötendes Augenzwinkern.
Verdammte Scheiße, dachte Sanchez. Die ist mindestens sechzig. Und die reinste Schreckschraube. Sie war tatsächlich sechzig und damit genau doppelt so alt wie er. Also ganz und gar nicht die Art weiblicher Gesellschaft, die er sich für diesen Gratisurlaub erhofft hatte.
Es gab keinen freien Sitzplatz im Bus, und es war offensichtlich, dass es auch keine Paare gab. Jeder an Bord schien sein oder ihr Ticket durch die Teilnahme an der gleichen Umfrage gewonnen zu haben, an der auch Sanchez sich beteiligt hatte. So quetschten sich nun fünfundfünfzig alleinstehende Personen, von denen keine unter fünfundzwanzig Jahre alt war, in die Sitze. Die älteste und hässlichste war jedoch zweifellos die Mystische Lady, die neben Sanchez saß.
Ich muss sie so früh wie möglich loswerden, dachte er. Wenn er sich nicht in Acht nahm, kamen die Leute glatt auf die Idee, dass er sie mochte, und das könnte möglicherweise seine Chancen bei jeder der anderen Frauen im Bus ruinieren, die er als Kandidatinnen für seinen unwiderstehlichen Charme betrachtete. Vor allem war da eine attraktive portugiesische Frau zwei Reihen vor ihm auf der anderen Seite des Mittelgangs. Entweder hatte sie ihn schon während des größten Teils der Reise auf dem Kieker oder sie schielte oder war kurzsichtig. Egal was, es störte ihn nicht. Sie war definitiv eine bessere Partie als die alte Vogelscheuche neben ihm.
Es wurde Zeit, jegliche Missverständnisse von Anfang an auszuräumen, fand Sanchez und wandte sich mit dieser Absicht zu seiner Reisegefährtin um. »Ich schätze, Sie wissen, wie diese Überraschungsreisen verlaufen, Annabel«, sagte er, und seine Stimme troff geradezu vor Unaufrichtigkeit. »Wir werden wahrscheinlich schon früh getrennt und sehen uns erst wieder bei der Heimreise. Wenn überhaupt noch einmal.«
»Unsinn«, erwiderte Annabel lachend und schlug ihm mit der flachen Hand auf den Oberschenkel. »Da wir niemand anderen kennen, müssen wir zusehen, dass wir zusammenbleiben. Es ist doch viel netter, jemanden zu kennen, wenn man sich an einem fremden Ort aufhält, nicht wahr?« Ihre Hand blieb auf seinem Oberschenkel liegen. Er trug braune knielange Shorts aus einem der billigeren Synthetikstoffe, und sie war ihm während des Fluges am Hintern hochgerutscht, sodass Annabels Hand gefährlich nahe davor war, nacktes Fleisch zu berühren.
In dem Brief, der sein gewonnenes Flugticket enthielt, war ihm empfohlen worden, Kleidung für warmes Wetter einzupacken, daher trug Sanchez zu der Hose ein rotes kurzärmeliges Hawaiihemd. Als Vorsichtsmaßnahme hatte er auch noch eine braune Wildlederjacke eingepackt, aber dem Wetter nach zu urteilen, das sie bisher begleitet hatte, würde er sie nicht brauchen. Allerdings müsste er erst einmal Annabel abhängen. Er zwang sich zu einem höflichen Lächeln und antwortete mit zusammengebissenen zähnen auf ihren schwärmerischen Sermon.
»Oh ja, sicher. Natürlich. Das Problem ist nur, dass ich mich ziemlich schnell verlaufe, wenn ich in der Fremde bin. Ernsthaft. Gerade war ich noch da, und dann drehen Sie sich für einen kurzen Moment um und schon bin ich verschwunden.«
»Nun, dann muss ich darauf achten, dass ich Sie nicht aus den Augen verliere, nicht wahr? Keine Sorge, Schätzchen – ich achte schon darauf, dass Sie nicht auf der Strecke bleiben.« Abermals spürte Sanchez, wie ihre Hand seinen Oberschenkel drückte, und er schüttelte sich innerlich. Im Gegensatz zu ihm hatte sie dem Hinweis auf warmes Wetter keine Beachtung geschenkt und trug ein langes Kleid unter zwei Strickjacken. Eine war dunkelblau und verhüllte eine hässliche mottenzerfressene dunkelgrüne Jacke. Ihr langes graues Haar hing bis auf diese reizenden Kleidungsstücke herab und diente den Motten und anderem Ungeziefer als Weg, um von ihrem Kopf auf ihre Kleidung zu gelangen. Sanchez hätte am liebsten ihre Hand von seinem Oberschenkel gewischt, aber ihre vergilbten Fingernägel und die faltigen Hände ekelten ihn an. Wegen ihnen hätte sich sogar ein Leprakranker geschämt. Glücklicherweise nahm sie nach einer ziemlich langen Zeit die Hand von selbst weg und deutete durch das Fenster auf irgendetwas dicht am Straßenrand vor ihnen.
»Sehen Sie mal«, sagte sie aufgeregt. »Da ist ein Straßenschild. Können Sie erkennen, was darauf steht?«
Sie saßen jetzt seit zwei Stunden im Bus. Bei ihrer Ankunft auf einem Flugplatz namens Goodman’s Airfield hatte Sanchez zu seiner Überraschung festgestellt, dass dort kein Reiseführer auf sie wartete. Tatsächlich war niemand da, der ihnen erklärte, wohin sie überhaupt unterwegs waren. Er hatte herumgefragt, aber niemand hatte etwas gewusst. Sogar die Mystische Lady mit ihrem zweifelhaften Talent, in die Zukunft zu blicken, hatte keine Ahnung. Und alle beklagten sich, dass sie keine Netzverbindung für ihre Mobiltelefone hatten. Daher war ein Wegweiser etwas, das auf jeden Fall einer eingehenden Betrachtung wert war.
Seit ihrer Abfahrt vom Flugplatz waren sie auf einem verlassenen Highway durch eine ausgedörrte und eintönige Wüstenlandschaft gerollt. Der Busfahrer hatte mit niemandem gesprochen und sich geweigert, auf irgendwelche Fragen nach ihrem Bestimmungsort zu reagieren, geschweige denn sie zu beantworten. Er war ausgesprochen unfreundlich, aber auch ein ziemlich massiger Kerl, daher hatte sich niemand darüber aufgeregt und sich beklagt. Und bis zu diesem Punkt ihrer Reise waren sie an keinem einzigen Straßenschild vorbeigekommen, dem sie hätten entnehmen können, wo zum Teufel sie sich überhaupt befanden.
Während das Schild näher kam, blinzelte Sanchez durch das Fenster, um zu sehen, was darauf zu lesen war. Das Schild stand vor kilometerweitem Wüstengelände und wurde von einem fernen Panorama orangefarbener Hochebenen und Felsbastionen eingerahmt. Es war schwarz, mindestens drei Meter hoch und an die sieben Meter breit. Und darauf stand: WILLKOMMEN AUF DEVIL’S GRAVEYARD.
»Nett«, sagte Sanchez laut. »Sind nicht gerade die verdammten Bahamas, nicht wahr?« Annabel, die sicherlich um einiges aufgeregter war als er, zeigte es, indem sie mit der einen Hand erneut seinen Oberschenkel drückte und sich mit der anderen Hand auf den eigenen Oberschenkel schlug.
»Finden Sie das nicht einfach nur spannend?«, fragte sie. »Ich habe Santa Mondega seit Jahren nicht mehr verlassen. Ist das alles nicht ein großer Spaß? Junge, Junge, ich könnte jetzt einen Drink gebrauchen, um meine Nerven zu beruhigen.«
Sanchez seufzte, dann griff er in seine Jackentasche. Er holte eine kleine, flache silberne Flasche heraus.
»Da, trinken Sie«, bot er ihr düster an, schraubte die Flasche auf und reichte sie Annabel.
»Du liebe Güte! Was ist das denn?«, fragte sie, wobei ihre Augen in erwartungsvoller Vorfreude auf Alkohol lüstern glänzten.
»Das ist meine eigene Mischung. Ich hab sie für eine besondere Gelegenheit aufbewahrt.«
»Oh, Sanchez, Sie sind ein wahrer Gentleman.«
»Nicht der Rede wert.«
Annabel nahm die Flasche und trank einen kräftigen Schluck. Ein oder zwei Sekunden später begann sie zu husten. Sie verzog ihr ohnehin schon hässliches Gesicht zu einer furchtbaren Grimasse.
»Igitt! Das ist ja grauenhaft. Was ist das?«, fragte sie und würgte.
»Man muss sich erst daran gewöhnen. Sie müssen einfach durchhalten. Wenn wir erst einmal unser Reiseziel erreicht haben, wollen Sie nichts anderes mehr trinken.«
Die Mystische Lady schien nicht überzeugt zu sein. Zehn Minuten nach ihrem ersten Schluck von Sanchez’ Spezialgebräu hatte sie sich in der engen einzigen Toilette des Reisebusses eingeschlossen. Ihre angebliche Fähigkeit, die Zukunft vorherzusagen, hatte ihr nicht geholfen zu erkennen, dass Sanchez ihr eine Flasche mit seiner eigenen Pisse anbieten würde.
Noch wichtiger war jedoch, dass sie das Grauen nicht vorhergesehen hatte, das sie während ihres kurzen Aufenthalts auf Devil’s Graveyard erwartete. Ein Ort mit einem noch viel größeren Untotenproblem als Santa Mondega.
VIER ♦
Fast in derselben Sekunde verstaute der Bourbon Kid die Pistole in seiner Lederjacke und schob sie in ein verstecktes Holster unter seiner linken Achselhöhle. Wie in Zeitlupe begann Joes immer noch aufrechter Körper zu schwanken. Es war eine Folge von einzelnen Abläufen, die der Kid nur zu gut kannte – die Knie des Opfers würden gleich unter ihm nachgeben. Auf die Sekunde genau, bei drei, zitterte der Körper ein wenig, dann sackte er in sich zusammen und stürzte zu Boden wie eine Stoffpuppe. Auf dem Weg nach unten krachte das Gesicht des alten Mannes auf die Massivholztheke. Alles, was dort zurückblieb, war sein Blut. Einige aparte Spritzer befleckten die lange Reihe weißer Porzellanbecher hinter der Theke, während ein paar vereinzelte Tropfen eine Kollektion Keksriegel neben der Kasse zierten. Ein wahres Kunstwerk. Wenn der Kid sich entschlösse, dieses Arrangement zu signieren, könnte es ein Vermögen wert sein.
Zu seiner Linken hatte der Kid den Gast im roten Lederanzug erschrocken über das, was geschehen war, aufspringen sehen. Der Mann sagte nichts. Stattdessen ging er langsam hinüber zur Theke, um einen Blick auf die Leiche des Imbissinhabers zu werfen. Normalerweise suchten die Menschen ziemlich schnell das Weite, wenn der Kid begann, Leute wegzublasen, aber dieser Typ schien vergessen zu haben, dass der Killer immer noch zugegen war. Der Kid beobachtete, wie er sich über die Theke beugte und beim Anblick von Joes Leiche zusammenzuckte. Nachdem er ein paar Sekunden lang die sterbliche Hülle seines Freundes betrachtet hatte, schien dem Typ plötzlich einzufallen, dass der Kid im Raum war. Und natürlich seine Pistole. Langsam drehte er sich zu ihm um. Der Kid wartete auf seine Reaktion. Und, was noch wichtiger war, er wartete darauf, dass der Bursche endlich die Flaschen Bourbon holte, um die er ihn gebeten hatte, kurz bevor er Joe in den Hals schoss.
»Du hast ihn getötet«, sagte der Mann und stellte fest, was nicht zu leugnen war.
»Glaubst du?«
»Warum hast du das getan? Joe ist ein guter Kerl.«
»War.«
»Hä?«
»Er war ein guter Kerl. Jetzt ist er ein toter guter Kerl.«
»Er hat dir nichts getan.«
»Er hat mich mit einer Pistole bedroht, falls es dir nicht aufgefallen sein sollte.«
»Du hast deine Pistole zuerst gezogen!«
»Willst du, dass ich es noch einmal tue?«
»Nicht wirklich.«
»Wie heißt du, mein Sohn?«
»Jacko.«
»Richtig, Jacko, jetzt hör gut zu. Wenn du mir nicht, ehe ich bis drei gezählt habe, die beiden Flaschen Bourbon, die ich haben wollte, heranschaffst, hole ich meine Pistole wieder raus.«
Jacko nickte. »Ja, ich habe verstanden.« Er ging mit vorsichtigen Schritten hinter die Theke und starrte dabei auf den Boden. Er wollte wohl sichergehen, nicht in Blut zu treten. »Bourbon, hm?«, murmelte er.
»Genau.«
»Kommt sofort.«
»Bring auch Zigaretten mit.«
»Welche Sorte?«
»Egal.«
Der Kid nahm einen Texas-Schokoriegel aus dem Karton auf der Theke. Mit dem Zeigefinger schnippte er etwas vom Einwickelpapier, das blutiger Knorpel sein konnte, und riss dann das Papier an einem Ende auf. Er biss ein Stück von dem Riegel ab, entschied, dass der Geschmack annehmbar war, ließ Jacko in Ruhe, damit er die restlichen Posten auf der Einkaufsliste zusammensuchte, und kehrte nach draußen zu seinem Wagen zurück.
Der Kid hatte einen ausgeprägten Instinkt, wenn es darum ging, aufkommende Gefahr zu wittern. Er hatte sich zum Beispiel als sehr nützlich erwiesen, als er aus dem Augenwinkel beobachtet hatte, wie Joe unter der Theke nach irgendetwas griff. Es hätte ein Donut sein können, aber es bestand auch die entfernte Chance, dass es irgendeine Waffe war. Wie sich herausstellte, hatte er Recht gehabt, daher war die Kugel, die er dem alten Sack durch den Hals geschossen hatte, nicht vergeudet gewesen. Nun sagte ihm der gleiche Instinkt, dass Unheil im Anmarsch war. Zu Halloween kam das nicht gerade überraschend. Das hatte er auf die harte Art und Weise erfahren. Er hatte an Halloween zum ersten Mal gemordet. Vor genau zehn Jahren. Seitdem hatte er Hunderte von Leuten vom Leben zum Tod befördert – einige hatten es verdient und einige nicht –, aber keine dieser Tötungen war so schwer gewesen wie die erste.
Im zarten Alter von sechzehn Jahren seine Mutter mit sechs Kugeln ins Herz ins Jenseits zu schicken, war nichts anderes als traumatisch gewesen. Obgleich sie von einem Vampir gebissen worden war und sich vor seinen Augen in einen solchen verwandelt hatte. Sicher, erst als sie versuchte, ihn zu beißen, hatte er begriffen, dass er keine andere Wahl hatte, als sie zu töten. Aber wie nicht anders zu erwarten, war es ein prägender Moment in seinem Leben gewesen. Etwa genauso prägend wie die erste Flasche Bourbon, die er geleert hatte.
Und jetzt? Da war er nun an Halloween, zehn Jahre später, in einer Wüstengegend, bekannt als Devil’s Graveyard, und im Begriff, einen Anhalter mitzunehmen, der gekleidet war wie einer der Mitwirkenden des Thriller-Videos. Und er hatte nur noch zwei Kugeln übrig. Er besaß immer noch ein umfangreiches Waffenarsenal, aber keine Munition, nachdem er seine letzte Schrotpatrone für den jungen Cop im Streifenwagen verbraucht hatte. Das hatte er nun davon, dass er kurz vorher so viele Menschen getötet hatte. Wahrscheinlich hatte er noch einen harten Tag vor sich. Er spielte kurz mit dem Gedanken, Joes Pistolen, und sämtliche Munition einzustecken, die er finden konnte, doch er verwarf diese Idee. Er hatte nichts übrig für kleinkalibrige Pistolen und diese sah aus wie die sprichwörtliche Samstagabend-Handtaschenflak, zielgenau auf höchstens zwei Meter. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie in seiner Hand explodierte, war mindestens genauso groß wie die Wahrscheinlichkeit, das Ziel zu treffen und auszuschalten.
Der Sitz des Firebird war noch warm, als er sich hineinsinken ließ und durch die staubbedeckte Windschutzscheibe blickte. Die Scheibenwischer hatten genug von der Schmutzschicht entfernt, sodass er wenigstens sehen konnte, wohin er fuhr, doch die Flächen außerhalb der Reichweite der Scheibenwischer waren mit Sand, Staub und Schlamm beschmiert. Es war nicht zu leugnen, dass die Jagd durch die Wüste ihren Tribut gefordert hatte, aber der Wagen hatte ihn nicht im Stich gelassen. Das tat er niemals. Der nach seinen speziellen Wünschen aufgemotzte Motor war nicht nur stark genug, um die meisten anderen Fahrzeuge abzuhängen, sondern er war auch äußerst zuverlässig.
Er drehte den Zündschlüssel und ließ den Motor an. Gleichzeitig kam Jacko aus dem Imbiss, beladen mit ein paar Flaschen, die er sich von hinter der Theke geholt hatte. Der Kid lehnte sich zur Seite und öffnete die Beifahrertür. Sein neuer Mitfahrer stieg ein und legte zwei Flaschen Sam Cougar und zwei Flaschen Shitting-Monkey-Bier neben seine Füße auf den Wagenboden. Er zog die Tür zu und öffnete das Handschuhfach, um zwei Schachteln Zigaretten hineinzuwerfen, und schloss es gleich wieder. Der Kid war beeindruckt. Nicht viele Leute hatten den Mumm, in seinen Wagen einzusteigen. Zumindest nicht freiwillig. Und das zu tun, nachdem er soeben Zeuge geworden war, wie der Kid einen alten Mann kaltblütig niedergeschossen hatte – nun, dazu gehörte einiges an Mut. Trotzdem sah Jacko in seinem roten Lederkostüm wie ein Volltrottel aus.
Der Kid musterte Jacko durch die dunklen Gläser seiner Sonnenbrille und wartete darauf, dass er ihm den Weg zum Hotel Pasadena erklärte. Stattdessen fing die Michel-Jackson-Kopie an, Fragen zu stellen.
»Schätze, du bist der Bourbon Kid, oder nicht?«
»Was hat mich verraten?«
»Ich habe für solche Dinge einen sechsten Sinn.«
»Gut. Dann sollte dich dein sechster Sinn ab jetzt lieber nicht im Stich lassen. Denn wenn du einen Fehler machst und wir nur einmal falsch abbiegen, bist du ein toter Mann.«
»Okay. Bei der nächsten Kreuzung rechts abbiegen.«
Der Kid löste die Handbremse und rammte den Fuß aufs Gaspedal. Der Wagen ließ Sleepy Joe’s Diner hinter sich und schoss auf den Highway. Die durchdrehenden Hinterräder schleuderten eine Wolke aus Sand und Staub hoch. Als sie sich wieder gesenkt hatte, waren der Imbiss und die Tankstelle schon längst nicht mehr zu sehen.
An einer Kreuzung, knapp einen Kilometer die Straße hinunter, lenkte der Kid den Firebird nach rechts, wie Jacko es verlangt hatte. Der Wagen war von der bisherigen Fahrt mit Schmutz bedeckt, und diese ausgesprochen beschissene Betonstraße mit ihrer steinigen Fahrbahn und den zahlreichen Schlaglöchern bedeutete in keinerlei Hinsicht eine Verbesserung dieses Zustands.
»Was machst du denn ausgerechnet in dieser Gegend?«, fragte Jacko.
»Ich kümmere mich ausschließlich um meine Angelegenheiten. Ist dir schon mal der Gedanke gekommen, dass du lieber das Gleiche tun solltest?«
Es wäre sicherlich nicht allzu schwierig gewesen, aus dieser Antwort abzuleiten, dass der Kid wenig Lust auf Smalltalk hatte. Jacko schien das jedoch völlig zu entgehen.
»Ich hoffe, in dem Hotel an diesem Gesangswettbewerb teilzunehmen«, fuhr er fort. »Du hast doch schon mal von dieser Back-From-The-Dead-Show gehört, nicht wahr?«
Der Kid antwortete nicht oder löste den Blick auch nur für eine Sekunde von der Straße vor ihnen. Jacko fuhr unverdrossen fort: »Weißt du, ich bin ein Michael-Jackson-Double.«
Der Kid atmete tief durch die Nase ein, hielt die Luft für einen kurzen Moment an und atmete dann langsam aus. Er gab sich alle Mühe, ruhig zu bleiben. Es war ein innerer Kampf, den er oft auszufechten hatte, vor allem an Halloween. Schließlich hob er den Blick von der Fahrbahn und sah Jacko an. Als er schließlich redete, klangen seine Worte überraschend vernünftig.
»Da er mittlerweile tot ist, werden bei dieser Show sicherlich Tausende von Michael-Jackson-Kopien auftreten. Alle wollen von seinem Ruhm profitieren. Warum bist du nicht einfach nur du selbst?«
»Man muss irgendeinen berühmten toten Sänger spielen. Und falls du es noch nicht bemerkt haben solltest, ich bin nicht tot … oder berühmt.«
»Ich könnte dir zu beidem verhelfen.« Der raue, drohende Klang war wieder in die Stimme des Fremden zurückgekehrt.
Jacko runzelte die Stirn. »Ich vermute, du bist kein besonders geselliger Mensch, nicht wahr?«
»Das habe ich nicht nötig.«
»Meinst du? Nun, du wirst im Hotel eine ganze Menge Leute wie mich antreffen, und die sind eigentlich durch die Bank freundlich und umgänglich. Vielleicht solltest du mal ein wenig an deinen Umgangsformen arbeiten.«
Tiefe Stille setzte ein. Sogar der Firebird schien die Luft anzuhalten, bis der Kid knurrte: »Und du solltest lieber üben, die Klappe geschlossen zu halten.«
»Würde ich auch gerne tun«, erwiderte Jacko fröhlich, »aber ich muss meine Stimme aufwärmen.«
»Aber das tust du nicht in meinem Wagen.«
»Ach, nun komm schon, ich muss üben. Ich will beim Vorsingen für die Show den ›Earth Song‹ vortragen. Willst du mal hören?«
Der Kid krampfte die Hände um das Lenkrad. »Wenn du nur einen Ton von diesem Song singst, dann sorge ich dafür, dass die Schrei-Passagen ewig dauern.«
»Ich verstehe. Ich könnte auch ›Smooth Criminal‹ singen, wenn dir das lieber ist.«
Der Kid bremste scharf. Kreischend und mit qualmenden Reifen kam der Firebird schlingernd zum Stehen. »Raus«, knurrte der Fahrer.
Sogar Jacko erkannte, dass er es ernst meinte.
»Aber es ist noch ein ganzes Stück bis zum Hotel«, protestierte er. »Und du könntest dich ohne mich verfahren.«
Der Kid atmete mehrmals tief durch, während er überlegte, ob er eine Pistole herausholen und seinen Mitreisenden töten sollte oder nicht. Am Ende entschied er, ja, der Kerl verdiente den Tod, aber womit sollte er ihn töten? Mit bloßen Händen? Mit einem Messer? Oder sollte er ihm mit einem Pistolenknauf eins über den Schädel ziehen? Während er nach der Pistole in seiner Jackentasche griff, traf sein Mitfahrer eine weise Entscheidung.
»Ich sage jetzt nichts mehr. Ich erkläre dir nur noch den Weg. Wie wäre das?«
»Du würdest dann auf jeden Fall länger leben.«
»Cool.«
Der Kid trat aufs Gaspedal und der Wagen jagte den verlassenen Highway hinunter und wirbelte hinter sich eine weitere Wolke aus Staub, Sand und Auspuffgasen auf.
»Nach etwa drei Kilometern gabelt sich die Straße«, sagte Jacko. »Halte dich rechts, wenn du dort bist.«
Sie folgten dem Highway weitere zwei Minuten, bis die Gabelung in Sicht kam. Der Kid folgte den Anweisungen und nahm die rechte Abzweigung. Der Friede und die Ruhe im Wagen taten ihm gut, aber er spürte, dass die Stille seinem Mitfahrer Unbehagen verursachte. Zu wissen, dass dieser Schwachsinnige jeden Moment wieder zu labern anfangen würde, reichte aus, um ihn in Rage zu bringen. Und tatsächlich, genau wie der Kid erwartet hatte, begann Jacko schließlich wieder zu reden.
»Hat dieser Wagen kein Radio?«
»In dieser Scheißwüste hat man weder einen TV- noch einen Radio- oder Mobiltelefonsignalempfang. Man ist hier total abgeschnitten. Genau so wie ich es liebe.«
»Nun, ich könnte ein paar Melodien pfeifen. Dann hätten wir für den Rest der Fahrt ein wenig Unterhaltung.«
»Aber mit gebrochenem Hals wirst du das schlecht können.«
Jacko öffnete den Mund, um etwas darauf zu erwidern, aber aufgrund eines plötzlichen Anfalls von gesundem Menschenverstand entschied er sich dagegen. Die beiden redeten für den Rest der Fahrt kein Wort mehr miteinander außer einer letzten Anweisung Jackos, als er dem Kid riet, an einer Einmündung nach links abzubiegen. Eine halbe Stunde Schweigen später bog der schwarze Pontiac Firebird auf die lange Auffahrt ein, die von der Straße zum Hotel Pasadena hinaufführte. Erstaunlich wenige Wagen waren zu sehen, während er zum Hoteleingang rollte. Ein junger Hoteldiener mit buschigem dunklem Haar erwartete sie am Fuß der Treppe zur Rezeption. Menschen liefen ständig rein und raus, und durch die doppelte Glastür des Hoteleingangs waren im Foyer viele offenbar reiche Leute zu sehen.
Als der Wagen vor dem Hotel anhielt, näherte sich der Hoteldiener. Er war Anfang zwanzig und seine Uniform bestand aus einem weißen Hemd, einer roten Weste und einer schwarzen Hose. Der Kid schaute zu Jacko, der eine Hand auf den Türgriff legte, um auszusteigen.
»Du bleibst im Wagen. Achte darauf, dass der Diener keine Beule in den Wagen fährt.«
Jacko nickte. »Okay.«
»Und gib mir eine Packung Zigaretten.«
Jacko griff ins Handschuhfach und holte eine der Zigarettenschachteln heraus, die er kurz vorher dort deponiert hatte. Er warf sie dem Kid zu, der sie auffing und in der Innentasche seiner Jacke verstaute. Während er die Fahrertür öffnete, gab er seinem Fahrgast noch eine letzte Instruktion. »Wenn der Diener den Wagen geparkt hat, vergiss nicht, ihm ans Knie zu fassen.«
»Wie bitte?«
»Fass ihm an sein Knie und drück es, nur einmal. Das ist in diesem Laden so üblich. Wenn du es nicht tust, sind sie richtig angefressen.«
Jacko war zutiefst verwirrt. »Herrgott im Himmel, vielen Dank. Das wusste ich überhaupt nicht.«
»Schon gut.« Der Kid stieg aus dem Wagen und zog einen Einhundertdollarschein aus seiner Gesäßtasche. Er schob ihn dem Diener unauffällig in die rechte Hand. Das Gesicht des jungen Latino begann zu strahlen.
»Hey, danke, Mister.«
Der Kid deutete mit einem Kopfnicken auf Jacko auf dem Beifahrersitz. »Siehst du ihn?«, fragte er.
Der Diener warf einen Blick in den Wagen und entdeckte Jacko mit seinem dauergewellten schwarzen Haar und seinem roten Lederanzug. Er grinste ihn an. »Ja, ich sehe ihn.« Er klang wachsam.
»Wenn er dein Knie berührt, verpass ihm eins in seine Fresse.«
Während er die Treppe zum Hoteleingang hinaufging, überkam den Kid das Gefühl, dass er Jacko wiedersehen würde, ehe der Tag zu Ende wäre. Sei Instinkt sagte ihm, dass an diesem Michael-Jackson-Imitator etwas nicht ganz so war, wie es sein sollte.
Er hatte nur noch nicht herausbekommen, was das sein könnte.
FÜNF ♦
Das Hotel Pasadena war aus der Nähe betrachtet genauso eindrucksvoll wie von Weitem. Die Wüstensonne wurde von den vielen Fenstern des vierzigstöckigen Gebäudes reflektiert, wodurch der Eindruck entstand, dass sie auf einen gigantischen Spiegel zufuhren. Je näher der Bus kam, desto prachtvoller sah der Bau aus. Der Bus bog nach rechts vom Highway ab und rollte durch eine mit gusseisernen Bögen überwölbte Einfahrt in einer weißen Betonmauer, die das Hotelgrundstück umgab. Über der Einfahrt prangte ein Schild mit einem Namen in hellroten, metallisch glänzenden Lettern.
HOTEL PASADENA.
Sag bloß, dachte Sanchez.
Eine fast vierhundert Meter lange betonierte Zufahrt führte zum Hoteleingang. Während der Bus zur Rückseite des Gebäudes weiterfuhr, starrte Sanchez mit offenem Mund auf die überwältigende Pracht der Anlage. Vielleicht war das Ganze doch nicht so übel. In Santa Mondega gab es kein einziges Gebäude, das dem hier auch nur entfernt nahekam. Das örtliche Museum war durchaus beeindruckend, sah jedoch neben diesem geradezu monströsen Bauwerk alt und baufällig aus.
Der Bus parkte auf dem hinteren Teil eines im Gegensatz zu dem auffälligen Mangel an Fahrzeugen vor dem Hotel außerordentlich dicht besetzten Parkplatzes. Nachdem er sein Reisegepäck aus dem Kofferabteil des Busses geangelt hatte, eilte Sanchez mit – für seine Verhältnisse – schnellen Schritten in die vordere Eingangshalle des Hotels, ehe Annabel, die Mystische Lady, sich wieder an ihn hängen konnte. Vier breite weiße Marmorstufen bildeten den Aufgang zu einer imposanten gläsernen Doppeltür. Sanchez nahm jeweils zwei Stufen auf einmal und rannte fast durch die automatischen Türen, die sich für ihn öffneten, als er die oberste Stufe erreichte.
Auch das Foyer war riesig. Von der fast fünfzehn Meter hohen Decke hing ein prunkvoller Leuchter herab, in dessen mehreren tausend geschliffenen Kristallglastrauben sich das Licht brach. Der Fußboden bestand aus auf Hochglanz polierten, einander abwechselnden grauen und schwarzen Marmorplatten und weckte in Sanchez den dringenden Wunsch, sich die Schuhe auszuziehen, um ihn nicht zu beschädigen.
Und hier war die Hölle los! Offenbar war soeben die halbe freie Welt im Begriff einzuchecken. Überall drängten sich Leute mit Koffern und Reisetaschen und erzeugten einen dichten Lärmteppich. Sanchez hatte nicht viel für den Kontakt mit anderen Menschen übrig, und nach einer langen Reise in direkter Nachbarschaft mit jemandem, den er, in seinen freundlicheren Momenten, als schwachsinnige alte Krähe betrachtete, war er nicht gerade der Tolerantesten einer. Das ständige Gewusel vor ihm brachte seine Stimmung auf den Nullpunkt. Etwa einhundert Leute eilten vor ihm durch das Foyer. Es war groß genug, um jedem ausreichend Platz zu bieten, aber seine runde Form hatte zur Folge, dass jeder Laut von den cremeweißen Wänden zurück und direkt in Sanchez’ Ohren geworfen wurde.
Sanchez sah zu seiner Erleichterung, dass zahlreiche Gepäckträger, Pagen und Empfangsdamen sich um die Gäste kümmerten, die sich vor der Rezeption drängten. Das tröstete ihn ein wenig, da das Einchecken in einem Hotel ungefähr die verhassteste Tätigkeit war, die er sich vorstellen konnte. Er empfand sie als genauso schlimm, wie sich den Oberschenkel von einer abstoßenden Wahrsagerin tätscheln zu lassen.
Er erkannte schnell, dass seine Zeit mit dem Angaffen der Dimensionen und Üppigkeit seiner Umgebung zu vertrödeln ihn wahrscheinlich um die Chance bringen würde, schnell abgefertigt zu werden. Einige Leute hatten ihn bereits auf dem Weg zum Rezeptionstisch überholt. Infolgedessen schaltete Sanchez einen Gang höher und nahm Kurs auf eine der sechs Empfangsdamen. Sie saßen in einer Reihe hinter dem brusthohen Eichenpult und hatten jeweils einen Computerbildschirm vor sich. Fünf von ihnen waren bereits beschäftigt, aber die Bestaussehende schien frei zu sein.