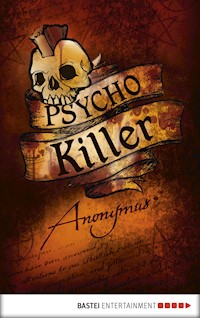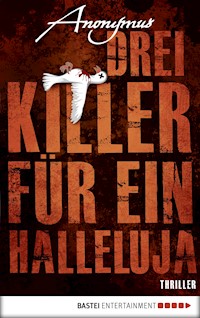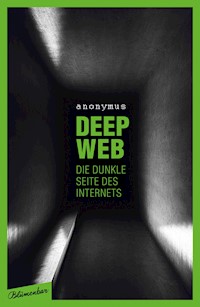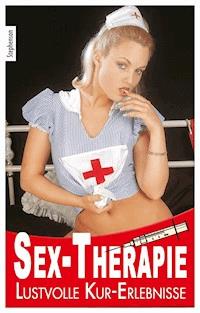4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Bourbon Kid
- Sprache: Deutsch
Das Kultbuch jetzt endlich als preisgünstiges E-Book! Ein wilder und blutrünstiger Ritt!
In Santa Mondega bricht die Hölle los: Ein Buch ohne Titel und ohne Autor tötet jeden, der es liest. Ein geheimnisvoller blauer Stein ist plötzlich verschwunden - und alle suchen ihn. Eine Sonnenfinsternis wird das gesetzlose Städtchen bald in völlige Dunkelheit tauchen, und dann wird es blutig werden. Blutiger als es sich irgendjemand vorstellen kann. Denn ein Killer ist in der Stadt: The Bourbon Kid. Und er ist nicht der einzige - aber der durchgeknallteste.
Allein Detective Miles Jensen, Chief Detective für übernatürliche Fälle, kann das alles verhindern. Doch er hat keine Ahnung, worauf er sich eingelassen hat: Denn Santa Mondega hat mehr zu bieten als nur ein paar Gangster und den üblichen Abschaum. Der Ort ist voll von Kopfgeldjägern, Kung-Fu-Mönchen, Vampiren ... und einem äußerst gefährlichen Elvis-Imitator.
Band 1 der SPIEGEL-Bestseller-Reihe um den verrückten Killer Bourbon Kid - Quentin Tarantino und Robert Rodriguez hätten ihre helle Freude daran.
Massenhaft begeisterte Leserrezensionen bei Amazon: "Ein absoluter Pageturner ... supergut geschrieben, voll schwarzem Humor ..." - "Erfrischend neu, erschreckend witzig, entsetzlich spannend" - "Ich habe noch nie etwas Vergleichbares gelesen!"
Bourbon Kid metzelt weiter in:
Band 2: Das Buch ohne Staben
Band 3: Das Buch ohne Gnade
Band 4: Das Buch des Todes
eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 605
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Inhalt
Cover
Grußwort des Verlags
Über dieses Buch
Titel
Vorwort
Eins
Zwei
Drei
Vier
Fünf
Sechs
Sieben
Acht
Neun
Zehn
Elf
Zwölf
Dreizehn
Vierzehn
Fünfzehn
Sechzehn
Siebzehn
Achtzehn
Neunzehn
Zwanzig
Einundzwanzig
Zweiundzwanzig
Dreiundzwanzig
Vierundzwanzig
Fünfundzwanzig
Sechsundzwanzig
Siebenundzwanzig
Achtundzwanzig
Neunundzwanzig
Dreißig
Einunddreißig
Zweiunddreißig
Dreiunddreißig
Vierunddreißig
Fünfunddreißig
Sechsunddreißig
Siebenunddreißig
Achtunddreißig
Neununddreißig
Vierzig
Einundvierzig
Zweiundvierzig
Dreiundvierzig
Vierundvierzig
Fünfundvierzig
Sechsundvierzig
Siebenundvierzig
Achtundvierzig
Neunundvierzig
Fünfzig
Einundfünfzig
Zweiundfünfzig
Dreiundfünfzig
Vierundfünfzig
Fünfundfünfzig
Sechsundfünfzig
Siebenundfünfzig
Achtundfünfzig
Neunundfünfzig
Sechzig
Einundsechzig
Zweiundsechzig
Dreiundsechzig
Vierundsechzig
Fünfundsechzig
Über den Autor
Weitere Titel des Autors
Impressum
Liebe Leserin, lieber Leser,
vielen Dank, dass du dich für ein Buch von beTHRILLED entschieden hast. Damit du mit jedem unserer Krimis und Thriller spannende Lesestunden genießen kannst, haben wir die Bücher in unserem Programm sorgfältig ausgewählt und lektoriert.
Wir freuen uns, wenn du Teil der beTHRILLED-Community werden und dich mit uns und anderen Krimi-Fans austauschen möchtest. Du findest uns unter be-thrilled.de oder auf Instagram und Facebook.
Du möchtest nie wieder neue Bücher aus unserem Programm, Gewinnspiele und Preis-Aktionen verpassen? Dann melde dich auf be-thrilled.de/newsletter für unseren kostenlosen Newsletter an.
Spannende Lesestunden und viel Spaß beim Miträtseln!
Dein beTHRILLED-Team
Melde dich hier für unseren Newsletter an:
Über dieses Buch
In Santa Mondega bricht die Hölle los: Ein Buch ohne Titel und ohne Autor tötet jeden, der es liest. Ein geheimnisvoller blauer Stein ist plötzlich verschwunden – und alle suchen ihn. Eine Sonnenfinsternis wird das gesetzlose Städtchen bald in völlige Dunkelheit tauchen, und dann wird es blutig werden. Blutiger als es sich irgendjemand vorstellen kann. Denn ein Killer ist in der Stadt: The Bourbon Kid. Und er ist nicht der einzige – aber der durchgeknallteste.
Allein Detective Miles Jensen, Chief Detective für übernatürliche Fälle, kann das alles verhindern. Doch er hat keine Ahnung, worauf er sich eingelassen hat: Denn Santa Mondega hat mehr zu bieten als nur ein paar Gangster und den üblichen Abschaum. Der Ort ist voll von Kopfgeldjägern, Kung-Fu-Mönchen, Vampiren … und einem äußerst gefährlichen Elvis-Imitator.
Band 1 der SPIEGEL-Bestseller-Reihe um den verrückten Killer Bourbon Kid – Quentin Tarantino und Robert Rodriguez hätten ihre helle Freude daran.
A N O N Y M U S
Band 1
Roman (wahrscheinlich)
Aus dem Englischen von Axel Merz
Verehrter Leser!
Nur wer reinen Herzens ist, mag auf die Seiten dieses Buches blicken.
Jede umgeblätterte Seite, jedes gelesene Kapitel bringt ihn dem Ende näher.
Nicht alle werden es schaffen. Die zahlreichen unterschiedlichen Handlungsstränge und Stilrichtungen mögen manch einen verwirren und blenden, und obwohl sie gleich vor ihm liegt, ihn während der ganzen Zeit unablässig nach der Wahrheit suchen lassen.
Die Dunkelheit wird kommen, und mit ihr großes Übel.
Diejenigen, die dieses Buch gelesen haben, werden das Licht vielleicht niemals wieder erblicken.
Anonymus
EINS ♦
Sanchez hasste es, wenn Fremde in seine Bar kamen. Genau genommen hasste er auch seine Stammgäste, doch er schwieg, weil er Angst vor ihnen hatte. Einen Stammgast abzuweisen wäre gewesen, als hätte er sein eigenes Todesurteil unterzeichnet. Die Kriminellen und Verbrecher, die im Tapioca verkehrten, waren stets auf der Suche nach einer Gelegenheit, sich innerhalb der vier Wände des Lokals zu beweisen, weil auf diese Weise jeder, der irgendetwas darstellte in der Welt der Kriminellen, davon erfahren würde.
Das Tapioca war eine Bar mit echtem Charakter. Die Wände waren gelb, doch es war ganz und gar kein hübscher Gelbton, sondern eher eine von Tabakrauch hervorgerufene Abwesenheit jeder anderen Farbnuance. Keine große Überraschung, weil eines der zahlreichen ungeschriebenen Gesetze der Tapioca Bar lautete, dass jeder, der dort verkehrte, rauchen musste: Zigarren, Pfeifen, Zigaretten, Joints, Wasserpfeifen, Zigarillos, Bongs, alles war akzeptabel außer Nichtrauchen. Nichtrauchen war vollkommen inakzeptabel. Keinen Alkohol zu trinken wurde ebenfalls als Sünde angesehen, doch die größte Sünde von allen war es, als Fremder dieses Lokal zu betreten. Niemand dort mochte Fremde. Fremde waren schlechte Neuigkeiten. Fremden konnte man nicht trauen.
Als eines Tages ein Mann in einem langen schwarzen Umhang mit über den Kopf gezogener Kapuze die Bar betrat und sich am Ende der Theke auf einen Holzhocker niederließ, rechnete Sanchez nicht damit, dass der Fremde es heil und an einem Stück wieder nach draußen schaffen würde.
Die vielleicht zwanzig Stammgäste an den Tischen unterbrachen ihre Unterhaltungen und nahmen sich einen Moment Zeit, um den die Theke besetzenden Kapuzenmann abzuschätzen. Sanchez bemerkte, dass sie nicht nur aufgehört hatten zu reden, sondern auch zu trinken. Gar kein gutes Zeichen. Falls Musik zuvor im Hintergrund gespielt hatte, so hatte sie zweifelsohne in dem Augenblick aufgehört, als der Fremde eingetreten war. Nun jedoch war nichts mehr zu hören außer dem stetigen Surren des großen Ventilators an der Decke.
Sanchez ignorierte seinen neuesten Gast demonstrativ, indem er tat, als hätte er ihn nicht gesehen. Was natürlich nur so lange funktionierte, wie der Fremde den Mund nicht öffnete.
»Barmann. Bringen Sie mir einen Bourbon.«
Der Mann sprach ohne aufzublicken. Er hatte seinen Drink bestellt, ohne Sanchez zur Kenntnis zu nehmen, und da die Kapuze nach wie vor das Gesicht überschattete, war es nicht möglich zu erkennen, ob er genauso bösartig aussah, wie er klang. Seine Stimme besaß genügend Rauheit, um damit Holz zu bearbeiten (in dieser Gegend des Landes wurde die Gefährlichkeit eines Fremden danach beurteilt, wie rau seine Stimme klang). Unter Berücksichtigung dieser Regel nahm Sanchez ein halbwegs sauberes Whiskyglas und ging zu der Stelle, wo der Fremde saß. Er stellte das Glas direkt vor dem Fremden auf den klebrigen Tresen aus zerschrammtem Holz und erlaubte sich einen flüchtigen Blick in die Finsternis unter der schwarzen Kapuze. Doch die Schatten waren zu dunkel, um irgendetwas zu erkennen, und er wollte nicht riskieren, beim Gaffen erwischt zu werden.
»Auf Eis«, murmelte der Mann so leise, dass es kaum zu verstehen war. Mehr ein raues Flüstern eigentlich.
Sanchez griff mit einer Hand unter den Tresen und brachte eine halbvolle Flasche mit der Aufschrift »Bourbon« zum Vorschein, bevor er mit der anderen zwei Eiswürfel einsammelte. Er ließ die Eiswürfel ins Glas fallen und den Whisky darüberlaufen. Er füllte das Glas knapp über die Hälfte, dann stellte er die Flasche wieder unter den Tresen zurück.
»Das macht drei Dollar.«
»Drei Dollar?«
»Jepp.«
»Machen Sie das Glas voll.«
Die Unterhaltungen in der Bar waren gedämpft gewesen, seit der Fremde das Lokal betreten hatte, doch nun kehrte buchstäblich Grabesstille ein. Mit Ausnahme des Deckenventilators, der im Gegenteil plötzlich lauter zu werden schien. Sanchez, der zu diesem Zeitpunkt bereits den Augenkontakt mit jedem seiner Stammgäste vermied, nahm die Flasche erneut hervor und füllte das Glas bis zum Rand. Der Fremde gab ihm eine Fünf-Dollar-Note.
»Behalten Sie den Rest.«
Der Barmann drehte sich um und tippte den Whisky in seine Registrierkasse. Dann wurden die leisen Geräusche der Transaktion plötzlich von Worten durchbrochen. Hinter sich vernahm er die Stimme von Ringo, einem seiner unangenehmsten Stammgäste. Auch er zeichnete sich durch eine raue Stimme aus, wie nicht anders zu erwarten, und wollte wissen: »Was machst du in unserer Bar, Fremder? Was hast du hier zu suchen?«
Ringo saß mit zwei anderen Männern an einem Tisch nur wenige Meter hinter dem Fremden. Er war ein großer, schwerer, unrasierter Widerling, genau wie die meisten anderen zwielichtigen Typen in der Bar. Und genau wie jene hatte auch er eine Pistole in einem Halfter an der Hüfte, und er brannte auf einen Vorwand, sie zu ziehen.
Sanchez, noch immer an der Registrierkasse hinter dem Tresen, atmete tief durch und bereitete sich auf den Tumult vor, der unausweichlich kommen würde.
Ringo war ein berüchtigter Gesetzloser, der sich so gut wie jedes vorstellbaren Verbrechens schuldig gemacht hatte: Vergewaltigung, Mord, Brandstiftung, Diebstahl, Polizistenmord, was auch immer – Ringo hatte sie alle begangen. Nicht ein Tag verstrich, an dem er nicht irgendetwas Illegales machte, das ihn ins Gefängnis bringen konnte. Dieser Tag bildete keine Ausnahme. Er hatte bereits drei Männer mit vorgehaltener Kanone ausgeraubt, und nun, nachdem er den größten Teil seines auf diese Weise erworbenen Geldes in Bier investiert hatte, war er auf einen richtigen Streit aus.
Als Sanchez sich von der Kasse zum Schankraum umwandte, sah er, dass sich der Fremde weder bewegt noch seinen Drink angerührt hatte. Für ein paar grauenvolle Sekunden antwortete er nicht auf Ringos Frage. Sanchez hatte einmal zugesehen, wie Ringo einem Mann ins Knie geschossen hatte, weil er nicht schnell genug mit seiner Antwort gewesen war. Deswegen atmete er erleichtert auf, als sich der Fremde zu einer Antwort herabließ – unmittelbar bevor Ringo seine Frage wiederholen musste.
»Ich suche keinen Streit.«
Ringo grinste bösartig und grollte (mit rauer Stimme): »Nun, ich bin Streit, und wie es aussieht, hast du mich trotzdem gefunden.«
Der Mann mit der Kapuze reagierte nicht. Er saß nur auf seinem Hocker und starrte seinen Drink an. Ringo erhob sich von seinem Stuhl und trat zu dem Fremden. Er lehnte sich neben ihm gegen den Tresen, streckte die Hand aus und riss dem Mann unsanft die Kapuze vom Kopf, sodass das gemeißelte, wenngleich unrasierte Gesicht eines Blondschopfs Anfang dreißig zum Vorschein kam. Der Blondschopf hatte blutunterlaufene Augen, was einen Kater vom Vorabend vermuten ließ, oder vielleicht war er zu früh aus einem trunkenen Schlaf gerissen worden.
»Ich will wissen, was du hier zu suchen hast, Kerl«, wollte Ringo wissen. »Uns sind Geschichten über einen Fremden zu Ohren gekommen, der heute Morgen in dieser Stadt eingetroffen ist. Dieser Fremde scheint zu glauben, er wäre ein harter Bursche. Glaubst du auch, du bist ein harter Bursche?«
»Ich bin kein harter Bursche.«
»Dann nimm deinen Mantel und mach, dass du verdammt noch mal von hier verschwindest!« Wie es mit Befehlen manchmal so ist – auch dieser hier hatte seine Grenzen. Der Fremde hatte seinen Umhang gar nicht abgelegt.
Er dachte für eine kurze Weile über Ringos Vorschlag nach, dann schüttelte er den Kopf.
»Ich kenne den Fremden, von dem Sie sprechen«, sagte er mit seiner rauen Stimme. »Und ich weiß, warum er hier ist. Ich erzähle Ihnen alles, wenn Sie mich danach in Ruhe lassen.«
Unter einem dunklen, dreckigen Schnurrbart breitete sich ein breites Grinsen über Ringos Gesicht aus. Er drehte sich zu seinem Publikum um. Die vielleicht zwanzig anderen Stammgäste saßen alle an Tischen und beobachteten gespannt, wie sich die Ereignisse entfalteten. Der Anblick des grinsenden Ringo lockerte die Spannung ein wenig, obwohl jeder im Lokal wusste, dass sich die Stimmung schon bald wieder verdüstern würde. Das hier war schließlich das Tapioca.
»Was meint ihr, Jungs? Soll uns dieser hübsche Bursche hier eine Geschichte erzählen?«
Ein lautstark zustimmender Chor antwortete, gefolgt von anstoßenden Gläsern. Ringo legte den Arm um den blonden Fremden und drehte ihn auf seinem Hocker um, sodass er die anderen ansah.
»Komm schon, Blondschopf – erzähl uns von diesem bösen Fremden. Was will er in meiner Stadt?«
In Ringos Stimme war ein spöttischer Unterton, der den blonden Mann jedoch nicht im Mindesten zu beeindrucken schien. Er begann zu sprechen.
»Vorhin war ich in einer Bar ein paar Meilen die Straße runter, und da kam dieser große, wild aussehende Kerl rein, setzte sich an die Theke und bestellte einen Drink.«
»Wie sah er aus?«
»Na ja, zuerst konnte man sein Gesicht nicht erkennen, weil er so eine große Kapuze trug. Aber dann ging irgend so ein Punkarsch zu ihm und zerrte ihm die Kapuze runter.«
Ringo grinste nicht mehr. Er vermutete, dass sich der Blonde über ihn lustig machte, also beugte er sich vor und straffte seinen Griff um die Schulter des anderen.
»Erzähl mir, Freund, was ist als Nächstes passiert?«, erkundigte er sich drohend.
»Also der Fremde, der im Übrigen ein gut aussehender Bursche ist, kippt seinen Drink in einem Zug, zieht eine Kanone und tötet jedes einzelne Arschloch in der Kneipe … mit Ausnahme von mir und dem Barmann.«
»Soso«, sagte Ringo und nahm einen tiefen Atemzug durch schmutzige Nasenlöcher. »Ich kann ja verstehen, dass er den Barmann am Leben gelassen hat, aber ich sehe keinen vernünftigen Grund, warum er dich nicht ebenfalls umgebracht hat.«
»Sie wollen wissen, warum er mich nicht umgebracht hat?«
Ringo zog seine Kanone aus dem Halfter, das an dem breiten schwarzen Ledergürtel baumelte, und zielte auf das Gesicht des Fremden. Er drückte ihm den Lauf fast in die Wange.
»Ja. Ich will wissen, warum dieser Hundesohn dich nicht erledigt hat.«
Der Fremde starrte Ringo hart in die Augen, ohne den Revolver an seiner Backe zu beachten. »Nun ja«, sagte er. »Er hat mich nicht erledigt, weil er wollte, dass ich in dieses Drecksloch gehe und ein fettes Arschloch finde, das auf den Namen Ringo hört.«
Die Betonung, die der Fremde auf die beiden Worte »fett« und »Arschloch« legte, entging Ringos Aufmerksamkeit keineswegs. Und doch blieb er in der betäubten Stille, die auf diese Bemerkung folgte, bemerkenswert ruhig. Wenigstens nach seinen eigenen Maßstäben.
»Ich bin Ringo. Wer zur Hölle bist du, Blonder?«
»Das ist nicht wichtig.«
Die beiden schmierigen Halunken, die zusammen mit Ringo am Tisch gesessen hatten, erhoben sich. Beide machten einen Schritt in Richtung Theke, bereit, den gemeinsamen Freund zu unterstützen.
»Es ist wichtig«, sagte Ringo übellaunig. »Weil es heißt, dass dieser Kerl, dieser Fremde, von dem wir gehört haben, sich selbst ›The Bourbon Kid‹ nennt. Und du trinkst da gerade Bourbon, oder?«
Der blonde Mann warf einen Blick auf die beiden compadres von Ringo, dann sah er über den Lauf von Ringos Waffe.
»Wissen Sie, warum man ihn ›The Bourbon Kid‹ nennt?«, fragte er.
»Klar weiß ich!«, rief einer von Ringos Freunden hinter ihm. »Es heißt, wenn der Kerl einen Bourbon trinkt, verwandelt er sich in ein beschissenes Monster, in einen Psychopathen, und er dreht völlig durch und tötet jeden in Sicht. Es heißt, er wäre unbesiegbar und kann nur vom Teufel persönlich erledigt werden.«
»Das ist richtig«, sagte der blonde Mann. »The Bourbon Kid tötet jeden. Es braucht weiter nichts als einen einzigen Drink, und er dreht völlig durch. Es heißt, der Bourbon verleiht ihm besondere Kräfte. Sobald er auch nur einen Schluck davon getrunken hat, erledigt er jeden verdammten Hurensohn im Laden. Ich muss es wissen. Ich hab es selbst gesehen.«
Ringo drückte dem Fremden den Lauf seiner Waffe hart gegen die Schläfe. »Los, trink deinen Bourbon.«
Der Fremde drehte sich langsam auf seinem Barhocker zum Tresen um und griff nach seinem Drink. Ringo folgte seinen Bewegungen und hielt ihm die Waffe unablässig gegen die Schläfe.
Hinter dem Tresen trat Sanchez beiseite in der Hoffnung, kein Blut und kein Gehirn abzukriegen, das möglicherweise in seine Richtung spritzte. Oder den einen oder anderen Querschläger, was das angeht. Er beobachtete, wie der Blonde sein Glas in die Hand nahm. Jeder normale Mann hätte so sehr gezittert, dass er die Hälfte seines Drinks verschüttet hätte – nicht so dieser Bursche. Der Fremde war so kalt wie das Eis in seinem Glas, das musste man ihm lassen.
Inzwischen war jeder Mann in der Tapioca Bar auf den Beinen, um zu sehen, was dort vorn geschah, und jeder einzelne hatte eine Hand an seiner Waffe. Sie alle beobachteten, wie der Fremde das Glas vor sein Gesicht hielt und den Inhalt inspizierte. Eine Schweißperle glitt außen am Glas nach unten. Richtiger Schweiß. Höchstwahrscheinlich von Sanchez’ Hand oder vielleicht sogar von der letzten Person, die aus diesem Glas getrunken hatte. Der Fremde schien die Schweißperle zu beobachten und zu warten, bis sie weit genug am Glas nach unten geglitten war, bis er den Geschmack nicht mehr auf der Zunge würde ertragen müssen. Schließlich, als der Schweißtropfen die nötige Entfernung zurückgelegt hatte, um nicht mehr mit dem Mund des Fremden in Kontakt zu kommen, atmete der Fremde tief ein und kippte den Drink in einem großen Schluck hinunter.
Innerhalb einer Sekunde war das Glas leer. Jeder in der Bar hielt den Atem an. Einschließlich des Deckenventilators. Nichts geschah.
Also hielt jeder noch etwas mehr den Atem an.
Und immer noch geschah nichts.
Also fing jeder wieder an zu atmen. Einschließlich des Deckenventilators.
Immer noch nichts.
Ringo nahm seine Waffe aus dem Gesicht des blonden Mannes und stellte die Frage, die jedem in der Bar auf der Zunge brannte. »Nun denn, Blonder, bist du der Bourbon Kid oder nicht?«
»Diese Pisse zu trinken beweist nur eines«, antwortete der blonde Mann, indem er sich mit dem Handrücken über den Mund wischte.
»Ach ja? Und das wäre?«
»Dass ich Pisse trinken kann, ohne zu kotzen.«
Ringo blickte Sanchez an. Der Barmann hatte sich so weit nach hinten verzogen, wie er konnte, und drückte sich mit dem Rücken an die Wand hinter der Theke. Er sah ein wenig zittrig aus.
»Hast du ihm den Drink aus der Pissflasche ausgeschenkt?«, verlangte Ringo zu erfahren.
Sanchez nickte nervös. »Seine Nase hat mir nicht gefallen«, sagte er.
Ringo steckte seine Kanone ins Halfter und trat zurück. Dann warf er den Kopf in den Nacken und begann schallend zu lachen, während er dem Blonden gleichzeitig auf den Rücken schlug.
»Du hast Pisse gesoffen, Mann! Hahaha! Ein ganzes Glas voll Pisse! Er hat Pisse getrunken!«
Alle in der Bar brachen in johlendes Gelächter aus. Restlos alle, bis auf den blonden Fremden. Er richtete den Blick auf den Barmann.
»Gib mir einen verdammten Bourbon.« Seine Stimme klang verdammt rau.
Der Barmann wandte sich um, nahm eine andere Flasche Bourbon aus dem Regal hinter der Theke und schenkte dem Fremden daraus in das Glas. Diesmal füllte er es gleich bis zum Rand, ohne auf eine Aufforderung zu warten.
»Drei Dollar.«
Es war offensichtlich, dass der blonde Mann nicht erbaut war darüber, dass Sanchez erneut Geld haben wollte, und er machte sein Missvergnügen unverzüglich erkennbar. Schneller als das Auge zu folgen vermochte, griff er in seinen Mantel und brachte eine Pistole zum Vorschein. Die Waffe war dunkelgrau und lag schwer in seiner Hand, was vermuten ließ, dass sie voll geladen war. Sie war wahrscheinlich früher einmal von glänzend silberner Farbe gewesen, doch wie jedermann in der Tapioca Bar nur zu gut wusste, hatte jemand, der eine glänzende Waffe bei sich trug, wohl noch niemals damit geschossen. Die Farbe der Pistole dieses Fremden hingegen deutete an, dass die Waffe häufiger als nur gelegentlich in Benutzung gewesen war.
Die plötzliche Bewegung des Fremden endete damit, dass der Lauf seiner Pistole genau auf Sanchez’ Stirn zeigte. Diesem aggressiven Verhalten folgte unmittelbar eine ganze Serie von lauten Klicks, mehr als zwanzig insgesamt, als jeder in der Tapioca Bar seine eigene Waffe aus dem Halfter riss, den Hahn spannte und auf den blonden Fremden zielte.
»Hey, ruhig Blut, Fremder!«, sagte Ringo und drückte dem Fremden einmal mehr den Lauf der eigenen Waffe gegen die Schläfe. Sanchez lächelte ein nervöses, entschuldigendes Lächeln in Richtung des Fremden, der immer noch mit seiner dunkelgrau angelaufenen Pistole auf seinen Kopf zielte.
»Der … geht aufs Haus?«, sagte Sanchez fragend.
»Siehst du mich vielleicht nach meiner verdammten Geldrolle greifen?«, lautete die knappe Antwort.
In der sich anschließenden Stille legte der blonde Mann seine Pistole auf die Theke gleich neben dem Glas mit Bourbon, dann stieß er einen leisen Seufzer aus. Er sah jetzt gründlich verstimmt aus und schien einen Drink bitter nötig zu haben. Einen richtigen Drink. Es war Zeit, den widerlichen Uringeschmack im Mund loszuwerden.
Er nahm das Glas und setzte es an die Lippen. Die ganze Bar sah zu. Die Spannung stieg ins Unerträgliche, während alle darauf warteten, dass er seinen Drink nahm. Wie um sie noch mehr zu quälen, kippte er den Inhalt diesmal nicht geradewegs hinunter. Er stockte, zögerte für eine Sekunde, als wollte er vorher noch etwas sagen. Alles hing an seinen Lippen, hielt den Atem an. Was würde er verkünden? Oder würde er doch den Bourbon trinken?
Die Antwort kam allzu bald. Wie ein Mann, der seit einer Woche nichts mehr zu trinken gehabt hatte, kippte er den gesamten Inhalt des Glases in einem einzigen mächtigen Schluck herunter, bevor er es zurück auf den Tresen knallte.
Es war definitiv ein echter Bourbon.
ZWEI ♦
Vater Taos war zum Heulen zumute. Nicht, dass es keine traurigen Momente in seinem Leben gegeben hätte, im Gegenteil: traurige Tage, traurige Wochen, ja hin und wieder sogar den einen oder anderen traurigen Monat. Doch das hier war das Schlimmste. Es war das Traurigste, was er in seinem Leben je empfunden hatte.
Er stand, wo er so häufig stand, am Hochaltar im Tempel von Herere, und blickte hinab auf die Reihen von Bänken unter sich. Heute jedoch war etwas anders als sonst. Die Bänke waren nicht, wie er sie gerne gesehen hätte. Normalerweise waren sie wenigstens zur Hälfte gefüllt mit den verdrießlichen Gesichtern zahlreicher Brüder seines Ordens von Hubal. Zu den wenigen Gelegenheiten, an denen die Bänke leer blieben, zog er sein Vergnügen aus ihrer einfachen, geradlinigen Eleganz oder dem entspannenden lilafarbenen Polster der Sitzflächen. Nicht aber an diesem Tag. Weder waren die Bänke geradlinig noch die Polster lilafarbig. Und am Schlimmsten von allem war, dass seine Ordensbrüder keineswegs verdrießlich dreinblickten.
Der Gestank, der die Luft erfüllte, war nicht vollkommen unvertraut. Vater Taos war schon einmal einem ähnlichen Gestank begegnet – fünf Jahre zuvor, um genau zu sein. Er brachte Übelkeit erregende Erinnerungen zurück, denn es war der Gestank des Todes, der Zerstörung und des Betrugs, eingehüllt in den Dunst von Schießpulver.
Die lilafarbenen Polster der Bänke waren überzogen von rotem Blut. Selbst ein Optimist hätte sie nicht länger als hübsch und sauber beschreiben können – sie waren ein einziges Chaos. Und was die Verdrießlichkeit im Blick der Brüder des Ordens von Hubal anging … Sie blickten nicht mehr verdrießlich drein, sondern tot. Alle. Ohne Ausnahme.
Indem Vater Taos den Blick hob, zur Gänze, volle fünfzehn Meter, sah er Blut von der Decke tropfen. Das perfekt geschwungene Marmorgewölbe hoch über ihm war Jahrhunderte zuvor mit wunderschönen Bildern ausgeschmückt worden, Szenen, in denen heilige Engel mit glücklich lächelnden Kindern tanzten. Doch da er sie anstarrte, waren sämtliche Engel und Kinder befleckt vom Blut der Mönche unter ihnen. Es schien, als hätte sich selbst der Ausdruck in ihren Gesichtern verändert. Sie blickten nicht länger unbeschwert und glücklich drein. Ihre blutbesudelten Gesichter wirkten betrübt, reumütig und traurig. Genau wie Vater Taos.
Es waren gut dreißig Leichen, die zusammengesunken über den Bänken hingen. Noch einmal so viele, ungefähr jedenfalls, lagen außer Sicht zwischen den Sitzreihen oder am Boden. Nur ein einziger Mann hatte das Massaker überlebt, und das war Vater Taos selbst. Er hatte einen Schuss in den Bauch aus kürzester Entfernung erhalten, von einem Mann, der eine doppelläufige Schrotflinte geschwungen hatte. Der Schmerz war beinahe unerträglich gewesen, und die Wunde blutete immer noch ein wenig, doch sie würde verheilen. Vater Taos’ Wunden verheilten stets, wobei er im Laufe der Zeit gelernt hatte, dass Schusswunden in der Regel Narben hinterließen. Er hatte in seinem Leben zwei weitere Schusswunden erhalten, beide vor fünf Jahren, beide in der gleichen Woche, im Abstand von wenigen Tagen.
Es waren noch genügend Mönche auf der Insel am Leben geblieben, um ihm beim Aufräumen der Sauerei zu helfen. Es würde hart werden für sie, so viel war Vater Taos klar. Es würde ganz besonders hart werden für diejenigen, die vor fünf Jahren schon hier gewesen waren, als das letzte Mal der Geruch von Schießpulver den Tempel mit seinem faulen, gottlosen Odem erfüllt hatte. Deswegen war es ein tröstlicher Anblick für Taos, als zwei seiner jüngeren Lieblingsmönche, Kyle und Peto, den Tempel durch das klaffende Loch betraten, wo einst eine gewaltige geschwungene Doppeltür den Eingang gebildet hatte.
Kyle war um die dreißig Jahre alt, Peto näher an zwanzig. Im ersten Moment und bei flüchtigem Hinsehen konnte man sie für Zwillinge halten. Es war nicht bloß ihr Aussehen, sondern auch ihr Verhalten, das sich so sehr ähnelte. Hinzu kam, dass sie sich gleich kleideten und dass Kyle seit beinahe zehn Jahren Petos Mentor gewesen war; da war es nicht ausgeblieben, dass der jüngere Mönch unbewusst angefangen hatte, das nervöse, übervorsichtige Verhalten seines älteren Freundes zu imitieren. Beide Männer besaßen eine glatte olivenfarbene Haut und rasierte Schädel. Sie trugen identische braune Roben, genau wie die vielen toten Mönche im Tempel.
Auf ihrem Weg zum Altar und zu Vater Taos erwartete sie die unangenehme und irritierende Aufgabe, über eine Anzahl Leichen ihrer Brüder zu steigen. So aufwühlend der Anblick der ganzen Situation für Vater Taos auch sein mochte, tröstete ihn der Anblick Kyles und Petos’ ein wenig, jedenfalls genug, um seinen Herzschlag zu beschleunigen. Sein Herz hatte in der vergangenen Stunde nur zehnmal pro Minute geschlagen, und so war Vater Taos erleichtert, als es nun wieder an Geschwindigkeit zulegte und in einen stetigeren Rhythmus überging.
Peto war so geistesgegenwärtig gewesen, einen kleinen braunen Becher mit Wasser für Vater Taos mitzubringen. Er achtete sorgfältig darauf, auf seinem Weg zum Altar nichts davon zu verschütten, doch seine Hände zitterten unübersehbar, als ihm die Ungeheuerlichkeit dessen bewusst wurde, was sich im Tempel ereignet hatte. Er war beinahe genauso erleichtert wie Vater Taos selbst, als er diesem den Becher übergab. Der alte Mönch nahm ihn in beide Hände und benutzte den größten Teil seiner verbliebenen Kraft, um ihn an den Mund zu heben. Das kühlende, belebende Gefühl des Wassers in seiner Kehle weckte seine Lebensgeister und war eine beträchtliche Hilfe beim Beschleunigen des Heilungsprozesses.
»Danke sehr, Peto. Und sorge dich nicht – ich werde wieder ganz ich selbst sein, noch bevor der Tag zu Ende gegangen ist«, verkündete er und beugte sich vor, um den leeren Becher auf dem Steinboden abzusetzen.
»Selbstverständlich werdet Ihr das, Vater.« In der zitternden Stimme war keine Spur von Zuversicht, doch wenigstens eine gewisse aufkeimende Hoffnung.
Zum ersten Mal an diesem Tag lächelte Taos. Peto war so unschuldig und sorgte sich so sehr um andere, dass es schwer fiel, nicht ein wenig Hoffnung zu schöpfen, nachdem er in die blutigen Überreste des Tempels gekommen war. Er war im Alter von zehn Jahren auf die Insel gebracht worden, nachdem eine Bande von Drogenhändlern seine Eltern ermordet hatte. Durch das Leben bei den Mönchen gewann er inneren Frieden und schaffte es, mit seiner Trauer und seiner Verwundbarkeit ins Reine zu kommen. Taos verspürte ein Gefühl großer Zufriedenheit, dass er und seine Brüder Peto zu jenem wunderbaren, rücksichtsvollen, selbstlosen menschlichen Wesen gemacht hatten, das nun vor ihm stand. Unglücklicherweise würde er den jungen Mönch nun zurückschicken müssen in jene Welt, die ihn seiner Familie beraubt hatte.
»Kyle, Peto, ihr wisst, warum ihr hier seid, nicht wahr?«, begann er.
»Jawohl, Vater«, antwortete Kyle für die beiden jungen Männer.
»Seid ihr bereit für eure Aufgabe?«
»Ganz sicher, Vater. Wären wir es nicht, hättest du nicht nach uns geschickt.«
»Das ist wahr, Kyle. Du bist ein weiser Mann. Manchmal vergesse ich, wie weise du geworden bist. Vergiss das nicht, Peto – du wirst viel von Kyle lernen.«
»Ja, Vater«, sagte Peto demütig.
»Und nun lauscht aufmerksam, denn es bleibt nur sehr wenig Zeit«, fuhr Vater Taos fort. »Von diesem Moment an ist jede Sekunde entscheidend. Der Bestand – die Existenz an sich – der freien Welt ruht auf euren Schultern.«
»Wir werden dich nicht enttäuschen, Vater«, beharrte Kyle.
»Ich weiß, dass ihr mich nicht enttäuschen werdet, Kyle, doch wenn ihr keinen Erfolg habt, bin nicht ich es, sondern die gesamte Menschheit, die ihr enttäuscht habt.« Er zögerte, bevor er fortfuhr. »Findet den Stein. Bringt ihn hierher zurück. Lasst nicht zu, dass er in der Hand des Bösen bleibt, wenn die Dunkelheit beginnt.«
»Warum?«, fragte Peto. »Warum sollte so etwas geschehen?«
Taos legte Peto die Hand auf die Schulter und packte sie mit einer für einen Mann in seinem Zustand überraschenden Kraft. Er war entsetzt wegen des Massakers, wegen der Bedrohung, der sie alle gegenüberstanden, doch vor allem wegen der Tatsache, dass er gar keine andere Wahl hatte, als diese beiden jungen Mönche in so große Gefahr zu schicken.
»Hört, meine Söhne, wenn dieser Stein zur falschen Zeit in den falschen Händen ist, werden wir alle es merken. Die Ozeane werden das Land überfluten, und die Menschheit wird davongespült werden wie Tränen im Regen.«
»Tränen im Regen, Vater?«, wiederholte Peto.
»Jawohl. Tränen im Regen, Peto«, wiederholte Vater Taos sanft. »Wie Tränen im Regen. Und nun müsst ihr euch sputen, denn jetzt ist nicht die Zeit, um euch alles zu erklären. Die Suche muss sofort beginnen. Jede Sekunde, die vergeht, jede Minute, die dahinzieht, bringt uns einen Schritt näher zum Ende der Welt, die wir kennen und lieben.«
Kyle streckte die Hand nach der Wange des alten Mannes aus und wischte einen Blutspritzer ab.
»Sorge dich nicht, Vater, wir werden keinen weiteren Augenblick verschwenden.« Trotzdem zögerte er einen Moment, bevor er fragte: »Und wo sollen wir unsere Suche beginnen?«
»Am gleichen Ort wie immer, mein Sohn. In Santa Mondega. Dort wird das Auge des Mondes am meisten begehrt. Dort wollen alle immer nur das Auge.«
»Aber wer sind ›alle‹, Vater? Wer hat dieses Auge? Wer hat all das getan? Nach wem – oder was – suchen wir?«
Taos zögerte, bevor er antwortete. Sein Blick schweifte einmal mehr über das Gemetzel ringsum, und er dachte zurück an den Augenblick, als er seinem Angreifer gegenübergestanden hatte. Den Moment, bevor er niedergeschossen worden war.
»Nach einem Mann, Kyle. Ihr sucht nach einem einzigen Mann. Ich kenne seinen Namen nicht, doch wenn ihr Santa Mondega erreicht, fragt herum. Fragt nach einem Mann, der nicht getötet werden kann. Fragt nach dem Mann, der imstande ist, dreißig oder vierzig andere eigenhändig zu töten, ohne auch nur einen einzigen Kratzer abzubekommen.«
»Aber Vater, wenn es einen solchen Mann gibt, haben die Menschen dann nicht Angst, uns zu verraten, wer dieser Mann ist?«
Taos verspürte ein flüchtiges Gefühl von Irritation, weil ihn der jüngere Mann infrage stellte, doch es war ein gutes Argument, das Kyle da vorgebracht hatte. Er dachte für einige Sekunden nach. Eine von Kyles Stärken war es, dass er, wenn er Dinge infrage stellte, dies wenigstens auf intelligente Weise tat. Diesmal war Taos sogar imstande, die Frage zu beantworten.
»Ja, das haben sie, Kyle. Allerdings verkaufen in Santa Mondega die Leute ihre Seele für eine Handvoll grüner Scheine an die Dunkelheit.«
»Grüne Scheine? Ich verstehe nicht, Vater.«
»Geld, Kyle. Für Geld. Der Abschaum der Erde tut für Geld alles.«
»Aber wir haben kein Geld, Vater, oder? Geld zu besitzen verstößt gegen die heiligen Gesetze von Hubal.«
»Rein technisch betrachtet ist das richtig, mein Sohn«, sagte Taos. »Doch wir haben Geld hier. Wir benutzen es nur nicht. Bruder Samuel erwartet euch beim Hafen. Er wird euch einen Koffer voller Geld geben. Mehr Geld, als ein gewöhnlicher Sterblicher braucht. Ihr werdet dieses Geld sparsam einsetzen, um die Informationen zu erhalten, die ihr benötigt.«
Eine Woge aus Müdigkeit, gepaart mit Kummer und Schmerz, erfasste ihn. Er rieb sich mit der Hand über das Gesicht, bevor er fortfuhr. »Ohne Geld würdet ihr keinen halben Tag in Santa Mondega überleben. Also, was immer ihr tut, verliert es nicht. Seid auf der Hut und bleibt ständig wachsam. Wenn sich herumspricht, dass ihr Geld habt, werden die Menschen auf euch aufmerksam. Schlechte Menschen.«
»Jawohl, Vater.«
Kyle spürte, wie Aufregung ihn erfasste. Es würde sein erster Trip aufs Festland werden, seit er als kleines Kind auf der Insel eingetroffen war. Alle Mönche der Bruderschaft trafen als kleine Kinder ein, entweder als Waisen oder weil ihre Eltern sie verstoßen hatten, und eine Gelegenheit, die Insel zu verlassen, gab es vielleicht einmal im Leben, wenn überhaupt. Unglücklicherweise verdankte Kyle es auch seinem Lebens als Mönch, dass dem Anflug von Aufregung auf dem Fuß ein überwältigendes Gefühl von Schuld folgte. Schuld, weil er Aufregung verspürt hatte. Jetzt war nicht die Zeit für solche Gefühle, und die Insel war nicht der Ort.
»Gibt es sonst noch etwas, Vater?«, fragte er.
Vater Taos schüttelte den Kopf.
»Nein, mein Sohn. Geht nun. Ihr habt drei Tage, um das Mondauge zu finden und die Welt vor dem Untergang zu bewahren. Der Sand läuft unaufhaltsam durch das Stundenglas.«
Kyle und Peto verneigten sich tief vor Vater Taos, wandten sich ab und gingen vorsichtig zum Ausgang des Tempels. Sie konnten es kaum erwarten, zurück an der frischen Luft zu sein. Der Gestank nach Tod im Innern des Tempels verursachte beiden Übelkeit.
Was sie nicht wissen konnten – dieser Gestank würde ihnen nur allzu vertraut werden, sobald sie erst den Zufluchtsort ihrer Insel hinter sich gelassen hatten. Vater Taos wusste das. Während er ihnen hinterherblickte, wünschte er sich, er hätte den Mut aufgebracht, ihnen die Wahrheit über das zu erzählen, was in der Welt da draußen auf sie wartete. Er hatte schon einmal zwei junge Mönche nach Santa Mondega geschickt, vor fünf Jahren. Sie waren nie zurückgekehrt, und nur Vater Taos kannte den Grund dafür.
DREI ♦
Fünf Jahre waren vergangen seit jener Nacht, als der blonde Mann mit dem Kapuzenumhang in der Tapioca Bar aufgetaucht war. Das Lokal sah immer noch mehr oder weniger genauso aus wie damals. Die Wände waren vielleicht ein wenig nikotinfleckiger als früher und zeigten ein paar Löcher mehr von Querschlägern, doch ansonsten hatte sich nichts verändert. Fremde waren weiterhin unwillkommen, und die Stammgäste waren immer noch ausnahmslos Beutelschneider (allerdings waren es andere Stammgäste als vor fünf Jahren). Sanchez der Barmann war ein wenig fülliger in den Hüften geworden, doch ansonsten hatte auch er sich kaum verändert. Und so machte er, als die beiden merkwürdig aussehenden Fremden leise das Lokal betraten, Anstalten, ihre Drinks aus der Pissflasche auszuschenken.
Diese beiden Fremden hätten Zwillinge sein können. Ihre Köpfe waren vollkommen kahl geschoren, beide hatten olivfarbene Haut, und beide trugen die gleiche Kleidung: orangefarbene ärmellose Umhänge im Karatestil mit weiten schwarzen Hosen darunter und ziemlich unmännlich aussehenden spitzen schwarzen Stiefeln. Es gab zwar keine Kleiderordnung in der Tapioca Bar, doch hätte es eine gegeben, diese beiden Fremden wären nicht hereingelassen worden. Sie kamen zum Tresen und standen lächelnd vor Sanchez wie zwei zurückgebliebene Einfaltspinsel. Wie es Brauch war für Sanchez, ignorierte er sie. Unglücklicherweise jedoch – was ebenfalls Brauch war – hatten ein paar seiner weniger angenehmen (mit anderen Worten: höchst unangenehmen) Gäste die Neuankömmlinge bemerkt, und es dauerte nicht lange, ehe der Lärm im Schankraum einer erwartungsvollen Stille wich.
Die Tapioca Bar war normalerweise nicht sonderlich stark besucht, nicht um diese Tageszeit (es war noch früh am Nachmittag). Nur zwei der Tische waren besetzt, einer nahe beim Tresen mit drei Gästen, und einer in der anderen Ecke, wo zwei zwielichtige Gestalten über zwei Flaschen Bier hockten. Die Parteien an beiden Tischen unterzogen die beiden Fremden einer harten, eingehenden Musterung.
Die Stammgäste der Tapioca Bar waren nicht vertraut mit Mönchen von Hubal, weil diese sich nicht oft in dieser Gegend der Welt herumtrieben. Außerdem wussten die Gäste der Bar nicht, dass diese beiden Fremden in den merkwürdigen Kleidern die ersten beiden Mönche seit vielen Jahren waren, die die Insel von Hubal verließen. Der etwas größere und ältere von beiden war Kyle. Sein Begleiter Peto war lediglich ein Novize, der das Handwerk des Mönchtums erlernte. Nicht, dass Sanchez das hätte erkennen können. Oder dass es ihn interessiert hätte.
Die Mönche waren aus einem sehr speziellen Grund in die Tapioca Bar gekommen: Es war das einzige Lokal in Santa Mondega, von dem sie schon einmal gehört hatten. Sie hatten sich an Vater Taos’ Instruktionen gehalten und ein paar Einheimische gefragt, wo sie mit größter Wahrscheinlichkeit einen Mann finden würden, der nicht getötet werden konnte. Die Antwort hatte gelautet: »Versucht es in der Tapioca Bar.«
Einige wenige Leute waren so freundlich gewesen und hatten sogar einen Namen für den Mann vorgeschlagen, nach dem Kyle und Peto suchten. »The Bourbon Kid« wurde bei mehreren Gelegenheiten genannt. Der andere Name war der eines Mannes, der vor kurzem in der Gemeinde angekommen war. Er lautete einfach »Jefe«. Ein vielversprechender Anfang für die Suche, auf die sich die beiden Mönche begeben hatten. Oder zumindest dachten sie das.
»Entschuldigen Sie bitte, Sir«, sagte Kyle, indem er Sanchez höflich zulächelte. »Wir hätten gerne zwei Gläser Wasser.«
Sanchez nahm zwei leere Gläser, füllte Pisse aus der Flasche hinein und schob sie den beiden Fremden hin.
»Sechs Dollar.« Wenn die Fremden keine Herausforderung in diesem unverschämt hohen Preis bemerkten, war sie seinem Tonfall umso deutlicher zu entnehmen.
Kyle stieß Peto in die Rippen und flüsterte ihm etwas ins Ohr, während er Sanchez die ganze Zeit über sein erzwungen strahlendes Lächeln zeigte.
»Peto, gib ihm das Geld«, zischte er.
Peto schnitt eine Grimasse. »Aber Kyle, sind sechs Dollar nicht sehr teuer für zwei Gläser Wasser?«, flüsterte der junge Mönch zurück.
»Gib ihm einfach nur das Geld«, erwiderte Kyle drängend. »Wir wollen nicht wie Idioten aussehen.«
Peto blickte über Kyles Schulter zu Sanchez und lächelte den ungeduldig dreinblickenden Barmann an.
»Ich denke, dieser Kerl zieht uns über den Tisch.«
»Gib ihm einfach nur das Geld«, wiederholte Kyle. »Rasch.«
»Okay, okay, aber hast du nicht gesehen, was er uns für Wasser gegeben hat? Es ist so … so gelblich.« Peto holte Luft und fügte hinzu: »In meinen Augen sieht es aus wie Urin.«
»Peto – bezahl den Mann.«
Peto nahm eine Handvoll Banknoten aus einer kleinen schwarzen Tasche an seinem Gürtel, zählte sechs Ein-Dollar-Scheine ab und reichte sie Kyle. Kyle seinerseits reichte sie an Sanchez. Sanchez schüttelte missbilligend den Kopf. Es war nur eine Frage der Zeit, bis irgendjemand sich diese beiden komischen Käuze schnappte. Es war ihre eigene Schuld, so wie sie aussahen und sich verhielten. Er drehte sich um und wollte das Geld in seine Registrierkasse legen, doch wie üblich hatte er die Kurbel noch nicht zu Ende gedreht, als einer der Stammgäste den beiden Fremden die erste Frage zurief.
»Hey, was wollt ihr Blödmänner hier?«, rief eine der zwielichtigen Gestalten vom Tisch in der Ecke.
Kyle sah, dass der Mann, der diese Frage gerufen hatte, in seine Richtung blickte, also lehnte er sich zurück und flüsterte Peto zu: »Ich glaube, er redet mit uns.«
»Tatsächlich?«, fragte Peto und klang überrascht. »Was ist ein ›Blödmann‹?«
»Ich weiß es nicht, aber es klingt, als könnte es eine Beleidigung sein.«
Kyle drehte sich um und sah, dass sich die Männer am Tisch in der Ecke von ihren Sitzen erhoben hatten. Die Holzdielen erbebten heftig, als die beiden sehr zwielichtigen, sehr niederträchtig aussehenden Schläger quer durch den Laden zu den beiden Mönchen schlenderten. Sie sahen entschieden wenig einladend aus. Eher nach Ärger und Scherereien. Selbst zwei naive Landeier wie Kyle und Peto vermochten das zu erkennen.
»Was auch immer du tust«, flüsterte Kyle an Peto gewandt, »verärgere sie nicht. Sie sehen ziemlich gemeingefährlich aus. Besser, du überlässt alles Reden mir.«
Die beiden Schläger blieben kaum einen halben Meter vor Kyle und Peto stehen. Beide sahen ungewaschen aus, eine Eigenschaft, die durch den ihnen anhaftenden Geruch untermalt wurde. Der größere der beiden, ein Bursche namens Jericho, kaute auf einem Stück Tabak, und ein brauner Speichelfaden troff ihm aus dem Mundwinkel. Er war unrasiert und trug den allem Anschein nach obligatorischen unhygienischen Schnurrbart, und nach seinem Aussehen zu urteilen, konnte er durchaus bereits ein paar Tage in der Bar verbracht haben, ohne zwischendurch nach Hause gegangen zu sein. Sein Begleiter Rusty war ein gutes Stück kleiner, roch aber genauso übel. Er hatte verfaulte schwarze Zähne, die er nun zeigte, als er Peto angrinste – einer der wenigen Männer in der Stadt, die klein genug waren, um ihm auf Augenhöhe gegenüberzustehen. Wie Peto der Lehrling von Kyle war, war Rusty der von Jericho, einem in einheimischen Kreisen bereits bekannteren Kriminellen. Und wie um zu betonen, wer von beiden der Anführer war, unternahm Jericho den ersten aggressiven Schritt. Er tippte Kyle unsanft mit dem Finger gegen die Brust.
»Ich hab dir eine Frage gestellt. Was macht ihr Blödmänner hier drin?«
Beide Mönche bemerkten eine gewisse raue Qualität in seiner Stimme.
»Nun, ich bin Kyle, und das hier ist mein Novize Peto. Wir sind Mönche, kommen von der pazifischen Insel Hubal und sind auf der Suche nach einem Mann. Vielleicht könnt ihr uns helfen, ihn zu finden?«
»Kommt drauf an, wen ihr sucht.«
»Äh, nun ja, wie es scheint, ist der Mann, den wir suchen, unter dem Namen ›The Bourbon Kid‹ bekannt.«
Schlagartig herrschte völlige Stille in der Tapioca Bar. Selbst der Deckenventilator verstummte. Dann erklang hinter dem Tresen ein klirrendes Geräusch. Sanchez hatte das Glas, das er in den Händen gehalten hatte, vor Schreck fallen lassen. Dieser Name war schon seit sehr langer Zeit nicht mehr in seiner Bar erwähnt worden. Seit sehr langer Zeit. Er weckte schreckliche Erinnerungen in Sanchez. Die bloße Erwähnung des Namens ließ den Wirt der Tapioca Bar erschauern.
Jericho und sein Kumpan kannten den Namen ebenfalls. Sie waren in jener Nacht nicht in der Bar gewesen, als Bourbon Kid sein Gesicht gezeigt hatte. Sie hatten ihn nie gesehen. Sie hatten nur von ihm gehört und von jener Nacht, als er im Tapioca Bourbon getrunken hatte. Jericho starrte Kyle in die Augen, um zu sehen, ob dieser seine Frage ernst meinte. Es hatte den Anschein.
»Bourbon Kid ist tot«, grollte er. »Sonst noch irgendwas?«
Sanchez kannte Jericho und Rusty ziemlich gut und schätzte, dass die beiden merkwürdigen Gestalten noch vielleicht zwanzig Sekunden zu leben hatten. Doch selbst diese Schätzung erschien plötzlich ein wenig optimistisch, als Peto sein Glas vom Tresen nahm und einen großen Schluck daraus trank. Sobald die Flüssigkeit seine Geschmacksknospen berührte, wurde ihm klar, dass er etwas Unheiliges trank, und instinktiv spie er es voller Abscheu wieder aus. Und zwar – über Rusty! Sanchez hätte beinahe laut aufgelacht, doch er war schlau genug, um zu wissen, dass so etwas kaum in seinem besten Interesse gewesen wäre.
Wie dem auch sei, plötzlich war Rusty voller Pisse. Seine Haare, sein Schnurrbart, seine Augenbrauen. Peto hatte ihn von oben bis unten vollgespuckt. Rustys Augen drohten vor Wut aus den Höhlen zu quellen, als er die goldfarbene Flüssigkeit anstarrte, die von seiner Brust tropfte. Es war der Gipfel der Demütigung. Genügend Demütigung, um in ihm den Wunsch zu wecken, Peto auf der Stelle umzubringen, ohne einen weiteren Gedanken. In einer flüssigen, blitzschnellen Bewegung griff er nach der Pistole im Halfter an seiner Hüfte. Sein Kumpel Jericho war genauso wütend, denn er zog ebenfalls die Waffe.
Mönche Hubals schätzen Frieden über alles, lernen und üben allerdings von Kindesbeinen an Kampfeskünste. Für Kyle und Peto war es demzufolge ein Kinderspiel (buchstäblich, angesichts ihrer Erziehung), zwei betrunkene Schläger auszuschalten, und das, obwohl die Männer mit ihren Kanonen auf sie zielten. Beide Mönche reagierten wie auf ein geheimes Zeichen hin und mit geradezu verblüffender Geschwindigkeit. Ohne jedes Geräusch duckten sich beide und traten ihrem jeweiligen ungewaschenen Gegenüber mit voller Wucht zwischen die Beine. Dann hakten sie den Fuß hinter das Knie ihres Opponenten und wirbelten herum. Vollkommen überrascht von der Geschwindigkeit des Angriffs brachten Jericho und Rusty nicht mehr als ein erstauntes Grunzen zustande, während die Mönche ihnen die Pistolen entwanden. Fast im gleichen Moment gab es zwei schwere polternde Geräusche, als die beiden Männer rücklings auf die erzitternden Dielen krachten.
Einen Moment zuvor waren sie in der Position der Überlegenen gewesen, und nun lagen sie auf dem Boden und starrten an die Decke. Schlimmer noch, die beiden Mönche zielten mit ihren eigenen Pistolen auf sie. Kyle trat vor und stemmte einen spitzen schwarzen Stiefel auf Jerichos Brust, um ihn am Aufstehen zu hindern. Peto machte sich nicht die Mühe, es seinem Mentor gleichzutun – hauptsächlich, weil Rusty beim Fallen so hart mit dem Kopf aufgeschlagen war, dass er im Moment wohl nicht einmal mehr wusste, wo er war.
»So. Wisst ihr jetzt, wo Bourbon Kid ist, oder nicht?«, fragte Kyle, indem er den Stiefel gegen Jerichos Brust drückte.
»Fick dich!«
PENG!
Kyles Gesicht war plötzlich von Blutspritzern übersät. Er sah nach links und bemerkte Rauch, der aus dem Lauf von Petos Pistole aufstieg. Der jüngere Mönch hatte Rusty ins Gesicht geschossen. Auf dem Boden war eine riesige Sauerei, die sich auf der Garderobe der beiden Mönche fortsetzte.
»Peto! Warum hast du das getan?«
»Es … es tut mir leid, Kyle, aber ich hab noch nie eine Pistole in den Händen gehabt! Sie ging einfach los, als ich den Abzug durchgedrückt habe!«
»Dazu ist so ein Abzug da, weißt du?«, sagte Kyle, doch er sagte es nicht unfreundlich.
Peto zitterte so sehr, dass er die Waffe kaum festhalten konnte, so groß war der Schock, der ihn erfasst hatte. Er hatte soeben einen Mann getötet, etwas, was er niemals für möglich gehalten hätte. Niemals. Und doch, in seinem Bemühen, Kyle nicht zu enttäuschen, verdrängte er den Mord fürs Erste, so gut es ging. Es war nicht einfach, mit all dem Blut überall als quasi ständige Erinnerung.
Kyle für seinen Teil sorgte sich mehr über die Tatsache, dass ihre Glaubwürdigkeit einen argen Schlag erhalten hatte. Er war dankbar, dass die Bar nicht voll war.
»Ehrlich, man kann dich nirgendwohin mitnehmen!«, sagte er in gespielter Missbilligung.
»Es tut mir leid.«
»Peto, tu mir einen Gefallen.«
»Selbstverständlich. Was denn?«
»Hör auf, mit diesem Ding auf mich zu zielen.«
Peto senkte die Pistole. Erleichtert wandte sich Kyle wieder seinem Verhör Jerichos zu. Die drei Männer am anderen Tisch hatten den Vorgängen den Rücken zugewandt und unterhielten sich bei ihren Drinks, als wäre all das völlig normal. Kyle stand über dem überlebenden Halunken am Boden, den Stiefel auf seiner Brust.
»Hör zu, Freund«, sagte er umgänglich. »Wir möchten nichts weiter als erfahren, wo wir Bourbon Kid finden können. Kannst du uns dabei helfen oder nicht?«
»Kann ich nicht, gottverdammt!«
PENG!
Jericho schrie auf und packte sich das linke Bein, aus dem nun Blut aus einer Wunde unter dem Knie in mehrere Richtungen spritzte. Einmal mehr stieg Rauch aus dem Lauf von Petos Pistole auf.
»Tut-tut-tut mir leid«, stammelte Peto. »Sie ist wieder einfach losgegangen. Ehrlich, ich wollte das nicht …«
Kyle schüttelte verärgert den Kopf. Jetzt hatten sie einen Mann erschossen und den zweiten verwundet. Nicht gerade die diskreteste Art und Weise, um nach dem Verbleib des kostbaren blauen Steins zu forschen, dem Auge des Mondes. Obwohl er der Fairness halber einräumen musste, dass selbst er als der Ältere von beiden eine große Nervosität verspürte, weil er nicht auf Hubal war. Daher akzeptierte er, dass Peto wahrscheinlich doppelt so zittrig war.
»Na ja, egal. Versuch einfach, es nicht noch mal zu tun.«
Jerichos Fluchen ließ die Luft erröten, während er sich unter Kyles unerbittlichem Stiefel am Boden wand.
»Ich weiß nicht, wo Bourbon Kid ist, ich schwöre es!«, brüllte er heiser.
»Möchtest du, dass mein Freund noch einmal schießt?«, fragte Kyle.
»Nein, nein! Bitte! Ich schwöre, ich weiß nicht, wo er ist! Ich hab ihn noch nie gesehen! Bitte, ihr müsst mir glauben!«
»Also schön. Weißt du etwas über den Diebstahl eines kostbaren blauen Steins, der bekannt ist als das Auge des Mondes?«
Jericho unterbrach sein Winden für eine Sekunde, was den beiden verriet, dass er etwas wusste.
»Ja. Ja, ich weiß etwas!«, stöhnte er. »Ein Kerl namens El Santino ist hinter dem Stein her. Er hat eine große Belohnung ausgesetzt für den, der ihm den Stein bringt. Das ist alles, was ich weiß, ich schwöre!«
Kyle nahm den Stiefel von Jerichos Brust und kehrte zum Tresen zurück. Er nahm sein unberührtes Glas und trank einen großen Schluck, bevor er Petos Beispiel folgte und den Schluck voller Abscheu ausspie. Der einzige Unterschied war, dass er alles über Sanchez spie.
»Ich denke, Sie sollten ein paar Flaschen frisches Wasser beschaffen«, schlug er dem betröpfelten Barmann vor. »Das hier ist wohl schlecht geworden. Komm, Peto, wir gehen.«
»Warte«, sagte Peto. »Frag sie nach dem anderen Kerl, diesem Jefe. Vielleicht wissen sie, wo wir ihn finden können?«
Kyle blickte zu Sanchez, der sich mit einem schmutzigen Lappen, der früher vielleicht einmal weiß gewesen war, die Pisse aus dem Gesicht wischte.
»Barmann, haben Sie je von einem Burschen namens Jefe gehört, der in dieser Gegend leben soll?«
Sanchez schüttelte den Kopf. Er hatte von Jefe gehört, doch er war niemand, der andere verpfiff, oder jedenfalls verpfiff er niemanden an Fremde. Abgesehen davon mochte er vielleicht wissen, wer Jefe war, doch er hatte ihn nie persönlich kennengelernt. Der Mann war bekannt als Kopfgeldjäger, der durch die ganze Welt reiste. Zugegeben, es hieß, er wäre zurzeit in Santa Mondega, doch er hatte noch keinen Fuß in die Tapioca Bar gesetzt. Und das war, soweit es Sanchez anging, ein Segen.
»Ich kenne niemanden mit diesem Namen. Und jetzt verpisst euch aus meiner Bar!«
Die beiden Mönche waren ohne weiteres Wort gegangen. Die bin ich los, dachte Sanchez erleichtert. Blut von den Dielenbrettern der Tapioca Bar aufzuwischen war eine seiner ungeliebtesten Beschäftigungen. Dank der beiden Fremden, die er gleich wieder des Lokals hätte verweisen sollen, als sie aufgetaucht waren, musste er nun genau das tun.
Er ging nach hinten zur Küche, um einen Mopp und einen Eimer Wasser zu holen, und kehrte gerade rechtzeitig zurück, um zu sehen, wie ein Mann die Bar betrat. Ein weiterer Fremder genau genommen. Groß gewachsen. Gut gebaut. Eigenartig gekleidet. Genau wie die beiden letzten Mistkerle. Es versprach ein beschissener Tag zu werden. Sanchez hatte jetzt schon die Nase voll, und dabei war erst früher Nachmittag. Er hatte einen Toten auf den Dielen, dessen Gehirn in der ganzen Bar verspritzt war, und einen zweiten Kerl mit einer Kugel im Bein. Er würde die Polizei rufen müssen, auch wenn das noch eine Weile Zeit hatte. Eine ganze Weile, mindestens.
Sanchez ging zu Jericho, wickelte ihm einen alten Lappen um die Schusswunde im Bein und half ihm hoch, bevor er hinter die Theke ging und sich um seinen jüngsten Gast kümmerte. Jericho hockte sich auf einen Barhocker und blieb schweigend sitzen. Er würde nicht den Fehler machen, den Neuankömmling zu belästigen.
Sanchez nahm ein sauberes (säuberliches) Geschirrtuch und wischte sich das Blut von den Händen, während er seinen neuen Gast musterte.
»Was darf’s sein, Fremder?«
Der Mann hatte sich auf dem Hocker neben Jericho niedergelassen. Er trug eine schwere schwarze ärmellose Lederweste, die halb aufgeknöpft war und den Blick freigab auf eine üppig tätowierte Brust und ein großes silbernes Kruzifix. Dazu trug der Fremde passende schwarze Lederhosen und schwere schwarze Lederstiefel. Er besaß dichtes schwarzes Haar und darüber hinaus die schwärzesten Augen, die Sanchez jemals gesehen hatte. Und in dieser Gegend der Welt waren das wirklich sehr, sehr schwarze Augen.
Der Fremde ignorierte die Frage des Barmanns und nahm sich eine Zigarette aus dem dünnen Päckchen, das vor ihm auf dem Tresen lag. Er schnippte die Zigarette in die Luft und fing sie mit dem Mund auf, ohne sich zu bewegen. Eine Sekunde später hielt er wie aus der Luft ein brennendes Streichholz in der Hand, steckte sich damit die Zigarette an und schnippte es zu Sanchez, alles in einer einzigen, fließenden, schnellen Bewegung.
»Ich suche jemanden«, sagte er.
»Und ich verkaufe Drinks«, sagte Sanchez. »Wollen Sie jetzt einen Drink bestellen oder was?«
»Gib mir einen Whisky.« Dann fügte er hinzu: »Gib mir Pisse, und ich mach dich kalt.«
Sanchez war nicht überrascht, ein entschieden raues Element in der Stimme des Fremden zu entdecken. Er schenkte einen Whisky aus und stellte das Glas vor dem Fremden auf den Tresen.
»Zwei Dollar.«
Der Mann kippte den Drink hinunter und knallte das leere Glas auf die Theke.
»Ich suche nach einem Burschen namens El Santino. War er hier?«
»Zwei Dollar.«
Einen nervösen Moment lang fragte sich Sanchez, ob der Fremde bezahlen würde oder nicht, dann zückte er eine Fünf-Dollar-Note aus seiner Westentasche und legte sie auf den Tresen, ohne jedoch das eine Ende loszulassen. Sanchez zupfte am anderen Ende, doch der Fremde hielt die Banknote eisern fest.
»Ich soll mich hier in dieser Bar mit einem Burschen namens El Santino treffen. Kennst du ihn?«
Scheiße!, dachte Sanchez müde. Jeder sucht heute nach irgendjemandem, zuerst diese beiden durchgeknallten Killer, die nach Bourbon Kid fragen – der Name ließ ihn innerlich erschauern – und nach irgend so einem beschissenen Mondstein und diesem Kopfgeldjäger Jefe, und dann kommt dieser beschissene Fremde hier und fragt nach diesem Scheißkerl El Santino. Doch er behielt seine Gedanken für sich. »Ja, ich kenne ihn«, war alles, was er sagte.
Der Mann ließ sein Ende der Fünf-Dollar-Note los, und Sanchez schnappte sie hastig. Als er die Kurbel drehte und die Note in die Registrierkasse legte, begann einer seiner Stammgäste wie üblich mit dem Verhör des Neuankömmlings.
»Hey, was zur Hölle willst du von El Santino?«, rief einer der drei Männer von seinem Platz an dem Tisch in der Nähe der Theke. Der ledergekleidete Fremde antwortete nicht sofort. Das war das Zeichen für Jericho, sich von dem Barhocker zu erheben, auf dem er sich ausgeruht hatte, und nach draußen zu humpeln. Er hatte genug Ärger für einen Tag gesehen und verspürte keine Lust, erneut beschossen zu werden, zumal einer von diesen diebischen Bastarden von Mönchen mit seiner Kanone aus dem Laden gestiefelt war. Auf dem Weg nach draußen stolperte er über den Leichnam seines toten Kumpels Rusty und fällte den wohl überlegten Vorsatz, für eine Weile nicht mehr zu den Stammkunden der Tapioca Bar zu zählen.
Nachdem Jericho gegangen war, beschloss der schwarz gekleidete Fremde an der Theke, die an ihn gerichtete Frage zu beantworten.
»Ich hab etwas, das El Santino haben will«, sagte er, ohne sich zu dem Fragenden umzublicken.
»Hey, du kannst es mir geben. Ich geb’s El Santino weiter«, sagte einer der Männer am Tisch. Seine Kumpane johlten.
»Kann ich nicht machen.«
»Sicher kannst du.« Der Tonfall war entschieden böswillig.
Es gab ein leises Klicken, ganz ähnlich dem Geräusch, das entsteht, wenn jemand den Hahn seines Revolvers spannt. Der Fremde am Tresen stieß einen Seufzer aus und nahm einen tiefen Zug von seiner Zigarette. Die drei Taugenichtse am Tisch erhoben sich und machten sieben oder acht Schritte auf die Theke zu. Der Fremde drehte sich immer noch nicht zu ihnen um, obwohl sie sich direkt hinter ihm aufgebaut hatten.
»Hey, wie heißt du, Kerl?«, fragte der in der Mitte drohend.
Sanchez kannte den Burschen nur zu gut. Er war ein verschlagener kleiner Drecksack mit buschigen schwarzen Augenbrauen und zwei unterschiedlichen Augen. Das linke war dunkelbraun, das rechte hatte eine ganz eigene Farbe, die jemand einmal als »schlangenähnlich« beschrieben hatte. Seine beiden Kumpane Spider und Studley wirkten beide ein klein wenig größer als er, doch das konnte auch daran liegen, dass sie schmuddelige Cowboyhüte trugen, die eindeutig bessere Tage hinter sich hatten. Diese beiden Männer waren nicht das Problem. Sie waren nichts als die Eier. Es war der Schwanz in der Mitte mit dem merkwürdigen Auge, der die Scherereien brachte. Marcus das Wiesel war ein Gelegenheitsdieb, Gelegenheitsvergewaltiger und Gelegenheitsschläger. Und nun drückte er dem Fremden eine kleine Pistole in den Rücken. »Ich hab dir eine Frage gestellt«, sagte er. »Wie heißt du, Chef?«
»Jefe«, sagte der Fremde. »Mein Name lautet Jefe.« Scheiße, dachte Sanchez der Wirt, als er den Namen hörte. Ach du Scheiße.
»Jefe?«
»Ja. Jefe.«
»Hey, Sanchez!«, rief Marcus das Wiesel dem Barmann zu. »Diese beiden Mönche – waren die nicht auf der Suche nach einem Kerl namens Jefe?«
»Ja.« Der Barmann hatte beschlossen, so einsilbig wie möglich zu bleiben.
Jefe nahm einen tiefen Zug von seiner Zigarette, dann drehte er sich langsam zu seinem Fragesteller um und atmete langsam aus, indem er Marcus die ganze Ladung Rauch ins Gesicht blies.
»Hast du ›Mönche‹ gesagt?«
»Ja«, antwortete Marcus und bemühte sich nach Kräften, nicht zu husten. »Zwei Mönche. Sie sind gerade eben erst gegangen, kurz bevor du gekommen bist. Du bist wahrscheinlich an ihnen vorbeigelaufen.«
»Ich bin an keinen beschissenen Mönchen vorbeigelaufen.«
»Sicher, Mann. Was immer du sagst.«
»Hör zu, Junge, tu dir selbst einen Gefallen und verrat mir, wo ich El Santino finden kann.«
Marcus das Wiesel zog die Pistole zurück und zeigte mit ihr in die Luft, dann senkte er sie wieder und zielte damit auf Jefes Nasenspitze.
»Wie ich bereits sagte, warum gibst du mir nicht einfach, was du hast, und ich gebe es El Santino weiter, Chef … eh, wie heißt du überhaupt?«
Jefe ließ seine Zigarette zu Boden fallen und hob langsam die Hände als Zeichen, dass er sich ergab, während er die ganze Zeit grinste wie über einen Witz, den nur er verstand. Er legte die Hände hinter den Kopf, dann glitten sie langsam hinunter in seinen Nacken.
»Also schön, Mann«, sagte Marcus. »Ich gebe dir drei Sekunden, um mir zu zeigen, was du für El Santino hast. Eins … zwei …«
TOCK.
Simultan gingen Spider und Studley, die rechts und links neben ihrem Kumpan mit dem eigenartigen Auge gestanden hatten, zu Boden und rührten sich nicht mehr. Marcus machte den Fehler, nach unten zu sehen. Beide lagen auf den Dielen, tot wie Stein, jeder mit einem kurzen, zweischneidigen Messer in der Kehle. Als Marcus den Blick wieder hob, wurde ihm bewusst, dass er seine Pistole nicht länger in der Hand hielt. Sie war nun in Jefes Besitz und auf ihn gerichtet. Marcus schluckte mühsam. Dieser Kerl war schnell. Und tödlich.
»Hör mal«, erbot sich Marcus das Wiesel, dessen Überlebensinstinkte sich plötzlich und laut zu Wort meldeten, »warum bringe ich dich nicht zu El Santino, eh?« Sei großzügig, rief er sich ins Gedächtnis. Sei immer schön großzügig.
»Sicher. Warum nicht? Das wäre großartig.« Jefe grinste. »Aber warum kaufst du uns nicht zuerst zwei hübsche große Whisky?«
»Mit dem größten Vergnügen.«
Nachdem sie die Leichen von Rusty, Spider und Studley nach draußen in den Hinterhof geschleift hatten, wo sie niemand so schnell suchen würde, setzten sich die beiden Männer die nächsten paar Stunden an die Theke und tranken Whisky.
Marcus war derjenige, der die meiste Zeit über redete. Er versuchte seinen besten Fremdenführereindruck zu erwecken und belieferte Jefe mit den besten Adressen für den Fall, dass er sich amüsieren wollte. Er warnte seinen neuen Kumpan auch vor den Läden und Leuten, die aller Wahrscheinlichkeit nach versuchen würden, ihn über den Tisch zu ziehen. Jefe lauschte Marcus und tat, als würde er sich für das interessieren, was das Wiesel ihm erzählte, doch in Wirklichkeit suchte er nur jemanden, der für alle Drinks bezahlte. Zum Glück hatte Marcus die Geistesgegenwart besessen, sich Studleys Scheintasche anzueignen sowie die drei Dollar, die Spider in der Hemdentasche getragen hatte. Die Scheintasche war voller Banknoten, und so verfügte er über genügend Geld, um ein paar Tage lang die Getränkerechnungen zu bezahlen.
Am frühen Abend war Jefe sehr betrunken, und weder er noch Marcus hatten bemerkt, dass es in der Tapioca Bar ziemlich voll geworden war. Es gab noch immer reichlich freie Hocker und Tische, doch es gab auch zahlreiche Gäste – Stammgäste –, die sich in den Schatten herumtrieben. Irgendwie hatte sich herumgesprochen, dass Jefe etwas bei sich trug, das eine Menge Geld wert war. Er hatte sich einen Ruf als ein Mann erworben, den man fürchten musste, doch er war nicht besonders bekannt in dieser Gegend. Und er war inzwischen sehr betrunken, was ihn zu einem vorzüglichen Kandidaten für all die Halsabschneider und Diebe machte, die in der Tapioca Bar verkehrten.
Wie sich herausstellte, sollte das, was Jefe später in jener Nacht zustieß, der Katalysator für sämtliche sich daran anschließenden Ereignisse sein. Hauptsächlich jede Menge Mord und Totschlag.
VIER ♦
Detective Miles Jensens Ruf eilte ihm voraus, als er in Santa Mondega eintraf. Die anderen Cops mochten ihn schon vor ihrer ersten Begegnung nicht. Für sie war er einer jener schicken New-Age-Detectives. Wahrscheinlich hatte er in seinem ganzen Leben nicht einen Tag echte Action gesehen. Sie irrten sich selbstverständlich, doch er hatte Besseres zu tun, als seine Zeit damit zu verschwenden, seine Stellung gegenüber einer Bande inzestuöser Drecksäcke wie den Cops auf der Wache von Santa Mondega zu rechtfertigen. Der Grund, warum sie ihn für einen Hochstapler hielten, lag wohl hauptsächlich in seinem Titel begründet: Chief Detective Inspector für Übernatürliche Ermittlungen. Die reinste Verschwendung von Steuerzahlergeld, wenn es je eine gegeben hatte. Es wäre kein Problem gewesen, wenn er auf einer anderen Wache gewesen wäre, doch er war auf ihrer, und er verdiente wahrscheinlich eine Wagenladung mehr Geld als die meisten von ihnen. Doch es gab nichts, was sie dagegen hätten tun können, und sie wussten es. Jensen war von der Regierung der Vereinigten Staaten nach Santa Mondega geschickt worden. Normalerweise hätte die Regierung einen Dreck auf das gegeben, was in Santa Mondega vorging, doch vor Kurzem war etwas passiert, und ein paar Leute hatten interessiert aufgehorcht.