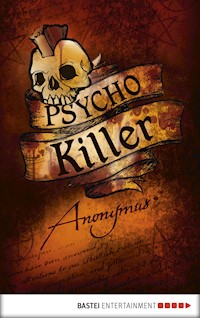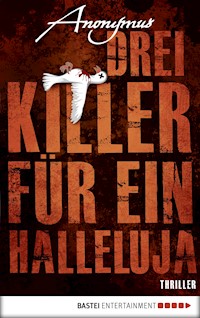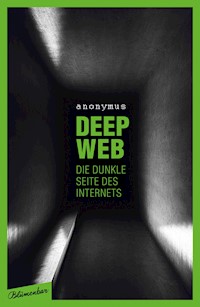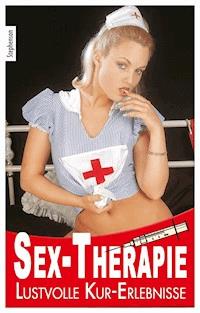4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Bourbon Kid
- Sprache: Deutsch
Auch ein Massenmörder muss an seine Rente denken. Erst recht nach achtzehn Jahren Gemetzel und einer höllischen Menge Bourbon. Und so kommt es, dass der berüchtigte Bourbon Kid seinen Job an den Nagel hängen will. Doch so einfach ist das nicht. Der Mönch Peto ist ihm auf den Fersen, denn Bourbon Kid hat dessen gesamten Orden auf dem Gewissen. Außerdem trachten dem Killer diverse Zeitgenossen nach dem Leben: eine Reihe von Vampiren und Söldnern, eine Mumie, ein neuer Dunkler Lord - die Liste scheint endlos.
Rente hin oder her: Bourbon Kid hat die Nase voll und erstellt seine eigene Abschussliste. Und diesmal verschont er niemanden ... Während die Zahl der Toten in den staubigen Straßen von Santa Mondega steigt, stellt sich die Frage: Wer wird der Letzte sein, der noch steht?
Die unerbittliche Fortsetzung des SPIEGEL-Bestsellers "Das Buch ohne Namen" - noch fesselnder und gruseliger, noch spannender und lustiger!
Bourbon Kid metzelt auch in:
Band 1: Das Buch ohne Namen
Band 3: Das Buch ohne Gnade
Band 4: Das Buch des Todes
eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 588
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Inhalt
Cover
Grußwort des Verlags
Über dieses Buch
Titel
Vorwort
Eins
Zwei
Drei
Vier
Fünf
Sechs
Sieben
Acht
Neun
Zehn
Elf
Zwölf
Dreizehn
Vierzehn
Fünfzehn
Sechzehn
Siebzehn
Achtzehn
Neunzehn
Zwanzig
Einundzwanzig
Zweiundzwanzig
Dreiundzwanzig
Vierundzwanzig
Fünfundzwanzig
Sechsundzwanzig
Siebenundzwanzig
Achtundzwanzig
Neunundzwanzig
Dreißig
Einunddreißig
Zweiunddreißig
Dreiunddreißig
Vierunddreißig
Fünfunddreißig
Sechsunddreißig
Siebenunddreißig
Achtunddreißig
Neununddreißig
Vierzig
Einundvierzig
Zweiundvierzig
Dreiundvierzig
Vierundvierzig
Fünfundvierzig
Sechsundvierzig
Siebenundvierzig
Achtundvierzig
Neunundvierzig
Fünfzig
Einundfünfzig
Zweiundfünfzig
Dreiundfünfzig
Vierundfünfzig
Fünfundfünfzig
Sechsundfünfzig
Siebenundfünfzig
Achtundfünfzig
Neunundfünfzig
Sechzig
Einundsechzig
Zweiundsechzig
Dreiundsechzig
Vierundsechzig
Fünfundsechzig
Sechsundsechzig
Siebenundsechzig
Achtundsechzig
Anmerkungen
Über den Autor
Weitere Titel des Autors
Impressum
Liebe Leserin, lieber Leser,
vielen Dank, dass du dich für ein Buch von beTHRILLED entschieden hast. Damit du mit jedem unserer Krimis und Thriller spannende Lesestunden genießen kannst, haben wir die Bücher in unserem Programm sorgfältig ausgewählt und lektoriert.
Wir freuen uns, wenn du Teil der beTHRILLED-Community werden und dich mit uns und anderen Krimi-Fans austauschen möchtest. Du findest uns unter be-thrilled.de oder auf Instagram und Facebook.
Du möchtest nie wieder neue Bücher aus unserem Programm, Gewinnspiele und Preis-Aktionen verpassen? Dann melde dich auf be-thrilled.de/newsletter für unseren kostenlosen Newsletter an.
Spannende Lesestunden und viel Spaß beim Miträtseln!
Dein beTHRILLED-Team
Melde dich hier für unseren Newsletter an:
Über dieses Buch
Auch ein Massenmörder muss an seine Rente denken. Erst recht nach achtzehn Jahren Gemetzel und einer höllischen Menge Bourbon. Und so kommt es, dass der berüchtigte Bourbon Kid seinen Job an den Nagel hängen will. Doch so einfach ist das nicht. Der Mönch Peto ist ihm auf den Fersen, denn Bourbon Kid hat dessen gesamten Orden auf dem Gewissen. Außerdem trachten dem Killer diverse Zeitgenossen nach dem Leben: eine Reihe von Vampiren und Söldnern, eine Mumie, ein neuer Dunkler Lord – die Liste scheint endlos.
Rente hin oder her: Bourbon Kid hat die Nase voll und erstellt seine eigene Abschussliste. Und diesmal verschont er niemanden … Während die Zahl der Toten in den staubigen Straßen von Santa Mondega steigt, stellt sich die Frage: Wer wird der Letzte sein, der noch steht?
Die unerbittliche Fortsetzung des SPIEGEL-Bestsellers »Das Buch ohne Namen« – noch fesselnder und gruseliger, noch spannender und lustiger!
A N O N Y M U S
Band 2
Roman (wahrscheinlich wieder)
Aus dem Englischen von Axel Merz
An den Leser:
Im Buch ohne Namen sprach die Mystische Lady folgende Warnung in Bezug auf das Auge des Mondes aus:
Der Stein hat eine machtvolle Aura, und er zieht das Böse an, wo immer er sich befindet. Ihr seid nicht sicher, solange ihr ihn besitzt. Ihr seid ehrlich gesagt überhaupt nicht mehr sicher, wenn ihr je Kontakt damit hattet.
Lieber Leser,
in Ihren Händen halten Sie nun Das Auge des Mondes. Genießen Sie es, solange es noch geht …
Anonymus
EINS ♦
Joel Rockwell konnte sich nicht erinnern, jemals zuvor so nervös gewesen zu sein. Seine bisherige berufliche Laufbahn als Nachtwächter im Santa Mondega Museum of Art and History war ereignislos gewesen, um es gelinde zu sagen. Er hatte dem Beispiel seines Vaters Jessie folgen und zur Polizei gehen wollen, doch er hatte die Tests an der Police Academy nicht bestanden. In mancherlei Hinsicht war er froh darüber. Polizeiarbeit war viel gefährlicher, wie sich gerade drei Tage zuvor herausgestellt hatte, als sein Vater in den Nachwehen der Sonnenfinsternis während des Mondfestivals vom Bourbon Kid erschossen worden war. Ein lockerer Job als Wachmann war die bessere – sicherere – Alternative. Zumindest hatte es so ausgesehen, bis vor ziemlich genau fünf Minuten.
Der beschwerlichste Teil seiner nächtlichen Pflichten bestand darin, im Büro vor einer Reihe von Monitoren zu sitzen, die im Allgemeinen zeigten, dass innerhalb der Mauern des Museums nichts, aber auch rein gar nichts passierte. Außerdem juckte die graue Uniform, die Joel tragen musste, wie die Hölle. Wahrscheinlich war sie bereits von zahllosen anderen Angestellten getragen worden, bevor er sie an seinem ersten Tag erhalten hatte, und sie war einfach nicht zum Herumsitzen gemacht worden. Zu versuchen, sich während der gesamten Schicht in ihr wohlzufühlen, war in der Regel die anspruchsvollste Aufgabe der Nacht. Bis auf die Tatsache, dass das, was er soeben auf dem Bildschirm Nummer drei gesehen hatte, schlagartig alles änderte.
Joel Rockwell war kein Mann, der unter einer überschäumenden Fantasie gelitten hätte. Er war auch kein sonderlich intelligenter Mann – genau der Mangel an diesen beiden Eigenschaften hatte letztendlich dazu geführt, dass er die Aufnahmeprüfung an der Police Academy nicht geschafft hatte. Wie einer seiner Prüfer – ein grauhaariger dreißigjähriger Lieutenant – in seiner vertraulichen Beurteilung festgehalten hatte: »Dieser Typ ist so dämlich, dass es sogar den anderen Bewerbern aufgefallen ist.« Nichtsdestotrotz besaß er eine gewisse Bauernschläue und Aufrichtigkeit, die ihn zu einem guten Zeugen und zuverlässigen Wachmann machten, wenngleich nur, weil ihm die Fantasie und Intelligenz fehlten, irgendetwas anderes zu tun.
Wenn seine Augen ihm keinen Streich spielten, dann hatte er auf dem Bildschirm soeben einen Mord beobachtet. Sein Kollege Carlton Buckley war während seines Rundgangs im ersten Untergeschoss angegriffen und getötet worden. Rockwell hätte die Polizei alarmiert, doch bei der Beschreibung dessen, was er soeben gesehen hatte, hätten die Beamten ihn wahrscheinlich ausgelacht und eingesperrt, weil er ihre Zeit verschwendete. Also tat er das Nächstbeste, was ihm einfallen wollte: Er rief Professor Bertram Cromwell an, einen der Direktoren des Museums.
Er hatte die Nummer des Professors in seinem Handy gespeichert, und obwohl er ein wenig nervös war angesichts der Tatsache, dass er zu so gottloser Zeit anrief, wählte er die Nummer trotzdem. Cromwell war einer jener ausgesprochen höflichen Gentlemen, die niemals aus der Haut fuhren wegen eines Anrufs, ganz gleich, wie trivial der Anlass auch sein mochte.
Mit pochendem Herzen und dem Handy am Ohr, während er darauf wartete, dass Cromwell den Anruf entgegennahm, verließ er das Sicherheitsbüro und begab sich zur Treppe, um hinunter ins Untergeschoss zu steigen und nachzusehen, was da passiert war.
Er hatte den Fuß der Treppe erreicht und bog nun nach rechts in einen langen Gang ein, als der Professor endlich abnahm. Wenig überrascht klang er ganz wie ein Mann, der soeben aus tiefstem Schlaf gerissen worden war.
»Hallo? Hier ist Bertram Cromwell. Mit wem spreche ich bitte?«
»Hi Bernard, hier ist Joel Rockwell aus dem Museum.«
»Hi Joel, ich heiße Bertram, nicht Bernard.«
»Wie auch immer. Hören Sie, ich glaube, wir haben einen Einbrecher im Museum, aber ich bin nicht völlig sicher, deswegen dachte ich, ich rufe zuerst Sie an, bevor ich die Polizei alarmiere und so weiter, Sie wissen schon.«
Cromwell schien ein wenig wacher zu werden. »Tatsächlich? Was ist denn los?«
»Na ja, es klingt wahrscheinlich verrückt, aber ich glaube, eben hat sich jemand aus einer von diesen ägyptischen Mumien ausgewickelt.«
»Wie bitte?«
»Die Mumienausstellung. Ich glaube, jemand ist aus diesem gottverdammten ägyptischen Grab gekommen.«
»Was? Das ist unmöglich! Was um alles in der Welt reden Sie da?«
»Ja, ich weiß, es klingt verrückt. Deswegen hab ich ja zuerst Sie angerufen und nicht die Polizei. Ich glaube, wer auch immer sich da ausgewickelt hat, er hat gerade eben den Kollegen erledigt.«
»Mit wem haben Sie heute Nacht Dienst?«
»Carter Bradley.«
»Sie meinen Carlton Buckley?«
»Wie auch immer. Ich bin nicht sicher, ob er mir einen Streich zu spielen versucht oder nicht. Aber wenn es kein Streich ist, dann hat er echte Probleme. Richtig echte Probleme, meine ich.«
»Warum denn? Was ist passiert?« Der Professor war jetzt hellwach. Er schwieg eine Sekunde, um sich zu sammeln, dann sagte er: »Was genau haben Sie gesehen, Joel? Fakten, mein Junge – ich brauche Fakten. Verzeihen Sie, wenn ich das sage, aber Sie reden nicht gerade vernünftig daher, und ich bin hundemüde.«
Während des Gesprächs mit dem Professor war Joel weiter den breiten, schwach erleuchteten Korridor hinuntergegangen, und jetzt – schneller, als ihm lieb war – hatte er das Ende erreicht. Er atmete tief durch, dann bog er nach rechts ab in die weite, offene Galerie, die als Lincoln Hall bekannt war. Das war der Moment, in dem er die Musik hörte. Eine leichte Klaviermelodie, sanft und traurig, nicht unähnlich dem Lonely-Man-Thema, das am Ende von Der unglaubliche Hulk gespielt wurde, der Fernsehserie aus den Siebzigern, die er als Kind so geliebt hatte. Er wusste zwar, dass irgendwo hier unten ein Flügel stand, aber wer zum Teufel spielte darauf? Und so verdammt schlecht obendrein …
»Warten Sie, eine Sekunde, Professor Crumpler. Das werden Sie nicht glauben, aber ich höre ein Klavier spielen. Ich stecke mein Handy für einen Moment in die Tasche. Warten Sie, und ich sage Ihnen gleich, was ich sehe.«
Rockwell schob sein kleines Handy in die Brusttasche seines grauen Uniformhemds und zog den Gummiknüppel aus der Schlaufe an seinem Gürtel. Dann betrat er die große Halle, um sich weiter umzusehen.
Der Flügel befand sich hinter einer sandfarbenen Wand zu seiner Linken, die sich bis zur Hälfte der Halle zog. Auf der gesamten Länge hingen Gemälde berühmter Musiker. Er ignorierte die Musik für eine Sekunde und richtete seine Aufmerksamkeit auf die ägyptische Ausstellung zu seiner Rechten, ein Diorama mit Namen »Das Grab der Mumie«. Es war verwüstet. Überall lagen Glasscherben am Boden, wo die schützende umlaufende Scheibe eingeschlagen worden war. Mehr noch, die Glasscherben lagen in Lachen voll Blut. Jeder Menge Blut.
Insbesondere war der goldene Sarkophag geöffnet, der aufrecht in der Mitte des Dioramas stand. Der Deckel lag auf dem Boden, und die mumifizierten Überreste des verstorbenen Bewohners waren verschwunden. Rockwell wusste, dass der Professor diese Ausstellung ganz besonders liebte. Er würde mächtig aufgebracht reagieren, wenn er erfuhr, dass seine wertvolle Prise gestohlen worden war oder jemand sich daran zu schaffen gemacht hatte. Es war das Herzstück des Museums, das seltenste und wertvollste Objekt in der gesamten gewaltigen Sammlung. Und jetzt fehlte ausgerechnet der beste Teil davon.
Rockwell dachte an das, was er auf dem Bildschirm im Sicherheitsbüro zu sehen geglaubt hatte, und schüttelte verwirrt den Kopf. Seither waren erst ein paar Minuten vergangen, und doch fing er schon an zu glauben, dass der Angriff auf Buckley nur Einbildung gewesen war. Das war doch sicher ein dummer Streich, oder nicht? Der Zeitpunkt war alles andere als gut gewählt, angesichts der vielen Morde in Santa Mondega und Umgebung – total geschmacklos, ehrlich, falls jemand sich für Joels Meinung interessierte –, aber nichtsdestotrotz ein Streich. Und was war überhaupt los mit dem verdammten Flügel? Verdammt, nimm Klavierunterricht, wer auch immer du bist!, dachte er mit einer selbst für jemanden wie ihn atemberaubenden Folgewidrigkeit.
Um zum Flügel zu gelangen – der, falls die Gerüchte stimmten, einst einem berühmten Komponisten gehört hatte –, musste er irgendwie um die Sauerei aus Blut und Glas herum und an einer riesigen Statue des griechischen Helden Achill vorbei bis zu einem kleinen Alkoven auf der anderen Seite der langen, sandfarbenen Wand. Wenn er sich recht erinnerte, saß eine lebensgroße Holzpuppe an dem Instrument, die so geschminkt und gekleidet war, dass sie dem ursprünglichen Besitzer ähnelte. Wer war das noch mal?, sinnierte er. Beethoven? Mozart? Manilow? Es war nicht wichtig genug, um sich darüber den Kopf zu zerbrechen, und abgesehen davon würde er bald seine Antwort bekommen.
Als er die Statue des großen, wenngleich ein wenig mürrisch dreinblickenden griechischen Kriegers passiert und das Ende der sandfarbenen Wand umrundet hatte, sah er, dass die Holzpuppe in einiger Entfernung vom Flügel auf dem Rücken am Boden lag, als hätte jemand sie mit beträchtlicher Kraft gepackt und weggeschleudert. Sie trug eine purpurrote Jacke über einem weißen Hemd, dazu dunkle ausgestellte Hosen über glänzend schwarzen Lackschuhen. Auf dem linken Revers war ein Schild, darauf stand Beethoven, doch Rockwell bemerkte es nicht, als er über die Holzpuppe stieg, weswegen er hinterher immer noch nicht wusste, welcher berühmte Komponist nun der Besitzer besagten Flügels gewesen war.
Jedenfalls war es nicht die Puppe, die am Flügel saß und spielte. Es war jemand anders. Er machte ein paar vorsichtige Schritte in Richtung des Instruments, um einen besseren Blick auf den Musiker werfen zu können, der so unbeschreiblich schlecht spielte. Als er nah genug war, sah er eine Gestalt auf dem kleinen Hocker vor dem Flügel sitzen und mit mehr Verve als Geschick in die elfenbeinernen Tasten hämmern. Der Anblick der Gestalt jagte Rockwell einen eisigen Schauer über den Rücken.
Die Gestalt trug ein langes, tief dunkelrotes Gewand mit einer Kapuze. Und weil sie die Kapuze über den Kopf gezogen hatte, sah sie aus wie ein Boxer auf dem Weg in den Ring. Sie schwankte leidenschaftlich nach rechts und links und bewegte den Kopf wie Stevie Wonder, während sie ihre furchtbar schräge Melodie spielte. Von Rockwells Kollegen Buckley war keine Spur zu sehen, auch wenn – ziemlich beunruhigend – eine Spur aus fetten Blutspritzern zu der vermummten Gestalt am Flügel führte.
Indem er in sicherem Abstand blieb, rief Rockwell die Gestalt an, in der Hoffnung, einen Blick auf das Gesicht des mysteriösen Pianisten unter der Kapuze werfen zu können. Falls ihm nicht gefiel, was er sah, hatte er zumindest zwanzig Meter Vorsprung, falls er schleunigst die Flucht ergreifen musste.
»Hey, Sie!«, rief er. »Wir haben geschlossen! Sie dürfen da nicht spielen. Sie dürfen überhaupt nicht mehr hier sein. Zeit zu gehen, Kumpel.«
Die Gestalt unterbrach ihr Spielen, und ihre knochigen Finger zitterten nahezu unmerklich über den glänzenden schwarzen und weißen Tasten. Dann sprach sie.
»Du summst die Melodie, und ich nehme sie auf.« Es war eine rostig klingende Stimme, die unter der roten Kapuze hervordrang. Ein schallendes Lachen folgte, und die Hände fielen herab, als die Gestalt ihre Melodie fortsetzte.
»Was? Wie? Hey, wo ist Carterton?«, rief Rockwell und trat einen Schritt näher. Die Hand, die den Gummiknüppel gepackt hielt, schwitzte reichlich.
Wieder hörte die Gestalt auf zu spielen, und diesmal drehte sie den Kopf und sah Rockwell direkt an. Da Rockwell nicht gerade forsch auf sie zuging, war es für ihn überhaupt kein Problem, wie angewurzelt stehen zu bleiben, gefolgt von einem verlegenen Moment, in dem er ernsthaft überlegte, ob er sich in die Hose pinkeln sollte oder nicht.
Die Gestalt unter der Kapuze besaß nur ein halbes Gesicht. Im Schatten des Stoffs erblickte der zu Tode erschrockene Nachtwächter etwas, das größtenteils aussah wie ein vergilbter Schädel. Faulende Überreste von Fleisch hingen an den Wangen, am Unterkiefer und an der Stirn, und er bemerkte auch ein einzelnes, ziemlich merkwürdig aussehendes grünes Auge, doch die andere Augenhöhle war leer, und das Gesicht hatte weder Lippen noch eine Nase. Voll Abscheu sah Rockwell zur Seite, nur um zu bemerken, dass die knochigen Finger, die in die Tasten des Flügels gegriffen hatten, genau das waren: Knochenfinger. Finger ohne jedes Fleisch und ohne Haut. Herr im Himmel!
Bevor Rockwell Zeit fand, sich abzuwenden und wegzurennen, erhob sich die verhüllte Gestalt von ihrem Hocker. Sie war gut über eins achtzig groß und schien die weitläufige Galerie zu dominieren. Sie streckte die Knochenfinger in Rockwells Richtung aus.
Und dann tat sie etwas Merkwürdiges.
Sie fuhr mit einer Hand durch die Luft, als würde sie die unsichtbaren Schnüre einer Marionette ziehen, während sie Rockwell unablässig mit ihrem ausdruckslosen Gesicht anzugrinsen schien.
Für Joel Rockwell sahen die Knochenhände aus, als würden sie in allernächster Zukunft hinter ihm her sein, obwohl er sicher zwanzig Meter entfernt war. Noch als er sich umwandte in der Absicht, so schnell aus der Galerie zu verschwinden, als wäre der Teufel persönlich hinter ihm her – so ein Ding war bestimmt kein guter Sprinter –, erlebte er den zweiten massiven Schock innerhalb kürzester Zeit.
Die Holzpuppe von Ludwig van Beethoven hatte sich aufgerichtet, irgendwie zum Leben erweckt von der winkenden Knochenhand dieses – dieses Dings am Flügel. Sie stand direkt vor Rockwell und starrte ihn unter ihrer mächtigen Mähne blicklos an, die Arme und die Holzhände ausgestreckt, wie um ihn an der Kehle zu packen.
Der geschockte Nachtwächter schlug mit dem Gummiknüppel nach ihr, mit dem einzigen Ergebnis eines lauten, dumpfen Geräuschs, als der Holzkopf den Treffer absorbierte. Ein Stück Ohr platzte ab, doch das war alles. Mit brennenden Fingern vom Schlag ließ Joel die nutzlose Waffe fallen, riss das Handy aus der Brusttasche und hielt es an sein Ohr, als die Puppe ihn am Hals zu fassen bekam. Während er mit dem hölzernen Assassinen über sich zu Boden ging, der ihm die Luft abdrückte und den Atem aus seinen Lungen trieb, gelang es ihm noch, einen kurzen Hilfeschrei in das Telefon zu krächzen, wider jede Vernunft in der Hoffnung, Cromwell möge ihn hören und ihn irgendwie retten oder wenigstens eine Rettungsmannschaft schicken.
»Bernard, um Himmels willen! Sie müssen mir helfen!«, ächzte er. »Ich werde hier von einem beschissenen Barry Manilow angegriffen!«
Ob der Professor antwortete oder seinen Hilferuf auch nur gehört hatte, sollte Rockwell niemals erfahren. Er ließ das Handy fallen und kämpfte mit jedem Quäntchen seiner rasch schwindenden Kräfte darum, sich seinem Angreifer zu entwinden – vergeblich. Die Holzpuppe war zu stark und völlig unbeeindruckt von seinen schwächer werdenden Bemühungen. Sie hielt ihn einfach am Boden fest, die Hände um seinen Hals gelegt, und drückte zu.
Rockwell wehrte sich verzweifelt, bis schließlich eine weitere Gestalt über ihm aufragte und er in die abscheuliche Fratze der Mumie starrte. Der untote Ägypter brauchte mehr menschliches Fleisch, um seinen verwesenden Leib zu ergänzen, und Rockwells Fleisch war wie geschaffen zu diesem Zweck.
Im Verlauf der nächsten zehn Minuten wurde der bemitleidenswerte Nachtwächter bei lebendigem Leib in Stücke gerissen und von der barbarischen Kreatur verschlungen. Es dauerte eine Weile, bis Rockwell in unvorstellbarer Agonie gestorben war. Er hatte nur drei Tage gebraucht, um seinem Vater ins Jenseits zu folgen.
Nachdem sie sich am Fleisch der beiden Nachtwächter gelabt hatte, fühlte sich die Mumie – die unsterblichen, ehemals einbalsamierten Überreste des Pharaos, der einst bekannt gewesen war unter dem Namen Rameses Gaius – frisch gestärkt und bereit, wieder in die Welt der Lebenden einzutreten. Wo sie zwei Dinge suchen – oder besser gesagt, fordern – würde. Rache an den Nachfahren derjenigen, die sie für so lange Zeit eingekerkert hatten, und die Rückgabe ihres wertvollsten Besitzes während ihrer Tage als Herrscher von Ägypten: dem Auge des Mondes.
ZWEI ♦
31. Oktober – achtzehn Jahre zuvor
Der jährlich stattfindende Halloween-Kostümball der Santa Mondega High School war für die Schüler der Höhepunkt des gesellschaftlichen Lebens. Die fünfzehnjährige Beth Lansbury hatte geduldig seit Anfang des Halbjahrs auf diesen Tag gewartet. Dies war ihre große Chance – vermutlich ihre einzige Chance, dachte sie –, die Aufmerksamkeit eines gewissen Jungen eine Klasse über ihr zu erwecken. Sie kannte seinen Namen nicht, und es wäre ihr viel zu peinlich gewesen, jemand anderen zu fragen, nicht zuletzt aus Angst, man könnte ihr anmerken, wie verknallt sie war, und sie deswegen hänseln. Was die anderen ganz bestimmt getan hätten.
Beth hatte keine Freundinnen in der Schule. Sie war immer noch ziemlich neu, und extrem hübsch zu sein half auch nicht gerade weiter. Das war einer der prinzipiellen Gründe, warum all die anderen Mädchen sie abzulehnen schienen. Genauer gesagt, Ulrika Price mochte Beth nicht, und sie hatte allen anderen Mädchen klargemacht, dass keine mit Beth zu reden hatte, es sei denn, um irgendetwas Hämisches zu ihr zu sagen.
Wie es in jener Gegend angesagt war, fand der Ball in der zur Schule gehörenden Sporthalle statt. Tagsüber hatte Beth ihrer Englischlehrerin, Miss Hinds, beim Schmücken der Halle geholfen. Die Halle hatte nicht wirklich umwerfend ausgesehen, als sie fertig gewesen waren, doch jetzt, nach Einbruch der Dunkelheit, mit all den bunten Lichtern und der Musik, gewann der große Raum eine ganz neue Ausstrahlung. Beth stellte erfreut fest, dass die Halle insgesamt trotz der spastisch blinkenden Discolichter ziemlich dunkel war – wie geschaffen als Deckung für Außenseiter und Einzelgängerinnen wie sie.
Es gab noch einen weiteren Grund für Beths Kummer. Ihre überaus herrschsüchtige Stiefmutter hatte darauf bestanden, Beths Kostüm auszusuchen, und – typisch für sie! – sie hatte etwas total Hässliches und Unvorteilhaftes gefunden. Während alle anderen entsprechend dem Anlass in Halloween-Kostümen daherkamen (beispielsweise als Geister, Zombies, Hexen, Vampire, Skelette, ja sogar eine wenig überzeugende Fledermaus und mindestens vier Freddy Krueger), war Beth als Dorothy aus dem Zauberer von Oz verkleidet, einschließlich der blöden roten Schuhe. Sie hatte sich eingeredet, dass sie sich trotzdem amüsieren würde – trotzdem war sie immer noch aufgebracht, dass ihre Stiefmutter ein so unangemessenes und dummes Kostüm ausgewählt hatte.
Zu sagen, dass Olivia Jane Lansbury extrem dominant war, war gleichbedeutend mit der Aussage, dass Hitler von Zeit zu Zeit ein wenig böse sein konnte. Schlimmer noch – sie schien eisern entschlossen zu verhindern, dass ihre Stieftochter jemals irgendwelche Jungen kennen lernte. Das mochte aus einer gewissen Bitterkeit herrühren, weil sie kurz nach der Heirat von Beths Vater zur Witwe geworden war. Beths richtige Mutter war bei ihrer Geburt gestorben, und so war Olivia der einzige Elternteil, den Beth je wirklich gekannt hatte. Und in Olivias Obhut aufzuwachsen war ziemlich hart gewesen. Selbst der heutige Abend wird kein Honigschlecken, sinnierte sie.
Und jetzt war sie hier am Halloween-Abend, angezogen wie die trübe Tasse persönlich und ohne eine einzige Freundin auf der ganzen Welt, eine Kandidatin wie geschaffen für die Zickenkommentare von Ulrika Price und ihrem Kreis von Stiefelleckerinnen. Ulrika und ihre drei treuesten Anhängerinnen waren als Katzen verkleidet zum Ball gekommen. Die Anhängerinnen in Schwarzer-Panther-Kostümen, Ulrika hingegen im Outfit eines bengalischen Tigers, inklusive scharfer Krallen an den Fingerspitzen.
Die Katzen hatten Beth in ihrem Plastiksessel am Rand der Tanzfläche entdeckt, wo sie zusammen mit einigen anderen Ausgestoßenen saß, alle in der verzweifelten Hoffnung, ein Junge möge sie ansprechen und zum Tanzen auffordern. Dass die Zielscheibe ihres Spottes als Dorothy aus Oz verkleidet war, bedeutete in der gegebenen Situation, dass keine gehässigen Kommentare erforderlich waren. Ulrika und ihre Freundinnen zeigten lediglich mit ausgestreckten Fingern auf sie und lachten laut und demonstrativ. Was genügend Aufmerksamkeit von allen Seiten auf das unglückselige Mädchen lenkte, und alle, die Beth bisher ignoriert hatten, stimmten in das Gelächter und das Kichern ein. Wenn Ulrika und ihre Freundinnen lachten, dann wollte jeder den Eindruck erwecken, den Witz ebenfalls gut zu finden. Soziale Akzeptanz war von größter Bedeutung in der Santa Mondega High, und wenn Ulrika Price, die wasserstoffblonde Cheerleaderin, den Verdacht hegte, das jemand nicht über ihre Witze lachte, dann konnte dieser Jemand genauso gut seine Sachen packen und sich auf den Heimweg machen. Beths einziger und winziger Trost bestand darin, dass ihre Stiefmutter sie wenigstens nicht gezwungen hatte, sich die Haare rot zu färben, um noch echter zu erscheinen. Wenigstens hatte sie das Glück, ihre wunderschöne lange braune Mähne behalten zu haben.
Es war ein kleiner Trost, wie sich herausstellen sollte, denn ihre Demütigung wurde kurz nach elf Uhr vervollständigt, als eine der schwarzen Pantherinnen den Typen an der Lichtorgel überredete, einen Scheinwerfer auf Beth zu richten. Und als das harte weiße Licht die verlorene Gestalt illuminierte, verkündete der DJ (noch einer von Ulrikas Freunden) über die Lautsprecheranlage, dass die gute alte Dorothy da im Scheinwerferlicht soeben den Preis für das langweiligste Kostüm gewonnen hatte. Was weiteres grölendes Gelächter nach sich zog von Seiten eines bellenden Mobs betrunkener und zugedröhnter Teenager.
Beth saß in würdevollem Schweigen da und wartete ergeben darauf, dass der Scheinwerfer wieder erlosch, während sie darum kämpfte, den Ozean von Tränen zurückzuhalten, der sich in ihr anstaute. Doch der Scheinwerfer blieb. Und weil Ulrika die einzigartige Gelegenheit auf keinen Fall versäumen wollte, schlenderte sie lässig herbei und tätschelte Beth den Kopf.
»Weißt du was, Honey?«, feixte sie. »Wenn es einen Wettbewerb für den größten Loser auf der Welt gäbe, kämst du an zweiter Stelle.«
Das war das Ende für Beth. Tränen rannen über ihre Wangen, und ein mächtiger Schluchzer entrang sich ihrer Kehle. Jetzt blieb ihr nur noch aufzuspringen und aus der Halle zu rennen. Als sie davonrannte, hörte sie hinter sich alle lachen. Selbst die anderen Außenseiter lachten mit – wer nicht beim Lachen gesehen wurde, wäre Ulrikas nächstes Opfer. Niemand wollte in der gleichen Kategorie von Loser landen wie das Mädchen, das als Dorothy aus dem Zauberer von Oz zur Halloween-Party gekommen war.
Als Beth durch die Doppeltür der Halle und nach draußen in den Korridor platzte, hatte sie das Gefühl, noch niemals so gedemütigt worden zu sein. Sie hatte ihre Stiefmutter angefleht, nicht so ein bescheuertes Kostüm für sie auszusuchen, doch ihr Flehen war auf taube Ohren gestoßen, wie Beth es von Anfang an gewusst hatte. Die Hexe hatte vor Schadenfreude gegackert, als Beth darum gebettelt hatte, etwas anderes anziehen zu dürfen. Alles – ihre öffentliche Demütigung, ihre tränenüberströmte Flucht aus der Halle – war die Schuld ihrer Stiefmutter. Beth wusste schon jetzt, dass die Hexe selbstzufrieden grinsen würde, sobald sie wieder zu Hause wäre, und hämisch anmerken, dass sie ihre Stieftochter gewarnt hätte, den Fehler zu begehen und zu erwarten, dass andere sie akzeptierten. Seit dem Tod ihres Vaters hatte ihre Stiefmutter sich daran ergötzt, Beth immer und immer wieder zu sagen, dass sie nichtsnutzig war. Und jetzt fühlte sie sich tatsächlich so. Sie begann zu verstehen, warum es Menschen gab, die sich das Leben nahmen. Manchmal war das Weiterleben einfach zu hart.
Als sie durch den Korridor zum Haupteingang der Sporthalle stolperte in dem verzweifelten Bemühen, schleunigst von hier wegzukommen, um nicht mehr das sie verfolgende schallende Gelächter anhören zu müssen, rief jemand hinter ihr ihren Namen. Es war die Stimme, die zu hören sie sich den ganzen Abend gewünscht hatte. Der Junge aus der Klasse über ihr. Sie hatte ihn erst einmal reden hören, als er sie gefragt hatte, ob alles in Ordnung war, nachdem eine von Ulrikas Speichelleckerinnen ihr auf dem Schulhof ein Bein gestellt hatte und sie gestürzt war. Er hatte ihr aufgeholfen, sie gefragt, ob sie sich wehgetan hätte, und als sie nicht geantwortet hatte – weil es ihr die Sprache verschlagen hatte –, bloß gelächelt und war weitergegangen. Seit jenem Tag hatte sie sich die größten Vorwürfe gemacht, weil sie ihm nicht gedankt hatte, und sie hatte sich geschworen, einen Weg zu finden, mit ihm zu reden und ihm ihre Dankbarkeit dafür zu zeigen, dass er ihr geholfen hatte. Und jetzt war es wieder seine Stimme, die fragte: »Deine Mutter auch, wie?«
Sie drehte sich um. Dort stand er, auf halbem Weg den Korridor hinunter, zwischen ihr und der Halle. Er war als bizarre Vogelscheuche verkleidet, mit einem spitzen braunen Hut auf dem Kopf, das Gesicht mit brauner Schminke bemalt, die wohl wie Schmutz aussehen sollte, und mit einer orangefarbenen, von einem Gummizug gehaltenen Pappkarotte auf der Nase. Sein Kostüm bestand im Grunde genommen nur aus braunen Lumpen, auch wenn er dazu ziemlich coole braune Stiefeletten trug.
»Wa-?« war alles, was Beth hervorbrachte, während sie versuchte, sich die Tränen aus dem Gesicht zu wischen und nicht mehr ganz wie ein heulendes Elend auszusehen.
»Meine Mutter ist auch so eine Zauberer-von-Oz-Verrückte«, sagte er und zeigte mit der Hand auf sich und seine Verkleidung. Endlich gelang es Beth, sich zu einem Lächeln zu zwingen, etwas, das ihr noch vor einer Minute unmöglich erschienen war. Sie blickte kläglich an sich und ihrem blauen Schürzenkleidchen mit der weißen Bluse hinunter. »Ich schätze, du hast das Kostüm nicht selbst ausgesucht, oder?«, fragte die Vogelscheuche.
Beth stellte fest, dass es ihr erneut die Sprache verschlagen hatte. Das war der Augenblick, auf den sie hingearbeitet hatte. Den ganzen Abend hatte sie auf diese Gelegenheit gewartet und hatte eine bittere Demütigung hinnehmen müssen. Und jetzt, da er gekommen war, verlief nichts nach Plan. Sie hatte sich nicht vorgestellt, so verheult auszusehen und so furchtbar, auch wenn sie jetzt nicht mehr viel daran ändern konnte. Lieber Gott, dachte sie. Er denkt bestimmt, ich bin eine totale Dumpfbacke.
»Zigarette?«, fragte der Junge und hielt ihr eine Packung hin, während er näher kam.
Beth schüttelte den Kopf. »Ich darf nicht.«
Der Junge nahm die Packung, hob sie an den Mund, pflückte mit den Zähnen eine Zigarette hervor und ließ sie lässig im Mundwinkel hängen. Dann, während er immer noch näher kam, zog er sich die Pappkarotte von der Nase und ließ sie am Gummiband um den Hals baumeln.
»Ach, komm schon«, sagte er grinsend. »Warum genießt du das Leben nicht ein wenig?«
Beth befürchtete angstvoll, er könnte sie für langweilig und uncool halten, und offen gestanden war das Verbot ihrer Stiefmutter tatsächlich der einzige Grund, aus dem sie nicht rauchte. Und weil das so war, konnte sie Beth im Moment den Buckel runterrutschen.
»Okay«, sagte sie und streckte die Hand aus, um sich eine Zigarette aus der Packung zu nehmen. »Hast du Feuer?«, fragte sie.
»Bestimmt nicht!«, entgegnete der Junge mit ungerührter Miene. »Ich kann keine offene Flamme in der Nähe vertragen. Es würde nur Puff machen, und weg wäre ich!«
»Hä?«
»Das Stroh, weißt du?« Er grinste, als er ihre Verwirrung bemerkte. »Das Vogelscheuchenkostüm?«
Beth riss die Augen auf und rang um ihre Fassung. »Oh. Ja, ja natürlich!«, lachte sie nervös. Du Idiotin!, schalt sie sich innerlich. Er macht einen Witz, und du kapierst ihn nicht! Konzentrier dich, Herrgott noch mal! Bring ihn nicht auf den Gedanken, dass du dämlich bist!
Eine verlegene Pause entstand, als sie sich die Zigarette zwischen die Lippen schob und sich fragte, was sie denn bitte schön ohne Feuerzeug damit anfangen sollte. »Wie mache ich sie an?«, fragte sie. Der Junge lächelte erneut, dann sog er heftig an der unangezündeten Zigarette in seinem Mundwinkel. Sie flammte auf wie ein Feuerwerk, und er nahm einen Zug.
»Wow, das ist vielleicht cool!«, sprudelte Beth hervor, als sie endlich ihre Stimme wiedergefunden hatte und vor dem Reden nicht mehr eine halbe Ewigkeit denken musste. »Wie hast du das gemacht?«
»Das ist ein Geheimnis. Ich verrate es nur meinen Freunden.«
»Oh.«
Eine weitere verlegene Pause dehnte sich, während Beth sich fragte, ob sie ihn bitten sollte, es ihr zu verraten. Die Sache war, falls er Nein sagte, bedeutete das zugleich, dass sie keine Freunde waren. Doch dann, nach einer grässlich langen und peinlichen Pause, nahm er einen weiteren Zug, bevor er die Zigarette mit der linken Hand aus dem Mund nahm.
»Diese Ulrika Price ist ein echtes Miststück, wie?«, fragte er, indem er den Rauch aus den Nasenlöchern blies.
Beth nickte unwillkürlich in heftiger Zustimmung. »Ich hasse sie!«, sagte sie und nahm die Zigarette aus dem Mund.
Sie lächelten sich ein paar Augenblicke lang an, dann ergriff der Junge wieder das Wort.
»Was ist – soll ich dir jetzt zeigen, wie du diese Zigarette anmachst, oder nicht?«
Beth nickte wie besessen, und ein strahlendes Grinsen breitete sich über ihr ganzes Gesicht aus. Es ließ die Tränen vergessen, die erst eine Minute zuvor über ihre Wangen geströmt waren, so wunderschön war dieses Grinsen.
»Ja. Ja, bitte!«, hauchte sie.
»Dann komm, machen wir, dass wir hier rauskommen, bevor wir den Rauchalarm auslösen.«
Der nächste Moment war der großartigste in Beths bisherigem Leben. Dieser Junge, dieser Typ, dessen Aufmerksamkeit sie so verzweifelt zu erwecken versucht hatte, streckte die Hand aus und legte den Arm um sie. Nervös legte sie den eigenen Arm um seine Taille und lehnte sich behutsam an ihn. Es schien ihm zu gefallen, denn er revanchierte sich, indem er sie noch fester an sich zog. Dann setzte er sich mit ihr im Schlepptau durch den Korridor in Richtung Ausgang in Bewegung. Dorothy und die Vogelscheuche gemeinsam unterwegs – wenn das nicht das Stichwort für ein Lied ist, dachte Beth.
»We’re off to see the wizard …«, begann sie zu summen.
»Nicht«, sagte ihr neuer Beau und schüttelte den Kopf. »Nicht singen.«
»Nein?«, fragte Beth und errötete vor Schreck. Sie fürchtete bereits, einen fatalen Fehler gemacht zu haben.
»Kein Wunder, dass du keine Freundinnen hast«, witzelte ihr Held. Beth blickte zu ihm auf und war erleichtert, als sie sein breites Grinsen bemerkte. Dann drückte er sie wirklich ganz fest an sich. Puh, er hat mich nur geneckt.
Auf dem Weg nach draußen durch die Tür zwängte sich ein junger Bursche in der Verkleidung eines riesigen Nagers an ihnen vorbei. Sein Kostüm war ein einteiliger rotbrauner Overall aus Teddyfell mit einem langen Schwanz auf der Rückseite. Ein Teil seines Gesichts war unter der Kapuze zu erkennen, doch es war in der gleichen Farbe bemalt wie das Kostüm und hatte zusätzlich aufgemalte Schnurrhaare auf den Backen. Beth kannte den Jungen nicht, im Gegensatz zu ihrem neuen Freund.
»Du bist spät dran«, sagte die Vogelscheuche, als die Fellkugel an ihnen vorbei wollte.
»Ja, ich hab meine Pillen zu Hause vergessen. Ich musste noch mal zurück und sie holen«, murmelte der Nager. »Hat einer von euch zufällig diese Ulrika Price irgendwo gesehen?«
»Sie ist in der Halle«, sagte Beth und nickte den Korridor entlang.
»Cool, danke«, sagte der Nager. »Ich werde ihr einen Drink kaufen, schätze ich.« Dann kratzte er sich in einer Region seines Kostüms, die implizierte, dass er sich selbst Freude bereitete, und eilte durch den Korridor in Richtung Halle davon.
»Wer war dieser gruselige Junge?«, fragte Beth.
Ihr hübscher Vogelscheuchenfreund schien den Jungen gut zu kennen.
»Das war Marcus, das Wiesel«, sagte er. »Der ist total durchgeknallt. Gott weiß, welche Überraschung er für deine Freundin Ulrika in petto hat.«
DREI ♦
Beth und die Vogelscheuche schlenderten an der Promenade entlang, und die Wellen plätscherten leise an die Hafenmauer zu ihrer Linken. Ein blauer Mond schien hell am Nachthimmel über ihnen, umgeben von dunklen Regenwolken, die aussahen, als würden sie sich jeden Augenblick öffnen und nur aus Respekt nicht vor den Mond ziehen, als wollten sie denen da unten seinen Anblick nicht verwehren.
In ihrem ganzen Leben hatte sich Beth niemals so lebendig gefühlt, so aufgeregt. Es war ihrer Stiefmutter stets gelungen, alle Jungen zu verscheuchen, die sich Beth zu nähern gewagt hatten, deswegen hatte sie auch noch nie eine längere Unterhaltung mit einem Jungen gehabt. Nach der Folter zu Hause seit frühester Kindheit hatte sie zwar eine anständige Erziehung erhalten, doch praktisch keinerlei Lebenserfahrung erworben, bis sie vor relativ kurzer Zeit in die Schule gekommen war. Und jetzt hatte sie zum ersten Mal in ihrem Leben einen Jungen neben sich, der auch noch den Arm um ihre Schulter gelegt hatte und mit ihr über die Promenade spazierte. Wenn die dunklen Wolken oben am Himmel Nummern getragen hätten, es wäre wohl fair, zu schreiben, dass sie geradewegs auf Wolke Nummer neun zuhielt. Mit der Vogelscheuche zu reden hatte sich als nicht annähernd so schwierig und nervenaufreibend erwiesen, wie sie befürchtet hatte. Zwar pochte ihr das Herz immer noch in der Brust, und sie war kaum imstande, sich zu beherrschen angesichts des gewaltigen Adrenalinrausches, den sie spürte. Es war ein warmes, benommenes Gefühl, das kein Ende nehmen zu wollen schien, und sie hoffte inbrünstig, dass es so bliebe.
»Also, Mister Vogelscheuche, sagst du mir jetzt deinen Namen oder nicht?«, fragte sie und kniff ihn verspielt in die Taille.
»Was denn, du weißt nicht, wie ich heiße?«, kam die überraschte Antwort.
»Nein. Ich kenne dich nur als den Jungen, der mir beim Aufstehen behilflich war, als mir eins der anderen Mädchen ein Bein gestellt hat.«
»Wow. Weißt du, ich habe Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, um deinen Namen herauszufinden, und zwar gleich am ersten Tag, nachdem ich dich auf unserer Schule gesehen habe. Du bist jetzt seit zwei Monaten hier, und du weißt meinen Namen immer noch nicht?«
»Nein. Du musst dich deswegen nicht schlecht fühlen. Ich kenne überhaupt keinen Jungen und auch keine Mädchen. Niemand redet mit mir.«
»Niemand?« Er klang beinahe ungläubig.
»Niemand. Die anderen Mädchen ignorieren mich wegen dieser Ulrika Price. Sie hat mich seit dem ersten Tag auf dem Kieker, deswegen will niemand mit mir reden.«
Vogelscheuche blieb stehen und nahm den Arm von ihren Schultern. Dann trat er ihr in den Weg, so dass sie nicht weitergehen konnte, und dann, als sie einander so nahe waren, dass sie sich fast berührten und sie seinen Atem auf ihrem Gesicht spüren konnte, strich er mit der linken Hand durch ihre langen braunen Haare.
»JD«, sagte er.
Sie hob eine Augenbraue. »Was soll das heißen, ›JD‹?«
»So nennen mich meine Freunde.«
»Oh, richtig. Wofür steht JD?«
»Das musst du raten.«
»Okay«, sagte Beth lächelnd. Sie sah hinauf zum Mond und versuchte sich einen interessanten Namen mit den Initialen J und D auszudenken.
»Und?«, fragte er.
»Joey Deacon?«
JD unterbrach seine streichelnden Bewegungen und versetzte ihr einen spielerischen Schubser. »Das ist der Grund, aus dem niemand mit dir redet!«
Sie lächelte ihn an. Mit JD zu reden machte großen Spaß, und es fiel ihr überraschend leicht. Es spielte überhaupt keine Rolle, was sie sagte, sie hatte das Gefühl, als würde er es verstehen. Vielleicht waren Jungen gar nicht so kompliziert. Zumindest dieser hier schien genau auf ihrer Wellenlänge zu sein. Sie hatte noch niemals zuvor eine Verbindung wie diese mit einem anderen Menschen gehabt, ganz zu schweigen von einem Jungen. Er schien sie zu verstehen, und zum ersten Mal in ihrem ganzen Leben hatte sie überhaupt keine Angst, sie könnte irgendetwas Dummes sagen. Tatsächlich begann sich ein Gefühl von Selbstbewusstsein in ihr zu entwickeln. Das war etwas völlig Neues.
»Ich sage dir was, Beth.« Er wich ein paar Schritte vor ihr zurück, während er redete. »Wenn du herausfindest, wofür JD steht, gehe ich mit dir aus.«
Beth neigte den Kopf zur Seite. »Was bringt dich auf die Idee, dass ich mit dir ausgehen möchte?«, fragte sie gelassen.
JD schwieg für einen Moment, während er über einer Antwort grübelte. Er brauchte nicht lange.
»Du willst mit mir ausgehen«, sagte er augenzwinkernd.
Beth setzte sich wieder in Bewegung und streifte ihn mit der Schulter, als sie ihn passierte.
»Vielleicht«, sagte sie.
JD sah ihr hinterher, als sie die Promenade entlang in Richtung des aufgegebenen Piers hundert Meter weiter vorn spazierte. Als sie sich vielleicht zehn Meter von ihm entfernt hatte, wanderte er ihr langsam hinterher, während er ihre beim Gehen sanft schwingenden Hüften bewunderte. Beth für ihren Teil wusste sehr genau, dass er sie ansah, und sie übertrieb ihre Hüftbewegungen ein klein wenig, um sicherzustellen, dass seine Augen auf ihrem Hinterteil verharrten.
»Willst du die ganze Nacht hinter mir herlaufen?«, rief sie ihm schließlich zu.
»Scheiße!«, hörte sie ihn rufen. Sie blieb stehen und drehte sich um. Seine Stimme verriet aufrichtige Verärgerung.
»Was ist denn?«
»Es ist beinahe zwölf!« Er schien einer Panik nahe und blickte sich gehetzt um.
»Was ist so schlimm daran? Musst du nach Hause?«
»Nein, nichts dergleichen. Hör zu, ich muss mich beeilen. Ich muss meinen kleinen Bruder von der Kirche abholen. Er ist ganz allein und hat sicher Angst, wenn ich zu spät komme.«
Beth machte einen Schritt auf ihn zu. »Ich komme mit dir, wenn du möchtest.«
»Nein, nein, danke für das Angebot, aber mein Bruder reagiert sicher ganz aufgeregt, wenn er dich sieht, und dann kriegen wir ihn niemals nach Hause. Und meine Mum dreht durch, wenn er zu spät kommt.«
»Schön, ich warte hier auf dich, wenn du hinterher zurückkommst.« Sie wollte nicht, dass der Abend schon zu Ende war, und sie wollte definitiv nicht schon jetzt wieder nach Hause und zu ihrer Stiefmutter.
»Bist du sicher?«, fragte JD.
»Absolut sicher. Und ich sag dir was. Wenn du es schaffst, bis ein Uhr wieder hier zu sein, bis zum Ende der Geisterstunde, dann darfst du mich ausführen.«
Er grinste sie an. »Dann sehen wir uns um eins. Warte am Pier auf mich. Aber sei vorsichtig, okay? Da treiben sich nachts ein paar eigenartige Gestalten rum.« Mit dieser ominösen Bemerkung wandte er sich um und rannte in Richtung Stadt davon.
Die Promenade lag immer noch verlassen, und Wellen plätscherten sanft gegen die Hafenmauer, keinen Meter von der Stelle entfernt, wo Beth ging. Die Meeresluft war erfrischend, und sie atmete mehrere Male in tiefen Zügen durch. Wenigstens stand sie im Begriff herauszufinden, wie es sich anfühlte, durch und durch glücklich zu sein.
Weniger als eine Minute später hatte sie den Pier erreicht und betrat die knarrenden Holzplanken, die hinaus auf das Wasser führten. Der Pier war keine fünfzig Meter lang und ein wenig klapprig, doch er galt noch nicht als unsicher. Beth schlenderte bis ganz nach vorn, wo sie sich auf das Holzgeländer lehnte und auf das Meer hinausblickte.
Der Mond leuchtete immer noch hell, und sie verlor sich in seinem Anblick und in seiner Reflexion auf den sich kräuselnden Wellen, während sie ununterbrochen lächelte, nach innen wie nach außen. Die Regentropfen, die seit einigen Minuten sanft auf sie fielen, nahmen an Intensität zu. Nicht, dass es ihr etwas ausgemacht hätte. Genauso wenig, wie es sie kümmerte, dass sie ihrer Stiefmutter versprochen hatte, um Mitternacht wieder zu Hause zu sein.
Unglücklicherweise gibt es eine ganze Reihe ungeschriebener Regeln in Santa Mondega. Eine davon besagt klipp und klar, dass es niemandem erlaubt ist, für längere Zeit glücklich zu sein. Ständig lauert irgendein Ungemach am Horizont. In Beths Fall war es sehr viel näher als der Horizont, auf den sie hinausstarrte.
Nur ein paar Meter entfernt lauerte einer der unangenehmsten Vertreter aus der Welt der Untoten. Hätte sie einen Blick nach unten geworfen, sie hätte die Fingerspitzen von zwei Knochenhänden bemerkt, die sich an das Ende des Bohlenweges klammerten. Sie gehörten einem Vampir. Die Beine des Vampirs baumelten im Wasser unter ihm. Sie baumelten deswegen im Wasser, weil Flut herrschte und der Wasserstand signifikant gestiegen war, während er dort gehangen und geduldig auf ein naives Opfer gewartet hatte, das herkam, um nach draußen auf das Meer zu starren. Und dieses naive Opfer war Beth.
Zeit zum Fressen.
VIER ♦
Sanchez hasste es, in die Kirche zu gehen, deswegen vermied er es, so oft er konnte. Dies hier jedoch war ein spezieller Anlass, alles, was recht war. Mit diesem Gedanken im Hinterkopf hatte er seine besten Sachen aus dem Schrank geholt: ein paar Bluejeans ohne Risse und ein weißes Polohemd ohne sichtbare Flecken. Er hatte sogar Gel in sein dichtes schwarzes Haar massiert, um sich diesen Hey-Mann-was-bist-du-cool-Look zu verpassen.
Der abendliche Anlass war dem neuen Prediger zu verdanken, der die Gemeinde kürzlich übernommen hatte und leidenschaftlich gerne neue Dinge ausprobierte. Der neueste Spleen war eine Mitternachtsmesse an Halloween, bei der es nach den Worten des Reverends einen Auftritt des größten Rock-’n’-Roll-Acts von ganz Santa Mondega geben sollte. Er hatte den Namen des Acts nicht verraten, also war Sanchez vorbereitet gekommen und hatte auf die vage Chance hin, dass es sich um irgendeinen käsigen Osmonds-Verschnitt handelte, eine braune Papiertüte mit allerlei verfaulten Früchten mitgebracht, um jeden damit zu bewerfen, dessen musikalisches Talent nicht seinen anspruchsvollen Standards genügte.
Es bestand nicht der geringste Zweifel – die Kirche der Gesegneten Heiligen Ursula und der Elftausend Jungfrauen (La Iglesia de la Bendita Santa Úrsula y las Once Mil Vírgines) war ein prachtvolles Spektakel, innen wie außen. In einer schönen Nacht hob sich das alte Bauwerk deutlich vor dem Himmel ab; die weißen, stuckierten Mauern leuchteten im Mondschein, und die Turmspitze schien nach den Sternen zu greifen. Diese spezielle Halloween-Nacht jedoch war so dunkel, wie man es sich nur denken konnte. Gerade als die Predigt begann, öffneten sich die Schleusen der schweren Wolken, die schon den größten Teil der Nacht über der Kirche gehangen hatten, und strömender Regen ergoss sich über das Haus des Herrn.
Selbst von seinem Platz in der zehnten Bankreihe aus konnte Sanchez noch hören, wie der Regen gegen die Bleiglasfenster hinter dem Altar prasselte, vor dem der Reverend stand und die Messe hielt. Die Reihen waren proppenvoll mit Leuten jeden Alters und aller Schichten. Gleich neben Sanchez saß der einheimische Trottel, ein zwölfjähriger Knabe namens Casper, der, wie sich die Leute erzählten, nicht ganz richtig war im Kopf. Niemand wusste, was genau mit ihm nicht stimmte, doch Sanchez hatte beobachtet, wie der arme Kerl während seiner gesamten Kindheit erbarmungslos von anderen Kindern schikaniert worden war. Es lag nicht allein daran, dass er ein wenig »bäuerlich« daherkam. Der Junge sah schon merkwürdig aus. Seine Haare zeigten ständig in mindestens acht verschiedene Richtungen, und seine Augen taten es den Haaren nach, sozusagen. Er war einer von jenen Jungen, bei deren Anblick man halb erwartete, dass es einen Blitz gab, gefolgt von einem Donnerschlag und vielleicht einer einsamen Kirchenglocke, die sonor im Hintergrund schlug. Genau das, was in dieser Nacht passierte und was Sanchez eine Scheißangst einjagte.
Die Kirche war nicht sonderlich hell erleuchtet. An diesem besonderen Abend waren Kerzen in den großen Wandleuchtern und in den Haltern rechts und links auf dem Altar die einzigen Lichtquellen, und ihr Flackern spiegelte sich auf dem großen goldenen Kruzifix, das im Zentrum des Altars eingelassen war. (Es war genaugenommen kein Gold, sondern Messing. Was einem Edelmetall auch nur halbwegs ähnelte, hielt sich in Santa Mondega nicht lange, es sei denn, man verschraubte es im Boden und ließ es Tag und Nacht von halbwilden Pitbulls bewachen.) Der Grund für die schlechte Beleuchtung, so vermutete Sanchez angesichts des inkongruenten Anblicks einer Masse von modernem Soundequipment und anderen Geräten zusammen mit den zugehörigen Kabeln vor dem Altar, lag darin, dass das anschließende Rockkonzert eine Lightshow mit Stroboskopblitzen beinhaltete.
Für Sanchez machte das Fehlen von Licht die Dinge nur noch schlimmer, denn jedes Mal, wenn es einen Donnerschlag gab, flackerten die Kerzen ein klein wenig, während er in den Sekunden anhaltenden grellen Blitzen nichts sehen konnte außer dem verrückten Jungen neben ihm, der ihn aus irren Augen anstarrte und unablässig grinste. Sanchez hätte sich einen anderen Platz gesucht, wäre die Kirche nicht so gottverdammt voll gewesen. Es gab nicht einen freien Platz in den Bänken hinter ihm, und er verspürte keine Lust, zu weit vorne zu sitzen und sich am Ende noch auffordern zu lassen, als Komparse bei einer der übereifrigen Predigten des Reverends mitzuwirken. Es gab Gerüchte, dass der erst kürzlich nach Santa Mondega gekommene neue Geistliche einen Tick für »New Age« hatte, weswegen er sich auch lieber Reverend rufen ließ anstatt Vater. Was auch immer dahintersteckte – der Reverend war jung und energiegeladen und hatte die lästige Angewohnheit, Mitglieder der Gemeinde nach vorn zu holen, damit sie bei seinen improvisierten David-und-Goliath-Rollenspielen mitmachten.
Nachdem Sanchez eine ganze Stunde lang der leidenschaftlichen Predigt des Reverends über Gott und Jesus und all diesen Kram gelauscht hatte, wurde er allmählich unruhig. Er war schließlich nur hergekommen, um die Band zu checken. Falls sie etwas taugte, würde er versuchen, sie dazu zu bewegen, in seiner neuen Kneipe zu spielen, der Tapioca Bar in der Innenstadt von Santa Mondega. Und falls nicht, würde er aufstehen und nach Hause gehen. Allerdings nicht, ohne vorher seine faulen Früchte abzufeuern.
Schließlich, um fünf Minuten nach Mitternacht, kam der Reverend hoch oben auf seiner Kanzel zum Ende. Er war eine ziemlich beeindruckende Gestalt, erst Anfang zwanzig, und Sanchez ahnte, dass sich unter der langen schwarzen Robe ein breitschultriger, muskulöser Kerl verbarg. Was wahrscheinlich der Grund dafür war, dass die ersten sechs oder sieben Reihen gefüllt waren mit strenggläubigen jungen Frauen und mit Nutten, die sich als strenggläubige junge Frauen ausgaben. Sie alle klebten förmlich an seinen Lippen. Was für eine gottverdammte Schande!, dachte Sanchez bei sich. Sie sind nur hergekommen, um den Reverend zu sehen. Haben sie denn kein Schamgefühl? Und wann zum Teufel fängt die Band endlich an zu spielen?
»Nun, liebe Leute«, sagte der Reverend und lächelte auf die Versammlung hernieder, »ich bin sicher, ihr habt genug von mir für eine Nacht gehört.« Er hatte ein Lächeln, das die Herzen der Frauen gleich reihenweise zum Schmelzen brachte, und für einen Mann Gottes ein höchst unangemessenes Glitzern in den Augen, wie Sanchez bemerkte. »Ich habe nur noch ein oder zwei kleinere Ankündigungen zu machen, bevor die musikalische Extravaganza des Abends ihren Lauf nimmt. Erstens möchte ich alle bitten, beim Gehen großzügig in die Kollekte zu geben – die Dosen stehen neben den Eingangstüren.« In seiner Stimme schwang ein nicht zu überhörender stählerner Unterton mit, und seine Zuhörer rutschten nervös auf den Bänken hin und her. (Mildtätigkeit fing in Santa Mondega zu Hause an, und Mildtätigkeit blieb auch dort.) Er hielt inne, während er offenkundig überlegte, was er als Nächstes sagen wollte. »Und zweitens«, dröhnte er sodann, »hat man mich zu meiner Enttäuschung informiert, dass im Weihwasser Spuren von Urin entdeckt wurden. Deswegen bitte ich alle, die Weihwasserbecken am Westeingang zu meiden. Für heilige Zwecke verfügen wir über Weihwasser in Flaschen – ansonsten, sollte jemand Durst verspüren, gibt es ausreichend Leitungswasser.« Er blickte streng auf seine Schafe hinunter. »Und wenn ich herausfinde, wer für diesen gotteslästerlichen Akt verantwortlich ist, dann Gnade ihm Gott.«
Seine Worte wurden mit missbilligendem Kopfschütteln und dementsprechendem »Tsss, tsss!« quittiert, und Sanchez wurde sich plötzlich des bösen Blickes bewusst, mit dem der irre Junge ihn bedachte – als hätte er den Barbesitzer im Verdacht, für die Verunreinigung verantwortlich zu sein.
»Was?«, fauchte Sanchez den Irren an, nervös geworden von seinem blinzelnden, abschätzenden Blick.
Der Junge schüttelte den Kopf, dann schlug er die Kapuze seines Parkas hoch und richtete seine Aufmerksamkeit wieder nach vorn auf den Prediger. Keine gute Idee, einen geistig zurückgebliebenen Jungen anzustarren und dabei beobachtet zu werden. Es machte einen irgendwie exzentrischen Eindruck. Und war seinem Ruf sicher nicht dienlich.
Oben bei der Kanzel legte der Reverend ein paar Schalter auf einer Konsole um. Zuerst begannen Lämpchen auf dem Soundequipment zu leuchten und zu flackern, und dann setzte die Musik ein. Die Titelmelodie von 2001: Odyssee im Weltraum schmetterte aus einer ganzen Serie gewaltiger Lautsprecher. Sanchez mochte die Melodie1, und sie schuf eine recht erstaunliche Atmosphäre, ganz besonders im dunklen, zugigen Mittelschiff der Kirche, während immer noch der Regen auf das Dach und gegen die Fenster prasselte.
Die Musik hatte weniger als zwanzig Sekunden gespielt, als von hinten ein Schwall kalter, feuchter Luft in das schwach erhellte Gebäude fuhr, begleitet von einem moderigen, unangenehmen Geruch. Irgendjemand hatte die große Doppeltür hinter den Reihen von Kirchenbänken geöffnet.
Alles drehte sich um, und der Reverend starrte aus zusammengekniffenen Augen von der Kanzel über die Köpfe seiner Gemeinde hinweg zur Tür, um zu sehen, wer da wohl so spät zum Gottesdienst erschien. Alle sahen einen Mann eintreten. Er trug einen langen schwarzen Umhang und hatte die Kapuze tief in die Stirn gezogen. Einen Moment später folgte eine Anzahl weiterer Männer, allesamt gekleidet wie der erste. Sie schwärmten nach rechts und links aus, sieben insgesamt, und der letzte von ihnen schloss hinter sich die schweren Türen. In den tiefen Schatten im hinteren Teil der Kirche waren die schwarzen Gestalten beinahe unsichtbar. Die Gestalten verbreiteten eine beängstigende, unheilvolle Aura, die über die Versammlung hinwegwehte wie zuvor der Gestank, als die Türen geöffnet worden waren. Diese Männer gehörten nicht hierher – um das zu erkennen, musste man kein Genie sein. Es war All Hallows Eve, Halloween – der Abend vor Allerheiligen –, und diese sieben vermummten Kreaturen sahen aus wie Schwarze Männer, die in die Kirche gekommen waren, um Chaos und Verderben zu bringen.
Der Reverend erkannte die Bedrohung augenblicklich und legte einen Schalter auf seinem Kontrollpult um. Die Beleuchtung im hinteren Teil der Kirche flammte auf. Die sieben Männer waren mit einem Mal hell angestrahlt und für alle zu sehen, und die grelle elektrische Beleuchtung machte jedes Überraschungsmoment zunichte, falls sie gehofft hatten, sich in der düsteren Kirche über jemanden herzumachen. Eigentümlicherweise war es genau das, was ihnen vorgeschwebt hatte.
Während die Musik lauter und eindringlicher wurde, starrten die Kirchgänger in ihren Bänken auf die sieben Männer, alle in Todesangst vor dem, was als Nächstes geschehen würde. Schließlich ergriff der Reverend für alle das Wort und wandte sich an die unwillkommenen Besucher.
»Ihr und euresgleichen seid hier nicht willkommen. Verlasst sofort diesen Ort!« Er redete mit ruhiger Stimme in sein Mikrofon, doch sie war laut genug, um die Musik zu übertönen. Und er redete mit einer unverkennbaren Autorität, die Sanchez trotz seines Schreckens in seiner Meinung bestätigte. Ja, er ist ein beeindruckender Mistkerl, keine Frage.
Einige Sekunden lang rührten sich die Schatten an der Rückseite der Kirche nicht. Dann trat der in der Mitte, der auch als Erster hereingekommen war, einen Schritt vor und schlug seine Kapuze zurück. Er hatte ein schmales, geisterhaft weißes Gesicht, eingerahmt von dunklem schulterlangem Haar. Als er den Mund zum Reden öffnete, enthüllte er riesige hellgelbe Fangzähne.
»Es ist Halloween, und es ist Geisterstunde«, zischte er. »Wir sind die Vampire vom Hoods-Clan, und wir erheben Anspruch auf diese Kirche und alle darin. Niemand kommt lebend wieder hier raus!«
Zu behaupten, seine Worte lösten eine Panik aus, wäre eine wilde Untertreibung gewesen. Jede einzelne Frau und mindestens die Hälfte aller Männer im Gotteshaus schrien und kreischten und sprangen von ihren Plätzen auf. Es gab kein Halten mehr – dumm nur, dass niemand so recht wusste, wohin er rennen sollte. Die gesamte Kirche lag im Halbdunkel, mit Ausnahme der hinteren Wand, wo die sieben Vampire standen, und der Reverend machte keine Anstalten, weitere Lichter einzuschalten. Zu Anfang jedenfalls nicht. Doch dann, als die Titelmelodie von 2001 endete, setzte ein neues Lied ein, und er legte weitere Schalter auf seiner Konsole um. Plötzlich erhellte ein Scheinwerfer die Bühne direkt vor dem Mittelgang, der sich zwischen den beiden Reihen von Bänken hindurch über die gesamte Länge der Kirche zog. Nichts war zu sehen im hellen Spot des Scheinwerfers, nichts außer einem Mikrofon auf einem Ständer, umgeben von einem dichten, wogenden Nebel.
Der Anblick lenkte die Anwesenden kaum länger als eine Sekunde ab, bis die Vampire laute Schreie ausstießen wie wilde Tiere, die sich bereit machten, ihre Beute anzufallen. Einer nach dem anderen schlugen sie ihre Kapuzen zurück, sprangen in die Luft und jagten hinauf unter das Deckengewölbe des Kirchenschiffs, jeder nur mit einem einzigen Gedanken: ein Opfer auszuwählen und hinunterzustoßen auf die arme Seele, um sich an ihrem Blut zu laben.
Die panische Versammlung hatte immer noch keinen Schimmer, wohin sie sich wenden sollte. Wild ringende Gestalten kletterten über die massiven Bänke, während sich andere darunter zu verstecken versuchten. Sanchez war wie versteinert vor Angst. Sein erster Gedanke war, in die braune Papiertüte zu greifen, die er mitgebracht hatte, und die Vampire mit dem verfaulten Obst zu bewerfen, doch dann wurde ihm schnell klar, dass das möglicherweise gar keine gute Idee war. Stattdessen beschloss er, unter der Bank in Deckung zu gehen und zu hoffen, dass irgendjemand anders zuerst geschnappt wurde. Mit dem Mut, der ihn als Mann und Barbesitzer ausmachte, ließ er sich fallen und duckte sich unter den Sitz. Sicherheitshalber riss er Casper, den Jungen mit dem Dachschaden, mit nach unten und zog ihn als zusätzliche Deckung über sich. Während die Vampire oben in der Kirche umherschwirrten und ihre Beute umkreisten und sich an der Angst ergötzten, die sie bei den schreienden Kirchgängern hervorriefen, plärrte unvermittelt der blecherne Klang von Trompeten durch die Lautsprecher und trug seinen Teil bei zur allgemeinen Verwirrung und Orientierungslosigkeit.
Und dann passierte etwas Unerwartetes.
Der Reverend, der die ganze Zeit auf der Kanzel gestanden hatte, bellte in sein Mikrofon.
»Ich habe euch gewarnt, ihr verdammten Mistviecher!«, bellte er. »Ich habe euch gewarnt, jemals den Fuß in meine Kirche zu setzen! Und jetzt macht euch bereit für die Konsequenzen!« Er riss die geballte Faust in die Luft und schüttelte sie in Richtung der verhüllten Untoten, die über der Menge aus von Todesangst gelähmten Kirchgängern kreisten. »Ladys und Gentlemen und Scheiß-Vampire – hiiier ist er! Der King of Rock ’n’ Roll!«
Eine wilde und imposante Gestalt betrat den Lichtkreis, wo vorher nur das Mikrofon gestanden hatte. Ein Mann in weißem Overall mit dickem goldenem Gürtel um die Hüfte, dichtem schwarzem Haar und Killerkoteletten. Der größte lebende Berufskiller von ganz Santa Mondega – Elvis. Er hatte eine Bluesgitarre in den Händen, ein schickes schwarzes, glänzendes Ding, so blankgewetzt, dass die Vermutung nicht abwegig erschien, dass diese Gitarre sein ganzer Stolz und seine ganze Freude waren. Mit ruhiger Hand und unerschrocken begann er zu spielen, während aus den Lautsprechern die Hintergrundmusik erklang. Er schlug ein paar laute Blues-Akkorde an und tappte mit dem rechten Fuß den Rhythmus, während er sich auf die erste Zeile des Steamroller Blues vorbereitete.
Elvis war so versunken in seine Musik und seine Bemühungen, den Klang so vollkommen wie möglich zu machen für sein Publikum, dass er überhaupt nicht zu bemerken schien, was rings um ihn herum vorging. Und seine Aura auf der Bühne war so präsent, dass alle mit ihrem Tun innehielten und gafften, einschließlich der zwielichtigen Vampire, die dicht unter dem Dach verharrten. Jeder der sieben fasste Elvis als seine erste Beute ins Auge.
Und dann begann Elvis zu singen.
I’m a steamroller baby
I’m ’bout to roll all over you …
Die ersten Töne dröhnten aus den Lautsprechern, und einer der Vampire vermochte seinen Blutdurst nicht länger zu zügeln. Mit einem durchdringenden Schrei und weit aufgerissenem Maul stürzte er sich auf Elvis hinunter, bereit zum Töten. Der King für seinen Teil schwenkte ungerührt die Hüften zur einen und die Gitarre zur anderen Seite und zielte mit dem Hals des Instruments auf den herabsausenden Blutsauger.
Aus einem getarnten Loch im Kopf der supercoolen schwarzen Gitarre jagte ein silberner Pfeil. Er zischte schneller als die Blitze draußen durch die Luft und grub sich mit einem hörbaren dumpfen Schlag mitten ins Herz des herannahenden Vampirs. Der schockierte Angehörige der Untoten spürte, wie es seine Brust zerriss. Mitten in der Luft hielt er inne, und die Augen drohten ihm aus den Höhlen zu fallen vom plötzlichen Schmerz und Unglauben. So ein Dreck!, war sein letzter Gedanke. Ich will nicht bei einem dämlichen James-Taylor-Song sterben …! Eine Sekunde später ging er spontan in Flammen auf und stürzte ab. Er landete mit einem lauten Krachen vor Elvis’ Füßen, wo er rasch zu einem kleinen Häuflein Asche verbrannte.
In der Kirche der Gesegneten Heiligen Ursula und der Elftausend Jungfrauen wichen die Panik und die Angst der Kirchenbesucher von einer Sekunde zur anderen neuer Hoffnung und neuer Zuversicht. Was für die unter dem Kirchendach kreisenden Vampire nicht gesagt werden konnte. Für einen Augenblick wie betäubt vom ebenso endgültigen und gewaltsamen wie unerwarteten Ende eines der ihren, konzentrierten sie nun ihre Aufmerksamkeit auf den Sänger, der allein auf der Bühne stand und seine Nummer darbot.
Der King für seinen Teil spielte den Blues, als wäre nichts geschehen.
Von seinem Versteck auf dem kalten Steinboden unter dem – überraschend schweren – verrückten Jungen, den er als Deckung auf sich gerissen hatte, starrte Sanchez ehrfürchtig nach oben.
Alles sah ganz danach aus, als würde es eine höllische Show geben.
FÜNF ♦
Kione liebte den 31. Oktober. Das Halloween-Gemetzel hatte etwas ganz Besonderes. Einen ach so süßen Beigeschmack.
Santa Mondega war voll von Vampiren aus der ganzen Welt, doch das Stadtzentrum war reserviert für die Untoten aus Nord- und Südamerika und Europa. Die ersten Vampirsiedler waren aus Paris hierhergekommen, und schon lange vor der Entdeckung Amerikas durch Kolumbus waren ihnen viele ihrer europäischen Cousins und Cousinen gefolgt und hatten ihnen Gesellschaft geleistet. Im achtzehnten Jahrhundert hatte die Stadt einen großen Zustrom lateinamerikanischer Flüchtlinge erlebt. Einmal niedergelassen, waren viele von ihnen bald darauf Mitglieder der Gesellschaft der Untoten geworden und hatten ihre eigenen Clans gebildet. Nicht lange, und die Vampir-Population war viel zu groß geworden für die Stadt, so dass um die Zeit, als die ersten afrikanischen Vampire – wie Kione – gekommen waren, eine ungeschriebene Regel eingeführt worden war. Als Resultat mussten die afrikanischen und asiatischen Vampire in den Hügeln siedeln, die Santa Mondega umgaben. Die Orientalen und besonders die Nordafrikaner liebten die Freiheit und die frische, unverbrauchte Luft der Berge und Täler und zogen es vor, ihre Beute in der Wildnis jenseits des Stadtrands zu schlagen. Alle, das heißt mit Ausnahme von Kione. Er war seit vielen Jahren schon aus den Hügeln verbannt worden, weil er nicht nur einen, sondern sämtliche Grundsätze gebrochen hatte, die den Ehrenkodex der Vampire bildeten. Er war eine Kreatur ohne jeden Skrupel, ohne Klasse und ohne Stolz, er lebte unter dem Pier und erbeutete des Nachts, was er in seine fauligen Hände bekam.