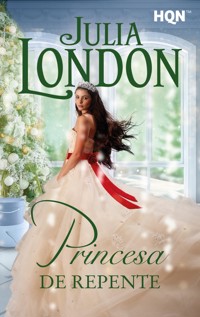The Cabot Sisters - drei Schwestern nehmen ihr Schicksal selbst in die Hand - 3-teilige Serie E-Book
Julia London
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: CORA Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: eBundle
- Sprache: Deutsch
Drei Schwestern nehmen ihr Los selbst in die Hand, um ihre Familie und ihr eigenes Wohlergehen zu schützen, bevor der Stiefbruder ihr Schicksal bestimmt. SKANDAL IN MAYFAIR "Ich soll was für Sie tun?" George Easton traut seinen Ohren nicht. Hat die entzückende Miss Honor Cabot ihn tatsächlich gebeten, die Verlobte ihres Stiefbruders zu kompromittieren? Immerhin hat die eigenwillige Debütantin einen einleuchtenden Grund für ihr skandalöses Ansinnen: Besagte Dame droht nämlich damit, den Cabot-Schwestern die gesellschaftliche Stellung zu rauben. Halb amüsiert, halb beeindruckt lässt der umtriebige Lebemann sich auf das riskante Spiel ein. Schließlich ist er berüchtigt für seine pikanten Affären. Doch nur allzu bald wird ihm klar, dass er viel lieber die erfrischend unkonventionelle Miss Honor verführen würde … DER TEUFEL VON BLACKWOOD HALL Ein höchst verwegener Plan: Die schöne Grace Cabot hat sich zu einem verschwiegenen Rendezvous mit dem vermögenden Lord Amherst verabredet. Durch eine kompromittierende Situation will sie ihn zur Ehe zwingen und so den Ruin von ihrer Familie abwenden. Und kaum betritt sie den dunklen Raum, spürt sie seinen hungrigen Mund, heiße Hände und das Reißen des Stoffs über ihren Brüsten … Doch als das Licht angeht, sieht sie schockiert, wer sie da schamlos verführt hat: nicht der charmante Lord Amherst, sondern sein düsterer Bruder Jeffrey, Earl of Merryton! Man sagt, er sei mit dem Teufel im Bunde - und ihn muss Grace nun heiraten! DER ABENTEURER UND DIE LADY Der Skandal um ihre Familie hält jeden Ehekandidaten fern! Die zauberhafte Miss Prudence Cabot fürchtet, als alte Jungfer zu enden. Aus Verzweiflung beschließt sie, eine weit entfernt lebende Cousine zu besuchen. Doch auf dem Weg dorthin trifft sie einen waghalsigen Amerikaner, der ihr Herz in allergrößte Unruhe versetzt. Roan Matheson ist so ganz anders als die stocksteifen englischen Gentlemen. Er hat breite Schultern, ein freches Lächeln, warme, starke Hände … und küsst so zärtlich und verführerisch! Ein Abenteuer beginnt, das Prudence‘ Ruf für immer zerstören könnte - oder macht es sie vielleicht zur glücklichsten Engländerin auf Erden?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1532
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Julia London
The Cabot Sisters - drei Schwestern nehmen ihr Schicksal selbst in die Hand - 3-teilige Serie
IMPRESSUM
HISTORICAL GOLD erscheint in der HarperCollins Germany GmbH
© 2014 by Dinah Dinwiddie Originaltitel: „The Trouble With Honor“ erschienen bei: HQN Books, Toronto Published by arrangement with HARLEQUIN ENTERPRISES II B.V./S.àr.l.
© Deutsche Erstausgabe in der Reihe HISTORICAL GOLDBand 287 - 2015 by HarperCollins Germany GmbH, Hamburg Übersetzung: Claudia Heuer
Abbildungen: Harlequin Books S.A., alle Rechte vorbehalten
Veröffentlicht im ePub Format in 04/2015 – die elektronische Ausgabe stimmt mit der Printversion überein.
E-Book-Produktion: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 9783733761714
Alle Rechte, einschließlich das des vollständigen oder auszugsweisen Nachdrucks in jeglicher Form, sind vorbehalten. CORA-Romane dürfen nicht verliehen oder zum gewerbsmäßigen Umtausch verwendet werden. Sämtliche Personen dieser Ausgabe sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind rein zufällig.
Weitere Roman-Reihen im CORA Verlag:BACCARA, BIANCA, JULIA, ROMANA, MYSTERY, TIFFANY
Alles über Roman-Neuheiten, Spar-Aktionen, Lesetipps und Gutscheine erhalten Sie in unserem CORA-Shop www.cora.de
Werden Sie Fan vom CORA Verlag auf Facebook.
1. KAPITEL
Im Frühjahr 1812 fing der ganze Ärger an. Und das ausgerechnet in einer Spielhölle in Southwark am südlichen Ufer der Themse, die sogar in diesem Stadtviertel einen besonders schlechten Ruf hatte, weil es hier von Dieben nur so wimmelte.
Es war mehr als merkwürdig, doch gerade dieses alte, baufällige Haus, das noch aus Zeiten stammte, als die Wikinger England erobert hatten, war jetzt zum vornehmsten Treffpunkt für junge Gentlemen aus den besten Familien geworden. Die Einrichtung des Etablissements war kostbar, mit dicken Vorhängen aus rotem Samt, Holzvertäfelungen und kunstvoll verzierten Decken. Jede Nacht strömten die jungen Herren des ton in Scharen aus dem vornehmen Viertel Mayfair herbei. Sie fuhren in gut bewachten Kutschen vor, um anschließend horrende Summen aneinander beim Glücksspiel zu verlieren. Sobald einer der Gentlemen sein Limit für den Abend erreicht hatte, konnte er sich noch immer anderen Vergnügungen widmen, denn es mangelte weder an bequemen privaten Räumlichkeiten noch an französischen Damen, von denen jede einzelne ihnen gern zu Diensten war.
In einer eiskalten Nacht – etwa einen Monat vor Beginn der Ballsaison – betrat eine Gruppe sportlicher junger Gentlemen das Etablissement. Eigentlich hatten sie vorübergehend die Spielhölle gegen die Salons und Ballsäle von Mayfair eingetauscht, wo sie sich zur Abwechslung auf gesellschaftlich akzeptierte Weise vergnügen wollten. Aber dort waren sie mit dem süßen Lächeln und dem inständigsten Flehen junger Damen überredet worden, ihnen diese Spielhölle zu zeigen.
Den jungen Damen diesen Wunsch zu erfüllen, war nicht ohne Risiko für ihren Ruf. Aber jung, rücksichtslos und zu jedem Spaß aufgelegt, wie sie nun einmal waren, kamen sie der Bitte gerne nach. Es verstieß zudem gegen die Regeln des Etablissements, Frauen mitzubringen, doch davon ließen sie sich genauso wenig abschrecken. Auch die anderen Risiken für die jungen Damen wie Unglücksfälle oder Verbrechen kamen ihnen kaum in den Sinn. Für sie war das Ganze ein kleines Abenteuer im ansonsten trostlosen Winterhalbjahr.
In eben dieser Spielhölle in Southwark traf George Easton zum ersten Mal auf Miss Honor Cabot, eine Debütantin dieser Saison.
Der Aufruhr um die Ankunft der jungen Hitzköpfe und ihrer Eroberungen war ihm zunächst überhaupt nicht aufgefallen. Dabei waren sie ganz erfüllt von ihrem Wagemut und vom Stolz darauf, dass es ihnen gelungen war, den Türsteher dazu zu bringen, sie hereinzulassen. Georges Aufmerksamkeit war vom Kartenspiel gefangen gewesen, in dem er gerade dabei war, dem notorischen Spieler Charles Rutherford dreißig Pfund abzunehmen. Ihm war nicht einmal aufgefallen, dass etwas nicht in Ordnung war, bis Rutherford sagte: „Was zum Teufel soll das denn?“
Dann erst fiel sein Blick auf die jungen Damen, die in der Mitte des Raumes standen und herumflatterten und die Köpfe reckten wie ein Schwarm Vögel. Die Kapuzen ihrer Umhänge rahmten ihre hübschen Gesichter ein, mit ihrem Gekicher steckten sie sich immer wieder gegenseitig an. Neugierig blickten sie die Männer an, die sie im Gegenzug ansahen wie eine Herde guter Pferde auf dem Viehmarkt.
„Zur Hölle“, murmelte George. Als er seine Karten niederlegte, stand Rutherford auf und schubste dabei unsanft das Mädchen zu Boden, das auf seinem Schoß gesessen hatte.
„Was in drei Teufels Namen wollen die denn hier?“, wollte Rutherford wissen. Er sah sie aus zusammengekniffenen Augen an. „Das ist doch vollkommen verantwortungslos. Sehen Sie mich an!“, polterte er laut. „Das ist ganz und gar unmöglich! Die Damen müssen sofort wieder gehen!“
Die drei jungen Gentlemen, auf deren Konto dieses Abenteuer ging, sahen einander betreten an. Der kleinste von ihnen reckte schließlich das Kinn, um seinen Worten Nachdruck zu verleihen. „Die Damen haben das gleiche Recht, hier zu sein, wie Sie, Sir!“
Mr Rutherfords Gesichtsfarbe nach zu urteilen, würde ihn gleich der Schlag treffen, deshalb sagte George schnell: „Dann sorgen Sie um Gottes willen dafür, dass sie Plätze finden und spielen können. Wenn sie da herumstehen, lenken sie nur die anderen Gentlemen ab.“
„Spielen?“, fragte Rutherford, während ihm die Augen beinahe aus den Höhlen quollen. „Sie sind nicht einmal in der Lage zu spielen.“
„Das bin ich wohl“, sagte eine einzige Frauenstimme.
Na, das war ja allerhand, welche der Damen wagte denn jetzt zu sprechen? George beugte sich zu Rutherford hinüber, um besser sehen zu können. Doch da die Vögelchen ständig durcheinanderflatterten, konnte er nicht erkennen, welches von ihnen gepiepst hatte.
„Wer hat das gesagt?“, wollte Rutherford wissen, so laut, dass die Herren an den umstehenden Tischen auf die Auseinandersetzung aufmerksam wurden.
Keine der jungen Damen machte einen Mucks; sie sahen den Bankdirektor vielmehr mit weit aufgerissenen Augen an. Gerade als Rutherford zu einem weiteren Wutausbruch ansetzte, trat jedoch eine von ihnen vor. Sie blickte zunächst Rutherford und dann George an. Ihre Augen waren von atemberaubend tiefem Blau, im Kontrast dazu waren ihre Wimpern und ihr Haar tiefschwarz und ihre Haut alabasterweiß. Eine solche jugendliche Schönheit sah man hier nicht oft.
„Miss Cabot?“, rief Rutherford ungläubig. „Was in drei Teufels Namen haben Sie denn hier verloren?“
Sie machte einen Knicks, als befänden sie sich mitten in einem Ballsaal, und verschränkte dabei die Hände miteinander. Dabei hatte sie noch immer ihre Handschuhe an. „Meine Freundinnen und ich wollten mit eigenen Augen den Ort sehen, an den die Gentlemen stets verschwinden.“
Eine Welle von Gelächter lief durch die Menge der Anwesenden. Rutherford wirkte beunruhigt, so als wäre er in irgendeiner Weise verantwortlich für diesen Verstoß gegen die Regeln des Anstandes. „Miss Cabot … dies ist nun wirklich nicht der richtige Ort für eine tugendhafte junge Dame.“
Eines der Vögelchen, die hinter ihr standen, flatterte und flüsterte ihr etwas zu, aber Miss Cabot achtete nicht auf sie. „Verzeihen Sie mir, Sir, aber ich verstehe nicht ganz, wie ein Ort genau der richtige für einen tugendhaften jungen Herren sein kann, aber nicht für eine tugendhafte Dame.“
Sie schaute George wieder aus ihren unglaublich blauen Augen an. Dabei verspürte er ein seltsames Ziehen in der Brust. Dann fiel ihr Blick auf die Spielkarten, die auf dem Tisch lagen. „Sie spielen Commerce?“, fragte sie.
„Allerdings“, antwortete George. Es erstaunte ihn sehr, dass sie dies sofort erkannt hatte. „Wenn Sie spielen möchten, Miss, dann lassen Sie sich um Himmels willen nicht davon abhalten.“
Rutherford war in der Zwischenzeit kreidebleich geworden und George bemerkte nicht ganz ohne Belustigung, dass er aussah, als würde er gleich in Ohnmacht fallen. „Auf keinen Fall!“, rief Rutherford. Dabei schüttelte er energisch den Kopf und hob abwehrend die Hände. „Ich muss doch sehr bitten, Miss Cabot, aber ich kann diese Tollheit auf keinen Fall dulden. Sie müssen sofort wieder nach Hause fahren.“
Miss Cabot wirkte enttäuscht.
„Dann übernehme ich die Verantwortung“, sagte George und schob mit dem Fuß einen der Sessel in ihre Richtung. Ein Raunen ging durch die Menge und die dicht gedrängte Gruppe kleiner Vögel begann aufgeregt zu flattern, dass die Säume ihrer Umhänge dabei über den Boden fegten. Aufgeregt tuschelten sie miteinander. „Wen habe ich das Vergnügen, an diesem Tisch zu dulden?“, fragte er.
„Miss Cabot“, antwortete sie. „Aus Beckington House.“
Sie war also die Tochter des Earl of Beckington. Wollte sie ihn etwa beeindrucken? Dann war ihr das keineswegs gelungen. George zuckte mit den Schultern. „George Easton. Aus Easton House.“
Die Mädchen hinter ihr kicherten, aber Miss Cabot verzog keine Miene. Sie lächelte ihm höflich zu. „Es ist mir ein Vergnügen, Mr Easton.“
Wahrscheinlich hatte sie dieses Lächeln schon in frühester Kindheit benutzt, um zu bekommen, was sie wollte. George hielt sie für eine bemerkenswert schöne junge Frau. „Das sind hier keine Gesellschaftsspiele, Miss, haben Sie Geld für Ihren Einsatz?“
„Das habe ich allerdings“, antwortete sie und hielt ihm ihre Geldbörse hin.
Gott, war das Mädchen naiv. „Das stecken Sie lieber wieder weg“, sagte er. „Hinter der hübschen Fassade, den seidenen Halstüchern und polierten Lederstiefeln verbirgt sich eine echte Diebesbande.“
„Zumindest haben wir noch einen Geldbeutel, Easton, und haben nicht alles mit einem Schiff versenkt“, warf jemand ein.
Einige der Gentlemen lachten bei dieser Bemerkung, doch George nahm keine Notiz von ihnen. Er hatte sich sein Vermögen hart erarbeitet und einige der Männer waren neidisch auf die Klugheit, mit der er dabei vorgegangen war.
Er lud die liebreizende Miss Cabot mit einer Handbewegung ein, sich zu setzen. „Sind Sie überhaupt alt genug, um die Feinheiten eines Spiels wie Commerce zu verstehen?“
„Warum fragen Sie?“, wollte sie wissen, dabei zog sie eine Augenbraue hoch und ließ sich anmutig auf dem Sessel nieder, den er ihr hingeschoben hatte. „Wie alt muss man denn sein, um sich in einem Spiel zu versuchen, bei dem es hauptsächlich um Glück geht?“
Hinter ihr tuschelten die Vögelchen eifrig, doch Miss Cabot sah George ruhig in die Augen, während sie auf seine Entgegnung wartete. Sie ließ sich nicht so leicht einschüchtern, weder von ihm noch von der ungewohnten Umgebung oder von sonst irgendetwas.
„Ich würde mir nicht anmaßen, eine Altersgrenze festzulegen“, antwortete er galant. „Meinetwegen könnte jedes Kind mitspielen.“
„Easton“, rief Rutherford in warnendem Ton. George aber folgte eben nicht den Regeln der adligen Gentlemen und das wusste Rutherford auch ganz genau. Die Angelegenheit war ein netter Zeitvertreib; George hatte ganz und gar nichts dagegen, eine Stunde oder auch länger mit einer Dame zu verbringen – in London war er dafür wohlbekannt –, vor allem, wenn die junge Dame so attraktiv war wie diese hier. „Ist Ihnen klar, dass Sie alles bis auf den letzten Penny verlieren können?“
Sie lachte ein perlendes Lachen. „Das habe ich keineswegs vor.“
Die anwesenden Gentlemen stimmten in ihr Lachen ein, einige von ihnen waren sogar aufgestanden, um sich das Geschehen aus der Nähe anzusehen.
„Man muss stets darauf gefasst sein zu verlieren, Miss Cabot“, warnte George sie noch einmal.
Sie öffnete mit großer Sorgfalt ihr Handtäschchen, nahm ein paar Münzen heraus und blickte ihn stolz an. George ermahnte sich innerlich, sich nicht von ihrem Lächeln beeindrucken zu lassen … zumindest nicht am Spieltisch.
Rutherford hingegen starrte erst George und dann Miss Cabot entsetzt an, ehe er sich langsam und sehr zögerlich wieder hinsetzte.
„Soll ich geben?“, fragte George, indem er den Kartenstapel in die Höhe hielt.
„Bitte“, antwortete Miss Cabot und legte ihre Handschuhe sorgfältig geglättet zur Seite, direkt neben ihren kleinen Stapel Münzen. Während George die Karten mischte, schaute sie sich im Saal um. „Wissen Sie, ich bin tatsächlich noch nie in den Vierteln südlich der Themse gewesen.“
„Das erstaunt mich wenig“, brummte er, während er ausgab. „Ihr Einsatz, Miss Cabot.“
Sie sah sich die Karten an, die vor ihr lagen, und legte ein Schillingstück in die Mitte des Tisches.
„Mit diesem Einsatz kommen Sie in diesem Spiel nicht weit“, sagte George.
„Ist es denn zulässig, so zu setzen?“
Er zuckte mit den Schultern. „Natürlich.“
Statt einer Antwort lächelte sie nur.
Rutherford folgte sofort und auch die junge Dame, die schon beinahe den ganzen Abend über auf seinem Schoß gesessen hatte, nahm ihren Platz wieder ein. Der Blick, den sie Miss Cabot zuwarf, während sie sich auf seinen Knien zurechtrückte, war eine Provokation.
„Oh“, murmelte Miss Cabot. Offensichtlich hatte sie gerade erst verstanden, was für eine Sorte Frau da auf Rutherfords Schoß Platz nahm, denn sie wandte den Blick ab.
„Sind Sie schockiert?“, flüsterte George amüsiert.
„Ein wenig“, gab Miss Cabot zu, während sie der noch jungen Hure einen Seitenblick zuwarf. „Ich hätte gedacht, sie wären irgendwie schlichter. Aber sie ist sehr hübsch, nicht wahr?“
George sah zu der jungen Frau auf Rutherfords Schoß hinüber. Er hätte sie als verführerisch bezeichnet, aber nicht unbedingt als hübsch. Miss Cabot selbst war hübsch.
Er sah sich sein Blatt an – er hatte ein Paar Könige. Das war eine leicht gewonnene Partie, dachte er, als er seinen Einsatz machte.
Eines der Dienstmädchen kam mit einem Tablett voll Essen vorbei, um es an einen der Tische zu bringen, an dem das Spiel ebenfalls wieder aufgenommen worden war. Miss Cabot schaute ihr nach.
„Miss Cabot“, sagte George.
Sie sah ihn an.
„Sie sind an der Reihe.“
„Oh!“ Sie sah lange ihre Karten an, nahm eine weitere Münze und legte sie zu den anderen Einsätzen.
„Gentlemen, es liegen zwei Pfund auf dem Tisch. Wenn wir in diesem Tempo weitermachen, dann ist das Spiel noch nicht zu Ende, wenn die Sonne wieder aufgeht.“
Miss Cabot lächelte ihm zu, dabei funkelten ihre blauen Augen vor Vergnügen.
George musste sich ins Gedächtnis rufen, dass er sich keine schönen Augen machen lassen durfte.
In der nächsten Runde schien Rutherford seine Vorbehalte aufgegeben zu haben, mit einer Debütantin zu spielen. In der übernächsten setzte Miss Cabot zwei Schillinge auf einmal ein.
„Miss Cabot, werden Sie nicht übermütig. Sie wollen doch nicht schon im ersten Spiel alles verlieren“, sagte einer der jungen Kerle und lachte dabei nervös.
„Ich denke, dass es nicht weniger schmerzlich ist, mein ganzes Geld in sechs Spielen zu verlieren, als in einem, Mr Eckersly“, antwortete sie heiter.
George gewann diese Runde, wie er erwartet hatte, doch Miss Cabot schien nicht so leicht aufgeben zu wollen. „Ich finde, es sollte überall mehr Glücksspiele geben, meinen Sie nicht?“, fragte sie die umstehende Menge, die zusehends größer wurde. „Sie sind so viel unterhaltsamer als Whist.“
„Nur wenn man gewinnt“, wandte einer der Männer ein, die weiter hinten standen.
„Und das mit dem Geld seines Vaters“, witzelte Miss Cabot zum großen Vergnügen sowohl der umstehenden Herren als auch der Vögelchen, die sie begleiteten, denn sie hatten jetzt die Aufmerksamkeit aller anwesenden Gentlemen.
Sie machten eine Zeit lang so weiter: Miss Cabot setzte hier und da einen Schilling und unterhielt die Menge mit geistreichen Bemerkungen. Die Einsätze waren bei Weitem zu gering, als dass George Spaß am Spiel gehabt hätte, aber dafür hatte er umso mehr Spaß an Miss Cabot. Sie war ganz und gar keine gewöhnliche Debütantin. Sie war geistreich und spielte gern, genoss ihre kleinen Triumphe und diskutierte ihr Spiel mit jedem, der gerade hinter ihr stand.
Nach etwa einer Stunde hatte Miss Cabot gerade noch zwanzig Pfund in ihrer Geldbörse. Sie war mit Mischen und Geben an der Reihe. „Sollen wir den Einsatz erhöhen?“, fragte sie leichthin.
„Wenn Sie meinen, dass Sie meinen Einsatz halten können, bin ich ganz Ohr“, sagte George.
Sie warf ihm einen kecken Blick zu. „Zwanzig Pfund für das Spiel“, sagte sie und begann, die Karten zu verteilen.
George musste angesichts von so viel Naivität lachen. „Aber das ist alles, was Sie noch haben“, stellte er fest.
„Nehmen Sie einen Schuldschein von mir?“, fragte sie und sah ihn an. Sie hatte noch immer dieses Funkeln in den Augen. Doch ihr Blick hatte sich verändert. Sie wollte ihn herausfordern. Der Himmel mochte wissen, was das Mädchen im Schilde führte, doch sie hätte George keinen größeren Gefallen tun können. Er grinste.
„Miss Cabot, ich muss Ihnen dringend abraten“, sagte einer der jungen Männer, derselbe, der schon während des gesamten Spiels hinter ihr gestanden hatte und dabei immer nervöser geworden war. „Es ist höchste Zeit, dass wir nach Mayfair zurückkehren.“
„Ihre Vorsicht und Ihre Sorge um die vorgerückte Stunde habe ich verstanden und schätze sie sehr, Sir“, sagte sie mit zuckersüßem Lächeln. Dabei hielt sie den Blick auf George gerichtet. „Aber Sie sind doch noch im Spiel, Mr Easton, oder etwa nicht?“, fragte sie. „Und nehmen einen Schuldschein von mir?“
George hatte einer Dame noch nie etwas abschlagen können, speziell, wenn er sie so anziehend fand. „Aber mit dem größten Vergnügen“, sagte er mit der eleganten Andeutung einer Verbeugung. „Ich würde einen Schuldschein über jede beliebige Summe von Ihnen nehmen.“
Diese Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer im ganzen Saal und im Handumdrehen war die Menge der Umstehenden noch größer geworden. Alle wollten Zeuge werden, wie eine Debütantin ein Vermögen an George Easton verlor, der sich selbst als Bastard des Duke of Gloucester bezeichnete.
Die Einsätze wurden immer höher, bis Rutherford sich schließlich aus dem Spiel zurückzog, weil er den Gedanken nicht ertrug, dass eine Debütantin ihm Geld schuldete. George und Miss Cabot spielten von da an alleine weiter, was ihr erstaunlich wenig auszumachen schien. Das war typisch für die Gesellschaft aus Mayfair, dachte George. Vollkommen gleichgültig, wie viel vom Geld ihres Vaters sie verspielte – Schuldscheine wie Münzen würden wie von Zauberhand wiederauftauchen.
Der Einsatz war bis auf einhundert Pfund gestiegen, als George innehielt. Auch wenn er ihre Chuzpe bewunderte, war ihm doch nicht wohl bei dem Gedanken, einer Debütantin so viel Geld abzunehmen. „Wir sind jetzt bei einhundert Pfund, Miss Cabot. Wird Ihr Herr Vater diese Summe einfach so wieder in Ihr Täschchen stecken?“, fragte er, woraufhin die umstehenden Herren anfingen, zustimmend zu lachen.
„Du liebe Zeit, Mr Easton, ist diese Frage nicht ein wenig persönlich? Sollte ich mich vielleicht ebenfalls vergewissern, dass Sie einhundert Pfund in der Tasche haben, für den Fall, dass ich gewinne?“
Was für ein freches kleines Ding. Um sie herum war einige Unruhe entstanden und George wagte nicht, sich auszumalen, wie sehr diese Bemerkung einigen der Herren im Raum gefallen hatte. Er warf eine Handvoll Geldscheine auf den Tisch und zwinkerte ihr zu. „Das habe ich allerdings.“
Sie ging mit, nachdem sie sich von jemandem ein Blatt Papier hatte geben lassen, auf dem sie mit ihrer Unterschrift bestätigte, dass sie ihm einhundert Pfund schuldig war.
George legte seine Karten auf den Tisch. Er hatte eine kleine Straße, die Zehn war der höchste Wert. Sie hatte kaum eine Chance, dieses Blatt zu schlagen, und tatsächlich holte Miss Cabot vor Überraschung tief Luft. „Du lieber Himmel, das ist ja sehr beeindruckend!“, sagte sie.
„Ich spiele ja heute nicht zum ersten Mal.“
„Natürlich nicht.“ Sie hob den Blick und lächelte ihn an und in diesem Augenblick wusste George, dass er sich geschlagen geben musste. Ihr Lächeln war einfach zu frech und zu triumphierend.
Als sie ihre Karten auf den Tisch legte, waren überall um sie herum überraschte Ausrufe zu hören, gefolgt von Applaus. Miss Cabot hatte ihn mit einem Dreier geschlagen, sie legte drei Zehnen auf den Tisch. George starrte ungläubig die Karten an, dann hob er langsam den Blick und sah ihr in die Augen.
„Darf ich?“, fragte sie ungerührt und fing an, mit beiden Händen das Geld einzustreichen, das auf dem Tisch lag. Sie nahm alles an sich, bis auf die letzte Münze, und steckte es in ihre elegante kleine Handtasche. Sie dankte George und Mister Rutherford, dass sie sie hatten mitspielen lassen, und entschuldigte sich dann höflich. Anschließend zog sie ihre Handschuhe wieder an und schlüpfte wieder in ihren Umhang, ehe sie zu ihrem kleinen Vogelschwarm zurückkehrte.
George sah ihr nach und trommelte dabei mit den Fingern auf den Tisch. Er war ein erfahrener Spieler und war gerade von einer Debütantin abgezockt worden.
Das war jedoch nur der Anfang des Ärgers mit Honor Cabot.
2. KAPITEL
Lady Humphreys jährliches Frühjahrskonzert galt gemeinhin als das Ereignis, bei dem die Damen der vornehmen Gesellschaft ihre modischen Vorstellungen von der beginnenden Saison preisgaben. Dabei stach jedes Jahr unweigerlich eine von ihnen besonders heraus. Im Jahre 1798 trug Lady Eastbourne ein Kleid mit kurzen Flügelärmeln, das viele für so gewagt und doch für so klug befanden, dass in ganz Mayfair wochenlang von nichts anderem geredet wurde. 1804 hatte Miss Catherine Wortham zum allgemeinen Entsetzen auf jede Form von Unterrock für ihren Musselin verzichtet, sodass der Umriss ihrer Beine für alle sichtbar war.
Im wunderschönen Frühjahr 1812 allerdings hinterließ Miss Honor Cabot bleibenden Eindruck mit ihrem eng geschnittenen Ballkleid, das ein gewagt tiefes Dekolleté zierte. Sie war in exquisite Pariser Seide gehüllt, die allem Anschein nach ein kleines Vermögen gekostet hatte. Immerhin wurde es von Schmuckbändern und umfangreichen Perlenstickereien gesäumt. An Pariser Mode war zudem in diesen Tagen nicht leicht heranzukommen, befand sich England doch noch immer im Krieg mit Frankreich. Die Seide hatte das Blau von Pfauenfedern, das die Farbe ihrer Augen besonders schön zur Geltung brachte. Auch ihr rabenschwarzes Haar hatte sie mit kleinen Kristallen geschmückt, welche den Farbton ihres Kleides spiegelten.
Honor Cabot war auch sonst ein Sinnbild für Schönheit. Ihre Kleider waren stets hervorragend geschnitten, ihre ebenmäßige helle Haut bildete einen hübschen Kontrast zu ihren dunklen Wimpern, den vollen roten Lippen und der gesunden Farbe ihrer Wangen. Sie wirkte stets heiter und ihre Augen funkelten vor Vergnügen, wenn sie mit ihren vielen Freunden oder den Gentlemen, die sie anhimmelten, um die Wette lachte.
Sie hatte den Ruf, die Grenzen vornehmen und tugendhaften Benehmens für Debütantinnen ständig zu verschieben. Alle hatten von ihrem jüngsten Abenteuer in Southwark gehört. Skandalös! Die Gentlemen der vornehmen Gesellschaft nannten sie im Scherz einen Haudegen.
An diesem Abend, als die Gesangsdarbietung gerade vorüber war und die Gäste eingeladen waren, über Hanover Square zum Stadthaus der Humphreys zu promenieren, um dort das Abendessen einzunehmen, war es jedoch nicht das Ballkleid, das für allgemeinen Gesprächsstoff sorgte, sondern ihre Haube.
Und was für eine kunstvoll gestaltete Haube sie trug! Lady Chatham, die anerkannte Autorität in allen Belangen der Hutmacherei, behauptete, dass niemand anders als die exklusive Firma Lock and Company in der St James Street diese Kreation entworfen haben konnte. Die Materialien waren schwarzer Crêpe und tiefblauer Satin und der Stoff war auf einer Seite zu einem kleinen Fächer zusammengefasst, der von einem funkelnden Aquamarin zusammengehalten wurde. Aus diesem ragten wiederum zwei Pfauenfedern hervor, die, wenn man Lady Chatham glauben durfte, den langen Weg aus Indien nach London gekommen waren. Sie sagte das, als müsste jedermann wissen, dass indische Pfauenfedern den englischen weit überlegen waren.
Als Miss Monica Hargrove diese Haube auf Honors dunkelhaarigem Schopf zu sehen bekam, hätte sie um ein Haar einen Herzanfall erlitten.
In ganz Mayfair verbreitete sich wie ein Lauffeuer die Nachricht, dass es im Damensalon zu einem unglücklichen Zusammenstoß zwischen Miss Cabot und Miss Hargrove gekommen sei. Es ging sogar so schnell, dass die Neuigkeit den Earl of Beckington in seinem Stadthaus am Grosvenor Square erreicht hatte, ehe Miss Cabot selbst wieder zu Hause war.
Honor war sich keiner Schuld bewusst, als sie sich mit dem ersten Hahnenschrei ins Haus zurückstahl. Sie lief, so schnell sie konnte, die Treppe hinauf in ihr Schlafzimmer. Sobald sie die Tür hinter sich geschlossen hatte, warf sie die Haube auf das Sofa, zog das wunderschöne Kleid aus, das Mrs Dracott extra für sie angefertigt hatte, und fiel kurze Zeit später in einen tiefen, traumlosen Schlaf. Ihre dreizehnjährige Schwester Mercy weckte sie nur wenig später unsanft aus ihrem Schlummer, indem sie sich über sie beugte und sie unverwandt anstarrte.
Honor erschrak fürchterlich, umklammerte die Bettdecke, während sie sich aufsetzte und fragte: „Mercy, was um Himmels willen ist denn los?“
„Augustus sagt, du sollst zu ihm kommen“, sagte Mercy und sah Honor dabei durch ihre großen Brillengläser hindurch eindringlich an. Mercy hatte die gleichen blauen Augen und dunklen Haare wie Honor. Ihre beiden Schwestern, Grace, die mit einundzwanzig nur ein Jahr jünger war als Honor selbst, und die sechzehnjährige Prudence hingegen waren blond und hatten haselnussbraune Augen.
„Augustus?“, wiederholte Honor und gähnte dabei. Sie war an diesem Morgen nicht in der Stimmung, mit ihrem Stiefbruder zu sprechen. War es überhaupt schon Morgen? Sie warf einen Blick auf die Uhr auf dem Kaminsims, die halb zwölf zeigte. „Was will er denn?“
„Woher soll ich das wissen?“, fragte Mercy zurück und setzte sich mit einem Schwung auf das Fußende von Honors Bett. „Warum hast du so schwarze Ränder unter den Augen?“
Honor stöhnte. „Müssen wir heute Besuche empfangen?“
„Nur Mr Jett“, sagte Mercy. „Er hat dir seine Karte dagelassen.“
Der gute Mr Jett – der Mann wollte einfach nicht glauben, dass Honor nicht wünschte, dass er ihr den Hof machte. Es schien ihr Schicksal zu sein, immer genau diejenigen Gentlemen der Londoner Gesellschaft anzuziehen, für die sie auch in ihren wildesten Träumen keinerlei Zuneigung hätte entwickeln können. Mr Jett war bestimmt zweimal so alt wie sie und außerdem hatte er außerordentlich fleischige Lippen. Es wurmte sie, dass es von Frauen erwartet wurde, jeden Mann zu akzeptieren, dessen Vermögen und Status mit dem eigenen mithalten konnten. Was war denn mit Seelenverwandtschaft? Mit gegenseitiger Wertschätzung?
Am nächsten war Honor solchen Gefühlen im Jahr ihres Debüts gekommen. Damals hatte sie sich unsterblich in Lord Rowley verliebt, einen gut aussehenden, charmanten jungen Gentleman, der bisher ungeahnt zärtliche Gefühle in ihr geweckt hatte. Honor war so sehr von ihm eingenommen gewesen, dass sie geglaubt hatte – und sie war auch in diesem Glauben gelassen worden –, dass ein Antrag kurz bevorstand.
Tatsächlich war auch ein Antrag gefolgt … allerdings an Delia Snodgrass.
Honor war zum Tee bei jemandem zu Gast gewesen, als sie von der Verlobung erfahren hatte, und die Nachricht hatte sie so aus der Bahn geworfen, dass Grace sie hatte entschuldigen müssen. Honor war schnurstracks nach Hause gelaufen. Diese Enttäuschung hatte ihr das Herz gebrochen und sie war wochenlang nicht über ihren Liebeskummer hinweggekommen. Es hatte sie zu sehr geschmerzt, mit ansehen zu müssen, wie Rowley Miss Snodgrass den Hof machte, und sie hatte sich in ihrem Schmerz immer und immer kleiner und unbedeutender gefühlt.
Wie hatte sie sich nur so schrecklich täuschen können? Hatte ihr Rowley nicht immer wieder Komplimente für ihre Anmut und Schönheit gemacht? Hatte er ihr nicht ins Ohr geflüstert, wie gern er sie küssen würde, und nicht nur auf die Wange? Waren sie nicht lange im Park spazieren gegangen und hatten dabei über ihre Wünsche und Träume für die Zukunft gesprochen?
Eines Tages, nachdem sie die Wahrheit erfahren hatte, hatte sie Lord Rowley zufällig getroffen. Er hatte gelächelt und ihr hatte das Herz bis zum Hals geklopft. Sie konnte nicht anders als ihn zur Rede zu stellen und ihn – so höflich, wie es ihr eben möglich war – zu fragen, was aus dem Antrag geworden war, den sie von ihm erwartet hatte.
Solange sie lebte, würde sie niemals den überraschten Gesichtsausdruck seiner Lordschaft vergessen. „Verzeihen Sie, Miss Cabot, aber ich hatte ja keine Ahnung von der Tiefe Ihrer Gefühle für mich“, hatte er als Entschuldigung vorgebracht.
Diese Reaktion hatte sie entsetzlich schockiert. „Sie wussten es nicht?“, hatte sie gefragt. „Aber Sie haben mich so oft besucht! Wir sind im Park zusammen spazieren gegangen und haben Zukunftspläne geschmiedet, wir haben sogar sonntags nebeneinander in der Kirche gesessen.“
„Ja, also“, hatte er gesagt und dabei sehr unbehaglich ausgesehen. „Ich habe viele Freunde des schönen Geschlechts. Ich bin unzählige Male spazieren gegangen und habe viele interessante Gespräche geführt. Aber mir war nicht klar, dass Sie Gefühle für mich entwickelt hatten, die über Freundschaft hinausgingen. Sie haben sich nicht das Geringste anmerken lassen.“
Honor war sprachlos gewesen. Natürlich hatte sie sich nichts anmerken lassen! Sie war immerhin ein wohlerzogenes Mädchen – sie war ordentlich und tugendhaft, so wie man es ihr beigebracht hatte! Sie hatte geduldig darauf gewartet, dass der Gentleman den ersten Schritt machte, so wie sie glaubte, dass solche Dinge funktionierten.
„Und ich möchte ausdrücklich betonen, Miss Cabot“, hatte er mit leidvoller Miene hinzugefügt, „dass es nichts geändert hätte, wenn ich es gewusst hätte.“ Dann war er rot geworden bis über beide Ohren und hatte mit den Schultern gezuckt. „Unsere Verbindung wäre bestimmt nicht glücklich gewesen.“
Das hatte sie noch mehr schockiert als seine anfängliche Täuschung. „Wie bitte?“
Er hatte sich geräuspert und auf seine Hände gestarrt. „Ich will damit sagen, dass ich der erstgeborene Sohn eines Earls bin und von mir erwartet wird, mich nicht mit Beckingtons Stieftochter zufriedenzugeben … oder der Tochter eines Bischofs, was das angeht.“ Er konnte ihr dabei nicht in die Augen sehen. „Das verstehen Sie doch sicherlich.“
Honor hatte sehr gut verstanden, was er ihr sagen wollte. Für Rowley, ebenso wie für die anderen Gentlemen in Mayfair, ging es bei einer Heirat ausschließlich um Position und Status. Liebe oder auch nur Zuneigung waren ihm vollkommen gleichgültig. Und sie war ihm erst recht gleichgültig.
Die Wunden, die Honor sich in diesem Sommer zugezogen hatten, waren nur schlecht verheilt und wirklich erholt hatte sie sich von ihnen nie. Sie hatte sich und ihren Schwestern geschworen, sich niemals wieder in eine solche Lage zu begeben. Niemals.
Sie gähnte und sah Mercy an. „Kannst du bitte Augustus sagen, dass ich gleich unten bin?“
„In Ordnung, aber beeile dich, er ist ziemlich wütend auf dich.“
„Warum? Was habe ich denn nun schon wieder getan?“
„Ich weiß nicht, aber auf Mama ist er auch wütend“, fügte Mercy hinzu. „Angeblich hat er Mama gestern gesagt, dass die Hargroves zum Abendessen kommen, aber sie sagt, das hat er nicht getan. Sie hat kein Essen vorbereiten lassen und sie haben sich ziemlich gestritten.“
„Oh nein“, sagte Honor. „Und was ist dann passiert?“
„Wir haben kaltes Hühnchen zum Abendessen gegessen“, antwortete Mercy. „Ich muss gehen“, fügte sie unbekümmert hinzu und hüpfte aus dem Zimmer.
Honor stöhnte noch einmal und schälte sich aus der Bettdecke. Sie hatte Augustus wirklich sehr gern, alles in allem. Er war jetzt seit zehn Jahren ihr Stiefbruder. Er war vierundzwanzig, kaum größer als Honor und ein wenig korpulent. Er war nie der Typ gewesen, der lange Wanderungen unternimmt oder auf die Jagd geht. Er verbrachte seine Nachmittage lieber mit einem Buch oder seinen Freunden im Club, wo er mit ihnen die englischen Flottenmanöver diskutierte. Die Einzelheiten dieser Gespräche gab er dann beim Abendessen zum Besten.
Aber von seinem schrecklich langweiligen Lebensstil abgesehen war Augustus Devereaux, Lord Sommerfield, ein guter Mann. Er war freundlich und fürsorglich, aber schwach und fürchterlich schüchtern, wenn es um Frauen ging. Jahrelang hatten Honor und Grace ihn leicht um den Finger wickeln können. Das hatte sich allerdings geändert, nachdem er sich in Monica Hargrove verliebt und sich mit ihr verlobt hatte. Wäre der Earl nicht bei so schlechter Gesundheit gewesen, wären die beiden in der Zwischenzeit verheiratet. Doch wie die Dinge standen, erschien es allen Beteiligten geschmacklos, die Hochzeit des Erben des Titels von Beckington zu feiern, solange das Leben des Earls am seidenen Faden hing. Honors Stiefvater litt unter Schwindsucht. Die vielen Ärzte, die im Haus ein und aus gingen, glaubten, dass er nur noch Monate, wenn nicht sogar Wochen zu leben hatte.
Honor zog ein schlichtes Tageskleid an und bürstete ihr Haar, ohne es wieder aufzustecken, denn dazu war sie einfach zu erschöpft. Sie ging die Treppe hinunter, wo sie ihre Schwestern und Augustus im Frühstückszimmer antraf. Sie war nicht eben froh darüber, dass all ihre Geschwister anwesend waren, insbesondere wenn sie Graces finstere Miene betrachtete – das war ganz und gar kein gutes Zeichen. Der Anblick des Essens auf der Anrichte hingegen weckte Honors Lebensgeister, denn sie konnte sich kaum noch erinnern, wann sie zum letzten Mal etwas gegessen hatte. „Guten Morgen allerseits“, sagte sie fröhlich, während sie über die kostbaren Teppiche hinweg zur Anrichte schritt und sich einen Teller nahm.
„Honor, meine Liebe, wann genau bist du letzte Nacht nach Hause gekommen?“, fragte Augustus mit scharfer Stimme.
„Es war noch nicht spät“, antwortete Honor ausweichend und versuchte, ihm nicht in die Augen zu sehen. „Ich wollte eigentlich auch schon früher gehen, aber Lady Humphrey hat eine Partie Faro organisiert und ich habe über dem Spiel die Zeit vergessen …“
„Faro! Das ist ein schmutziges Spiel, das von Trunkenbolden in Spelunken gespielt wird! Ich muss schon sagen, denkst du denn nie darüber nach, was dein Verhalten für eine Wirkung hat?“
„Doch, das tue ich immer“, gab Honor zu.
Augustus blinzelte verwirrt. Er zog die Stirn kraus. „Und was glaubst du, welcher Gentleman eine Debütantin heiraten will, die das Vermögen ihres Stiefvaters verspielt und erst in den frühen Morgenstunden nach Hause kommt?“, fragte er.
Honor blieb die Luft weg, doch dann sah sie ihrem Stiefbruder fest in die Augen. „Ich habe keineswegs das Vermögen des Earls verspielt, Augustus! Ich habe mit dem Geld gespielt, das ich gewonnen habe!“ Sie würde sich dafür nicht entschuldigen – sie gewann gar nicht so selten. Vor nicht einmal einem Monat hatte sie einem Mr George Easton vor aller Augen in einer Spielhölle in Southwark einhundert Pfund abgenommen. Sie erinnerte sich noch lebhaft an die Niederlage in seinen Blick.
Doch so leicht ließ sich Augustus nicht beschwichtigen. „Und inwiefern verbessert es deinen Ruf, wenn du gewinnst?“, wollte er wissen.
„Erzähl uns lieber vom Konzert“, sagte Prudence eifrig und ging damit einfach über Augustus’ Empörung hinweg. „War die Musik himmlisch? Wer war alles eingeladen? Wie haben die Kleider der Damen ausgesehen?“
„Die Kleider?“, wiederholte Honor gedankenverloren, während sie sich mit einem Teller voller Käse und Crackern neben Augustus an den Tisch setzte. „Ich habe nicht wirklich darauf geachtet. Ich nehme an, das Übliche: Musselin und Spitzen.“ Sie zuckte gleichgültig mit den Schultern.
„Und was war mit Hauben?“, fragte Augustus wütend und nahm sich einen der Cracker von Honors Teller.
Honor war klar, dass er vom Streit mit Monica wusste. Sie zögerte nur eine Sekunde, dann richtete sie sich auf, lächelte ihren Stiefbruder an und sagte: „Ich kann mich nur an meine eigene Haube erinnern.“
„Siehst du, Augustus!“, sagte Grace triumphierend. „Siehst du? Sie kann unmöglich Monicas Haube genommen haben.“
„Genommen?“, fragte Honor ungläubig.
„Wir alle wissen, dass Honor einen zur Weißglut treiben kann, aber sie ist durch und durch aufrichtig“, fuhr Grace fort, so als sei Honor überhaupt nicht anwesend. „Im Gegenteil! Wenn man ihr etwas vorwerfen kann, dann, dass sie zu ehrlich ist!“
„Wie kann man denn zu ehrlich sein?“, wollte Prudence wissen. „Entweder man ist ehrlich oder eben nicht.“
„Ich will damit sagen, dass es ihr manchmal an Taktgefühl fehlt“, erklärte Grace.
„Vielen Dank auch“, sagte Honor trocken. „Das ist wirklich zu nett von dir.“
Grace blinzelte, als sei sie sich keiner Schuld bewusst.
„Miss Hargrove kann man ebenso wenig einen Mangel an Aufrichtigkeit vorwerfen“, sagte Augustus streng. „Sie würde mir gegenüber nicht solche Vorwürfe äußern, wenn sie nicht wahr wären.“ Wie um seiner Aussage Nachdruck zu verleihen, stopfte er sich das letzte Stück des Crackers in den Mund und kaute eifrig, während er Honor finster anstarrte.
Honor verkniff sich die Bemerkung, dass es Monica Hargrove noch an ganz anderen Dingen fehlte und dass sie es wissen musste, denn immerhin kannten sie sich schon seit ihrem sechsten Lebensjahr, als ihre Mütter es für angezeigt gehalten hatten, sie gemeinsam zu einem Tanzlehrer zu schicken. Soweit Honor sich erinnern konnte, war dieser Lehrer ein einfältiger Kerl mit einer spitzen Nase und langen, dünnen Armen gewesen, der Monica besonders gemocht und ihr bei allen Aufführungen die besten Rollen gegeben hatte. Außerdem hatten Monicas Kostüme immer Flügel gehabt, Honors aber nie. Das hätte Honor auch hingenommen, wenn Monica es ihr nicht immer wieder unter die Nase gerieben hätte. „Vielleicht wirst du ja auch noch besser und darfst nächstes Jahr dieses Kostüm tragen“, hatte sie gesagt, während sie sich hin und her drehte, damit Honor ihr Kostüm in seiner ganzen Pracht bewundern konnte.
In den nächsten sechzehn Jahren war die Konkurrenz zwischen den beiden immer stärker geworden.
„Monica würde auch mit dem kleinsten Missverständnis zu dir kommen, wenn es bedeutet, dass sie bei dir besser dasteht als ich“, sagte Honor.
„Willst du etwa leugnen, dass Miss Hargrove bei Locke and Company eine Haube bestellt hat“, fuhr Augustus fort, der jetzt seinen Cracker heruntergeschluckt hatte, „und dass sie empört darüber war, sie während des Konzerts auf deinem Kopf zu sehen? Sie muss einen schrecklichen Schock erlitten haben, die Arme!“
Mercy, die in einem Buch blätterte, ohne darin zu lesen, musste lachen, aber ein finsterer Blick von Grace brachte sie sofort zum Schweigen. Grace sagte beruhigend zu Augustus: „Das ist bestimmt nur ein kleines Missverständnis.“
„Nein“, sagte Augustus und schüttelte dabei den Kopf. „Miss Hargrove hat mir selbst erzählt, dass sie Honor beim Abendessen zur Rede gestellt und dass Honor alles abgestritten hat. Aber als Miss Hargrove sagte, die Bestellung habe sie eine erhebliche Summe gekostet, hat Honor gesagt, so erheblich auch nun wieder nicht. Also bitte, sie hat Miss Hargrove gegenüber quasi zugegeben, dass sie ihre Haube gestohlen hat.“
„Ich habe damit nur sagen wollen, dass ich sie nicht so teuer fand, als ich die Haube gekauft habe“, sagte Honor mit sanfter Stimme.
Augustus lief fleckig rot an, wie er es immer tat, wenn er erregt und verwirrt war. „Honor, das …“ Er schwieg, dabei schob er seine Brust nach vorn, im Versuch, Autorität auszustrahlen. „So geht das nicht.“
„Was geht so nicht?“, fragte Honor und hielt ihm den Teller mit den Crackern hin. „Sie hat meine Haube bewundert und dann behauptet, dass sie ihr gehört. Aber wie kann sie ihr gehören, wenn der Hutmacher sie mir verkauft hat und ich sie auf meinem Kopf hatte, frage ich dich? Frag doch bei Locke and Company nach, wenn du mir nicht glaubst.“
Augustus wirkte sehr verwirrt, als er in seinem Kopf versuchte, Ordnung in die Sache mit der Haube zu bringen. „Es liegt mir doch überhaupt nichts daran, deine Verlobte gegen mich aufzubringen, Augustus“, fuhr Honor fort. „Ich möchte, dass wir Freundinnen sind, wirklich! Aber ich will dir nichts vormachen, ich frage mich manchmal, welche Absichten sie eigentlich wirklich hat.“
„Sie hat nur die allerbesten Absichten!“, sagte Augustus. „Ich kann mir keine liebenswertere und sanftmütigere Frau vorstellen.“ Plötzlich griff er nach Honors Hand, doch dabei stieß er mit dem Handrücken gegen den Teller, deshalb umfasste er ihr Handgelenk und sah sie flehend an. „Ich muss darauf bestehen, dass du das nicht noch einmal tust, Honor. Oder … oder dass du nicht die Sachen kaufst, auf die sie ein Auge geworfen hat“, sagte er verunsichert.
Hinter Augustus’ Rücken verdrehte Grace die Augen.
„Ich gebe dir mein Wort“, sagte Honor feierlich. „Ich werde nicht Monicas Hauben stehlen.“ Das unterdrückte Kichern kam von Prudence, die sich alle Mühe gab, nicht laut herauszuplatzen.
„Ich will zwischen euch keinen Streit haben“, fuhr Augustus fort. „Du bist meine Stiefschwester und sie wird meine Frau sein. Ich will kein Gerede über euch zwei in der Stadt und für Papas Gesundheit ist es auch nicht gut.“
„Nein, da hast du natürlich recht“, sagte Honor, die sich nun ein klein wenig schuldbewusst fühlte. „Wie geht es dem Earl heute?“
„Er ist sehr schwach. Ich war vor dem Frühstück bei ihm, da hat er mich darum gebeten, die Vorhänge zuzuziehen, damit er schlafen kann. Die Nacht war wohl sehr unruhig.“
Augustus erhob sich, dabei streifte er mit seinem runden Bauch die Tischkante. Er zog seine Weste zurecht, die sich ständig nach oben schob, wenn er saß, und nahm die Serviette ab, die er sich in den Kragen gesteckt hatte. „Ihr entschuldigt mich?“
„Ich wünsche dir einen schönen Tag, Augustus!“, sagte Grace freundlich.
„Alles Gute!“, rief Honor ihm nach.
Grace warf ihr dafür einen bösen Blick zu, ehe sie sagte: „Alles klar, Pru, Mercy, bitte lasst euch jetzt die Haare machen, ja? Wir unternehmen nach dem Mittagessen einen Ausritt mit Mama.“
Mercy hüpfte von ihrem Stuhl. „Darf ich den Fuchs reiten?“
„Da musst du Mr Buckley fragen.“ Grace scheuchte sie mit einer Handbewegung zur Tür hinaus. Während Mercy und Prudence folgsam den Salon verließen, lächelte Grace dem Lakaien zu, der sie bediente, und sagte: „Vielen Dank, Fitzhugh. Meine Schwester und ich kommen jetzt allein zurecht.“
Fitzhugh folgte den jüngeren Schwestern und schloss die Tür hinter sich.
Als sie allein waren, wandte Grace sich mit finsterem Blick in den haselnussbraunen Augen Honor zu. Diese leerte heißhungrig ihren Teller und tat so, als bemerke sie nichts.
„Was hast du getan?“, fragte Grace leise.
„Gar nichts.“ Doch Honor konnte ein Lächeln nicht unterdrücken. „Also gut, ich habe eine Haube gekauft.“ Sie nahm ein Stück Käse.
„Warum ist Monica dann so außer sich?“
„Ich vermute, weil sie die Haube für sich hat machen lassen.“ Honors Lächeln wurde immer breiter.
Grace sah sie mit offenem Mund an und brach dann in schallendes Gelächter aus. „Du lieber Gott, du bist wirklich unverbesserlich! Du richtest uns noch alle zugrunde!“
„Das ist so nicht ganz richtig. Ich bin sehr verbesserungswürdig.“
„Honor, also wirklich!“, sagte Grace, die noch immer lachen musste. „Wir hatten doch ausgemacht, dass du sie nicht schon wieder ärgern solltest.“
„Ach, weißt du, was ist schon eine Haube?“, sagte Honor und schob den Teller von sich weg. „Sie lag im Schaufenster von Locke and Company und ich fand sie wunderschön. Die Verkäuferin fand überhaupt nichts dabei, mir zu erzählen, dass Miss Monica Hargrove sie vor über einem Monat in Auftrag gegeben hatte, es ihr aber noch nicht eingefallen war, die Rechnung zu bezahlen. Da lag sie also, Grace, die wunderschöne Haube, und wenn ich das so frei heraus sagen darf, hatte sie ohnehin die falschen Farben für Monicas farbloses Gesicht. Der Laden wäre sonst vielleicht auf den Kosten für die Herstellung sitzen geblieben! Natürlich war die Verkäuferin froh, dass ich sie gekauft habe. Und ehrlich gesagt war es mir vollkommen egal, ob Monica sie bestellt hatte oder nicht. Sie ist eine unangenehme Person! Weißt du, was sie gestern Abend zu mir gesagt hat?“, fragte sie und beugte sich zu ihrer Schwester hinüber. „Sie hat gesagt: Ich weiß, was du vorhast, Honor Cabot“, Honor sprach in übertrieben tiefem und drohendem Ton, „aber es wird dir nicht gelingen. Augustus und ich werden heiraten und du kannst nichts tun, um das zu verhindern. Und wenn wir erst verheiratet sind, wirst du dich in einem Cottage in den Cotswolds wiederfinden und dort brauchst du ganz bestimmt keine vornehme Haube, das kannst du mir glauben.“ Honor lehnte sich zurück und ließ ihre Worte auf ihre Schwester wirken.
Grace holte tief Luft. „In den Cotswolds? Warum verbannt sie uns nicht gleich in die afrikanische Wüste? Das wäre auch nicht viel schlimmer! Mein Gott, Honor, genau davor hatten wir doch immer Angst und jetzt hast du sie genau dazu provoziert!“
Honor schnaubte verächtlich und nahm sich noch ein Stückchen Käse. „Glaubst du im Ernst, dass Monica Augustus dermaßen im Griff hat? Ihm liegt das Wohlergehen seiner Schwestern doch am Herzen.“
„Ja natürlich!“, sagte Grace mit bewegter Stimme. „Ja, ich glaube allerdings, dass sie so viel Einfluss auf ihn hat! Egal, wie sehr wir alle Augustus am Herzen liegen, glaubst du im Ernst, dass Monica ein Haus mit uns allen teilen wird, wenn der Earl stirbt? Ganz gleich, ob Beckington oder das Landhaus in Longmeadow oder überhaupt irgendeins?“
Honor seufzte tief. Es war gesellschaftlich allerdings alles andere als üblich, dass ein frischgebackener Earl und dessen ebenfalls frischgebackene Ehefrau die dritte Ehefrau des verstorbenen Earls mit allen vier Stieftöchtern bei sich aufnahmen. Grace hatte vollkommen recht, aber Monica war einfach so … herrschsüchtig! Und so vollkommen, bescheiden, sittsam und so hübsch!
„Du bist manchmal einfach rücksichtslos“, sagte Grace. „Was soll denn aus Prudence und Mercy werden, wenn wir auf dem Land festsitzen? Und aus Mama?“
Es wäre allerdings sehr schwierig für ihre Mutter, einen neuen Ehemann zu finden, dem es nichts ausmachte, auch für ihre vier unverheirateten Töchter zu sorgen, die einen ziemlich luxuriösen Lebensstil gewohnt waren und eine nicht unerhebliche Mitgift erwarteten. Die Familie Cabot hatte nur wenig eigenes Vermögen in die Ehe eingebracht, das reichte ganz bestimmt nicht aus, um alle vier Töchter gut zu verheiraten. Sie waren vollkommen abhängig vom Vermögen des Earls.
Erschwerend kam noch hinzu, dass die Cabots sich ganz bestimmt am Rande der vornehmen Gesellschaft wiederfinden würden, wenn irgendjemand erfuhr, was Grace und Honor bei ihrer Mutter beobachteten: Sie verlor langsam, aber sicher den Verstand. Es hatte vor zwei Jahren angefangen, nach einem Aufenthalt in Longmeadow. Ihre Mutter war in einen Unfall verwickelt gewesen, bei dem sich ihr Zweispänner überschlagen hatte und sie auf die Straße geschleudert worden war. Körperlich hatte sich die Countess wieder erholt, aber Honor und Grace hatten danach immer wieder bemerkt, dass ihr Geist nicht ganz klar zu sein schien. Meistens waren es Gedächtnisschwierigkeiten. Aber es gab auch andere Veränderungen, die offensichtlicher waren. Einmal erzählte sie davon, wie sie ihre Schwester getroffen hatte, so als wäre diese noch am Leben. Ein anderes Mal konnte sie sich nicht mehr an den Titel des Earls erinnern.
In letzter Zeit war es eher schlimmer mit ihrer Mutter geworden als besser. An den meisten Tagen war sie bei klarem Verstand und wich ihrem Gatten nicht von der Seite. An anderen Tagen hingegen konnte sie mehrmals dieselbe Frage stellen oder sie machte innerhalb von wenigen Minuten drei oder sogar vier Mal dieselbe Bemerkung über das Wetter. Honor hatte einmal versucht, ihre Mutter auf ihre immer schlimmer werdende Vergesslichkeit anzusprechen, daraufhin war ihre Mutter sehr verwirrt und auch wütend gewesen. Sie hatte Honor sogar vorgeworfen, ihr ihre eigene Vergesslichkeit in die Schuhe schieben zu wollen.
„Und ich muss dir ja wohl nicht sagen, dass der Earl seit zwei Tagen das Bett nicht mehr verlassen hat“, fügte Grace hinzu.
„Ich weiß, ich weiß“, sagte Honor mit trauriger Stimme. Sie zog die Füße unter sich auf ihre Stuhl. „Grace … ich habe nachgedacht“, sagte sie zögernd. „Was wäre, wenn Monica Augustus nicht heiraten würde?“
„Warum sollte sie denn nicht?“, fragte Grace und schnitt Honor damit das Wort ab. „Augustus ist ganz hingerissen von ihr. Er läuft ihr nach wie ein Hündchen.“
„Aber was wäre, wenn … wenn Monica von einem noch größeren Vermögen angelockt würde?“
„Wie bitte?“ Grace sah Honor ängstlich an. „Wie? Warum?“
„Nehmen wir nur einmal an, dass Monica weggelockt werden würde. Das würde uns die Zeit verschaffen, die wir brauchen, um unsere Angelegenheiten zu regeln. Sieh mal, Grace, wenn der Earl stirbt, wird Augustus sie so schnell wie möglich zum Altar führen – und was sollen wir dann noch machen? Aber wenn sie nicht ganz so schnell heiraten …“
„Das ist alles schön und gut, du vergisst dabei nur eins: Augustus liebt sie“, sagte Grace und war dabei sichtlich bemüht, einen kühlen Kopf zu bewahren.
„Das habe ich nicht vergessen. Aber er ist ein Mann, oder etwa nicht? Er wird sie vergessen und eine andere finden.“
„Aber doch nicht unser Augustus!“, sagte Grace zweifelnd. „Monica Hargrove ist die erste Frau, die er auch nur genauer angesehen hat, und selbst das hat noch mehrere Jahre gedauert!“
„Ich weiß“, antwortete Honor, der bei der Sache nicht ganz wohl war. „Ich versuche doch bloß, ihre Hochzeit ein bisschen zu verschieben.“
„Und bis wann?“
„So weit war ich noch nicht“, musste Honor zugeben.
Grace sah ihre Schwester eine Weile nachdenklich an, doch dann schüttelte sie den Kopf. „Das ist doch lächerlich. Eine fixe Idee! Monica gibt doch nicht einfach so den Spatz in der Hand wieder her – selbst wenn Augustus blind und taub wäre, wäre ihr das egal. Außerdem habe ich eine bessere Idee.“
„Und welche?“, fragte Honor mit skeptischem Blick.
Grace richtete sich auf. „Wir heiraten vor den beiden. So schnell wie möglich. Wenn wir verheiratet sind, müssen unsere Ehemänner Mutter und unsere Schwestern mit aufnehmen, wenn der Earl stirbt.“
„Wer hat hier jetzt die fixe Idee?“, fragte Honor. „Was glaubst du denn? Dass wir nur mit den Fingern schnipsen müssen, um einen Ehemann zu finden? Wen sollten wir denn heiraten?“
„Mr Jett, zum Beispiel …“
„Auf gar keinen Fall! Das ist der schlechteste Plan überhaupt, Grace. Erstens hat er keiner von uns einen Antrag gemacht und zweitens will ich überhaupt noch nicht heiraten. Ich will mich nicht um einen Ehemann kümmern und tun, was er von mir verlangt, und vielleicht aufs Land ziehen, wo nichts los ist, weil er das so will.“
„Wovon redest du denn? Wer ist denn dazu gezwungen worden, aufs Land zu ziehen? Jetzt mal im Ernst, Honor, willst du denn nicht heiraten? Sehnst du dich nicht nach Liebe und Zweisamkeit und Kindern?“
„Natürlich“, sagte Honor mit deutlichem Zweifel in der Stimme. Sie mochte ihre Freiheit. Sie sehnte sich nicht wie andere Frauen in ihrem Alter nach Familienglück und Ehe. „Aber im Augenblick bin ich in niemanden verliebt und ich will nicht einfach nur heiraten, weil es von mir erwartet wird. Es macht mich wütend, dass wir tun sollen, was man von uns verlangt, und diesen Mann heiraten oder jenen Antrag annehmen. Warum sollten wir das machen? Wir sind freie Menschen. Wir sollten tun und lassen können, was uns gefällt, so wie die Männer.“
„Du vergisst, dass wir nicht allein auf der Welt sind“, gab Grace zu bedenken. Damit meinte sie vor allem Prudence und Mercy.
Diese Bemerkung versetzte Honors Begeisterung für Gleichberechtigung einen Dämpfer.
„Außerdem kannst du Rowley nicht für immer nachtrauern …“
„Ich trauere ihm nicht nach“, setzte Honor an, doch Grace hob die Hand, um sie zum Schweigen zu bringen.
„Ich will dir wirklich nicht zu nahetreten, aber seit dem Vorfall bist du wirklich nicht mehr dieselbe, Honor. Du lässt überhaupt niemanden mehr an dich heran.“
Ehe Honor noch zu einer Gegenrede ansetzen konnte, fuhr Grace fort: „Zumindest sind wir uns in einem einig: Es muss etwas passieren.“
„Ja, natürlich sind wir uns einig. Deswegen will ich ja Monica von Augustus weglocken. Und ich weiß auch schon, wer der Köder sein wird.“
„Wer?“, fragte Grace skeptisch.
Honor musste lächeln, so genial fand sie ihren eigenen Plan. „George Easton!“
Vor Überraschung riss Grace die Augen auf und vergaß, den Mund wieder zu schließen. Es dauerte einen Moment, bis sie wieder sprechen konnte. „Bist du jetzt vollkommen verrückt geworden?“
„Das bin ich nicht“, verkündete Honor entschieden. „Er ist genau der richtige Mann dafür.“
„Reden wir von dem George Easton, dem du in diesem skandalösen Glücksspiel in Southwark einhundert Pfund abgenommen hast?“
„Allerdings!“
Grace stieß einen Laut aus, der genauso gut Verzweiflung wie Überraschung bedeuten konnte, Honor war sich nicht sicher, doch plötzlich erhob sich ihre Schwester und kam im Halbkreis um ihren Stuhl herum. Die Hände verschränkte sie dabei hinter dem Rücken. Als sie Honor schließlich gegenüberstand, kreuzte sie die Arme über der Brust und sah sie streng an. „Nur damit wir uns richtig verstehen, wir reden von dem Mann, der sich selbst den Bastard des Duke of Gloucester nennt? Dem Mann, der ein Vermögen genauso schnell verliert wie verdient?“
„Genau der“, bekräftigte Honor, von ihrer Idee überzeugt. „Er sieht gut aus, er ist ein Neffe des Königs und zur Zeit sind seine Taschen, soweit wir wissen, gut gefüllt.“
„Aber er ist ein Mann ohne eigenen Titel. Und ohne Verbindungen in der vornehmen Gesellschaft. Es nützt überhaupt nichts, wenn alle glauben, dass er der leibliche Sohn des verstorbenen Dukes ist, wenn der Duke selbst ihn niemals als sein Fleisch und Blut anerkannt hat. Und wo wir gerade davon sprechen: Der jetzige Duke – der ja dann Eastons Halbbruder wäre, wenn seine Geschichte stimmt – meidet ihn vollständig. Man darf in seiner Gegenwart nicht einmal Eastons Namen erwähnen! Um Himmels willen, Honor, seine angebliche Herkunft nützt ihm gar nichts! Monica Hargrove wird niemals den Titel des Hauses Beckington für ihn aufgeben, auf gar keinen Fall.“
„Vielleicht doch“, beharrte Honor. „Wenn man es nur geschickt anstellen würde mit der Verführung.“
Grace blinzelte verwirrt. Sie sank wieder auf ihren Stuhl, legte die Hände auf die Knie und sah ihre Schwester mit offenem Mund an. „Das ist eine nicht nur lächerliche, sondern auch gefährliche Idee. Du musst mir versprechen, dass du keine solchen Gemeinheiten vollbringen wirst.“
„Gemeinheiten!“ Honor war ein wenig gekränkt, dass Grace die Genialität ihres Planes nicht erkannte. „Er soll sie doch nur ein wenig verführen, nicht kompromittieren! Er soll sie nur in dem Glauben lassen, es gäbe noch andere Interessenten an einer Ehe mit ihr, dann wird sie schon von selbst versuchen, ihre Optionen auszuloten, ehe sie Augustus heiratet. In meinen Augen ist der Plan so einfach wie genial. Oder hast du eine bessere Idee?“
„Allerdings“, sagte Grace im Brustton der Überzeugung. „Wenn du nicht heiraten willst, dann werde ich es eben tun.“
„Oh, hast du Anträge bekommen, von denen du mir noch nichts erzählt hast?“
„Nein“, sagte Grace und schnaubte dabei. „Aber ich habe schon eine Idee, wie ich einen bekomme.“
„Zum Beispiel?“
„Das geht dich nichts an“, konterte Grace. „Aber du musst mir versprechen, dass du keine Dummheiten machst.“
„Also gut, also schön“, antwortete Honor und wedelte dabei vor Ungeduld mit der Hand. „Ich verspreche es dir“, sagte sie mit dramatischem Tonfall, dann nahm sie ihren Teller wieder in die Hand. „Ich verhungere fast.“
Honor hatte tatsächlich fest vor, ihr Versprechen zu halten. Das hatte sie eigentlich immer.
Aber dann traf sie noch am selben Nachmittag zufällig auf George Easton.
3. KAPITEL
Finnegan, der für George Easton sowohl Butler als auch Lakai und Kammerdiener war, hatte Georges besten dunkelbraunen Mantel und die dazu passende Weste sowie ein Halstuch im selben Farbton sorgfältig gebügelt. Er hatte die Kleidungsstücke so aufgehängt, dass sie George sofort ins Auge fallen mussten: direkt vor dem Waschbecken, sodass er an ihnen vorbei nicht in den Spiegel sehen und auch die Rasierklingen, Bürsten und Manschettenknöpfe nicht erreichen konnte.
Bevor er Finnegan engagiert hatte, war George mit zwei Lakaien, einer Köchin und einer Haushälterin als einzigen Dienstboten vollkommen zufrieden gewesen. Doch seine Geliebte, Lady Dearing, hatte darauf bestanden, dass George Finnegan einstellte, nachdem ihr eigener Ehemann den Kammerdiener auf die Straße gesetzt hatte. Lady Dearings Aussage nach war diese Entlassung den schlechten finanziellen Verhältnissen im Hause Dearing zu verdanken. George kannte sich mit finanziellen Schieflagen aus, er hatte in seinen einunddreißig Lebensjahren durchaus schon einige erlebt.
Es waren einige Wochen in Georges Dienst verstrichen, ehe er den wahren Grund für Finnegans Entlassung erfuhr: Er war ebenfalls von Lady Dearing eingeladen worden, ihr Bett zu teilen. George war durchaus nicht verborgen geblieben, dass seine blonde Löwin einen überaus großen Appetit besaß, aber der Kammerdiener? Das verstieß gegen die Regeln des guten Geschmacks. Doch in der Zwischenzeit hatte George sich an Finnegans Dienste gewöhnt und so hatte er sich der Geliebten entledigt und ihn als Butler behalten.
Er hatte sich gerade fertig angezogen, als Finnegan mit einem Hut in der Hand in der Tür seines Schlafzimmers erschien.
„Was ist das?“
„Ihr Hut, Sir.“
„Das sehe ich selbst, warum bringen Sie ihn mir?“
„Sie haben einen Termin mit Mr Sweeney. Anschließend treffen Sie sich mit den beiden Misses Rivers bei den Ställen von Cochran. Sie haben die jungen Damen zu einem Ausritt eingeladen.“
George runzelte entnervt die Stirn. „Was habe ich? Und wann soll ich diese Einladung ausgesprochen haben?“
„Offensichtlich gestern Abend, Sir. Ein Lakai der Rivers war vorhin hier, um die Nachricht zu überbringen, dass beide Misses Rivers Ihre Einladung mit dem größten Vergnügen annehmen.“ Er lächelte. Oder grinste. Ganz sicher war George sich da nie.
Er konnte sich an keinerlei Einladung erinnern, doch andererseits hatte er wohl gestern Abend im Coventry House Club ein wenig zu viel Spaß gehabt. Der Club war genau das Richtige für Männer wie ihn, er wurde viel von den Gentlemen der feinen Gesellschaft besucht, die – so wie George selbst – über ein üppiges Budget fürs Glücksspiel verfügten und sowohl Whiskey als auch südamerikanische Zigarren schätzten. Der Club war das Gegenteil von versnobt und damit von White’s in St. James. Zumindest stellte sich George das so vor.
Tom Rivers, der Bruder der beiden Damen, war gestern Abend ebenfalls im Coventry House gewesen, daran konnte er sich erinnern, ebenso an zu viele Drinks und jede Menge Gelächter. „Gott im Himmel“, murmelte er, stand auf und streckte die Hand nach dem Hut aus.
Er lief die mit dicken Teppichen ausgelegten Treppen des repräsentativen Hauses in Mayfair hinunter, das er in aller Stille dem Count of Wellington abgekauft hatte. Der Count hatte an einen Mann wie ihn – den unehelichen Sohn eines Dukes und Halbbruder eines anderen, der den Gedanken an seine Existenz schon kaum aushalten konnte – keineswegs verkaufen wollen, aber er hatte das Geld gebraucht, das George ihm zu bieten hatte.
Auch für die Verhältnisse der eleganten Audley Street in Mayfair war es ein geradezu spektakuläres Haus. Von der hohen Decke der Eingangshalle hing ein reich verzierter Kronleuchter von der Größe eines Pferdes herab und die Treppen wanden sich um ihn herum. Die mit Seidentapeten bespannten Wände der Halle waren mit Gemälden und Porträts geschmückt, die allesamt noch der Vorbesitzer zusammengetragen hatte.
Mittlerweile fielen sie George kaum noch auf, aber er hatte früher viel Zeit damit verbracht, sie einzeln sehr genau zu studieren und nach Ähnlichkeiten mit seinem eigenen Äußeren zu suchen. Schließlich war er zu dem Schluss gekommen, dass sie alle als seine Vorfahren in Frage kamen. Was spielte es schon für eine Rolle, um wen genau es sich handelte? Wenn man der Sohn eines Dukes und eines niederen Zimmermädchens war – eines Zimmermädchens, welches der Duke sofort entlassen hatte, als er von der Schwangerschaft erfuhr –, ist einem nichts so sicher wie verschlossene Türen und unangenehmes Schweigen, wenn man nach seinen Vorfahren forscht.
Barns, einer seiner Lakaien, stand an der Tür und öffnete sie, noch ehe George sie erreicht hatte. Das war Finnegans Werk. Finnegan war der einzige Mensch in seinem Leben, jetzt oder früher, der ihn jemals wie den Urgroßenkel eines Königs und Neffen eines weiteren behandelt hatte. George war sich nie ganz sicher, ob ihm diese Behandlung gefiel. Er zog es eigentlich vor, seine Türen selbst zu öffnen. Er sattelte auch sein Pferd lieber selbst – da er das schon als kleiner Junge gelernt hatte, als er in den Stallungen der Royal Mews gearbeitet hatte, während seine Mutter dort die Nachttöpfe ausleerte, ging es bei ihm sehr schnell.
„Vielen Dank, Barns“, sagte George. Er war einen ganzen Kopf größer als sein Lakai. George verfügte über die Statur der königlichen Familie und die robuste Gesundheit der Familie seiner Mutter. All seine Verwandten mütterlicherseits hatten sich mit ihrer Hände Arbeit ihren Lebensunterhalt verdient. In Montagu House aber hing ein Porträt seines Vaters, das George sich gewissenhaft angesehen hatte, als sich die Gelegenheit dazu ergab. Es kam ihm so vor, als hätte er die schmale, aristokratische Nase und das energische Kinn seines Vaters, aber das kastanienbraune Haar seiner Mutter und ihre hellblauen Augen. Die anderen Kinder, die in den Royal Mews arbeiteten, hatten gesagt, er sei ein Mischling, nicht der Neffe eines Königs.
Georges Pferd stand bereits gesattelt auf dem gepflasterten Bürgersteig vor seinem Haus. Er warf dem Stallburschen einen Viertelpenny zu, der die Münze geschickt auffing und in die Tasche steckte, während er George die Zügel übergab. „Tach auch, Sir“, sagte er und rannte zurück zu den Ställen.
George setzte sich den Hut auf, schwang sich in den Sattel und trieb sein Pferd im Trab die Audley Street hinunter.
Eine Viertelstunde später kam er beim Büro von Sweeney and Sons an. Sam Sweeney, sein Anwalt und Schiffsmakler, grinste breit. „Woher die gute Laune?“, fragte George, als er kurz darauf in der Eingangshalle seinen Hut einer alten Dienstbotin mit einer Spitzenhaube übergab.
„Es gibt allen Grund zur Freude, ja zum Glücklichsein“, antwortete Mr Sweeney, während er Georges Hand ergriff und überschwänglich schüttelte. „Kommen Sie doch bitte herein, Mr Easton. Ich habe wunderbare Neuigkeiten.“
„Ist das Schiff wiederaufgetaucht? Hat man es in den Hafen gebracht?“
„Nicht ganz“, gab Mr Sweeney zu, während er George in sein Büro bat. Umständlich wedelte er mit seinem Taschentuch über die Polster eines Ledersessels und bat George, dort Platz zu nehmen.
Als George sich hingesetzt hatte, sagte Mr Sweeney: „Die ‚St. Lucia Rosa‘ liegt im Hafen. Ich habe mit dem Kapitän selbst gesprochen. Er hat mir berichtet, dass Godsey und seine Mannschaft Indien erreicht haben und eine Woche später nach England aufbrechen sollten. Das bedeutet, er müsste in spätestens einer Woche hier sein.“
Erleichterung durchflutete George. Er hatte einen nicht unerheblichen Teil seines Vermögens in dieses Schiff investiert und den Gedanken, alles zu verlieren und wieder einmal von vorn anzufangen, konnte er kaum ertragen.
„Lassen Sie uns außerdem nicht vergessen, dass Kapitän Godsey ein Mann mit viel Erfahrung ist“, ergänzte Sweeney.