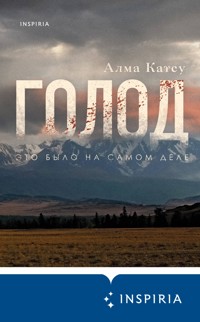11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Mitte April 1846 bricht die so genannte »Donner Party« – insgesamt fast neunzig Männer, Frauen und Kinder – aus Springfield, Illinois, auf. Ihr Ziel ist Kalifornien. Ein Ort, an dem alles besser ist. An dem schon viele Siedler ihr Glück gefunden haben. Doch schon bald sind die Nerven zum Zerreißen angespannt: der Hunger, das Klima und die Feindseligkeiten innerhalb der Gruppe verwandeln den Wagentreck in ein Pulverfass. Dann kommt ein kleiner Junge unter mysteriösen Umständen zu Tode, und ein Siedler nach dem anderen verschwindet spurlos. Langsam aber sicher wird klar, dass die Donner Party in den Weiten der Prärie nicht alleine ist. Dass »Etwas« sie begleitet. Etwas, das großen Hunger hat ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 504
Ähnliche
Das Buch
Es ist der April des Jahres 1846. Aus Springfield in Illinois bricht ein gewaltiger Treck nach Westen auf. Fast neunzig Männer, Frauen und Kinder ziehen unter der Leitung des Großgrundbesitzers George Donner in Richtung Kalifornien. Einen Ort, an dem alles besser ist. An dem Wohlstand, Freiheit und Glück warten. Doch der Weg dorthin ist lang und gefährlich. Die Angst vor wilden Tieren und Überfällen der Ureinwohner, das raue Klima und die Lebensmittelknappheit verwandeln den Wagentreck schon bald in ein Pulverfass. Und dann noch die unheimlichen Schreie, die nachts aus der Ferne zu ihnen herüberdringen … Als eines Tages ein kleiner Junge aus dem Treck verstümmelt aufgefunden wird, macht sich Misstrauen unter den Siedlern breit: Wurde er von Wölfen getötet? Von Indianern? Oder ist etwa einer von ihnen ein Mörder? Einzig Tamsen Donner, die schöne Frau des Anführers, fürchtet, dass andere böse Kräfte hinter dem Tod des Jungen stecken könnten, doch niemand glaubt ihr. Als weitere Siedler verschwinden, und der Winter näher rückt, trifft George Donner eine fatale Entscheidung: Er führt den Treck direkt in die östlichen Berge der Sierra Nevada. Nun sitzen sie in der Falle – und das Heulen aus der Prärie kommt immer näher …
In The Hunger – Die letzte Reise erzählt Alma Katsu einen der dunkelsten Momente der amerikanischen Geschichte nach und verwebt historische Fakten mit einem großen fantastischen Abenteuer.
Die Autorin
Alma Katsu wurde 1959 in Fairbanks, Alaska, geboren und ist Absolventin der Johns Hopkins University und der Brandeis University, an der sie zusammen mit John Irving Literatur und Kreatives Schreiben studierte. Sie arbeitete viele Jahre als Senior Intelligence Analyst für verschiedene US-Bundesbehörden und ist immer noch als politische Beraterin tätig, wenn sie nicht gerade schreibt. Alma Katsu lebt mit ihrem Mann in der Nähe von Washington, D.C. Die Filmrechte an The Hunger wurden an Ridley Scotts Produktionsfirma Scott Free Productions verkauft.
ROMAN
Aus dem Amerikanischen übersetzt
von Michael Pfingstl
Mit einem Anhang über den historischen
Hintergrund von »THE HUNGER«
WILHELM HEYNE VERLAG
MÜNCHEN
Die amerikanische Originalausgabe erschien unter dem Titel
»The Hunger« bei Putnam, New York.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Deutsche Erstausgabe 09/2018
Redaktion: Joern Rauser
Copyright © 2018 by Alma Katsu and Glasstown Entertainment, LLC
Copyright © 2018 der deutschsprachigen Ausgabe und der Übersetzung by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkterstraße 28, 81673 München
Karte: Meighan Cavanaugh
Umschlaggestaltung: DAS ILLUSTRAT, München, unter Verwendung eines Motivs von Slava Gerj/Shutterstock
Satz: Leingärtner, Nabburg
e-ISBN: 978-3-641-22627-5V001
www.heyne.de
Für meinen Mann, Bruce
Prolog
April 1847
Es war ein harter Winter gewesen, das sagten alle, einer der schlimmsten überhaupt. So schlimm, dass manche Indianerstämme, Paiute und Miwok, aus den Bergen heruntergekommen waren. Es gab kein Wild zum Jagen, ihren Bewegungen wohnte ein ruheloser Hunger inne, die Lagerplätze, die sie zurückließen, waren kahl, voller schwarzer, geruchloser Feuerstellen, die wie dunkle Augen in den Himmel schauten.
Zwei Paiute behaupteten sogar, sie hätten einen verrückten Weißen gesehen, der diesen entsetzlichen Winter irgendwie überstanden hatte. Wie ein Geist sei er über den zugefrorenen See geschwebt.
Das musste er sein: Lewis Keseberg. Der letzte Überlebende der Donner-Party-Tragödie. Der Bergungstrupp war ausgesandt worden, um ihn zu finden und, wenn irgend möglich, lebend zurückzubringen.
Mitte April war es, und der Schnee reichte den Pferden bis zur Brust. Sie hatten sie bei einer Ranch zurückgelassen, den Rest der Strecke mussten sie zu Fuß bewältigen.
Vom Gipfel waren es noch drei Tage bis zum See – kalt und ausgesetzt und trostlos. Frühling bedeutete Matsch, eine ganze Menge davon, aber hier oben herrschte immer noch Winter, der Boden lag unter einer dicken Schicht Weiß verborgen. Es war tückisch, dieses Weiß: Darunter versteckten sich Spalten und steile Abrisskanten. Der Schnee hatte Geheimnisse. Man glaubte, man befände sich auf festem Grund, doch es war nur eine Frage der Zeit, bis er einem unter den Füßen wegbröckelte.
Der Abstieg war viel schwieriger als erwartet, der Schnee gab nach, nass und rutschig, beseelt von einem übergroßen Verlangen, die ganze Gruppe einfach zu verschlingen.
Je näher sie dem See kamen, desto dunkler wurde es. Die Bäume waren so hoch, dass sie die Berggipfel genauso verdeckten wie die Sonne. Aufgrund der Schäden an den Bäumen konnte man sehen, wie unfassbar viel es geschneit hatte: abgebrochene Äste und abgekratzte Rinde bis in eine Höhe von vier und noch mehr Metern. Und es war gespenstisch still. Nicht ein einziges Geräusch, kein Zwitschern, kein Plätschern, wenn eine Gans auf dem Wasser landete. Nur das Stampfen ihrer Füße und der angestrengte Atem, ab und zu das Knistern von schmelzendem Schnee.
Das Erste, was auffiel, als ihnen der Nebel über dem See entgegenstieg, war der Geruch: Der ganze Ort roch nach Aas. Der durchdringende Gestank verrottenden Fleisches vermischte sich mit dem harzigen Duft der Kiefern und machte die Luft schwer. Der Geruch von Blut, dieser Geschmack von Eisen schien von überall herzukommen, aus dem Boden, aus dem Wasser und vom Himmel.
Ihnen war gesagt worden, die Überlebenden hausten in einer großen verlassenen Hütte und zwei kleineren mit Schrägdach, von denen eine an einen großen Felsen gebaut war. Sie folgten dem Ufer des Sees, dessen Wasser sich unter dem Nebel träge kräuselte, und hatten die Hütte bald gefunden. Sie stand mutterseelenallein auf einer kleinen Lichtung, eindeutig verlassen. Trotzdem wurden sie das Gefühl nicht los, dass sie nicht allein waren. Dass drinnen jemand auf sie wartete, ein Geschöpf wie aus einem Schauermärchen.
Das mulmige Gefühl schien sich durch die gesamte Gruppe zu fressen, der unnatürliche Geruch in der Luft machte alle nervös. Ganz langsam gingen sie auf die Hütte zu, die Gewehre im Anschlag.
Mehrere Dinge lagen im Schnee: ein kleines Gebetbuch, das Lesebändchen flatterte in der Brise.
Zähne.
Etwas, das aussah wie der Wirbelknochen eines Menschen, blank genagt.
Das mulmige Gefühl war nun ganz deutlich spürbar und drückte von innen gegen den Schädel. Einige weigerten sich, auch nur einen einzigen Schritt weiterzugehen. Die Eingangstür befand sich jetzt direkt vor ihnen, neben dem Rahmen lehnte eine Axt.
Die Tür schwang von allein auf.
Erster Teil
1
Für Charles Stanton gab es nichts Besseres als eine ordentliche, glatte Rasur.
Er stand vor dem Spiegel, den er an die Seite von James Reeds Wagen gehängt hatte. In jeder Richtung erstreckte sich die Prärie wie eine endlose Decke, in der gelegentlich der Wind spielte: Meile um Meile unberührten Büffelgrases, nur unterbrochen von der roten Spitze des Chimney Rock, der wie ein Wachposten in der Ferne aufragte. Wenn Stanton die Augen zusammenkniff, wirkten die Wagen wie Kinderspielzeug, das im endlosen Gras verstreut lag – klein, unwichtig und bedeutungslos.
Er wandte sich dem Spiegel zu und setzte die Klinge an. Eine Lieblingsredensart seines Großvaters fiel ihm ein: Ein schlechter Mann versteckt sich hinter einem Bart wie Luzifer. Stanton kannte Männer, die sich mit einem scharfen Jagdmesser zufriedengaben, manche benutzten sogar eine Axt, aber für ihn musste es ein gerades Rasiermesser sein. Die Kälte des Stahls an seinem Hals schreckte ihn nicht. Er mochte sie sogar.
»Eigentlich hätte ich Sie nicht für eitel gehalten, Charles Stanton«, kam eine Stimme von hinten, »aber wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, dass Sie sich gerade im Spiegel bewundern.« Edwin Bryant kam mit einer Blechtasse voll Kaffee heran. Sein Lächeln verblasste. »Sie bluten.«
Stantons Blick wanderte zu dem Rasiermesser. Die Klinge war rot. Im Spiegel sah er einen blutigen Strich auf seinem Hals, fünf Zentimeter lang und klaffend, genau an der Stelle, wo die Klinge gewesen war. Sie war so scharf, dass er nicht das Geringste gespürt hatte. Er riss das Handtuch von seiner Schulter und presste es auf die Wunde. »Ich muss abgerutscht sein.«
»Setzen Sie sich«, erwiderte Bryant. »Lassen Sie mich mal sehen. Mit Medizin kenne ich mich ein bisschen aus, wie Sie wissen.«
Stanton wich zurück. »Mir fehlt nichts. Ein kleines Missgeschick, nichts weiter.« Genau das war, zusammengefasst, diese ganze verfluchte Reise: ein »Missgeschick« nach dem anderen.
Bryant zuckte die Achseln. »Wenn Sie meinen. Wölfe wittern das Blut aus zwei Meilen Entfernung.«
»Wie kann ich Ihnen helfen?«, fragte Stanton. Er wusste, Bryant war nicht den ganzen Weg von der Spitze des Trosses herübergekommen, bloß um zu reden. Nicht, wenn sie sich eigentlich fertig machen sollten. Um sie herum tobte das übliche allmorgendliche Chaos: Die Fahrer trieben die Ochsen zusammen, und der Boden erzitterte unter dem Gewicht der Tiere. Männer bauten ihre Zelte ab und luden sie auf die Wagen, oder sie löschten das Lagerfeuer mit Sand. Die Luft war vom Geschrei der Kinder erfüllt, die das Wasch- und Trinkwasser in Eimern herbeiholten.
Stanton kannte Bryant noch nicht lange, aber die beiden hatten sich schnell angefreundet. Die Gruppe, mit der Stanton zuvor gereist war – ein kleiner Wagentreck aus Illinois, hauptsächlich aus den Familien Donner und Reed bestehend –, hatte sich vor Kurzem in der Nähe von Independence mit einem größeren Treck vereinigt, der von dem pensionierten Offizier William Russell angeführt wurde. Edwin Bryant war einer der Ersten aus der Russell-Gruppe gewesen, die sich vorstellten, und er schien Stantons Gesellschaft zu suchen; vielleicht weil sie beide allein reisten – inmitten all der Familien.
Äußerlich gesehen, war Bryant Stantons genaues Gegenteil. Stanton war groß, eine imposante Erscheinung, ohne es darauf anzulegen. Sein ganzes Leben lang schon bekam er Komplimente wegen seines Aussehens, das er wohl von seiner Mutter geerbt hatte. Er hatte das gleiche wellige, dunkelbraune Haar und die gleichen gefühlvollen Augen.
Dein Aussehen ist ein Geschenk des Teufels, Junge. Du verleitest andere zur Sünde. Das war noch so ein Ausspruch seines Großvaters gewesen. Einmal hatte er Stanton mit der Gürtelschnalle mitten ins Gesicht geschlagen, vielleicht um den Teufel auszutreiben, den er darin sah. Es war vergeblich. Stanton behielt alle seine Zähne, die Nase heilte wieder, und die Narbe auf seiner Stirn war inzwischen verschwunden. Der Teufel war, soweit Stanton wusste, immer noch in ihm.
Edwin Bryant mochte zehn Jahre älter sein als er. Die Jahre als Zeitungsjournalist hatten ihn weicher gemacht, als die meisten anderen Männer im Treck es waren – Farmer, Tischler und Schmiede, Männer, die ihren Lebensunterhalt mit harter körperlicher Arbeit verdienten. Er hatte schlechte Augen und trug fast ständig eine Brille. Sein Haar war immer zerzaust, als wären seine Gedanken regelmäßig woanders. Trotzdem war er ohne Zweifel klug, wahrscheinlich sogar der Klügste von allen hier. Ein paar Jahre hatte er bei einem Arzt gelernt, damals, als er noch jung war, wollte sich aber nicht in die Rolle des Lagerarztes pressen lassen.
»Sehen Sie sich das an.« Bryant trat nach einem Büschel Grau, eine kleine Staubwolke flog auf. »Ist es Ihnen auch aufgefallen? Das Gras ist ungewöhnlich trocken für diese Jahreszeit.«
Sie waren seit Tagen in dieser Ebene unterwegs, der Horizont bildete eine lange flache Linie aus hohem Präriegras und Gestrüpp. In der Ferne erhoben sich goldbraune und rot-gelbe Hügel, manche wie knorrige Finger direkt gen Himmel gereckt. Stanton ging in die Hocke und riss ein paar Halme aus. Sie waren kurz, keinen Fuß lang, und schon zu einem stumpfen Grünbraun verblasst. »Sieht so aus, als hätte es hier vor nicht allzu langer Zeit eine Dürre gegeben«, erwiderte er. Stanton stand auf, klopfte sich den Staub von den Händen und blickte hinaus in den violetten Dunst am Horizont. Das Land vor ihnen schien endlos.
»Dabei haben wir die Ebenen gerade erst betreten«, merkte Bryant an.
Es war klar, worauf er hinauswollte: Möglicherweise gab es unterwegs nicht genug Gras für die Ochsen und das restliche Schlachtvieh. Gras, Wasser, Holz: die drei Dinge, auf die jeder Treck dringend angewiesen war. »Die Bedingungen sind schlechter, als wir gedacht hatten, und wir haben noch einen langen Weg vor uns. Sehen Sie den Höhenzug dort in der Ferne? Das ist erst der Anfang, Charles. Dahinter kommen richtige Berge – Wüste, Prärie und Flüsse, breiter und tiefer als alles, was wir bisher durchqueren mussten. Bis zum Pazifik haben wir noch einiges vor uns.«
Stanton kannte die Litanei. Seit sie vor zwei Tagen an der Trapperhütte bei Ash Hollow vorbeigekommen waren, redete Bryant von kaum etwas anderem. Die verlassene Hütte diente inzwischen als eine Art Vorposten. Viele, die in die dahinterliegenden Ebenen weiterfuhren, ließen dort Briefe zurück in der Hoffnung, dass der Nächste, der von Ash Hollow nach Osten unterwegs war, sie zu einem Postamt mitnahm. Die meisten dieser Briefe waren nicht mehr als ein gefaltetes Stück Papier, mit einem Stein beschwert.
Beim Anblick der Briefe hatte Stanton einen eigenartigen Trost verspürt. Sie waren wie ein Beweis für die Freiheitsliebe der Menschen, für ihren Wunsch, ihre Lebenssituation zu verbessern, gleichgültig wie hoch das Risiko sein mochte. Bryant hingegen erschien inzwischen ganz aufgeregt. Sehen Sie sich doch all diese Briefe an. Das müssen Dutzende sein, vielleicht sogar mehr als hundert. Die Siedler, die sie geschrieben haben, sind alle vor uns auf dem Trail. Wir gehören zu den Letzten, die sich dieses Jahr auf den Weg machen, und Sie wissen, was das bedeutet, nicht wahr?, hatte er Stanton gefragt. Wir sind vielleicht zu spät dran. Wenn der Winter kommt, macht der Schnee die Gebirgspässe unpassierbar, und in diesen Höhen kommt der Winter früh.
»Geduld, Edwin«, erwiderte Stanton. »Wir sind doch gerade erst von Independence aufgebro…«
»Und trotzdem haben wir schon Mitte Juni. Wir kommen zu langsam voran.«
Stanton legte das Handtuch zurück auf seine Schulter und sah sich um: Die Sonne war schon vor Stunden aufgegangen, und trotzdem war das Lager noch immer nicht abgebrochen. Überall saßen die Familien noch um die herunterbrennenden Kochfeuer und beendeten ihr Frühstück. Mütter mit Babys auf den Armen tauschten den jüngsten Klatsch aus. Ein Junge spielte mit seinem Hund, statt die Ochsen vom Grasen zu holen.
»Wer könnte ihnen an einem so schönen Morgen das Trödeln schon verübeln?«, sagte er leichthin. Nach vielen Wochen auf dem Trail hatte es niemand eilig, den nächsten Tag zu beginnen. Die Hälfte der Männer hatte es ohnehin nur dann eilig, wenn es darum ging, das nächste Fass Bier oder Schnaps aufzumachen. »Wenn, dann müssen Sie mit Russell sprechen.«
Bryant runzelte die Stirn und stellte seine Kaffeetasse ab. »Ich habe schon mit ihm gesprochen. Er ist der gleichen Meinung, trotzdem unternimmt er nichts. Kann niemandem was abschlagen. Anfang der Woche – Sie erinnern sich – hat er den Männern eine Büffeljagd erlaubt. Danach haben wir zwei Tage Pause gemacht, um das Fleisch zu räuchern und zu trocknen.«
»Vielleicht werden wir später noch dankbar sein für das Fleisch.«
»Ich garantiere Ihnen, dass wir unterwegs noch mehr Büffeln begegnen werden. Aber die verlorenen Tage holen wir nicht mehr auf.«
Stanton sah ein, dass Bryant recht hatte. Er wollte nicht mit ihm streiten. »Gut. Heute Abend gehe ich mit Ihnen zu Russell, und wir sprechen gemeinsam mit ihm. Wir zeigen ihm, dass wir es ernst meinen.«
Bryant schüttelte den Kopf. »Ich habe das Warten satt. Ich bin hier, weil ich Ihnen sagen möchte, dass ich den Treck verlassen werde. Ich und ein paar andere, wir reiten mit unseren Pferden voraus. Die Wagen sind zu langsam. Die Familienväter … ich verstehe ja, dass sie ihre Wagen brauchen. Sie haben kleine Kinder, Alte und Kranke dabei. Sie müssen auf ihr Hab und Gut aufpassen. Ich nehme es ihnen nicht übel, aber ich lasse mich auch nicht zu ihrer Geisel machen.«
Stanton dachte an seinen eigenen Wagen und die beiden Ochsen. Die Ausstattung hatte ihn beinahe das gesamte Geld gekostet, das er mit dem Verkauf seines Ladens verdient hatte. »Ich verstehe.«
Bryants Augen blitzten hinter den Brillengläsern. »Der Reiter, der sich uns gestern Abend angeschlossen hat, sagte, dass sich die Washoe immer noch südlich ihres gewöhnlichen Weidelandes aufhalten, etwa zwei Wochen westlich von hier. Ich darf sie nicht verpassen.« Bryant hielt sich für eine Art Menschenkundler. Angeblich schrieb er ein Buch über den Glauben und die Geisterwelt verschiedener Indianerstämme. Er konnte stundenlang von ihren Legenden erzählen – von sprechenden Tieren, verschlagenen Göttern, Geistern, die in der Erde, dem Wind und dem Wasser lebten. Dabei wurde er oft so leidenschaftlich, dass er manchen Siedlern bereits verdächtig vorkam. Stanton mochte Bryants Geschichten, gleichzeitig wusste er, wie erschreckend sie in den Ohren eines Christen klingen mussten, der nur die Bibel kannte und sonst nichts; für Menschen, die einfach nicht nachvollziehen konnten, was einen Weißen an der Religion der Eingeborenen faszinierte.
»Ich weiß, diese Menschen hier sind Ihre Freunde, aber«, fuhr Bryant fort – wenn er einmal in Fahrt war, konnte er nur schwer von einem Thema ablassen – »wie um Himmels willen kommen die Leute denn auf die Idee, sie könnten ihren gesamten Hausstand mit nach Kalifornien nehmen?«
Stanton konnte sich ein Lächeln nicht verkneifen. Er wusste, was Bryant meinte: George Donners riesenhafte Sonderanfertigung von einem Planwagen. Als er noch in Bau war, war er das Stadtgespräch von Springfield gewesen, und jetzt war er das Gespräch der Siedler. Der Wagen war ein ganzes Stück höher als die anderen, drinnen war Platz für eine Sitzbank und sogar für einen kleinen Ofen, dessen Kamin durch das Stoffdach ragte.
Bryant nickte in Richtung von Donners Wagen. »Ich meine, wie wollen sie denn bloß mit diesem Ding über die Berge kommen? Das ist ein Behemoth. Nicht einmal vier Ochsen können diesen Koloss die Steigungen dort hinaufziehen. Und wozu das Ganze? Damit Königin Saba es schön bequem hat.« In der kurzen Zeit, seitdem die beiden Gruppen sich vereinigt hatten, hatte Bryant eine herzliche Abneigung gegen Tamsen Donner entwickelt, so viel war klar. »Haben Sie einmal das Innere gesehen? Da sieht es wie in Kleopatras Vergnügungsbarke aus, mit Federbetten, Seidenkissen und … einfach allem.«
Stanton grinste innerlich. Die Donners schliefen nicht in ihrem Wagen, denn der war bis oben hin voll mit Haushaltsgütern – und dazu gehörte nun mal Bettzeug, wie bei allen anderen auch. Bryant hatte einen Hang zur Übertreibung.
»Ich hatte George Donner für einen klugen Mann gehalten. Anscheinend habe ich mich getäuscht.«
»Wollen Sie ihm verübeln, dass er seine Frau glücklich machen möchte?«, fragte Stanton. Er hätte George Donner gerne seinen Freund genannt, aber das war unmöglich. Donner kannte die falschen Leute.
Was alles noch schlimmer machte, war, dass er kaum den Blick von Donners Frau losreißen konnte. Tamsen Donner war gute zwanzig Jahre jünger als ihr Mann und betörend schön, wahrscheinlich sogar die schönste Frau, die Stanton je gesehen hatte. Sie war wie eine dieser Porzellanpuppen in den Schaufenstern der Damenschneider, an denen man die neueste Mode aus Frankreich in Miniaturversion bewundern konnte. Eine gewisse Gerissenheit lag in ihrem Blick, die Stanton magisch anzog, und ihre Taille war so schmal, dass ein Mann sie mit zwei Händen umspannen konnte. Mehrere Male hatte er sich dabei ertappt, wie er sich vorstellte, wie diese Taille sich in seinen Händen anfühlen würde. Wie es George Donner gelungen war, eine solche Frau zu erobern, war Stanton ein Rätsel. Sein Geld dürfte eine Rolle gespielt haben, vermutete er.
»Wie gesagt, ich breche morgen mit den anderen auf«, sagte Bryant nun etwas leiser. »Möchten Sie sich uns anschließen? Sie sind ungebunden, haben keine Familie, für die Sie sorgen müssen. Würden Sie mitkommen, wären Sie … viel schneller dort, wo immer Sie hinmöchten.«
Bryant klopfte ihn also wieder einmal ab in dem Versuch herauszufinden, warum Stanton den langen Weg nach Westen auf sich nahm. Die meisten sprachen nur zu gerne über ihre Gründe. Bryant wusste, dass Stanton in Springfield eine Kurzwarenhandlung und ein Haus gehabt hatte, aber Stanton hatte ihm nicht verraten – genauso wenig wie allen anderen –, warum er all das eigentlich zurückließ. Sein Partner, derjenige mit dem Geschäftssinn, war überraschend gestorben, sodass Stanton sich allein um alles hatte kümmern müssen. Er hatte zwar den nötigen Grips dazu, aber nicht die Nerven: sich ständig um die Kunden kümmern, das ständige Feilschen um die Preise. Versuchen, seine Regale mit Dingen zu füllen, die Menschen, die Stanton kaum kannte und noch viel weniger verstand, gefallen könnten. Exotische Duftwasser vielleicht, oder lieber bunte Seidentücher? Es war eine einsame Zeit gewesen und sicher mit ein Grund, warum er Springfield den Rücken gekehrt hatte.
Aber nicht der einzige.
Er beschloss, die versteckte Frage einfach zu ignorieren. »Und was mache ich mit meinem Wagen und den Ochsen? Ich kann sie doch schlecht hier stehen lassen.«
»Müssen Sie auch nicht. Ich bin sicher, jemand würde sie Ihnen abkaufen. Oder Sie bezahlen einen der Fahrer, damit er dafür sorgt, dass Ihr Wagen es sicher bis nach Kalifornien schafft.«
»Ich weiß nicht.« Im Gegensatz zu Bryant machte es Stanton nichts aus, gemeinsam mit all den Familien zu reisen. Er hatte nichts gegen das Geschrei der Kinder oder gegen das helle Geschnatter der Frauen. Aber da gab es noch etwas anderes. »Geben Sie mir ein wenig Zeit, darüber nachzudenken.«
Eine Staubwolke kündigte einen Reiter an, er hielt im Galopp auf sie zu. George Donner. Zu seinen Aufgaben gehörte es, in der Früh dafür zu sorgen, dass sie loskamen. Normalerweise verrichtete er diese Aufgabe gut gelaunt, forderte die Leute mit einem Lachen auf, das Lager abzubrechen und die Ochsen einzuspannen, aber diesmal war seine Miene düster.
Stanton grüßte ihn kurz. Es konnte also endlich losgehen. »Ich wollte gerade …«, begann er, aber Donner schnitt ihm das Wort ab.
»Wir brechen noch nicht sofort auf«, sagte er finster. »Weiter vorn gab es ein Missgeschick.«
Stanton spürte eine böse Ahnung in sich aufsteigen, doch er schluckte sie hinunter.
Bryant blickte auf. »Soll ich meinen Arztkoffer holen?«
Donner rutschte im Sattel hin und her. »Nicht diese Art von Missgeschick. Ein Junge wird vermisst. Er war nicht im Zelt, als seine Eltern ihn wecken wollten.«
Stanton war sogleich erleichtert. »Kinder entfernen sich eben manchmal ein Stück vom Tross …«
»Wenn wir unterwegs sind, ja, aber nicht nachts. Seine Eltern werden hierbleiben und nach ihm suchen. Ein paar andere bleiben ebenfalls und helfen ihnen.«
»Brauchen Sie noch mehr Freiwillige?«
Donner schüttelte den Kopf. »Wir haben schon mehr als genug. Sobald sie ihre Wagen vom Trail gezogen haben, fährt der Rest los. Haltet die Augen nach dem Jungen offen. So Gott will, taucht er bald wieder auf.«
Donner ritt wieder davon, unter den Hufschlägen seines Pferdes spritzte trockene Erde auf. Wenn sich der Junge tatsächlich nachts vom Lager entfernt haben sollte, war es unwahrscheinlich, dass seine Eltern ihn jemals wiedersahen. In dieser Weite, in dieser unerbittlichen Leere, die sich in alle Richtungen erstreckte, konnte ein Kind einfach verschluckt werden – von diesem unendlichen Horizont, dem selbst die Sonne nicht zu entrinnen vermochte.
Stanton zögerte. Vielleicht sollte er sich der Suche anschließen. Zwei Augen mehr konnten nicht schaden. Er legte sich eine Hand auf den Hals und überlegte, sein Pferd zu satteln. Als er die Hand wegzog, war sie rot. Er blutete wieder.
2
Die Karawane erstreckte sich vor Tamsen Donner über die Ebene soweit ihr Auge reichte. Wer auch immer sich das Wort »Prärieschoner« hatte einfallen lassen, war ein Genie, denn die Dächer aus Baumwolltuch, strahlend weiß unter der morgendlichen Sonne, sahen exakt wie Segel aus. Die von den Wagenrädern aufgewirbelten Staubwolken konnte man beinahe für Wellenkämme halten, auf denen Schiffe durch ein endloses Wüstenmeer fuhren.
Die meisten Siedler ritten abseits des Trails auf ihren Pferden, um den Ochsen das zusätzliche Gewicht zu ersparen und sich selbst den Staub. Das Nutzvieh, Rinder, Ziegen und Schafe, trotteten ebenfalls nebenher durch das hohe Gras. Kinder trieben sie mit ihren Ruten an, und der Familienhund gab Acht, dass kein Nachzügler verloren ging.
Tamsen ging lieber zu Fuß, als zu reiten. So konnte sie besser nach Kräutern und Pflanzen Ausschau halten, die sie für ihre Arzneien brauchte: Schafgarbe gegen Fieber, Weidenrinde gegen Kopfschmerz. Sie führte Buch über alle Pflanzen, die sie fand. Auch von denen, die sie nicht kannte, nahm sie ein paar mit, um sie zu untersuchen und damit zu experimentieren.
Außerdem hatten die Männer so mehr Gelegenheit, ihre Figur zu bewundern. Wozu sein Aussehen verschwenden, wenn man so aussah wie sie?
Aber es gab noch einen Grund: Wenn Tamsen den ganzen Tag im Wagen eingesperrt war, regte sich wieder diese nagende, ruhelose Unzufriedenheit in ihr. Wie ein gefangenes Tier, genau wie zu Hause. Hier draußen konnte das Tier – dieses Unglücksgefühl – frei umherstreifen, während Tamsen Platz zum Atmen und Nachdenken hatte.
An diesem Morgen sollte sie ihre Entscheidung allerdings schon bald bereuen – Betsy Donner, die Frau von Georges jüngerem Bruder, Jacob, kam in ihre Richtung geeilt. Sie hatte nicht direkt eine Abneigung gegen Betsy, sie mochte sie nur einfach nicht. Betsy war so schlicht wie eine Vierzehnjährige und kein bisschen wie die Frauen, die Tamsen vor ihrer Hochzeit mit George in Carolina gekannt hatte: die anderen Lehrerinnen, vor allem Isabel Topp – und Isabels Hausmädchen Hattie, die Tamsen all die Heilkräuter gezeigt hatte – oder auch die Frau des Pfarrers, die Latein beherrschte. Tamsen vermisste sie alle.
Das war das größte Problem. Sie waren jetzt seit eineinhalb Monaten unterwegs, doch Tamsen war immer noch unruhig. Sie hatte sich vorgestellt, sich umso freier zu fühlen, je weiter sie nach Westen kamen. Mit diesem Gefühl des Gefangenseins hatte sie nicht gerechnet. Während der ersten Wochen hatte es immer Ablenkung gegeben: das vollkommen neue Leben in einem Planwagen und die Nächte unter dem Sternenhimmel – und dann, die Kinder Tag für Tag auf dem endlosen Trail beschäftigen und neue Spiele erfinden und aus den Spielen Unterrichtsstunden machen zu müssen. Es hatte wie ein Abenteuer begonnen, doch jetzt konnte Tamsen nur noch daran denken, wie langweilig das alles war und wie viel die Familie verloren hatte.
Wie viel Tamsen verloren hatte.
Wie das dunkle, nagende Verlangen in ihr mit jeder Meile stärker wurde statt schwächer.
Sie war von Anfang an dagegen gewesen, nach Westen zu gehen, doch George hatte ihr klargemacht, dass er allein über die wirtschaftliche Zukunft der Familie zu entscheiden hatte. Als Besitzer eines großen Landwirtschaftsbetriebes, Hunderten von Morgen Ackerfläche und einer Rinderherde war er an sie herangetreten. Ich bin zum Erfolg geboren. Überlass mir die Geschäfte, dann wirst du nie Mangel leiden, hatte er ihr versprochen. Seine Zuversicht hatte etwas Gewinnendes gehabt. Seit ihr erster Mann an den Pocken gestorben war, war Tamsen allein gewesen. Sie hatte das ständige Kämpfen sattgehabt und geglaubt, sie würde schon noch lernen, George zu lieben.
Sie musste. Es war die einzige Möglichkeit, die Verkehrtheit in ihrem Herzen auszulöschen, diese Gebrochenheit.
Und außerdem: Was auch immer geschah, sie wusste, auf Jory war Verlass. Ihr Bruder hatte George für den Richtigen gehalten, und Tamsen war geneigt gewesen, ihm zu glauben. Hatte sich dazu gezwungen.
Dann kam George mit der Idee, nach Kalifornien zu gehen. Dort liegt das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, sagte er, nachdem er Bücher von Siedlern gelesen hatte, die die Reise gewagt hatten. Wir werden reich sein, reicher als in unseren kühnsten Träumen. Wir könnten Tausende Morgen Land kaufen, viel mehr als hier in Illinois. Wir werden unser eigenes Imperium aufbauen und es an unsere Kinder vererben. Seinen Bruder Jacob überzeugte er, ebenfalls mitzukommen und ein großes Stück Land zu erwerben. Als Tamsen ihn nach den Gerüchten fragte, die sie gehört hatte – lebten in Kalifornien nicht schon die Mexikaner? Wie freiwillig würden die ihr Land wohl hergeben? Und was war mit dem Gerede von einem baldigen Krieg mit Mexiko, wie es einen in Texas gegeben hatte? –, da winkte George nur ab. Die Leute übersiedeln scharenweise nach Kalifornien, entgegnete er. Das würde die Regierung gar nicht zulassen, wenn es dort nicht sicher wäre. Er zog sogar sein Lieblingsbuch hervor, Der Auswandererführer für Oregon und Kalifornien, geschrieben von Lansford Warren Hastings, einem Rechtsanwalt, der die Reise bereits gemacht hatte. Tamsen hätte noch viele weitere Fragen gehabt, gleichzeitig wollte sie genauso hoffen wie George … hoffen, dass vielleicht tatsächlich alles besser würde in Kalifornien.
Und nun war sie gefangen auf diesem endlosen Trail, umgeben von den Menschen, mit denen sie am wenigsten anfangen konnte: der Verwandtschaft ihres Mannes.
»Guten Morgen, Betsy«, begrüßte sie ihre Schwägerin mit einem gezwungenen Lächeln. Als Frau musste man immer lächeln; Tamsen beherrschte es so gut, dass sie manchmal selbst darüber erschrak.
»Guten Morgen, Tamsen.« Betsy war eine kräftige Frau mit breiten Schultern und Hüften und Speck um die Taille, gegen den jedes Korsett machtlos war. »Hast du schon gehört? Weiter vorne wird ein Junge vermisst.«
Tamsen war nicht überrascht von dieser Nachricht. Schon die ganze Zeit widerfuhr dem Tross ein Unglück nach dem anderen. Vorzeichen, wenn man sie nur zu deuten wusste. Erst letzte Woche hatte Tamsen ein Fass mit Mehl aufgemacht. Es war von Rüsselkäfern befallen gewesen, sie hatte es wegwerfen müssen. Ein teurer Verlust. In der Nacht darauf hatte Philippine Keseberg, die junge Frau eines der weniger appetitlichen Männer im Tross, eine Totgeburt gehabt. Tamsen dachte mit einem Schaudern an Mrs. Kesebergs Klageschreie, die einfach nicht verhallen wollten, als hielte die Prärie sie fest.
Dann waren da noch die Wölfe, die ihnen folgten. Eine Familie hatte ihr gesamtes Trockenfleisch an sie verloren, sogar ein quiekendes neugeborenes Kalb hatten sie sich geholt.
Und jetzt wurde ein Junge vermisst.
»Die Wölfe«, antwortete Tamsen. Eigentlich hatte sie die beiden Vorfälle nicht miteinander in Verbindung setzen wollen, aber sie konnte nicht anders.
Betsy schlug sich eine Hand vor den Mund – eine ihrer vielen affektierten Angewohnheiten. »Aber es haben doch noch andere Kinder in dem Zelt geschlafen«, entgegnete sie. »Wären sie nicht wach geworden?«
»Wer weiß?«
Betsy schüttelte den Kopf. »Natürlich können es auch Indianer gewesen sein. Ich habe von Stämmen gehört, die weiße Siedlungen überfallen und die Kinder entführen …«
»Um Himmels willen, Betsy, hast du auf den letzten zwanzig Meilen auch nur einen einzigen Indianer gesehen?«
»Aber was ist dann mit diesem Jungen passiert?«
Tamsen schüttelte nun ebenfalls den Kopf. Kindern – und Frauen – widerfuhren ständig schreckliche Dinge: in ihrem Zuhause, durch Menschen, die sie kannten, denen sie vertrauten. Und als ob das nicht schon schlimm genug wäre, waren sie hier von Hunderten vollkommen Fremden umgeben. Die Chancen, dass mindestens einer davon sich schrecklicher Sünden schuldig gemacht hatte, standen gut.
Tamsen hatte nicht vor, einer Tragödie zum Opfer zu fallen. Nicht, wenn sie etwas dagegen tun konnte. Sie hatte – wenn auch begrenzte – Mittel und Wege: Zauber, Talismane, einige Methoden, das Böse von der eigenen Türschwelle fernzuhalten.
Nur leider taugten diese Methoden nicht, das Böse in einem selbst auszutreiben.
Ein Mann, in dem Tamsen Charles Stanton erkannte, trieb mit einem Stock die Rinder zusammen. Er war jünger als George und sah aus wie jemand, der sein bisheriges Leben mit harter Feldarbeit verbracht hatte, nicht irgendwo in einem Laden. Stanton blickte auf, sah, wie Tamsen ihn anstarrte, und sie schaute eilig weg.
»Die Wahrheit ist oft viel schlimmer, als wir uns das vorstellen können«, erwiderte sie und genoss Betsys entsetzten Gesichtsausdruck.
»Wo sind deine Töchter überhaupt? Ich sehe nur drei«, fragte Betsy. Ihre Stimme klang plötzlich ganz aufgeregt.
Normalerweise ließ Tamsen ihre Töchter während der ersten Tageshälfte zu Fuß gehen. Sie hoffte, dass sie auf diese Weise schlank und gesund blieben. Im Mädchenalter konnte ihre Schönheit ihnen zwar gefährlich werden, aber sie war eine der wenigen Waffen, die einer Frau im Erwachsenenalter blieben. Tamsen wollte, dass ihre Töchter ihre Schönheit behielten, falls möglich. Die älteren, Elitha und Leanne, die aus Georges zweiter Ehe stammten, passten auf die jüngeren auf: Frances, Georgia und Eliza. Heute gingen nur Elitha und Leanne zu Fuß, während Frances wie ein verspieltes Fohlen um sie herumsprang, voller Energie und Freude darüber, ihre ungeteilte Aufmerksamkeit zu haben. Betsys sieben Söhne und Töchter waren ein Stück weiter vorn. Mit hängenden Köpfen schleppten sie sich wie hirnlose Ochsen dahin.
»Kein Grund zur Sorge. Georgia und Eliza sind im Wagen«, antwortete Tamsen. »Sie hatten heute früh Fieber. Ich hielt es für besser, wenn sie sich ausruhen.«
»O ja, ganz recht. Die Kleinen ermüden ja so leicht.«
Manchmal konnte Tamsen selbst kaum glauben, dass sie Mutter war. Dass sie schon lange genug mit George verheiratet war, um drei Kinder mit ihm in die Welt gesetzt zu haben, schien ihr unmöglich. Sie waren hübsch, ein Ebenbild ihrer selbst als Kind – Gott sei Dank. Elitha und Leanne hingegen kamen ganz nach ihrem Vater: grobschlächtiger Körperbau und längliche Gesichter. Wie bei einem Pferd.
Aber sie bereute es nicht. Mutter zu sein gehörte wahrscheinlich zu den wenigen Dingen, die Tamsen nicht bereute. Sie war stolz auf ihre Töchter, hatte ihnen als Babys Honig auf die Zunge getan, damit sie süß wurden; hatte ihnen geflochtene Balsamtannenzweige in die Bettdecken gesteckt, damit sie stark wurden. So hatte die indianische Dienerin es ihr beigebracht, als Tamsen selbst noch Kind gewesen war.
Sie würden immer wählen können, würden nie unter das Joch der Ehe kommen, wie es Tamsen nicht nur einmal passiert war, sondern zweimal.
Doch Tamsen hatte ihre Methoden, auf ihre Kosten zu kommen, wie mancher sagen würde.
Stanton fing ihren Blick ein zweites Mal auf. Betsy war zu ihren Kindern gegangen, und diesmal schaute Tamsen erst weg, als er es tat.
Sie streckte die Arme nach den Wildblumen und ließ ihre Finger über die Blüten gleiten. Einen Augenblick lang dachte sie an den Gelben Sonnenhut, der auf den weiten Weizenfeldern ihres Bruders Jory gedieh, unbezähmbar in seinem Überfluss. Sie wusste, ihr Zuhause lag vor ihr, nicht hinter ihr. Eigentlich sollte sie jede Erinnerung an Jorys Farm aus ihren Gedanken verbannen, so wie alle Gedanken an ihr altes Leben. Aber sie konnte es einfach noch nicht.
Die Blüten wogten und schaukelten unter ihrer Hand so zart, dass es beinah kitzelte.
3
Mary Graves kniete sich ins Gras und stellte den Waschzuber ans Flussufer. Der nördliche Platte River floss hier langsam und sanft, vielleicht lag es aber auch daran, dass der Sommer ihn bereits hatte schrumpfen lassen. Das Land ringsum zeigte alle Anzeichen einer bevorstehenden Dürre.
Sich um die Wäsche der Großfamilie zu kümmern war eine von Marys vielen Aufgaben. Sie waren insgesamt zu zwölft – ihre Eltern, fünf Schwestern und drei Brüder, nicht zu vergessen der Mann ihrer älteren Schwester Sarah. Das bedeutete eine Menge schmutziger Kleider und Laken, und Mary erledigte lieber jeden Abend einen kleinen Teil, als zu warten, bis sich die Wäsche türmte. Außerdem war es eine der wenigen Gelegenheiten, wo sie allein sein konnte. Den ganzen Tag über war sie von ihrer Familie umgeben, kümmerte sich um die jüngeren Geschwister, bereitete mit ihrer Mutter die Mahlzeiten zu, saß abends mit ihrer Schwester am Feuer und stopfte zerrissene Kleidung. Von dem Moment an, da sie morgens aufstand, bis sie sich wieder hinlegte, drangsalierten die anderen sie mit ihren Stimmen und Bedürfnissen, Geschichten und Beschwerden. Manchmal kam sich Mary vor, als stünde sie in einem Sturm, der sie mal hierhin, mal dorthin wehte. Selbst hier am Fluss hörte sie noch das raue Gelächter und das Geschrei aus dem Lager.
Oft verschwand sie von dort, um einfach nur dazustehen und dem sanften Rascheln der Gräser in der Brise zu lauschen, doch heute machte ihr die Nähe all der anderen Menschen nicht so viel aus. Das Verschwinden des Jungen hatte alle erschreckt, selbst sie. Armer Willem Nystrom. Seine Familie gehörte zum ursprünglichen Russel-Treck, mit dem sie nur wenig zu tun hatten, deshalb hatte Mary den Jungen auch nur aus der Ferne gesehen. Er war ein süßes Kind gewesen, immer am Spielen und Lachen, sechs Jahre alt und so blond, dass sein Haar beinahe weiß war. Ihre Brüder, Jonathan und Franklin junior, waren in einem ähnlichen Alter. Bei dem Gedanken, einer der beiden könnte einfach verschwinden, setzte Marys Herz jedes Mal einen Schlag lang aus. Es war wie in einer dieser Schauergeschichten, in denen Kinder über Nacht ins Totenreich verschleppt wurden, entführt von zornigen Geistern.
Der Anblick der Lagerfeuer ein Stück entfernt tröstete sie. Die Männer trieben das Vieh zum Grasen und banden die Pferde an, damit sie nicht davonliefen, suchten Achsen und Wagenräder nach Anzeichen von Verschleiß ab, damit am nächsten Tag wieder alles bereit war. Kinder kamen zurück ins Lager, die Arme voller Zweige, Äste und Kleinholz für das Feuer. Als Mary zum Fluss ging, waren ihre kleinen Brüder gerade damit beschäftigt gewesen, ein Feld für eine Partie Fuchs und Gänse in den kahlen Boden zu ritzen. Kurz gesagt: Alle versuchten, die tägliche Routine aufrechtzuerhalten.
Sie hatte gerade begonnen, das erste Wäschestück zu schrubben – Williams Hemd, das ganz steif war vom Schweiß –, da sah sie Harriet Pike und Elitha Donner, ebenfalls mit Waschzubern unterm Arm, in ihre Richtung kommen. Mit einem Gefühl der Erleichterung, das sie selbst überraschte, winkte Mary den beiden zu.
»Guten Abend, Mary«, sagte Harriet steif. Sie waren im gleichen Alter, kannten sich aber kaum. Mary fand, dass Harriet sich weit älter gab, als es für ihre zwanzig Jahre normal gewesen wäre; sie schrieb es der Tatsache zu, dass Harriet schon verheiratet war und Kinder hatte. Sie ausgerechnet mit Elitha Donner zu sehen, die sieben oder acht Jahre jünger war und sich sogar noch jünger benahm, war eigenartig.
»Ihr kommt gerade noch rechtzeitig«, erwiderte Mary möglichst fröhlich. »Es wird schnell dunkel.«
Harriet schaute Elitha lange von der Seite an, während sie die Wäsche sortierte. »Na ja, ich hab’s mir nicht ausgesucht. Ich wollte heute keine Wäsche mehr machen, aber Elitha hat mich angefleht mitzukommen. Sie hatte zu viel Angst, um allein zu gehen.«
Elitha sagte nichts, während sie mit bis zu den Ohren hochgezogenen Schultern in dem seichten Wasser schrubbte. Sie war ein zappeliges, nervöses Mädchen. Wie ein schreckhaftes Pferd.
»Stimmt das, Elitha?«, fragte Mary. »Ist es wegen des verschwundenen Jungen? Dafür musst du dich nicht schämen. Ich glaube, deshalb sind alle ein wenig beunruhigt.«
Die Kleine schüttelte stumm den Kopf, also versuchte Mary es noch einmal. »Liegt es an den Indianern?« Mary selbst konnte es kaum erwarten, endlich welchen zu begegnen. An ihrem ersten Tag im Indianergebiet hatten sie ein paar aus der Ferne gesehen – eine Gruppe berittener Pawnee, die aus der Entfernung beobachtete, wie die Karawane sich durch das Tal schlängelte, aber nicht näher kam.
Die meisten im Treck hatten Angst vor Indianern, ständig erzählten sie Geschichten von Viehraub und Kindesentführungen, aber Mary fürchtete sich nicht. Einer der Siedler am Little Blue River hatte ihr erzählt, bei den Pawnee hätten die Frauen das Sagen. Die Männer gingen zwar auf die Jagd und auf den Kriegspfad, aber die Entscheidungen würden von den Frauen getroffen.
Der Gedanke faszinierte Mary.
»Es sind nicht die Indianer, vor denen ich Angst habe«, antwortete Elitha. Sie arbeitete schnell, ohne aufzublicken, als wollte sie keine Sekunde länger hier sein als unbedingt nötig.
»Sie hat Angst vor Geistern«, erklärte Harriet seufzend. »Sie glaubt, es spukt hier.«
»Das habe ich nicht gesagt«, fuhr Elitha auf. »Und von Geistern habe ich auch nichts gesagt.« Sie zögerte, ihr Blick sprang zwischen Harriet und Mary hin und her. »Aber Mr. Bryant meint …«
Harriet schnaubte. »Ist es das, was dich beunruhigt? Eine von Mr. Bryants Geschichten? Eigentlich solltest du es ja besser wissen, als auf diesen Kerl zu hören.«
»Das ist nicht fair«, entgegnete Elitha. »Er ist klug. Du hast es selbst gesagt. Er ist hier, weil er ein Buch über Indianer schreibt. Er sagt, sie hätten ihm verraten, dass es hier Geister gibt. Waldgeister, Hügelgeister und Flussgeister.«
»Ach, Elitha, mach dir nichts aus Mr. Bryants Gerede«, warf Mary ein. Sie wusste selbst nicht recht, was sie von dem Mann halten sollte. Er war sehr gebildet, das war offensichtlich. Dass er auch als Arzt was konnte, hatte er eindrücklich bewiesen, als er Billy Murphys gebrochenes Bein wieder einrichtete, das der sich beim Sturz vom Pferd gebrochen hatte. Aber die Art, wie er umherlief und mit seinen Gedanken regelmäßig woanders war, hatte etwas Beunruhigendes. Als lausche er auf eine Stimme, die nur er allein hören konnte.
»Aber ich habe sie gehört«, sprach Elitha mit gerunzelter Stirn weiter. »Ich höre sie, wie sie nachts nach mir rufen. Ihr nicht?«
»Die Geister rufen dich?«, fragte Mary.
»Sie hat zu viel Fantasie. Ihre Stiefmutter gibt ihr Romane zum Lesen. Das bekommt ihr nicht«, antwortete Harriet, ohne Elitha zu Wort kommen zu lassen.
Mary spürte Ärger in sich aufsteigen. Im Lauf der Jahre war sie vielen Frauen von Harriets Schlag begegnet, Frauen mit schmalen Lippen und Gesichtern, als hätte die endlose Bibellektüre sie zerdrückt. Sie tätschelte Elithas Hand. »Da war bestimmt nichts. Vielleicht haben sich Leute im Nachbarzelt unterhalten, und du hast es gehört.«
»Es klang nicht wie zwei Menschen, die sich unterhalten. Es klang überhaupt nicht so.« Elitha biss sich auf die Lippe. »Es klang wie … jemand, der mit hoher Stimme etwas flüstert, aber die Stimme war sehr schwach, als würde der Wind sie von weit entfernt hertragen. Es war komisch … und traurig. Es war das Beängstigendste, was ich je gehört habe.«
Mary lief ein Schauder über den Rücken. Seit sie dem nördlichen Platte River folgten, hörte auch sie nachts seltsame Dinge, sagte sich aber jedes Mal, sie bilde sich das nur ein, es sei der Schrei eines unbekannten Tieres oder der Wind, der durch eine tiefe Schlucht weht. Hier in dieser Weite hörten sich die Geräusche anders an.
»Du lässt bloß deine Fantasie mit dir durchgehen«, kommentierte Harriet. »Ich glaube, du solltest ein bisschen vorsichtiger damit sein, den Leuten von Geistern und Indianern und dergleichen zu erzählen. Sie könnten auf die Idee kommen, du hättest es mit den Heiden, so wie dieser Mr. Bryant.«
»Ach, Harriet, komm schon«, murmelte Mary.
Harriet ließ sich nicht beirren. »Wieso? Vielleicht hat einer der Siedler schon ein Auge auf sie geworfen, aber wenn sie sich wie ein dummes, ängstliches Mädchen benimmt, wird er sie bestimmt nicht heiraten.«
Mary wrang das letzte Wäschestück besonders kräftig aus und stellte sich vor, es wäre Harriets Hals, dann warf sie es in den Zuber. »Elitha ist erst dreizehn und noch ein bisschen zu jung, um ans Heiraten zu denken, findest du nicht?«
Harriet wirkte verletzt. »Nein, das finde ich nicht. Ich war bei meiner Hochzeit vierzehn.« Sie warf Mary ein kaltes Lächeln zu. »Was ist überhaupt mit dir? Hattest du je einen Liebsten? Ich finde es seltsam, dass du noch nicht verheiratet bist.«
»Ich war verlobt, vor nicht allzu langer Zeit«, antwortete Mary knapp. Sie wusch sich die Hände im Fluss ab. »Aber mein Verlobter ist überraschend gestorben, bevor wir heiraten konnten.«
»Wie schlimm für dich«, sagte Elitha leise.
»Manchmal ist das Schicksal eben unbeständig«, erwiderte Mary, so fröhlich sie konnte. »Man weiß nie, was das Leben für einen bereithält.«
Harriet hob den Kopf und blickte die beiden von oben herab an. »Du überraschst mich, Mary. Du bist eine gute Christin. Gott allein entscheidet, was mit uns passiert, alles geschieht nach seinem Plan. Er wird einen Grund gehabt haben, warum er diesen Mann von dir genommen hat.«
Mary machte sich nichts aus dem Kommentar, doch Elitha schnappte nach Luft. »Das kann nicht dein Ernst sein, Harriet. Gott wäre bestimmt nie so grausam zu Mary!«
»Ich behaupte ja nicht, dass es Marys Schuld ist«, entgegnete Harriet, auch wenn ihre Stimme etwas anderes nahelegte. »Ich sage nur, dass solche Dinge nicht zufällig geschehen. Gott hat Mary gezeigt, dass die Hochzeit eben nicht sein sollte.«
Mary biss sich auf die Zunge. Harriet machte es Spaß, gemein zu sein, aber in einer Hinsicht hatte sie recht: Mary würde es nie vor anderen zugeben, und ganz bestimmt nicht vor ihren Eltern, doch tief in ihrem Herzen hatte sie gewusst, dass sie noch nicht bereit war. Sarah war neunzehn gewesen, als sie Jay Fosdick geheiratet hatte, und sie hatte ihn gern geheiratet, aber Mary war nicht wie ihre ältere Schwester – etwas, das mit jedem Tag offensichtlicher wurde. Als ihr Vater verkündete, dass sie nach Kalifornien gehen würden, war Mary insgeheim entzückt gewesen. Sie hatte die Kleinstadt, in der sie seit ihrer Geburt lebte – wo jeder wusste, wie arm sie einmal gewesen waren –, so satt. Dass sie das Feuerholz verkauft und zum Heizen Kuhdung verwendet hatten, bis die Pflanzen auf ihrem Acker kräftiger waren und die Ernten besser wurden. Die Leute dort würden bis ans Ende aller Zeiten von Mary erwarten, exakt dem Bild zu entsprechen, das sie sich von ihr gemacht hatten. Sie hätten ihr niemals gestattet, mehr zu sein als das. Für immer geknechtet unter einem Joch.
Beim Tod ihres Verlobten hatte Mary vor allem Erleichterung verspürt – und sich dafür gewaltig geschämt. Sie wusste, ihr Vater hatte alles auf diese Hochzeit gesetzt, auf den höheren Lebensstandard, den sie mit sich gebracht hätte.
Sarahs Ehe war aus praktischen Gründen geschlossen worden, aber auch aus Liebe. Doch für Mary hatte Franklin Graves schon immer andere Pläne gehabt. Sie war diejenige, die durch eine vorteilhafte Verbindung die gesamte Familie retten sollte. Mary konnte nicht einmal mehr zählen, wie oft ihr Vater zu ihr gesagt hatte, sie sei seine einzige Hoffnung.
Genauso wenig konnte sie zählen, wie oft sie sich schon gewünscht hatte, Sarah wäre die Hübschere von ihnen, diejenige, auf deren Schultern das Glück der anderen lastete.
Harriet stand auf und stützte den Waschzuber auf ihre Hüfte. »Gott hat einen ganz besonderen Plan für jeden von uns. Es steht uns nicht zu, seine Weisheit zu hinterfragen. Vielmehr ist es unsere Pflicht zuzuhören und zu gehorchen. Ich gehe jetzt zum Lager zurück. Kommst du mit, Elitha?«
Elitha schüttelte den Kopf. »Ich bin noch nicht fertig.«
Mary legte Elitha eine Hand auf den Arm. »Keine Sorge, ich warte so lange, und dann gehen wir gemeinsam zurück.«
»Umso besser!«, rief Harriet über die Schulter und machte sich auf den Weg. »Das Abendessen kocht sich nicht von allein.«
Elitha wartete, bis Harriet außer Hörweite war, dann sagte sie mit geweiteten Augen zu Mary: »Es macht dir doch nichts aus, wenn ich dir davon erzähle, oder? Ich muss es einfach jemandem sagen. Es waren nicht die Stimmen, die mir Angst gemacht haben.« Verstohlen blickte sie über die Schulter. »Die höre ich nämlich schon immer. Tamsen sagt, ich bin empfänglich – für die Geisterwelt, meint sie. Meine Stiefmutter interessiert sich für solche Dinge. In Springfield hat sie sich von einer Frau aus der Hand lesen lassen. Und die Karten legen. Die Frau sagte ihr, dass die Geister mich mögen. Dass es ihnen leichtfällt, zu mir zu sprechen.«
Mary zögerte, dann nahm sie Elithas Hand. Sie war ganz kalt vom Wasser. »Ist schon in Ordnung. Du kannst es mir ruhig erzählen. Ist etwas passiert?«
Elitha nickte langsam. »Vor zwei Tagen, als wir an der verlassenen Trapperhütte vorbeikamen …«
»Ash Hollow?« Mary sah den winzigen Schuppen noch vor sich, die provisorisch zusammengezimmerten Bretter, die wegen der gnadenlosen Präriesonne so weiß wie Knochen waren. Es war ein trauriger, einsamer Ort, wie das verlassene Farmhaus, an dem Mary jeden Sonntag auf dem Weg zum Gottesdienst vorbeigekommen war. Wind und Wetter hatten dem Haus arg zugesetzt, die Fenster waren dunkel und leer wie die Augenhöhlen eines Totenschädels. Ein eindringliches Mahnmal für das Scheitern einer Familie. Lass es dir eine Lehre sein, sagte ihr Vater, als sie mit dem Wagen – nur wenige Jahre nachdem sie selbst kurz davor gewesen waren, alles zu verlieren – an dem Haus vorbeifuhren. Wäre uns Gott nicht so gnädig gewesen, hätte es genauso gut uns treffen können.
Die Welt war zerbrechlich. Am einen Tag Gedeihen, am nächsten Verderben.
Elitha presste die Augenlider zusammen. »Ja, Ash Hollow. Warst du drinnen?«
Mary schüttelte den Kopf.
»Überall waren Briefe, Hunderte. Sie lagen aufgestapelt auf einem Tisch, mit Steinen beschwert. Mr. Bryant hat gesagt, dass die Siedler sie dort gelassen haben, damit jemand, der nach Osten unterwegs ist, sie zum nächsten Postamt bringen kann.« Sie blickte Mary unsicher an. »Würdest du mich für einen schlechten Menschen halten, wenn ich dir sage, dass ich ein paar davon gelesen habe?«
»Aber Elitha, diese Briefe waren nicht für dich bestimmt.«
Sie wurde rot. »Ich dachte, es tut ja niemandem weh. Es war, wie eine Geschichte zu lesen. Die meisten Briefe waren nicht einmal versiegelt. Sie lagen einfach zusammengefaltet auf dem Tisch, die Absender wussten also, dass jeder sie lesen kann. Nur dass es gar keine Briefe waren.«
Mary blinzelte verwirrt. Elitha stand gebeugt vor ihr, blass wie der aufgehende Mond. »Wie meinst du das?«
»Es war keine Adresse drauf und auch keine Anrede.« Elitha senkte die Stimme zu einem Flüstern. »Und es stand auch keine Nachricht darin … Ich habe einen nach dem anderen gelesen, in jedem stand das Gleiche, immer wieder.«
»Ich verstehe immer noch nicht, was du meinst.« Mary hatte das Gefühl, ihr laufe eine Spinne über den Rücken, rauf und runter. »Aber wenn es keine Briefe waren, was dann?«
Unbeholfen griff Elitha in ihre Schürze, zog ein gefaltetes Stück Papier hervor und reichte es Mary. »Einen habe ich mitgenommen. Ich wollte ihn jemandem zeigen, habe es aber nie getan. Ich wusste nicht, wem. Mir hätte ohnehin keiner geglaubt. Vielleicht hätte er gedacht, ich habe ihn selbst geschrieben, um Aufmerksamkeit zu erregen. Aber ich habe ihn nicht selbst geschrieben, wirklich nicht.«
Mary nahm das Stück Papier. Von der Hitze in der Hütte war es trocken und brüchig, so sehr, dass sie fürchtete, es könnte sich unter ihren Fingern auflösen. Sie faltete es vorsichtig auseinander. Die Tinte war verblasst, als wären die Worte schon vor langer Zeit geschrieben worden, aber sie waren noch immer gut zu entziffern.
Macht kehrt, stand dort in dünner, krakeliger Handschrift. Macht kehrt, oder ihr werdet alle sterben.
4
Sie fanden den Nystrom-Jungen, oder was von ihm übrig war, später in derselben Nacht.
Stanton folgte George Donner aus dem Wagenkreis hinaus in die dunkle, leere Ebene. Angst schnürte ihm die Kehle zu.
Zwei Fahrer hatten die Entdeckung erst vor wenigen Minuten gemacht, als sie das Vieh zum Grasen trieben. Im verblassenden Licht hatten sie im hohen Gras eine Vertiefung entdeckt und nachgesehen. Beide waren gestandene Männer, trotzdem hatte sich einer von ihnen übergeben.
Ein Stück voraus tanzten Lichtpunkte durch die Nacht. Stanton hielt sie im ersten Moment für eine Sinnestäuschung, doch im Näherkommen wurden die Punkte zu Flammen und die Flammen zu Fackeln. Ein Dutzend Männer stand in einem Kreis versammelt, die Fackeln schwebten wie ein Heiligenschein aus Feuer über ihren Köpfen. Stanton kannte die meisten von ihnen – William Eddy, Lewis Keseberg und Jacob Wolfinger, außerdem Edwin Bryant –, aber es waren auch ein paar Mitglieder des Russel-Trecks dabei, Freunde der Familie des Jungen, die er bisher nur im Vorbeigehen gesehen hatte. Ein eigenartiges Geräusch, irgendetwas zwischen einem Schrei und einem Heulen, erhob sich in der Ferne. Wie eine Welle rollte es über die Ebene auf sie zu.
»Verfluchte Wölfe«, murmelte jemand.
Das Erste, was Stanton sah, als er sich einen Weg durch den Kreis bahnte, war Edwin Bryant, der auf dem Boden kniete. Was wie ein nasser roter Fleck im Gras wirkte, stellte sich als ein Leichnam heraus. Stanton schloss für einen Moment die Augen. Es war nicht der erste schreckliche Anblick in seinem Leben, aber er konnte sich nicht erinnern, jemals etwas so Entsetzliches gesehen zu haben. Dann öffnete er die Augen wieder.
Der Kopf war unversehrt. Wenn man nur das Gesicht betrachtete, würde man nicht einmal merken, dass etwas nicht stimmte. Die Augen des Jungen waren geschlossen, lange braune Augenbrauen hoben sich dunkel von den kreideweißen Wangen ab. Das dünne blonde Haar klebte ihm am Schädel, der kleine Mund war geschlossen. Er sah so friedlich aus, als schlafe er.
Aber vom Hals abwärts …
George Donner stieß ein leises Wimmern aus.
»Was ist mit ihm passiert?«, fragte Lewis Keseberg. Er klopfte mit dem Gewehrkolben den Boden um die Leiche ab, als ließe es sich auf diese Weise herausfinden. Keseberg und Donner waren befreundet – weshalb, war Stanton ein Rätsel. Keseberg war unbeherrscht und gewalttätig, für ihn gab es nur Schwarz und Weiß: deine Seite, meine Seite. Stanton konnte sich Keseberg nur schwer als Vater vorstellen, trotzdem hatte er anscheinend eine kleine Tochter.
»Das müssen Wölfe gewesen sein, so wie die Leiche aussieht.« William Eddy rieb sich den Bart, eine nervöse Angewohnheit. Eddy war Tischler und gut im Reparieren von gebrochenen Rädern und Achsen. Das machte ihn bei seinen Mitreisenden beliebt, aber er war auch nervös und schreckhaft. Stanton wusste nicht, ob er ihm trauen sollte.
»Was meinen Sie, Doc?«, fragte Jacob Wolfinger mit seinem leichten deutschen Akzent.
Bryant setzte sich mit den Hinterbacken auf die Fersen. »Ich bin kein Arzt«, berichtigte er. »Und ich weiß es wirklich nicht. Aber wenn Sie mich fragen, ich glaube nicht, dass es Wölfe waren. Es sieht mir zu sauber aus.«
Stanton erschauerte. Es gab nicht einmal eine richtige Leiche. Es war praktisch nur noch das Skelett übrig. Fleischfetzen und verstreute Knochen auf einem flachgedrückten, blutgetränkten Stück Gras, die Eingeweide bereits schwarz von Fliegen. Und noch etwas beunruhigte ihn: Sie befanden sich sechs Meilen von der Stelle entfernt, an der der Junge verschwunden war. Kein Wolfsrudel schleppte seine Beute so weit, bevor es sie fraß.
»Was immer es war, es war jedenfalls hungrig«, kommentierte Donner mit bleichem Gesicht. »Wir sollten die Überreste begraben. Bevor die Frauen und Kinder sie noch sehen.«
Eddy spuckte auf den Boden. »Was ist mit den Eltern? Jemand muss feststellen, ob das der richtige Junge ist oder nicht …«
»Wir sind hier mitten im Nirgendwo. Die nächste weiße Siedlung ist mehrere Tage weit entfernt«, sagte Wolfinger. »Wer sollte es sonst sein?« Wolfinger hatte sich als Anführer der Deutschen im Tross etabliert und übersetzte für die, die kein Englisch konnten. Sie blieben die meiste Zeit unter sich, versammelten sich nachts um ihre Lagerfeuer und sprachen ihr Schnellfeuer-Deutsch. Dennoch war Stanton Wolfingers hübsche, junge Frau Doris aufgefallen. Ihre Hände sahen aus, als wären sie fürs Klavierspielen gemacht, nicht um Feuerholz zu schleppen oder Zügel zu halten.
Am Ende holten ein paar der Männer Schaufeln, während die anderen zurück zu den Wagen liefen und nach ihren Familien sahen, ihre schlafenden Kinder weckten oder sie einfach nur anschauten, sich von ihrem Anblick beruhigen ließen.
Stanton schlug die Ärmel hoch und machte sich ans Graben.
Sie brauchten kein großes Loch – es war nur noch so wenig von dem Jungen übrig –, aber es sollte tief genug sein, damit die Kojoten die Knochen nicht wieder ausgruben. Außerdem fühlte sich die körperliche Anstrengung gut an. Stanton wollte möglichst müde sein, wenn er später zu Bett ging.
Zu müde zum Träumen.
Wie zu erwarten gewesen war, blieb George Donner zwar, warf aber nur ein paar Schaufeln voll Erde auf das Grab. Als sie endlich fertig waren, sprach er stockend ein kurzes Gebet. Die altehrwürdigen Worte klangen jedoch dünn in der Nachtluft.
Danach ging Stanton mit Donner, James Reed und Bryant zurück zu den Wagen. Er kannte Reed nicht gut und war auch nicht sicher, ob er es wirklich wollte. Reed war unter den Geschäftsleuten in Springfield zwar wohlbekannt gewesen, aber nicht geschätzt. Seine Fackel war beinahe heruntergebrannt, die Flamme richtete wenig gegen die Dunkelheit aus, die die Gruppe umgab. Mal befanden sich Reed und Donner im Flammenschein, mal außerhalb, ihre blassen Gesichter schwebten im Dunkel wie Geister. Der Boden war uneben und tückisch, immer wieder unterbrochen von den Tunneleingängen der Präriehunde und dicken Grasbüscheln. Die tags so drückend heiße Sommerluft hatte sich abgekühlt, war aber immer noch trocken und staubig.
»Etwas Derartiges habe ich noch nie gesehen«, sagte Reed nach einiger Zeit in die entstandene Stille hinein. »Ich stimme mit Ihrer Einschätzung überein, Mr. Bryant. Wäre es ein Tier gewesen, hätte die Leiche anders ausgesehen. Die Antwort liegt auf der Hand. Indianer … es müssen Indianer gewesen sein.« Er hob die Hand, bevor Bryant ihn unterbrechen konnte. »Ich weiß, Sie halten sich für eine Art Indianerexperten, Mr. Bryant. Gehen Sie ruhig zu ihnen, leben Sie unter ihnen, reden Sie mit ihnen und machen Sie Ihre Notizen für Ihr Buch. Aber Sie haben nie gegen sie gekämpft, haben nie ihren Hass erlebt, wie ich ihn erlebt habe. Ich weiß, wozu sie in der Lage sind.« Reed erzählte jedem, der es hören wollte oder nicht, dass er im Black-Hawk-Krieg gekämpft hatte – wahrscheinlich, damit die anderen Siedler endlich aufhörten, ihn wie ein Greenhorn zu behandeln.
Bryants Stimme blieb ruhig. »Ganz recht, Mr. Reed. Alles, was ich über Indianer weiß, habe ich herausgefunden, indem ich mit ihnen gesprochen habe, statt aus der Entfernung auf sie zu schießen. Aber Streiten bringt uns nicht weiter. Selbst Sie werden zustimmen müssen, dass es alles nur noch schlimmer macht, wenn wir die Leute glauben lassen, die Indianer wären es gewesen. Wir befinden uns auf ihrem Gebiet. Das Letzte, was wir jetzt brauchen, ist eine Panik. Außerdem«, fügte er hinzu, als Reed gerade widersprechen wollte, »habe ich noch nie zuvor von einem Indianerbrauch gehört, bei dem eine Leiche so drapiert wird.«
Donner fuhr herum. »Drapiert? Sie reden ja, als wäre der Junge von einem Fleischer geschlachtet worden.«
Bryant erwiderte nichts. Musste er auch nicht.
»Das würde bedeuten, dass alles mit Absicht geschah«, warf Stanton ein. Allein die Worte schmeckten übel auf der Zunge. »Aber wenn es nicht Indianer waren, wer dann?«
Bryants Miene wurde hart. »Wir dürfen die Möglichkeit nicht ausschließen, dass der Mörder des Jungen zum Treck gehört. Dass er sich mitten unter uns befindet.«
Die Stille war angespannt. »Unsinn«, stammelte Reed und zog sein Taschentuch hervor, so wie jedes Mal, wenn er nervös war. Ein unverkennbares Anzeichen.
»Ein solcher Mann würde doch sicher auffallen.« Donner fingerte an den Knöpfen seines Mantels herum. »Sein Verhalten würde ihn verraten.«
Stanton wusste, dass das nicht unbedingt stimmen musste. Der Anblick des toten Jungen hatte ihn an einen längst vergangenen Tag in seiner Heimatstadt in Massachusetts erinnert, als die Frau, die er geliebt hatte, aus dem zugefrorenen Fluss gezogen und auf den Schnee gelegt worden war. Lydia. Fünfzehn Jahre waren seitdem vergangen, und er konnte die Erinnerung noch immer kaum ertragen. Auch sie hatte ausgesehen, als hätte sie sich nur schlafen gelegt, ihr Gesicht hatte genauso friedlich gewirkt wie das des Jungen. Eine Lüge. Stanton erinnerte sich an die dunklen Wimpern über der Haut, die vom kalten Wasser bläulich geworden war, an die Lippen, violett wie ein Bluterguss. Etwas Schreckliches hatte sie an jenem Wintertag hinaus auf das dünne Eis getrieben, ein Übel, das mitten unter ihnen lebte und das er nicht als solches erkannt hatte. Zumindest in dieser Hinsicht hatte sein Großvater recht gehabt: Das Böse war unsichtbar, und es war überall.
»Auch ein Verrückter kann sich normal benehmen, wenn er muss«, entgegnete Bryant. »Es könnte ihm gelingen, sich noch eine ganze Weile zu verstecken. Es könnte ihm gelingen, sein wahres Gesicht für immer vor uns zu verstecken.«
Reed wischte sich über die Stirn. »Wenigstens ist Colonel Russell von seinem Posten zurückgetreten. Es ist Zeit für einen neuen Anführer.«
Stanton schaute zu Donner hinüber, dessen sonst so selbstsicherer Gang im tanzenden Fackelschein ein wenig schief wirkte. Donner war einer von Russells Leutnants gewesen, er hatte seinen Posten und all die kleinen Pflichten, die dieser mit sich brachte, ganz offensichtlich genossen. Donner redete gerne mit, wenn es darum ging, etwas zu entscheiden. Es gefiel ihm, wenn die Leute zu ihm aufschauten, er schien geradezu nach der Bewunderung anderer zu lechzen. Deshalb respektierte ihn Stanton umso weniger.
»Sie haben nicht etwa vor, Russell dafür verantwortlich zu machen?«, fragte Bryant.
»Es war ein Fehler, ihn überhaupt zu unserem Anführer zu wählen. Unter einem stärkeren Mann wäre das gar nicht erst passiert«, antwortete Reed mit einem Räuspern. Stanton glaubte zu wissen, was als Nächstes kommen würde. »Mein Ruf, so denke ich, spricht für sich selbst.«
»Überschätzen Sie Ihre Chancen nicht«, wandte Donner ein; sein großes Gesicht strahlte hell im Fackelschein. »Sie mögen ein guter Geschäftsmann sein, aber ich bin nicht sicher, wie viel das hier draußen wert ist.«
»Faktisch gehöre ich schon jetzt zu den Anführern dieser Gruppe, wenn auch nicht dem Rang nach. Das können Sie nicht bestreiten«, erklärte Reed steif. Stanton musste ihm zustimmen; wann immer eine wichtige Entscheidung anstand, wandten sich die Leute schon beinahe instinktiv an James Reed.
»Sie würden zulassen, dass wir den ersten Indianer, dem wir begegnen, sofort umbringen«, platzte Donner heraus. »Sie würden uns in einen Krieg stürzen, wo wir nicht den geringsten Beweis haben, wer oder was den Jungen getötet hat.«
»Verstehe. Ich nehme an, Sie halten sich für einen besseren Anführer, als ich es wäre?« Reeds Stimme schnitt wie ein Messer.
Selbst in dem spärlichen Fackelschein sah Stanton, wie Donner errötete. »Das tue ich in der Tat. Ich habe bereits Erfahrung im Führen dieses Trosses. Die Leute kennen mich – und sie mögen mich. Das ist wichtig, James. Unterschätzen Sie das nicht.«
Reed blickte Donner finster an. »Ich werde lieber respektiert als gemocht.«