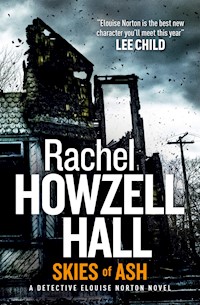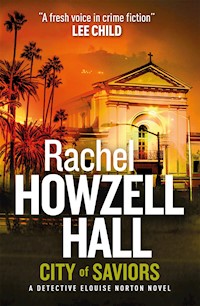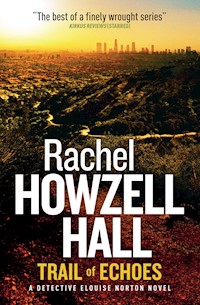16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Loewe Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Schicksalsberührt
- Sprache: Deutsch
Vergessen. Verloren. Verraten. Ohne jegliche Erinnerung erwacht Kai in einer Welt, die vom Tod gezeichnet ist. Sie weiß weder, woher sie kommt, noch wer – oder was – sie eigentlich ist. Nur einer Sache ist sich Kai sicher: Sie muss unbedingt ihr gestohlenes Amulett zurückerlangen, ohne das sie sich taub und leer fühlt. Als der attraktive Schmied Jadon ihr seine Hilfe anbietet, zieht dieser sie sofort in seinen Bann. Doch die Suche nach Antworten birgt tödliche Gefahren. Und noch tödlichere Geheimnisse … Der Auftakt der Must-Read Romantasy-Reihe! The Last One von New York-Times-Bestsellerautorin Rachel Howzell Hall ist Band 1 einer spannenden Romantasy-Dilogie – voller Magie, Götter, Liebe, Geheimnissen und Gefahren. Mit einer prickelnden Strangers-to-Lovers-Romance, die einen sofort in den Bann zieht!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 799
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Inhalt
Teil IANKUNFT EINER FREMDEN
Kapitel 1 – Ich öffne die …
Kapitel 2 – Und dann berührt …
Kapitel 3 – Der Mann, der …
Kapitel 4 – Olivia läuft los, …
Kapitel 5 – Aber nicht, bevor …
Kapitel 6 – Der Nachtstern steht …
Kapitel 7 – Nachdem ich dunkles …
Kapitel 8 – Aus dem Tor …
Kapitel 9 – Als Jadon meinen …
Kapitel 10 – Mach die Augen …
Kapitel 11 – Blitzschnell schwinge ich …
Kapitel 12 – Trinkt.« Eine Frau …
Kapitel 13 – Oh nein. Nicht …
Kapitel 14 – Philia schleicht durch …
Kapitel 15 – Die blutroten Buchstaben …
Kapitel 16 – Wieder einmal bin …
Teil IIDURCHS FEUER
Kapitel 17 – Maford hinter mir …
Kapitel 18 – Wir reiten weiter …
Kapitel 19 – Der Himmel erhellt …
Kapitel 20 – Der Himmel wird …
Kapitel 21 – Weck die Mädchen …
Kapitel 22 – Was geht hier …
Kapitel 23 – Kennen wir uns?«, …
Kapitel 24 – Nachdem Jadon fort …
Kapitel 25 – Veril rührt in …
Kapitel 26 – Verils Gedächtnistee riecht …
Kapitel 27 – Ich trage eine …
Kapitel 28 – Ich öffne die …
Kapitel 29 – Das Licht, das …
Teil IIINICHT REDEN … MACHEN
Kapitel 30 – Ein neuer Tag …
Kapitel 31 – Das bizarre Zwitschern, …
Kapitel 32 – Veril und Philia …
Kapitel 33 – Bedrohlich zeichnet sich …
Kapitel 34 – Ich spüre, wie …
Kapitel 35 – Das Röcheln des …
Kapitel 36 – Vor Verils gesprungenem …
Kapitel 37 – Die Wanne in …
Kapitel 38 – Ich bin bereit, …
Kapitel 39 – Diese verfluchte Olivia. …
Kapitel 40 – Philia sitzt im …
Teil IVKOMM DOCH, WENN DU KANNST
Kapitel 41 – Olivia wird nach …
Kapitel 42 – Dampf umwabert die …
Kapitel 43 – Wir folgen dem …
Kapitel 44 – Der Bärenmann überragt …
Kapitel 45 – Endlich erreichen wir …
Kapitel 46 – Es regnet nicht, …
Kapitel 47 – Es ist vor …
Kapitel 48 – Jemand brüllt. So …
Kapitel 49 – Der schwarze Rauch, …
Kapitel 50 – Nach einer gefühlt …
Kapitel 51 – Nachdem wir einen …
Kapitel 52 – Philia will wieder …
Kapitel 53 – Das Abendessen wird …
Kapitel 54 – Jadon ist nicht …
Teil VZURÜCK NACH HAUSE FÜHRT KEIN WEG
Kapitel 55 – Und jetzt weiß …
Kapitel 56 – Mindestens siebzig Soldaten …
Kapitel 57 – Jadon und ich …
Kapitel 58 – Ich öffne die …
Kapitel 59 – Ein neuer Morgen …
Kapitel 60 – Es kommt mir …
Kapitel 61 – Bleib stehen!«, brüllt …
Kapitel 62 – Jadon Wake steht …
Epilog
Danksagung
In The Last One
Teil I
ANKUNFT EINER FREMDEN
In einem Land voll Sternenglanz
Erwacht der Heldin Seele ganz.
Ihr Weg durch fremde Reiche führt,
Die Zukunft ihr allein gebührt.
Hört, wie das Echo leise spricht,
Wie Sturmesmacht die Bäume bricht.
Verzauberte Wälder und Wüsten weit,
In diesem Land ist sie bereit.
Unter des Waldes Blätterdach
Vergoss sie Blut, ward niemals schwach.
Das Herz aus Gold, voll Kampfesmut,
Voll hehrer Ziele und Zornesglut.
Hört, wie das Echo leise spricht,
Diese Eine beugt sich nicht.
Grüne Hügel, wildes Meer,
In diesem Lande siegt ihr Heer.
Tief im Schattenlabyrinth
Erinnerungen noch verborgen sind.
Derweil die Götter in Reichen droben
Ihrer Mutter Liebe loben.
Sand und Felsen, Berg und Tal,
Die Kraft des Windes überall.
Freieren Geiste gibt es keinen,
Um Traum und Wahrheit zu vereinen.
Hört, wie das Echo leise spricht,
Diese Eine beugt sich nicht.
Ungebrochen, tief verletzt,
In diesem Land steht sie zuletzt.
Der Tagstern bald vom Himmel flieht
Bei Totenmesse und Wiegenlied.
Fortgetragen zum Weltenrand
Lebt ihre Legende in diesem Land.
Eine Elegie von Veril Bairnell dem Weisen
Ich öffne die Augen und entscheide mich für Gewalt.
Ich liege auf dem Rücken und eine Frau kniet auf mir. Mit ihrer blassen Hand umschließt sie meinen Hals. Sie riecht seltsam und widerlich süß. Das eigentlich Weiße ihrer großen blauen Augen ist gelb wie Stroh. Ihrer glatten Haut nach könnte sie neunzehn oder zwanzig sein. Ist sie eine Diebin? Eine Mörderin?
So oder so: Sie muss von mir runter. Also schlage ich mit einer Hand nach ihrem Ohr und greife mit der anderen nach ihren Fingern.
»Oh!« Sie reißt die Augen auf und weicht meinem Schlag erfolgreich aus. Bei dem Versuch, sich wegzudrehen, fällt sie auf mich. Sie schnappt nach Luft und ihr fauliger Atem steigt mir in die Nase.
Igitt! Ich muss würgen, dann presse ich ihre Hand zusammen.
Und breche ihr den kleinen Finger. Aber selbst da verzieht sie keine Miene. Nichts. Mit ihrer freien Hand greift sie rasch an meinen Hals. »Ha«, sagt sie grinsend. »Jetzt hab ich’s doch gekriegt.«
Was hast du doch gekriegt?, will ich fragen, aber meine Zunge hängt schlaff in meinem Mund wie eine welke Lilie. Ich bringe kein Wort heraus, erst recht nicht fünf.
Die Diebin hält eine dicke, glänzende Goldkette hoch. Daran hängt ein goldener Nachtfalter mit rubinbesetzten Flügeln. Der Stein auf der Brust des Nachtfalters ist so groß wie ein Rotkehlchenei und dunkel wie die dunkelste Nacht.
Der Verschluss der Kette ist so kaputt wie ich und meine Brust fühlt sich kalt an ohne den juwelenbesetzten Nachtfalter, seltsam leer, als wäre mir mehr als ein Amulett genommen worden.
Die Diebin schafft es, sich mit einem Ruck aus meinem Griff zu befreien. Sie versucht zu lachen, aber Tränen schimmern in ihren Augen, als sie mit schmerzverzerrtem Gesicht ihre verletzte Hand bewegt. »Musstest du mir unbedingt gleich einen Finger brechen?«
Ich öffne den Mund, um zu antworten – Was fällt dir ein, so mit mir zu sprechen? –, doch in meinem Hinterkopf pocht es und meine Zunge rührt sich immer noch nicht.
»Aber ich nehme diese Halskette als Entschuldigung an«, sagt die Diebin und rappelt sich auf. »Danke.« Sie verzieht wieder das Gesicht, als sie ihre wunde Hand strecken will, schwingt sich dann einen Rucksack über die Schulter und zwinkert mir zu. »Stimmt so.«
Und schon ist sie wie der Blitz zwischen den Bäumen verschwunden.
Hat sie gerade …? Ja, das hat sie. Und … Stimmt so?
Mit brodelnder Lava im Bauch drücke ich mich von der Schicht aus Zweigen, vergilbten Blättern und grauer Baumrinde hoch, um ihr zu folgen –, aber meine Beine knicken unter mir ein und ich lande wieder auf dem trockenen Laub.
Was ist hier los? Warum kann ich nicht aufstehen?
In meinem Kopf dreht sich alles, ich bin ganz benommen und orientierungslos. Gerade haben meine Füße doch noch funktioniert. Glaube ich. Denn was habe ich gerade gemacht, bevor ich mit einer Diebin über mir aufgewacht bin? Ähm … Daran erinnere ich mich nicht.
Das rasche Pulsieren in meinem Inneren lässt mich nach unten auf meine bebende Brust schauen, die von meinem scharlachroten Lieblingsbrustband bedeckt ist und …
Moment. Warum zum Henker kann ich auf mein Brustband schauen?
Mein Blick gleitet zu dem Streifen mahagonifarbener Haut an meinem Bauch und dann weiter nach unten. Meine Zehen und Knöchel sind mit aschgrauem Matsch besprenkelt, der sich von meinen braunen Füßen so deutlich abhebt wie winzige Pünktchen Sternenlicht vor dem samtenen Nachthimmel.
Ich sollte keine graue Erde sehen. Ich sollte nicht meine Zehen sehen.
Wo sind meine Stiefel? Warum ist mir so kalt? Wo ist mein Umhang?
Ich drücke gegen meine schmerzende Nasenwurzel.
Warum sehe ich nackte Hände? Wo sind meine Handschuhe?
Verdammt.
Die Diebin hatte ein blutrotes Lederwams, einen blutroten Kapuzenumhang, schwarze Lederhandschuhe und schwarze Wildlederstiefel an. Alles hing an ihr herunter wie tote Haut.
Warum? Weil das mein blutrotes Lederwams war, darum. Und das waren mein blutroter Kapuzenumhang, meine schwarzen Lederhandschuhe und meine Wildlederstiefel, die ich endlich – endlich – eingelaufen hatte.
Diese Diebin hat mir die Klamotten geklaut. Hat mich mit nichts als dem Brustband und den schwarzen ledernen Kniehosen zurückgelassen.
Ich brauche meine Sachen, vor allem mein Amulett, und je länger ich hier sitze, desto schwächer wird das Pulsieren in meinem Inneren. Es fühlt sich an, als würde etwas – meine Halskette – mich auffordern, der Gaunerin zu folgen.
»Du Diebin, bleib stehen!«, will ich rufen, aber ich sehe sie nicht mehr – sie ist in das niedrige Wäldchen mit den grauen Birken gelaufen. Aus meinem Mund kommen immer noch keine Wörter, und wenn ich versuche zu sprechen, wird mir schwindelig. Aber um eine Diebin zu fangen, brauche ich keinen Mund und keine Wörter. Nur meine Füße.
Noch etwas wackelig drücke ich mich wieder von meinem Blätternest hoch und diesmal gelingt es mir. Ich mache einen Schritt … und dann noch einen … und noch einen.
Wohin ist sie verschwunden? Ich kann sie zwar nicht sehen, aber immer noch riechen. Dieser unverkennbare, widerlich süße Gestank bedeutet …
Sie wird sterben.
Ja, der Tod stinkt. Sie hatte keine sichtbaren Verletzungen – bis auf die von mir zugefügten –, aber irgendwas stimmt nicht mit ihr. Sie sah aus, als hätte sie seit Tagen nichts gegessen. Und ihr Mundgeruch. Irgendeine Krankheit frisst sie von innen auf.
In dem Moment bemerke ich es: Eine golden-bernsteinfarbene Spur windet sich zwischen den gespenstischen Bäumen hindurch, wabert über rosa Granitblöcke und trübt die Luft. Eine golden-bernsteinfarbene Spur, die dem Weg der Diebin durch den Wald folgt.
Ich blinzle … Sehe ich diesen Lichtstrom, weil er wirklich da ist, oder sehe ich ihn, weil ich mich am Kopf verletzt habe?
Ich kneife die Augen zu, hole mehrmals tief Luft und öffne sie wieder.
Nichts anderes leuchtet, nicht die Bäume, die herabgefallenen Blätter oder die Erde. Aber das goldene Licht ist noch immer da, schwebt in der Luft, lädt mich ein, der Spur zu folgen.
Bernstein muss hier die Farbe des Todes sein.
Aber wo ist »hier«?
Ich presse die Finger gegen meine Schläfen, als könnte ich damit noch eine Erinnerung – irgendeine Erinnerung – heraufbeschwören. Aber nichts geschieht. Es sind keine mehr da.
Ich erinnere mich nicht, durch diesen Wald gelaufen zu sein. Ich erinnere mich nicht an die Ereignisse, die mich so sehr betäubt haben, dass eine Diebin es wagen konnte, mir fast sämtliche Kleider vom Leib zu reißen.
Über diese Gedächtnislücken werde ich mir später Gedanken machen, hoffentlich bei etwas Gebäck und einem Fässchen Rum. Manche Dinge, wie Rum und Kuchen, vergisst man anscheinend weniger leicht als andere. Aber ich höre auf, von Köstlichkeiten zu träumen, denn gerade habe ich ein größeres Problem: Das kalte und seltsam leere Gefühl, das ich vorhin beim Aufwachen gespürt habe, breitet sich jetzt in meiner Brust und bis hinunter in meinen Bauch aus.
»Kalt« und »leer« ist nie gut. »Kalt« und »leer« bedeutet Gefahr. Selbst das einfachste Lebewesen spürt Gefahr.
Ich bin zwar fast nackt, aber alles andere als einfach gestrickt.
Auf jeden Fall brauche ich meine Klamotten zurück. Und mein Amulett.
Ich bewege mich schneller und meine Beine werden fester. Bald renne ich, sodass Kiesel, spitze Steine und abgebrochene Zweige mich in die nackten Fußsohlen stechen. Schmerz durchzuckt meine Fersen und Knöchel, aber ich bleibe nicht stehen. Eine wandelnde Leiche hat meine Sachen geklaut. Und ich werde mir zurückholen, was mir gehört.
Während ich zwischen den Birken hindurcheile, fällt mir auf, dass fast jeder Baum Löcher und Risse in der Rinde hat. Dünne, absterbende Äste ragen in den Himmel und die Blätter rascheln unter meinen Füßen – mehr brüchig-braun als sattgrün, mehr tot als lebendig. Die schroffen Felsbrocken auf dem Waldboden haben größere Hoffnung auf Leben als diese Bäume.
Wo bin ich? Eine so karge Landschaft müsste ich doch wiedererkennen. Aber es kommt kein »Aha!«-Moment.
Regenwolken jagen über den Himmel und ihre Schatten verdunkeln den sterbenden Wald. Schwärme von hungrigen Stechmücken schweben durch die heiße, trockene Luft und pieksen mich. Sie wollen noch ein Häppchen vor dem Gewitter. Was ich natürlich verstehen kann. Wer mag schon bei einer solchen Hitze keinen leckeren Honigkuchen? Dafür müssen mich die fliegenden Mistviecher aber erst mal erwischen.
Ich bleibe nicht stehen, solange ich diese Diebin nicht in die Finger kriege und ihr den Hals umdrehe, bis sie ihren letzten Atemzug tut …
Ich sehe nur noch ein Flimmern, dann wird mir schwarz vor Augen und ich stolpere und falle auf die harte Erde. Mein Magen schlägt Purzelbäume, ich zittere und möchte mich in die trockenen Laubhaufen übergeben. Mir pocht der Schädel und ich betaste meinen Hinterkopf. Autsch! Wund. Leicht geschwollen. Ich halte mir zwei Finger vor die Augen. Blut. Nicht viel, aber schon einiges. Ich starre auf meine blutigen Finger und warte, dass die Welle der Übelkeit abebbt.
Was ist mit mir passiert? Hat mir jemand gegen den Kopf getreten? Hat mir die Diebin gegen den Kopf getreten? Wurde ich geschubst? Bin ich ausgerutscht? Kann man in einem so trockenen Wald überhaupt ausrutschen? Und wo ist dieser Wald? Und warum bin ich hier?
Keine Ahnung, achtmal.
Bin ich eine Jägerin, die sich den Kopf gestoßen und sich verirrt hat? Sucht mich gerade jemand, den Tränen nahe, hält Ausschau, ob ich um eine Ecke biege oder am Horizont auftauche, kämpft gegen die wachsende Angst an, dass ich entweder von einer Klippe gestürzt oder einem Bären zum Opfer gefallen bin?
Wieder: keine Ahnung.
Aber eins weiß ich: Sobald ich meine Kette, meine Kleider und meine eingelaufenen Stiefel zurückhabe, breche ich der Diebin auch die andere Hand. Und später werde ich … werde ich mir den Rest überlegen, wenn ich wieder angezogen bin.
Endlich lässt die Übelkeit nach und ich hebe meinen immer noch pochenden Kopf und schnuppere.
Etwas stinkt hier – und das bin nicht ich.
Die Diebin!
Ich drücke mich vom Boden hoch und atme tief aus. Los! Dann renne ich auf schmerzenden, aber nun kräftigeren Beinen weiter durch den Wald.
Die schwebende Todesspur leuchtet immer noch, aber sie ist heller geworden, von Bernstein- zu Maisbartgelb. Und das Pulsieren … schwach. Die Geisterbäume dünnen aus und der Trampelpfad wird zu einem ausgetretenen Kiesweg. Der Geruch von brennendem Holz und der zunehmende Gestank des Verfalls sagen mir, dass ich in die richtige Richtung laufe, dass ich fast da bin, dass ich am Ende dieser bernsteinfarbenen Spur die Diebin finde, aber ich muss mich beeilen.
Zwischen den Bäumen sehe ich Häuser und Rauch, der aus Schornsteinen aufsteigt. Dann ist sie wohl in ihr Dorf zurückgelaufen. Vielleicht kann ich sie dort aufspüren, mir mein Amulett schnappen und unbemerkt wieder im Wald verschwinden.
Klingt nach einem guten Plan.
Ich stürme aus dem Wäldchen hinaus ins Licht.
Als Erstes trifft mich der Geruch – diese süßliche Verwesung – und ich unterdrücke ein Würgen. Ich bleibe abrupt stehen.
Vor mir erstreckt sich eine lärmende Siedlung. An zwei Kieswegen stehen Grüppchen von Stein- und Strohhäusern mit Schindeldächern und verrauchten Schornsteinen. Ich zähle etwa zwanzig kleinere Holzhütten hinter einer Kirche, das Rathaus und ein paar Geschäfte. Auf dem Dorfplatz steckt ein hoher Pfosten in der sandigen Erde. An seiner Spitze ist ein großer hölzerner Ring angebracht. Drei Bootspaddel sind an dessen Oberseite festgenagelt und drei weitere an seiner Unterseite, wobei das mittlere größer und dicker ist als die anderen. Um diesen Pfosten herum stehen altersschwache Karren mit verschiedenen Waren.
Anscheinend ist heute Markttag. Dann haben sich die meisten Dorfbewohner wohl um die Karren versammelt?
Ich schleiche näher heran, laufe geduckt so unauffällig wie möglich den staubigen Weg entlang. Der Boden unter meinen Füßen besteht mehr aus trockenen gelben Büscheln als smaragdgrünem Rasen, mehr aus Kletten und Borstenhirsen als Grashalmen. Diesen Landstrich hat schon lange kein Wasser mehr geküsst. Ich erreiche ein Gebäude, das wohl ein Wirtshaus sein muss – es stinkt nach Bier, altem Wein und Schweiß –, und spähe um die Ecke auf den Marktplatz.
Zwölf Karren drängen sich dort. Einer ist mit Stoffballen in jeweils leicht unterschiedlichen Schattierungen von Beige beladen. Auf anderen klapprigen Karren liegen traurig aussehende Weizenbündel, schlaffes Gemüse und Tierhäute, umgeben von gackernden Hühnern, verkümmerten blökenden Schafen, knotigen Holzblöcken und Kohle – all das unter dem brütend heißen Tagstern, sodass die bereits verblassten Textilien noch weiter ausbleichen und der glänzende Krimskrams weicher wird.
Der Dorfplatz ist von feilschenden Stimmen und einer lebhaften Spielmannsmelodie erfüllt. Emsig schichten die Händler ihre magere Ware zu Pyramiden oder Türmen auf. Die Dorfbewohner kaufen von den schäbigen Karren. Sie führen die dürren Schafe die Straße entlang und zählen schrumpelige Kartoffeln und welke Rüben.
Wo ist das Farbkaleidoskop? Wo sind die tiefen Rot- und Gelbtöne von Gewürzen? Wo das leuchtende Grün und Gelb von schimmernder Seide?
Und erst die Leute.
Aufgedunsene, magere, gebrechliche Leute. Ungekämmt, mit vergilbten Zähnen oder ohne, nicht mehr hübsch, nicht mehr aufrecht. Knorrige, entstellte Leute. Mit sandbraunem oder aschblondem Haar, kurz geschnitten oder zu einem einfachen Pferdeschwanz gebunden, ohne Seitenscheitel oder Ponyfransen.
Hier gibt es kein Rot, kein Blau oder Gelb in Bändern, Tüchern oder Blumen. Keine Sterne, Vögel oder Edelsteine. Der einzige Schmuck sind ringförmige Anhänger, an denen oben und unten kleine Bootspaddel hervorstehen, jede Kette gleicht der anderen. Hier wagt es niemand aufzufallen.
Und alle glühen bernsteinfarben.
Wenn die Dorfbewohner derart krank sind – und anscheinend ist jeder hier krank –, sollte ich so nah bei ihnen stehen? Sollte ich ihre Luft einatmen? Sollte ich es riskieren, mich mit ihrer Krankheit anzustecken, nur um mir meine Kleider und meine Kette zurückzuholen? Oder sollte ich die Gaunerin erst einmal gewinnen lassen, warten, bis der Tod sie einholt – denn so, wie es in diesem Dorf aussieht, wird er sie einholen –, und mein Amulett dann aus ihrer leblosen, gebrochenen Hand ziehen?
Das Pulsieren in meinem Inneren wird stärker, aber die kalte Leere, gegen die ich kämpfe, hat inzwischen meine Hüftknochen und Fingerspitzen erreicht. Sollte ich hier herumstehen und mich davon besiegen lassen statt von welcher Krankheit auch immer, die dieses Dorf zum Glühen bringt?
Keine dieser Aussichten klingt verlockend.
Meine Entscheidung fällt, als ich sie entdecke. Die Diebin! Sie spricht mit dem Verkäufer der farblosen Stoffe und hält einen meiner Handschuhe hoch! Der Händler reibt meinen kostbaren Besitz zwischen seinen dreckigen Fingern.
Nein, nein, nein. Meine Sachen wird sie nicht verkaufen.
Ich atme tief ein und halte die Luft an, als könnte ich mich dadurch schützen. Nach zehn vorsichtigen Schritten atme ich so laut wieder aus, dass einige Dorfbewohner es hören.
Und jetzt drehen sie sich um und starren zu mir hoch. Ihre Gesichter lassen Mühsal und Sorge erkennen, während alle Blicke mir folgen, als ich vorbeieile.
Von wegen unauffällig.
»Du lieber Himmel«, ruft ein Mann und glotzt zu mir. »Die ist ja fast nackt.«
Zwei junge Frauen schnappen nach Luft und weichen zurück.
»Was ist das?«, flüstert ein junger Mann, dem vor Angst Tränen in den Augen stehen.
»Habt ihr schon mal eine so große Frau gesehen?«, fragt eine alte Marktbesucherin.
»Ihre Haare«, stammelt ein anderer junger Mann. »Sie sind so … so …«
»Sie ist eine von ihnen.«
»Sie kommen.«
»Der Höchste wird uns beschützen.«
»Vater Kneet! Holt Vater Kneet!«
»Die hat Nerven«, tuscheln alle.
Ähm, na ja … ich bin so aufgewacht. Bin barfuß einer Diebin nachgelaufen und dabei in dieses Dorf gestolpert. Und ich bin nun mal groß und nackt.
Die hat Nerven?
Ich bin ein einziges Nervenbündel.
Zwischen all den Gesichtern fällt mir eine Frau mit hellbrauner Haut und langen Korkenzieherlocken auf. Sie trägt einen blaugrünen Schal und sie glitzert. Ihr Glühen ist nicht bernsteinfarben. Nein, ihr Leuchten erinnert mich an den silbrigen Schein des Nachtsterns.
Vor ihr sitzt eine rotgesichtige Frau auf einem Schemel und flicht einen Strohkorb. Sie sieht oder spürt nicht, dass ich zu ihr starre.
Dort ist sie – die Diebin! – und hält sich die verletzte Hand, als sie den Händler verlässt, um eine junge Frau mit kupferfarbenem Haar in einem salbeigrünen Kleid zu begrüßen, das zu dramatisch für dieses dem Untergang geweihte Dorf wirkt. Noch ein Farbtupfer, die roten Haare und das grüne Kleid. Die zwei jungen Frauen gehen Arm in Arm und bis auf die Korbflechterinnen sind sie die Einzigen, die meine Ankunft nicht bemerkt haben.
Über mir wird der Himmel schiefergrau. Die Wolken von vorhin rollen heran, als würden sie mir folgen, und lassen die Dorfbewohner staunend nach oben schauen. Ich werfe einen finsteren Blick zum Himmel und hoffe, dass der Regen wartet, bis ich meine Mission erfüllt habe und aufgebrochen bin nach … nach … wo auch immer ich zu Hause bin.
Ich husche von Wagen zu Wagen, vorbei an Ständen mit runzeligen Karotten und Karren mit scheußlichen Röcken und Kitteln, und nähere mich den beiden Frauen. Versteckt hinter einem Karren, der voller bunter Arzneifläschchen und mit Ringen und Paddeln bemalt ist, beobachte ich, wie die Diebin zu einem anderen Händler geht und ihm meinen Handschuh zur Prüfung hinhält.
Der Händler streckt seine schmutzigen Finger nach meinem Handschuh aus.
Nein, nein, nein! Das lasse ich nicht zu!
Wütend richte ich mich auf und stoße dabei versehentlich ein paar ausgestellte Fläschchen um, die zerbrechen. Die Flüssigkeiten darin riechen nach Minze und Fisch.
Der Verkäufer dieser nun zerbrochenen Fläschchen ist ein froschgesichtiger Mann mit Geschwüren am Hals. Er reckt mir seine grobe Faust entgegen und schreit: »Kohlkopf!«
Kohlkopf? Netter Versuch, mein Herr. Ich verdrehe die Augen und ignoriere die Beschimpfung. Heute habe ich keine Zeit für ihn, ich muss die Diebin verfolgen.
»… lag einfach so da«, erzählt die Diebin ihrer grün gekleideten Freundin, immer noch mit meinem armen Handschuh in der Hand, »mitten im Wald, in diesen fantastischen Klamotten. Also dachte ich mir: ›Olivia, du wirst es bereuen, wenn du diese Schätze an der Leiche des armen Mädchens zurücklässt, denn damit kommen wir schneller raus aus diesem elenden Kaff.‹ Sie war dann aber doch nicht tot, darüber musst du dir also keine Gedanken machen. Und sie ist auch nicht meinetwegen bewusstlos geworden, darüber musst du dir also auch keine Gedanken machen. Außerdem hat sie mich verletzt, mir praktisch die Hand zerquetscht. Meinem kleinen Finger geht es inzwischen wieder besser, dem Höchsten sei Dank. Aber schau dir das an!«
Die Diebin hält inne, um mein Lederwams unter ihren Brüsten an ihren Körper zu drücken. »Entweder mache ich alles enger, weil sie größer und breiter ist als ich, oder ich nähe etwas ganz Neues aus all dem Stoff von dem Umhang. Das könnten wir dann für hundert Gild verkaufen. Zweihundert Gild.«
»Warum musst du immer solche Sachen machen?«, murmelt Kupferhaar. »Du wirst bestimmt einen guten Preis dafür kriegen, aber es fühlt sich an, als wärst du eine Grabräuberin.«
»Ich hab doch gerade erklärt«, sagt die Diebin nun etwas kleinlaut, »dass sie nicht tot war. Ehrlich.«
Kupferhaar seufzt. »Es ist schon ein hübsches Wams. Und dieser Umhang – die Farbe ist ein Traum.«
Als ich die beiden so über meinen Besitz sprechen höre, zersplittert mir die Sicht, und jetzt sind da unzählige prahlende Diebinnen Arm in Arm mit unzähligen kupferhaarigen Mädchen. Ich entscheide mich für die deutlichste prahlende Diebin, stürze los und schubse sie.
»Olivia!«, schreit Kupferhaar.
Olivia kreischt auf, als sie über den Platz fliegt und krachend an einer Kiste mit aufgerollten Teppichen landet. Sie stöhnt und windet sich vor Schmerzen, die Augen zu Schlitzen zusammengekniffen.
Mit zwei Sätzen bin ich bei ihr auf dem schmutzigen Boden, hocke mich rittlings auf sie und drücke ihr den Hals zu.
Ihre von Gelb umgebenen blauen Augen blitzen vor Angst und Überraschung. Sie hustet, ihr Puls pocht wild gegen meine Handflächen und lässt dann langsam nach.
»Hallo«, sage ich, »ich bin’s wieder.«
Wörter! Endlich habe ich Wörter. Ihr an die Gurgel zu gehen, scheint irgendwie die strangulierten Stimmbänder in meiner Kehle gelockert zu haben und jetzt strömen mir die Wörter über die Lippen wie Honig und Rauch.
Kupferhaar hat auch Wörter, laute Wörter, und sie schreit: »Hilfe! Haltet sie auf!«, während sie mir auf den Rücken haut.
Ich ignoriere die Rothaarige und drücke ihrer Freundin weiter den Hals zu. Ich weiß zwar nicht, wer ich bin oder wie ich hierherkam, aber ich weiß ganz sicher, dass ich mich erst komplett fühle, wenn meine Füße wieder in meinen Stiefeln stecken und meine Kette wieder um meinen Hals hängt.
Aber während ich zudrücke, flackert irgendetwas, vielleicht eine Erinnerung, in meinem Hinterkopf auf. Irgendjemand irgendwo hat mir einmal gesagt, dass ich zu schnell handle, zu schnell urteile, zu ungeduldig bin, um die besten Entscheidungen zu treffen, dass ich sorgfältiger über die Konsequenzen nachdenken muss.
In Ordnung. Na gut. Ich werde an meinem persönlichen Wachstum arbeiten, nachdem ich mit dieser verdammten Diebin hier fertig bin.
Denn jetzt gerade bin ich voll und ganz in meinem Element. »Na, wie fühlt sich das an?«, frage ich die Gaunerin. Alle meine Sinne sind hellwach. »Wie fühlt es sich an, wenn du aufwachst und eine Fremde dir den Hals zudrückt? Wie fühlt es sich an, wenn du …«
»Aufhören!«, ruft ein Mann.
»Niemals«, gebe ich zurück, ohne die Missetäterin aus den Augen zu lassen.
»Du hörst jetzt sofort auf«, verlangt er mit krächzender, barscher Stimme.
»Nein, tue ich nicht«, stoße ich zwischen den Zähnen hervor, während Olivia versucht, meine Arme wegzuschieben.
»Aufhören«, wiederholt der barsche Mann, »sonst …«
»Sonst was?«, fordere ich ihn heraus, wobei ich immer noch die Verbrecherin angrinse, die unter meinen Händen buchstäblich in der Klemme steckt.
Was kann mir dieser Kerl schon antun?
Etwas Kaltes, Hartes drückt gegen meine Wange.
Ah.
Das.
Ich weiß zwar nicht, wer ich bin oder wie ich hierherkam, aber ich erinnere mich an Kriegswaffen.
Sie sind scharf. Spitz. Gefährlich.
Und ich habe keine.
Noch nicht.
Und dann berührt noch etwas Scharfes, Spitzes, Gefährliches meine andere Wange. Das ist nicht gut.
Dorfbewohner versammeln sich um uns. Alle glühen bernsteinfarben.
Für sie läuft es gerade auch nicht besonders gut.
Wird irgendjemand von uns diesen Tag überleben?
Einige Dorfbewohner schließen die Augen und beten:
»Höchster, vernichte diese Kreatur.«
»Verbanne sie aus unserer Nähe, in Deinem Namen …«
Kalter Schweiß rinnt mir über die Stirn.
Vernichten? Sie beten für meinen Tod!
»Vertreibe dieses Ungeziefer von unserem Boden.«
»Schütze uns vor dieser Abscheulichen.«
Ich will einfach nur meine Sachen. Warum kann ich nicht einfach meine Sachen zurückhaben? Wieder dreht sich mir der Magen um und eine erneute Welle der Übelkeit zwingt mich, die Augen zu schließen.
»Noch eine Bewegung und du bist tot«, warnt mich der barsche Mann. »Also. Langsam. Nimm die Hände von ihr weg.« Aber seine Stimme klingt nicht so kräftig wie seine Schwerter.
Dennoch habe ich nicht vor, heute zu sterben. Ich knurre die junge Frau an, die unter mir gefangen ist, und löse dann langsam die Hände von ihrem Hals. Auf ihrer blassen Haut bleiben zwei scharlachrote Streifen zurück.
Der Mann steckt eines seiner Schwerter wieder in die Scheide, zerrt mich am Ellbogen hoch und dreht mich, sodass ich ihm gegenüberstehe. Als er zu mir aufschaut, schaudert er und weicht zurück, strafft dann aber die Schultern, als ihm wieder einfällt, dass er derjenige mit den zwei Klingen ist.
Die Gesichter der Verkäufer an den umstehenden Karren sind verzerrt vor Angst und Schrecken. Sie stellen sich mit verschränkten Armen vor ihre Ware, damit ihre Kartoffeln und ihre Keramik nicht in dem Aufruhr zerstört oder gestohlen werden. Andere packen ihre Sachen ganz zusammen, schütteln den Kopf und funkeln mich wütend an, weil ich für die Unruhe verantwortlich bin.
»Diese Augen!«, schreit eine Frau hinter ihm mit blecherner Stimme. »Seht ihr ihre Augen? Golden wie die einer Katze.« Sie zupft an seinem schmutzigen Kittel und ruft: »Du bist doch der Wächter, Johny! Tu was! Halte sie auf!«
Mich aufhalten? Wobei? Er ist doch derjenige, der mich mit einer Waffe bedroht.
Johny steckt auch die zweite Klinge ein, packt mich fester am Arm und hebt dann stolz das magere Kinn. »Wir wollen keine Schlammkriecher in unserem Dorf.«
Schlammkriecher? Ich bin keine Schlammkriecherin.
Wenn hier irgendjemand aussieht, als wäre er im Schlamm herumgekrochen, dann dieser Kerl mit seinem albernen, rostigen Helm und dem schäbigen, befleckten Bauernkittel.
Sei nicht wie die anderen, Johny. Du kannst das! Bitte sei besser!
»Diese Gorga hat Olivia völlig grundlos angegriffen!«, schreit Kupferhaar und versucht, Olivia aufzuhelfen.
Ich schnaube und sage dann: »Oh, ich habe sehr wohl einen Grund.«
Olivia fällt keuchend auf den Hintern. »Sie ist über mich hergefallen!«, bringt sie krächzend heraus.
»Schaut ihr nicht in die Augen! Ihr seid verflucht, wenn ihr ihr in die Augen schaut!«, behauptet die Frau mit der blechernen Stimme.
Alle ignorieren Blechstimmes Warnung und gaffen mich an.
Nachtsternglitzer mit den Korkenzieherlocken, die neben der Korbflechterin gestanden hatte, stellt sich nun neben mich. Sie wirkt gebückt, älter, als ich sie so aus der Nähe betrachte. Schnell streicht sie mit einer Hand über mein Ohr. »Du solltest nicht hier sein«, flüstert sie. Aber sie flüstert gar nicht – sie hat nicht mal den Mund geöffnet.
Was ist das jetzt für ein Trick und warum kann ich hören …?
Als die Frau den Schal um ihre schmalen Schultern zieht, ertönt ihre Stimme in meinem Kopf: »Du gehörst nicht hierher.«
Mir klappt die Kinnlade herunter. Wie kann ich sie hören?
»Dies ist ein Geschenk«, sagt sie – nein, denkt sie. »Erwarte keine weiteren von mir.«
Meine Überraschung schlägt rasch in Ärger um und nun funkle ich sie an.
Erstens habe ich sie nicht um irgendwelche Geschenke gebeten, schon gar nicht darum, die Gedanken anderer zu hören.
Und zweitens: »Auf gar keinen Fall gehöre ich hierher.«
Ich meine … diese Leute beten für meinen Tod.
Die Frau schüttelt kaum merklich den Kopf. »Ich weiß.«
Ich erschaudere. Hat sie mich gehört?
Sie presst die Lippen fest zusammen. »Ja, ich habe dich gehört. Jetzt pass gut auf: Verschwinde, so schnell du kannst.«
Ich ziehe die Augenbrauen hoch. »Und wie soll ich das anstellen?«
Der Himmel über uns verfinstert sich. Die leichten weißen Wolken ziehen fort und dunkelgraue rollen heran. Viele Dorfbewohner und Händler um mich herum starren zum Himmel, während sich aufgeregte Stille über eine Ortschaft legt, die seit Ewigkeiten keinen Regen mehr gesehen hat.
»Ich sagte, wie heißt du?«, schreit Johny, der Wächter, und schüttelt mich am Arm. »Zwing mich bloß nicht, noch mal zu fragen.«
Es rattert in meinem Kopf, aber ich komme nicht drauf. Ich habe nicht mal eine vage Ahnung. Nachdem das Rattern aufgehört hat, bleibt nur das leise Rauschen von Leere zurück.
Nicht gut.
Trotzdem hebe ich das Kinn und strecke die Brust raus. »Nenn mich … nenn mich …« Auf meiner Stirn bilden sich Schweißtropfen und wieder dreht sich alles in meinem Kopf. »Mein Name ist …«
Cassandra? Rose? Marget?
Nichts davon klingt richtig. Nichts davon fühlt sich richtig an.
Warum kenne ich diese Namen, erinnere mich aber nicht an meinen eigenen?
Johny presst meinen Arm zusammen.
Aua! Meine Knie geben nach.
»Und wo sind deine Kleider?« Sein feindseliger Blick verweilt auf meinem schmalen Brustband und den Kurven darunter, liegt wie ein Felsbrocken auf meiner Brust.
Ich nicke zu der Diebin namens Olivia. »Die da hat meine Kleider. Sie hat meine Kleider gestohlen.«
Ich hatte gehofft, dass Johny besser wäre als die anderen. Aber dem lüsternen Blick nach zu urteilen, mit dem er meine Haut abtastet, ist er schlimmer.
Am liebsten würde ich ihm die Augen auskratzen. Und das werde ich auch. Eher früher als später. Aber zuerst brauche ich meine Sachen.
»Nimm diese Schlammkriecherin fest!«, kreischt eine Frau mit schmutziger Haube. »Nimm sie fest wegen versuchten Mordes! Wegen Unsittlichkeit!«
Die Wolken drücken nach unten, die Dorfbewohner drängen sich dichter um mich und die Luft wird noch dicker. Der beißende Gestank von hundert Körpern überwältigt mich, ihr Schweiß und ihre Angst mischen sich mit dem Geruch von Schafen, Staub und verfaulendem Gemüse. Markttage sollten nach Gewürzen, Obst und frisch gebackenem Brot riechen. Nicht nach Scheiße und Schafen.
Die Dorfbewohner ziehen weiter über mich her.
»Wenn Fremde hierherkommen, bedeutet das nie etwas Gutes.«
»Der Höchste hat sie verflucht. Schaut sie euch nur an!«
»Diese Kreise auf ihrem Brustband! Hexerei.«
»Seht ihr die Elche und die seltsamen Wirbel auf ihrer Hose?«
Manche formulieren es in Gedanken, während andere untereinander oder zum Himmel flüstern, als würden sie sich beim Anblick einer Sternschnuppe etwas wünschen. So viele Urteile über mich, aus Furcht vor mir, einer halb nackten Frau und jetzt einer Hexe, und ihre Worte prallen in meinem Kopf aufeinander und lassen mein Herz zerspringen. Alles davon schmerzt und droht mich zu zerreißen. All dieses gleißend bernsteinfarbene Licht zwingt mich zu blinzeln und dieser Lärm macht es mir unmöglich, mir meinen Namen ins Gedächtnis zu rufen, und ich will die Augen schließen, um mich auszuruhen und zu erinnern. Aber dafür ist dies weder die richtige Zeit noch der richtige Ort.
Ich gehöre nicht hierher? Auf gar keinen Fall.
Wenn sie nur aufhören zu flüstern und einmal durchatmen, wenn sie mich nur erklären lassen, werden sie es verstehen. Sie werden sagen: »Oh, ja, das ist nachvollziehbar«, und dann werden sie sich Olivia vornehmen und sagen: »Stell dich nicht so an. Gib ihr sofort ihre Sachen zurück.« Dann wird Olivia mir alles aushändigen, was sie gestohlen hat. Und dann verlasse ich vollständig bekleidet ihr hässliches kleines Dorf und komme nie wieder zurück.
Johny rüttelt mich am Arm. »Willst du in meinem Dorf die starke Frau spielen? Wir werden ja sehen, wie stark du bist.«
Verzweifelt blicke ich zu Nachtsternglitzer, der einzigen Person in diesem Dorf, die möglicherweise auf meiner Seite ist. Aber sie legt nur den Kopf schief und schaut zu. »Sie verstehen das nicht, Kind. Sie sind sterbenskrank und verzweifelt. Und sie werden dafür sorgen, dass auch du stirbst, wenn du so weitermachst.« Ihre Gedanken sind so hell und fern von den anderen wie der Tagstern.
»Darum glühen sie bernsteinfarben, nicht wahr?«, frage ich sie in Gedanken.
Die Frau nickt leicht.
»Komm schon, trödel nicht herum.« Johny zerrt mich vom Markt weg und einen Trampelpfad entlang, der mit jedem Schritt steiniger wird. Aus dem Augenwinkel sehe ich, wie Kupferhaar den Saum eines Umhangs, meines Umhangs, benutzt, um der Diebin die Tränen von den geröteten Wangen zu wischen.
Offenbar habe ich Olivia nicht genug gewürgt – sie steht immer noch dort und atmet.
Warum tritt Nachtsternglitzer nicht für mich ein? Sie weiß, dass ich nichts falsch gemacht habe. Warum war sie erst freundlich und lässt mich jetzt im Stich? Mir wäre es lieber gewesen, wenn sie mich verteidigt hätte, statt mir das »Geschenk« zu machen, die Gedanken von Schwachköpfen zu hören.
Einige Dorfbewohner folgen uns, als Johny mich zu einem verfallenen, flachen Gebäude zieht, das geradezu strahlt vor Todesglühen. Über der Tür dieser fensterlosen Baracke ist ein bronzener, mit Rudern versehener Ring festgenagelt und die Erde um sie herum ist übersät mit braunen und faulig-grünen Klumpen. Fette, glückliche Fliegen summen um die Eisentür herum. Dem Geruch nach finden sie hier reichlich zu fressen.
In diesem ekelhaften Schuppen sind schon viele Menschen gestorben. In diesem ekelhaften Schuppen sterben immer noch viele Menschen, und obwohl ich sie durch die offene Tür nicht erkennen kann, sehe ich doch ihre bernsteinfarbenen Silhouetten, zusammengedrängt wie die Zähne dieses Wächters. Aber ihre Gedanken kann ich nicht hören. Vielleicht, weil die Leute, die zwischen diesen verrottenden Bretterwänden eingesperrt sind, kaum noch am Leben sind.
»Die hier ist wohlgenährt«, bemerkt eine Dorfbewohnerin. »Die wird’s im Kittchen schön lang aushalten.« Dann spuckt sie mich an und hält mir eins dieser Ringzeichen vors Gesicht.
»Sie hat auch keine Wunden auf der Haut«, fügt Schmutzhaube hinzu und umklammert ein kleineres Ringzeichen, zögert aber, es in meine Richtung zu halten. Um diese Frau ist das bernsteinfarbene Glühen am deutlichsten. Die Entzündung an ihrer Oberlippe eitert heftig und verstärkt das übrige Gift, das durch ihr Blut strömt. Sie sollte sich dringend darum kümmern, dass ihr Herz nicht aussetzt, statt mich zu quälen.
»Das wird sich im Knast bald ändern«, sagt die Spuckerin.
Sie lachen.
Wo ist Nachtsternglitzer? Ich lasse den Blick über die Menge schweifen. Sie ist nicht mehr da.
In meiner Brust steigt Panik auf. Das ist schlimmer als kalte Leere. Kalte Leere kenne ich. Aber dieses Gefühl ist schrecklich. Ich habe von Panik gehört, sie aber noch nie empfunden. Bis jetzt. Von der Gehässigkeit dieser Dorfbewohner und meiner Unfähigkeit, mich an irgendwas zu erinnern, fühle ich mich … überwältigt.
»Ist es ungefährlich, die da mit den anderen Gefangenen einzuschließen?«, fragt ein älterer Mann mit angefaulten Zähnen. »Wenn sie ein Geist ist, kann sie den anderen da drinnen die Lebenskraft aussaugen.«
»Aber Geister sehen nicht so aus«, sagt die Spuckerin. »Geister haben schrumpelige Haut und spitze Finger. Und sie berühren auch nicht den Boden. Aber die hier – schaut sie euch doch an. Trampelt hier herum auf ihren großen Füßen.«
»Und was ist sie dann?«, fragt der Mann.
Ich versuche, einen tiefen Atemzug zu nehmen, aber es gelingt mir nicht. Ich will schreien: »Ich bin niemand, gar nichts, lasst mich einfach gehen«, aber um zu schreien, müsste ich atmen. Ich kann nicht atmen, nicht schreien und nicht denken, weil ich Panik habe, weil ich nicht atmen kann. Überwältigt.
»Die ist ’ne Gorga«, sagt Schmutzhaube.
Gorga? Diese verbale Ohrfeige stoppt mein Gedankenkarussell.
»Gorga gibt’s nicht mehr.«
»Vielleicht ist sie ’ne Jundum. Die haben dieses Dorf schon mal verflucht. Haben Miasma mitgebracht.«
Jundum? Mias… was? Wovon reden diese Leute? Das ist eine Unverschämtheit. Grotesk. Aber dieser Abstecher ins Absurde gibt mir etwas, woran ich mich festklammern kann. Welche albernen Vorstellungen davon, wer und was ich bin, werde ich als Nächstes zu hören bekommen? Ich weiß zwar nicht viel über mich, aber immerhin weiß ich, dass ich kein beschissener Troll und keine Gorga bin.
»Sie ist eine von den Abscheulichen«, sagt die Spuckerin.
»Aber sind die Abscheulichen nicht die Schönsten von allen? Die ist doch nicht schön«, meint Schmutzhaube.
»Überhaupt nicht«, sagt Johny.
Ich kann nicht fassen, dass diese schrecklichen Leute derart schreckliche Dinge sagen. Ich kann nicht fassen, dass diese schrecklichen Leute mit ihren angefaulten Zähnen und schmutzigen Haaren, ihren blutenden Entzündungen und Warzennasen mich abscheulich nennen. Ein kleiner Teil von mir will lachen, aber eigentlich ist mir zum Heulen zumute.
Ihr Lärm und ihre Ausdünstungen hauen mich fast um, und nicht ein Mensch aus der Menge sagt: »Vielleicht sind wir voreilig«, oder: »Ich finde, wir sollten uns anhören, was sie zu sagen hat«, oder sonst irgendwas, was ihn vom Rest abheben würde.
Ich schwanke in Johnys Griff. Seine Hände verbrennen mir die Haut und seine Berührung verbiegt etwas Tieferes, etwas Unberührbares in meinem Inneren. Trotz des nahezu überwältigenden Gestanks aus diesem Gefängnis möchte ich mich an seine Wand lehnen, nur um aufrecht stehen zu können. Nur um mein Gleichgewicht zu finden, bevor ich mir meine nächsten Schritte überlege, mir überlege, wie ich dem Griff dieses Monsters entkomme.
Aber Johny lässt mich nicht los, also kann ich mich nirgendwo anlehnen außer an ihm.
Ich beiße die Zähne zusammen. Nein. Niemals. Lieber versinke ich hier, direkt vor diesem Gefängnis, und lasse die ganze Scheiße aus jedem Dorf in diesem Reich über mich fließen, bis ich ertrunken und im Angesicht ihres geliebten Höchsten wieder erwacht bin.
In der Ferne grollt Donner über die Hügel, die Brise wird zu Wind und lenkt die Menge ab. Die Wolken, die mir zu diesem Dorf gefolgt sind, öffnen sich schließlich und Regen weht wie zerrissene Schleier vom Himmel und weicht die harte Luft auf. Schon bald fallen Regentropfen auf das bernsteinfarbene Glühen der Dorfbewohner. Das Wasser trifft auch mich und ich fühle mich schwerer, schwächer.
Die Menge starrt zu den tröpfelnden Wolken. »Los! Holt die Eimer!«, schreit die Spuckerin.
Die nun schlammigen Pfade leeren sich, weil die Dorfbewohner in ihre Häuser rennen und dann wieder heraus, um Kübel auf die Kieswege, das vertrocknete Gras und unter die Dachvorsprünge aller Gebäude zu stellen. Klank-klank-klank. Das herabfallende Wasser lässt verblasste Farben dunkler werden. Die Blätter der Bäume schwellen an, während die ausgedörrte Erde die Regentropfen in sich aufsaugt, sobald sie auf dem Boden aufkommen.
Die fahrenden Händler vor ihren Karren werden unruhig. Zuerst ein nackter Geist und jetzt auch noch Regen? Sie holen Planen und Leinwand hervor, um ihre Ware abzudecken, und glotzen mich dann weiter an.
Johnys Griff um meinen Arm wird trotz der Aufregung nicht lockerer. Nicht einmal der langersehnte Regen nach der Dürre kann ihn von seiner Aufgabe ablenken. Er pfeift und ruft dann: »Narder! Hier kommt noch jemand für dich.«
»Du kannst mich nicht festnehmen«, widerspreche ich. »Ich habe nichts verbrochen.«
Ein Mann, an dessen Wams ein rostiger Schlüssel festgebunden ist, stapft durch den Regen auf uns zu. Seine buschigen Augenbrauen zeigen nach unten und sein Blick kratzt wie Krallen über meine Haut. Sein schmales, pockennarbiges Gesicht war schon lange nicht mehr mit Wasser und Seife in Kontakt. Fliegen schwirren um ihn herum, als wären sie seine Haustiere.
»Johny!«, poltert er. »Was hast du denn da?« Seine Stimme rasselt vor Schleim und Bösartigkeit.
»Ein neues Spielzeug für dich«, antwortet der Wächter. »Kein schlechter Anblick, was? Die läuft hier durch den Ort, erschreckt die Leute und macht nichts als Ärger. Wir können sie fürs Erste hier im Knast unterbringen.«
»Warum werde ich bestraft?« Ich zeige auf die Diebin und Kupferhaar, die jetzt zum nassen Himmel starren. »Sie hat mich bestohlen! Nehmt sie fest!«
Johny packt mich noch gröber am Arm und ich zucke zusammen.
»Das ist nicht richtig«, protestiere ich.
Niemand eilt mir zu Hilfe.
Mir rutscht das Herz in die Hose – wenn ich dieses Gebäude einmal betreten habe, komme ich nie wieder raus, das weiß ich. Zumindest nicht als das Ich, das ich sein sollte. Aber ich kann nichts tun, als zu schreien: »Lass mich los!«, und mich gegen den Wächter zu werfen, um mich aus seiner Hand zu befreien.
Aber Johnys Griff ist zu fest und zu sicher.
Wut und Angst steigen in mir auf, als Narder mich am anderen Arm packt. Meine Beine geben nach. Ich leiste zwar mit aller Kraft Widerstand, aber meine nackten Füße rutschen im frischen Matsch aus. Ich könnte heulen vor Zorn, Frust und Verwirrung, aber ich weigere mich, auch nur eine Träne zu vergießen, selbst als die zwei Männer mich näher zu meinem Verderben zerren.
»Oh ja«, sagt Narder, der Gefängnisaufseher. »Die ist ganz schön bockig.«
»Und ich werde mich über sie hermachen«, denkt er.
»Wenn du mich anfasst«, fauche ich, »dann werde ich …«
»Dann wirst du was?« Johny kneift mich in den Arm, bis ich aufschreie. Zu Narder sagt er: »Eine große Klappe hat sie auch. Ich weiß ja, dass du die Feurigen am liebsten magst.«
Gut, also bringe ich erst Johny um und dann Narder, aber erst, nachdem ich …
»Stopp!«, ruft eine Frau.
Erst, nachdem ich sie umgebracht habe.
Die Diebin – Olivia – stürmt mit erschrockenem, aber entschlossenem Gesichtsausdruck den schlammigen Pfad entlang. Irgendwie hat sie sich in der Zwischenzeit umgezogen. Denn jetzt trägt sie einen schwarzen Brokatumhang und ein blaues Kleid mit hoher Taille knapp unter ihren Brüsten. Und das ist auch nicht mein Umhang da auf ihren Schultern. Was hat sie mit meinem Wams und meiner Kette gemacht? Die schwarzen Stiefel an ihren Füßen sind von mir. Und die knallroten Handabdrücke an ihrem blassen Hals? Die sind auch von mir. An Kupferhaars Schulter hängt eine vollgestopfte Ledertasche. Haben sie da drin meine Sachen versteckt?
»Das hier geht dich nichts an, Olivia«, knurrt Narder.
»Ich lasse die Anklage fallen.« Olivias Augen sehen im Regen wild aus und sie hat seit vorhin jede Menge Fassung und Autorität hinzugewonnen. Nun, mit straffen Schultern und erhobenem Kinn, funkelt sie die vor ihr stehenden Männer an. »Habt ihr nicht gehört? Ich möchte, dass ihr bitte Abstand nehmt.«
Der Wächter und der Gefängnisaufseher sehen einander an, dann werfen sie die Köpfe nach hinten und brechen in Gelächter aus.
»Die hält sich wohl für die Königin«, sagt Johny wiehernd.
»Dass ihr bitte Abstand nehmt«, äfft Narder sie mit hoher Stimme nach.
Die Menge lacht. Das Todesglühen, das um ihre Körper und auch den Wächter und den Gefängnisaufseher geleuchtet hat, ist dank des Regens fast erloschen.
»Das ist kein Scherz«, sagt Olivia naserümpfend. »Lasst die junge Frau sofort frei. Bitte.«
»Auf wessen Befehl?«, spottet der Wächter nun wieder humorlos. »Ach, richtig. Du bist ja nicht befugt, welche zu erteilen, du einfältige Lügnerin. Mich täuschst du nicht schon wieder. Nicht nach dem letzten Mal.«
Olivia errötet und schüttelt den Kopf. »Das ist alles ein großes Missverständnis. Sie dachte, ich hätte ihr etwas gestohlen, was natürlich nicht stimmt.«
»Leere deine Taschen aus«, verlange ich. »Auch die Ledertasche! Sie hat mein Amulett versteckt.«
Der Wächter schüttelt mich. »Sei still.«
Olivia wirft mir einen verärgerten Blick zu und ich höre ihre Gedanken klarer als meine eigenen: »Höchster im Himmel, Mädchen. Schweig einfach und lass mich die Sache regeln.«
Zu Olivia sagt der Wächter: »Du kennst das Spiel. Leere deine Taschen aus. Jetzt.«
Olivia zieht eine der Umhangtaschen heraus. Leer. »Zufrieden?«
»Zeig mir auch die andere«, verlangt der Wächter.
Olivia zögert, murmelt: »Na gut, was soll’s«, und holt dann meinen Anhänger aus der zweiten Umhangtasche. Ihre Wangen und Ohren werden tiefrot.
»Was habe ich gesagt? Das gehört mir!« Ich stürze mich auf meine Kette, aber der Wächter zerrt mich zurück.
Ein eisblauer Blitz zuckt über den Himmel und färbt die dunklen Wolken lila. In der Ferne jubeln die Dorfbewohner und werfen noch mehr Eimer aus den Fenstern. Klank-klank-klank.
Vielleicht werden meine Peiniger ja von einem Blitz getroffen.
Johny lacht und tippt an meinen Anhänger. »So ein Theater wegen diesem Schrott? Diese Kette sieht aus wie etwas, was meine Oma tragen würde.«
Der Gefängnisaufseher stimmt in sein Gelächter ein.
Sogar Olivia muss grinsen.
»Aufhören«, flehe ich, den Tränen nahe. »Gebt mir einfach, was mir gehört, und ich verschwinde.« Meine Beine werden noch schwächer, ich knicke ein, rutsche aus Johnys Griff und falle auf die Knie. Es fühlt sich an, als würden Blitze über meine Kopfhaut knistern. Wenigstens bringt der Regen etwas Erleichterung.
Olivia mustert mich besorgt und wendet sich dann an den Wächter: »Lass uns ein Geschäft machen, wie beim letzten Mal. Du lässt die Frau gehen, und ich verkaufe die Kette in Pethorp und teile die Gild mit dir. Wegen der Dürre und allem weiß ich, dass du die Gild brauchst. Und du weißt, dass ich die Gild brauche …«
»Sie gehört nicht dir«, schreie ich aus dem Schlamm. »Du kannst sie nicht verkaufen. Das lasse ich nicht zu.«
»Halt die Klappe.« Der Wächter wirft Olivia die Kette zu und tritt mir dann gegen den Arm, sodass ich mit dem Gesicht in der nassen Erde lande. Und plötzlich bin ich doch eine Schlammkriecherin.
»Hör auf«, fleht Olivia. »Du tust ihr weh.«
»Sie ist eine Dashmala«, sagt Narder verächtlich. »Die spüren keinen Schmerz.« Er tritt mir in die Seite. »Siehst du? Das hat sie nicht gespürt.«
Und wie ich das gespürt habe. Hitze breitet sich in meinen Knochen aus und nimmt mir den Atem. Der Schmerz in meinen Rippen strahlt in alle Richtungen aus. Trotzig raffe ich mich auf und gehe in die Hocke, um die Wächter zornig anzustarren.
»Ich hab noch nie irgendwelche Dashmalakrieger in Maford oder Pethorp gesehen«, sagt Narder. »Scheint so, als würde sie bald sterben, ist mit allen möglichen Krankheiten infiziert. Sie sieht vertrocknet aus. Wisst ihr, so wie Erde, wenn sie hart wird, bevor keine Karotten und Kartoffeln mehr darin wachsen? Genau so sieht sie aus. Ich kenn mich aus mit harter Erde und glaubt mir: Dieses Weibsbild ist harte Erde.«
Olivias Gesichtsausdruck verwandelt sich blitzschnell von Schrecken in Ärger. »Das stimmt überhaupt nicht. Sie ist keine harte Erde. Schaut sie euch doch an!« Sie schiebt Narder von mir weg. »Bitte hör auf.«
Narder weicht mit erhobenen Händen zurück und macht sich über Olivia lustig. »Hast du so was schon gesehen?«, fragt der Gefängnisaufseher den Wächter.
»Lasst ihr sie jetzt endlich gehen?« Olivia steckt meine Kette wieder in ihre Umhangtasche. »Bei meiner Ehre, sie wird euch keine Probleme mehr machen. Ihr müsst mir glauben.«
»Dir glauben?«, sagt Johny mit großen Augen. »Bei deiner Ehre?« Er macht eine wegwerfende Handbewegung. »Du bist neunzehn. Du hast keine Ehre. Und die Bronzebecher, die du mir letzte Woche verkauft hast, hatten Löcher.«
Olivia schüttelt den Kopf. »Aber das hier ist was anderes …«
Johny mustert Olivia und leckt sich die fleischigen Lippen. »Hast du nicht gehört? Ich mach bei deinen Gaunereien nicht mehr mit. Jetzt verschwinde wieder an deinen Nähtisch, bevor ich dich wegen Ruhestörung festnehme.«
»Jawohl«, bekräftigt Narder, »du hast hier nichts zu melden.«
»Aber ich«, ertönt eine tiefe Stimme inmitten der Menge.
Der Mann, der gerade gesprochen hat, ist breitschultrig und zwei Köpfe größer als der größte der umstehenden Männer. Sein walnussbraunes Haar ist aus der Stirn gekämmt. Die Menge teilt sich, als er mit großen Schritten und hocherhobenem Kopf auf uns zukommt. Das Weiße seiner blauen Augen ist nicht vergilbt wie bei den anderen.
Er ist ein Geschenk, eine wundervolle Ablenkung, eine Augenweide in diesem Dreckskaff.
Ich blinzle ihn an und vergesse für eine Sekunde, dass ich stocksauer bin und unter Schmerzen im Matsch knie. Denn bei meinem Honigtöpfchen, wenn das der Mann ist, der mich retten soll, würde ich mich sofort noch mal von Johny gefangen nehmen lassen. Na ja, vielleicht doch nicht. Aber trotzdem …
Der Hübsche bleibt neben Olivia stehen und stemmt die Fäuste in die Hüften. Vor dem Schmutz dieses Dorfs ist auch er nicht gefeit. Um seine große rechte Hand ist ein befleckter Verband gewickelt und Ruß bedeckt die Nagelbetten seiner linken. Wenn er irgendwo anders als hier leben würde, wäre er ein schneidiger Ritter oder mächtiger Zauberer. Wie schade, dass er ein Niemand in einem Dreckskaff ist. Er sieht Olivia streng an und mustert mich dann besorgt.
»Was ist hier los?«, fragt der Hübsche Olivia.
»Jadon, das Ganze ist ein Missverständnis«, sagt sie.
»Deine diebische Schwester hat mal wieder was verbockt«, höhnt Narder. »Also, Jadon, welche Weisheit lässt du uns niederen Kreaturen heute zuteilwerden?«
Ich ziehe eine Augenbraue hoch. Na, Jadon?
Jadon reibt sich stirnrunzelnd über die kurzen Bartstoppeln an seinem kantigen Kiefer. Ich höre die Gedanken, die an seine Schwester gerichtet sind: »Machst du schon wieder Ärger, Olivia? Muss das immer sein?« Dann kehrt sein Blick zu mir zurück. »Arme Frau«, denkt er. »Arme, schöne Frau.« Er räuspert sich und zeigt erst auf Narder und dann auf mich. »Hilf ihr auf, Narder«, befiehlt er.
Narder grummelt und zieht mich widerwillig hoch.
Jadon dreht sich zu Olivia. »Was hast du ihr getan?«
»Nichts«, sagt Olivia. »Ich hab ihr kein Haar gekrümmt. Wirklich, das ist alles ein schreckliches Missverständnis und ist schon viel zu weit gegangen.«
»Dann klär das Missverständnis auf«, sagt Jadon und nickt mir zu, wie um zu sagen: »Jetzt bin ich da, also ist alles in Ordnung.« Er mustert mich, um sich zu vergewissern, dass es stimmt. Sein Blick verweilt auf meinen Hüften und ein Gedanke wird lauter als alle anderen: »Höchster im Himmel. Selbst mit Schlamm überall …«
In jeder anderen Situation hätte ich seinem Urteil rückhaltlos zugestimmt und erwidert: »Ja, oder? Ich bin schon eine Sensation. Danke, dass du das bemerkt hast.« Aber ich bin voller Dreck und Hühnerfedern und Narders fleischige Pranke hält mich immer noch am Arm. Wenn Jadon eine private Führung durch meinen geheimen Garten wünscht, muss er erst mal in Ordnung bringen, was seine Schwester angestellt hat. Und dann muss er mir Seife und sauberes Wasser besorgen. Außerdem etwas Gebäck, ein Fässchen Rum und alle meine gestohlenen Besitztümer.
»Ich versuche ja, alles zu erklären, aber mir hört keiner zu«, grummelt Olivia. »Eigentlich ist es ganz einfach. Pass auf: Diese arme Frau dachte, ich hätte etwas, was ihr gehört, darum sind wir aneinandergeraten und, na ja, ich habe versucht abzuhauen, aber sie ist auf mich drauf gefallen, weil es hier so rutschig ist bei dem plötzlichen Schauer, und ist es nicht toll, dass es endlich mal regnet?«
»Schon gut, schon gut«, sagt Narder und verdreht die Augen.
»Olivia«, warnt Jadon.
»Es ist alles ein Missverständnis«, fährt Olivia fort. »Wirklich. Darum möchte ich – ich meine, Jadon möchte die Anklage fallen lassen.«
Ich traue meinen Ohren nicht. »Absoluter Schwachsinn.«
»Wenn du wüsstest.« Jadons glühender Blick trifft auf meinen, bevor er seine Aufmerksamkeit wieder seiner Schwester zuwendet. Er ist ein paar Jahre älter als Olivia, vielleicht drei- oder vierundzwanzig, und mit den grauen Ringen unter den Augen sieht er aus, als hätte er noch nie geschlafen. Wie viele »Missverständnisse« hat Olivia pro Tag, bei denen er vermitteln muss?
»Das alles tut mir leid«, sagt Olivia zu Johny und Narder. »Versuchen wir nicht alle, irgendwie zu überleben? Halten wir uns nicht alle gerade so über Wasser? Nutzen eine Gelegenheit, wenn sie sich bietet?«
Noch mehr Schwachsinn.
»Olivia, du redest schon wieder dummes Zeug.« Jadon atmet hörbar aus und wendet sich dann an Johny und Narder. »Typisch Olivia … Aber wo sie recht hat, hat sie recht. Die Ernte reicht nicht, um das Dorf zu ernähren. Niemand kann sich irgendwas leisten, nicht mal Essen. Ich meine, im Ernst. Schaut euch doch diesen armseligen Markt an.« Er deutet auf die traurige Ansammlung von Wagen in der Ortsmitte, deren Verkäufer uns immer noch beobachten.
Wie aufs Stichwort bricht ein Rad an einem Holzkarren, sodass welke Rüben und schrumpelige Kartoffeln in den Matsch rollen.
Jadon schüttelt den Kopf und schaut wieder zu Narder und Johny. »Alle sind erschöpft und fahren darum schnell aus der Haut. Also lasst uns einmal durchatmen und uns entschuldigen …«
»Entschuldigen?«, unterbreche ich ihn. »Sie hat meine Sachen gestohlen.« Mir ist egal, wie gut er aussieht – mich wird er nicht davon überzeugen, dass ich im Unrecht bin, und ich lasse auch nicht zu, dass er uns alle beruhigt, ohne das Problem zu lösen.
»Na gut.« Olivia holt tief Luft und atmet dann langsam aus, genau wie ihr Bruder eben. »Ich entschuldige mich … Wald…mädchen. Ich wollte dir kein Leid zufügen.«
»Ich brauche immer noch meine Sachen«, beharre ich.
»Was ist mit Freyneys Karren und den zerbrochenen Fläschchen?«, fragt Narder Jadon, ohne mich zu beachten.
Oh. Ja. Das. Ich habe tatsächlich ein paar Sachen umgestoßen, bevor ich losgesprungen und auf einer Diebin gelandet bin.
»Und was ist mit der Störung der öffentlichen Ordnung, die sie verursacht hat?«, fragt Johny. »Alle – und du ganz besonders – sollten sich freuen. Denn endlich haben wir eine von ihnen erwischt! Und dir ist sicher nicht entgangen, dass sie nackt hier herumsteht.«
Aus Jadons Kehle dringt ein ersticktes Geräusch und demnach, wie sein Mund erstarrt, weiß er schon, dass er über jedes Wort stolpern wird, das er sagen will. Also macht er nur: »Hmm.«
Nein, es ist ihm nicht entgangen.
»Wir brauchen diese Arzneifläschchen«, fährt Narder fort. »Bist du bereit, dafür zu bezahlen?«
»Bezahlen?«, stößt Jadon hervor, der plötzlich seine Stimme wiedergefunden hat. »Auf gar keinen Fall! Ich habe kein Geld, um ausgerechnet Freyney zu bezahlen!«
»Dann muss sie ihre Schulden abarbeiten«, sagt Narder.
»Was?«, rufe ich. »Ich bin diejenige, der jemand etwas schuldig ist – und zwar meinen Besitz.«
»Wo soll sie wohnen, während sie ihre Schulden abarbeitet?«, knurrt der Gefängnisaufseher, der mich weiter ignoriert. »Wir haben keinen Platz. Zumindest nicht für jemanden wie sie.« Er macht eine Pause und hält dann einen schmutzigen Finger hoch. »Hey! Da fällt mir etwas ein! Sie könnte in meiner wunderbaren Strafanstalt hier unterkommen.« Er schielt lüstern zu mir. »Oder sie kann in meiner Hütte schlafen.«
»Im Bett ist noch Platz«, sagt Johny und stößt ihn mit dem Ellbogen an, »jetzt, nachdem Marget tot ist.«
Angewidert funkle ich die beiden Männer an. »Dann schlafe ich lieber bei der toten Marget.«
Olivia breitet die Arme aus. »Sie wird bei uns wohnen.«
Jadon und ich schrecken beide zusammen. »Nein, wird sie nicht«, sagt er, während ich sage: »Nein, werde ich nicht.«
»Wir haben Platz in der Scheune«, sagt Olivia und nickt. »Gut. Wunderbar. Das wäre geklärt.« Sie wirft Jadon einen Blick zu und dreht sich dann strahlend zu mir. »Es ist geklärt«, höre ich sie denken. »Jetzt sei bitte still.«
Der Wächter deutet auf Jadon. »Sorgst du auch dafür, dass sie Freyney alles bezahlt, was sie ihm schuldet? Wenn ich das so überschlage … sollten zwölf Gild wohl reichen.«
»Zwölf?«, wiederholt Olivia, die entgegen ihrem eigenen Rat selbst nicht still ist. »Aestard hat letzte Woche seinen Vater umgebracht und musste nur drei Gild bezahlen.«
»Sein Vater war ein vertrottelter Ketzer, der es verdient hatte, einen Kopf kürzer gemacht zu werden«, zischt Johny. »Es macht sechs Gild für Freyney und sechs Gild für die Störung im Dorf. Sie hat den Markttag unterbrochen und jetzt bekommen die Wanderweber vielleicht den falschen Eindruck – dass wir diebische, schlammkriecherische Dashmala dulden, dass unsere Leute nackt herumlaufen, Karren umstoßen und Chaos stiften. Und wenn sie nicht mehr herkommen, kriegen wir weder frisches Gemüse noch guten Wein oder sonst irgendwas, was wir zum Leben brauchen. Sechs Gild für Freyney, sechs Gild für mich. Zwing mich nicht, es auf je sieben anzuheben.«
»Aber warum ist ihr Preis so hoch?«, fragt Olivia.
»Olivia«, fährt Jadon sie an.
Johny bückt sich, bis er mit der Diebin auf Augenhöhe ist. »Das ist der Preis, den sie schuldig ist. Und wenn sie abhaut, wird das der Preis sein, den du schuldig bist, und sie wird noch mehr von ihrer Sorte hierherbringen. Darum rate ich dir, sie im Auge zu behalten. Sonst fordern Narder und ich die Gild von dir ein.«
»Wir haben immer noch nicht über die Tatsache gesprochen, dass sie mir meinen Besitz weggenommen hat«, stoße ich wütend hervor. »Wann kriegt sie eine Strafe von zwölf Gild …«
Johny dreht sich mit erhobenem Schwert zu mir.
Ich ducke mich und warte, dass er mich damit trifft.
»Halt.« Jadon schreit nicht, aber der Wächter schreckt trotzdem zurück und erstarrt augenblicklich.
Mir pocht der Schädel. Sonst fühle ich nichts, denn ich bin wie betäubt.
»Runter mit dem Schwert, Johny«, sagt Jadon mit finsterem Blick. »Und jetzt sag mir mal eins, unter vernünftigen Männern. Wie soll sie zwölf Gild verdienen, wenn niemand in diesem Dorf genug Geld hat, um Essen zu kaufen?« Er dreht sich zum Gefängnisaufseher. »Narder, irgendwelche Vorschläge?«
»Keine Ahnung«, sagt Narder. »Aber wenn ihr euch nicht schnell was einfallen lasst, kommt sie ins Gefängnis.«
Mir stockt der Atem. »Aber ich habe doch nichts getan.«
»Deine Handabdrücke sind immer noch an Olivias Hals«, sagt der Wächter.
Die Diebin stößt Jadon an, der jetzt die Augen geschlossen hat und sich über die Nasenwurzel reibt. Seine Lippen sind ein zorniger weißer Strich und seine Kiefermuskeln zucken.
Der Mann kocht vor Wut, das ist nicht zu übersehen.
Olivia stößt Jadon fester an. »Höchster im Himmel«, denkt sie. »Jetzt sag’s schon, damit wir gehen können.«
Jadon macht die Augen auf. »Lass das«, knurrt er seine Schwester an.
Mein Herz rast, weil Johny mich mit dem Schwert bedroht und ich fürchte, dass Jadon sagen wird: »Da muss sie alleine durch«, und ich gegen meinen Willen zum Haus der armen toten Marget geschleift werde.
In Jadon brodelt es weiter und er drückt sich die Nasenwurzel. Aber er fängt meinen Blick auf und sein Gesicht entspannt sich. »Ich kann nicht zulassen, dass sie ihr etwas antun.« Das denkt er. Er nickt entschlossen und sagt: »Na gut. Wir überlegen uns was.«
Und ich wage wieder zu atmen.
Narder zieht mich so dicht an sich, dass ich die Poren in seinem Gesicht und die lila Adern auf seiner Nase sehen kann. »Du wirst deine Schulden abbezahlen«, sagt er zu mir. Dann dreht er sich zu Olivia und Jadon. »Wenn sie aus dem Dorf verschwindet, zahlt ihr die Gild. An eurer Stelle würde ich dieses hässliche Schmuckstück als Pfand behalten, bis sie alles beglichen hat.«
Ich schnappe nach Luft. »Das ist kein …«
Johny dreht sich wieder zu mir und sieht mich noch finsterer an als zuvor. »Vielleicht nehme ich es besser an mich. Schmelze es ein und mach mir einen Löffel und ein paar Nägel daraus. Ist dir das lieber?«
Ich antworte mit einem schwachen Kopfschütteln. Mir treten Tränen in die Augen bei der Vorstellung, wie mein Anhänger über einem Schmiedefeuer schmilzt.