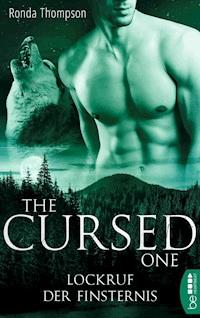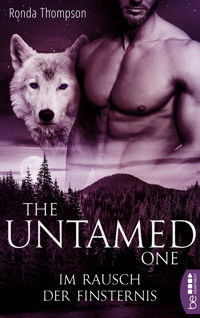
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Wild Wulfs of London
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Die Liebe erweckt den Fluch des Wolfes in Jackson - kann sie ihn auch davon erlösen?
England, 1821. Verzweifelt flieht die Hexe Lucinda in die Wälder, um dort ihr Kind zu bekommen. Ihre Verfolger kann sie abschütteln, doch ein anderer spürt sie dennoch auf: Jackson Wulf. Er glaubt, sich durch ihren Tod von seinem düsteren Fluch befreien zu können. Doch als er Lucinda gegenübersteht, kann er die Tat nicht vollbringen. Die beiden schließen einen Pakt: Lucinda verspricht, ihn von dem Fluch zu erlösen, dafür wird er sie und ihr Kind beschützen. Bald verfällt Lucinda seinem dunklen Charme, und auch Jackson fühlt sich mehr und mehr in ihren Bann gezogen. Doch mit den lange unterdrückten Gefühlen erwacht der Fluch des Wolfes in Jackson ...
"The Untamed One - Im Rausch der Finsternis" ist ein Teil der "Wild Wulfs of London"-Reihe von Ronda Thompson über die drei Wulf-Brüder. Weitere Bände der Historical Shapeshifter Romance sind: "The Dark One - Versuchung der Finsternis" und "The Cursed One - Lockruf der Finsternis".
Dieser historische Liebesroman ist in einer früheren Ausgabe unter dem Titel "Süßer Rausch der Finsternis" erschienen.
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 511
Ähnliche
Inhalt
Cover
Weitere Titel der Autorin
Über dieses Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
Widmung
Zitat
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
Epilog
Weitere Titel der Autorin
Wild Wulfs of London
The Dark One – Versuchung der Finsternis
The Cursed One – Lockruf der Finsternis
Über dieses Buch
Die Liebe erweckt den Fluch des Wolfes in Jackson – kann sie ihn auch davon erlösen?
England, 1821. Verzweifelt flieht die Hexe Lucinda in die Wälder, um dort ihr Kind zu bekommen. Ihre Verfolger kann sie abschütteln, doch ein anderer spürt sie dennoch auf: Jackson Wulf. Er glaubt, sich durch ihren Tod von seinem düsteren Fluch befreien zu können. Doch als er Lucinda gegenübersteht, kann er die Tat nicht vollbringen. Die beiden schließen einen Pakt: Lucinda verspricht, ihn von dem Fluch zu erlösen, dafür wird er sie und ihr Kind beschützen. Bald verfällt Lucinda seinem dunklen Charme, und auch Jackson fühlt sich mehr und mehr in ihren Bann gezogen. Doch mit den lange unterdrückten Gefühlen erwacht der Fluch des Wolfes in Jackson …
Über die Autorin
Ronda Thompson (1955-2007) lebte zuletzt mit ihrem Ehemann und ihren beiden Kindern in Texas, USA. In ihrer Heimat war sie mit ihren Büchern sehr erfolgreich; ihre Romane tauchten regelmäßig auf der New York Times-Bestsellerliste auf. Ronda Thompson hat bevorzugt Paranormal Romance geschrieben, da in diesem Genre alles passieren kann – und üblicherweise auch alles passiert.
Ronda Thompson
THE
UNTAMED
ONE
IM RAUSCHDER FINSTERNIS
Aus dem amerikanischen Englischvon Ulrike Moreno
beHEARTBEAT
Digitale Erstausgabe
»be« – Das eBook-Imprint der Bastei Lübbe AG
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2006 by Ronda Thompson
Titel der amerikanischen Originalausgabe: »The Untamed One«
Originalverlag: St. Martin’s Press, New York
Published by arrangement with St. Martin’s Press. All rights reserved.
Dieses Werk wurde im Auftrag von St. Martin’s Press durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover, vermittelt.
Für diese Ausgabe:
Copyright © 2009/2018 by Bastei Lübbe AG, Köln
Titel der deutschsprachigen Erstausgabe: »Süßer Rausch der Finsternis«
Covergestaltung: Guter Punkt, München | www.guter-punkt.de unter Verwendung von Motiven © thinkstock: Mike_Pellinni; © iStock: Olga Gladysheva; © Adobe Stock: blackday
eBook-Erstellung: Jilzov Digital Publishing, Düsseldorf
ISBN 978-3-7325-6352-4
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
Dieses Buch ist in liebevoller Anerkennung den »Tanten« gewidmet. Georgia, Lola, Nela, Lisa, Rose, Dora und Myriam, eure Unterstützung in den vergangenen Jahren hat mir mehr bedeutet, als ihr jemals wissen werdet.
Verdammt sei die Hexe, die mich mit diesemFluch belegte.Ich hielt ihr Herz für rein.Ach, keine Frau fühlt Verpflichtung,sei es gegenüber Familie, Namen oder Krieg.Ich fand keinen Weg, den Fluch zu brechen,keinen Trank, keinen Spruch und keine Tat.Vom Tag an, da sie den Bann über mich sprach,wird er sich vererben, von Saat zu Saat.
Verraten von der Liebe, von meiner eigenen falschen Zunge,hieß sie den Mond, mich zu verwandeln.Der Familienname, einst mein Stolz,steht jetzt für die Bestie, die mich bedrängt.Und in der Stunde ihres Todesrief die Hexe nach mir.Unversöhnlich, ohne Erbarmen,sprach sie dann, bevor sie starb:
»Suche und finde deinen ärgsten Feind,sei tapfer und laufe nicht davon.Liebe ist der Fluch, der dich bezwingt,doch auch der Schlüssel, der dich befreit.«
Ihr Fluch und Rätsel sind mein Verderben,ach Hexe, die ich liebte und doch nicht freien konnte.Schlachten habe ich ausgetragen und gewonnen,und dennoch hinterlasse ich nur Niederlagen.Ihr Wulfs, die ihr meine Sünden büßt, Söhne, die ihr weder Mensch noch Tier sein könnt,löst das Rätsel, das mir verschlossen blieb,und werdet erlöst von diesem Fluch.
Ivan Wulf,
1. Kapitel
Der Wald von Whit Hurch,England, 1821
Die Musketenkugel hatte seine Schulter durchschlagen. Blut schoss aus der Wunde, das sich warm und klebrig an Jackson Wulfs Haut anfühlte. Die Bauern von Whit Hurch waren abergläubische Irre, die ganze verdammte Bagage. Sie jagten ihn noch immer, mit zornig erhobenen Stimmen und Augen voller Blutgier, um ihn zu töten. Die Dorfbewohner glaubten, dass er eine Art Ungeheuer war – ein Mann im hellen Licht des Tages und ein Wolf, wenn der Mond des Nachts voll und rund am Himmel prangte.
Und diese verdammten Idioten hatten recht.
»Da ist er!«
Eine Muskete krachte. Die Kugel zersplitterte keine drei Zentimeter von Jacksons Gesicht entfernt an einem Baum. Verdammt. Sein gutes Aussehen war die einzige Gabe, die ihm in seinem verfluchten Leben mitgegeben worden war. »Nicht ins Gesicht, ihr verfluchten Mistkerle!«, brüllte er. »Schießt, wohin ihr wollt, aber nicht in mein Gesicht!«
Eine weitere Kugel pfiff vorbei, diesmal tiefer. Auch da nicht!, dachte Jackson und begann wieder zu rennen.
Plötzlich erhob sich eine schrille Frauenstimme hinter ihm. »Bringt ihn nicht um, Papa! Ich liebe ihn!«
Es war die süße kleine Hollis, das Schankmädchen aus der Taverne, in der Jackson die letzten fünf Nächte übernachtet hatte. Das Wirtshaus und die Zimmer darüber, von denen Jackson in dieser letzten Woche eines bewohnt hatte, gehörten ihrem Vater. Die Tochter hatte ihm hinter dem Rücken ihres Vaters den einen oder anderen Krug Bier zukommen lassen und ihm zu verstehen gegeben, dass sie nichts dagegen hätte, im Gegenzug dafür auch von Jackson etwas zu bekommen. Und er war durchaus versucht gewesen, da Frauen eine seiner vielen Schwächen waren, doch er war standhaft geblieben und hatte sich weiter auf sein Ziel konzentriert.
Frauen waren der Knackpunkt seiner Probleme und waren es immer schon gewesen. Ein Jahr zuvor, bevor er ins Ausland gereist war, hatte er sein Herz törichterweise einer jungen Dame der Gesellschaft geschenkt. Lady Anne Baldwin verkörperte alles, was ein wahrer Gentleman sich bei einer Frau nur wünschen konnte. Schönheit, Anmut, Liebenswürdigkeit. Er war betört gewesen von ihr und ihrer großherzigen Freundschaft zu einem Mann, der nahezu von der gesamten Gesellschaft geschnitten und gemieden wurde. Letztendlich hatte die junge Dame nie erfahren, dass sie sein Herz gestohlen hatte, und schon gar nicht, dass sie sogar den alten Familienfluch auf ihn herabgebracht hatte.
Vor Jahrhunderten waren alle männlichen Wulfs von einer Hexe verflucht worden. Eine Hexe hatte sie verflucht – und womöglich würde der Tod einer Hexe sie von dem gleichen Fluch befreien können, dachte Jackson. Gerüchte hatten ihn zu der kleinen Siedlung Whit Hurch geführt, wo angeblich eine Hexe unter den Dorfbewohnern lebte. Durch vorsichtige Fragen hatte er herausgefunden, dass die Frau vor einigen Monaten verschwunden war, sich aber vermutlich noch irgendwo in den Wäldern um das Dorf herum versteckte.
Jackson hatte sie noch nicht gefunden, sich aber geschworen, es zu tun. Seine Zukunft und die seiner Brüder konnten davon abhängen, diese Frau zu töten. Ein Gedicht, das der erste von dem Fluch getroffene Wulf seinen Nachkommen hinterlassen hatte, enthielt ein Rätsel, welches zukünftigen männlichen Wulfs riet, ihren ärgsten Feind zu suchen und zu finden, tapfer zu sein und nicht davonzulaufen. Falls Jackson die Hexe also fand, die früher einmal in dem Dorf gelebt hatte, konnte ihr Tod den Fluch für ihn und seine Brüder vielleicht ein für alle Mal brechen. Vorausgesetzt natürlich, dass er lange genug am Leben blieb, um sie zu töten.
Hinter ihm fielen wieder Schüsse. Jackson rannte, bis ihm der Schweiß auf die Stirn trat. Seine verletzte Schulter brannte, und der Blutverlust machte ihn benommen. Als er aufschaute, bemerkte er, dass es noch eine ganze Weile dauern würde, bis es dunkel wurde. Normalerweise wünschte er sich den Vollmond nicht herbei, doch um zu überleben, brauchte er jetzt den Wolf, der sich in ihm erheben würde.
Was ihn in seine derzeitige Notlage gebracht hatte, war eine solche Verwandlung gewesen, die von einem der Dorfbewohner am Vorabend beobachtet worden war, während sich Jackson allein im Wald geglaubt hatte. Er hatte leider keinerlei Kontrolle über diese Dinge. Vielleicht hätte er gelernt, damit zu leben, wenn er es hätte steuern können, doch wie bei seiner ausgeprägten Vorliebe für Alkohol und Frauen beugte er sich letzten Endes immer einer Kraft, die stärker war als sein Wille. Und das musste ein Ende haben.
Jacksons ältester Bruder, Armond, hatte geheiratet. Es war eine Vernunftehe, oder zumindest hatte Armond das behauptet, aber Jackson wusste es besser. Wenn Armond nicht schon jetzt rettungslos verliebt war in seine junge Braut, dann war es nur noch eine Frage der Zeit. Und deshalb hatte Jackson den Entschluss gefasst, sie alle zu retten.
Es war von enormer Wichtigkeit für ihn, den Bann zu brechen, der ihn und seine Brüder um ein normales Leben brachte. Den Fluch, der ihnen ihre Eltern und ihre gesellschaftliche Stellung in der Londoner Oberschicht genommen hatte. Jackson hatte keine wirklich bedeutende Aufgabe in seinem Leben … nichts als sein Streben, den Fluch, der auf seiner Familie lastete, zu entkräften. Und er war wild entschlossen, das zu schaffen. Er würde die Hexe finden und sie töten, wenn er dadurch den Fluch außer Kraft setzen konnte. Aber der Wald war groß, und nicht einmal seine überlegenen Instinkte und sein Spürsinn hatten ihn bisher zu der Frau geführt, nach der er auf der Suche war.
Erschöpft hielt Jackson inne und lehnte sich an einen Baum, um Atem zu holen. Mit dem Ärmel seines eleganten Gehrocks wischte er sich den Schweiß von seiner Stirn. Die leichte Brise frischte auf, und für einen Moment lang schloss er die Augen und ließ sich von der nun etwas kühleren Luft beleben. Doch dann trug der Wind plötzlich einen Duft zu ihm hinüber. Den Duft einer Frau. Selbst schwindlig und benommen durch den Blutverlust konnte Jackson den Duft einer Frau erkennen, wenn er ihn wahrnahm. Auch sein Gehör war weitaus besser als das eines normalen Menschen, und so lauschte er nun angestrengt.
Er hörte ein leises Stöhnen, ein weibliches Seufzen und dann das Geräusch von schwerem Atmen. Geräusche, die eine Frau vielleicht von sich geben mochte, wenn sie mit einem Liebhaber beschäftigt war. War es die Hexe? Das fiel ihm schwer zu glauben, denn in seiner Vorstellung war die Frau, die er suchte, alt und hässlich. Mit ihrem struppigen Haar und warzenübersäten Gesicht könnte eine solche Frau höchstens dann einen Mann ins Bett bekommen, wenn sie ihn mit einem Zauberspruch belegte.
Trotzdem fühlte Jackson sich wie magisch angezogen von ihrem Duft. Es war der Geruch nach Frau, nach Sonne, Erde und Regen, vermischt mit einem kaum merklichen Duft nach Geißblatt und, erstaunlicherweise, auch nach Blut. Die Geräusche schwerer Schritte, die durchs Dickicht stolperten, und die vor Aufregung und Jagdfieber erhobenen Stimmen verblassten schlagartig, und plötzlich hörte Jackson nur noch sie. Sie durchdrang ihn mit ihrer Gegenwart und lullte ihn ein mit den leisen Lauten, die sie von sich gab, sodass er bereitwillig zu ihr hinging, beinahe so, als ob das Schicksal es verlangte.
Während er sich zwischen den Bäumen hindurchschlängelte, kämpfte er gegen den Schmerz seiner Schussverletzung an, ignorierte das geronnene Blut unter seinem Hemd und drängte weiter. Die kleine Bauernkate, auf die er wenig später stieß, war kaum mehr als eine armselige Hütte und so stark von wildem Wein und anderen Ranken überwuchert, dass sie vor der dichten Wand des Waldes fast nicht zu erkennen war.
Jackson roch weder ein Küchenfeuer, noch sah er verräterische Rauchfähnchen aus dem zerfallenden Schornstein aufsteigen. Er nahm keine Anzeichen von Leben wahr, nicht einmal unter den Tieren dieses Waldes. Jackson sträubten sich die Nackenhaare, so unheimlich war diese Stille.
Aber die Frau war in der Kate; das spürte er.
Jackson griff nach dem Messer, das er an seinem Gürtel trug. Doch es war nicht da. Kein Messer, keine Waffe. Ein schöner Mörder war er. Die Dörfler hatten ihn überrascht. Es war ihm gerade noch gelungen, sich anzukleiden und aus seinem Zimmer über der Schenke zu entkommen, bevor sie die Jagd auf ihn eröffnet hatten.
Wenn es sein musste, würde er die Frau mit bloßen Händen töten, beschloss Jackson. Vorausgesetzt, dass diese Frau tatsächlich die Gesuchte war und ihr Tod ein normales Leben für ihn und seine Brüder bedeuten würde, konnte er das ruhigen Gewissens tun. In seinem Vorhaben bestärkt, schlich Jackson zu der Tür der Kate und öffnete sie vorsichtig.
Das Innere der Hütte war nur schwach beleuchtet, doch Jacksons Augen waren weitaus schärfer als die eines normalen Mannes. Eine Frau lag auf einem Strohsack auf dem festgestampften Lehmboden. Ihre Knie waren gebeugt und weit gespreizt, ihre Beine nackt. Die große Wölbung ihres Bauches bewegte sich unter dem schmutzigen Kleid, das sie bis zu den Oberschenkeln hinaufgezogen hatte. Es war kein Liebhaber, mit dem sie beschäftigt war, sondern der Schmerz und die Qual der Wehen.
Jacksons Blick glitt über ihren aufgeblähten Leib, vorbei an der wirren Mähne roter Locken, die ihr bis zu den Schultern reichten, und zu ihrem Gesicht. Ihre Blicke begegneten sich, ließen einander nicht mehr los, und es war, als verschlüge es ihnen beiden gleichzeitig den Atem.
»Ihr seid also schließlich doch gekommen«, flüsterte sie. »Tötet mich, aber tut dem Kind nichts an. Er ist unschuldig.«
Wieder sträubten sich die Haare in Jacksons Nacken. Wenn sie wusste, wozu er hergekommen war, dann war dies die Frau, die er gesucht hatte. Die Hexe. Seine schlimmste Feindin. Aber sie sah ganz anders aus, als er sie sich vorgestellt hatte. Sie war weder alt noch bucklig, und sie hatte auch keine Warzen oder Haare im Gesicht. Sie war schön. Sogar schweißbedeckt, mit ihrem zerzausten Haar und ihrer alten, abgetragenen Kleidung war ihre Schönheit nicht zu übersehen.
Ihre Augen waren von einem tiefen Grün, grün wie der Wald, der sie beschützte. Die wirren Locken, die ihr über die Schultern hingen, waren so glutrot wie ein Sommersonnenuntergang. Und obwohl ihr Leib durch die Schwangerschaft stark angeschwollen war, war sie so feingliedrig und zartknochig, dass Jackson sie mühelos hätte zerbrechen können.
»Noch nicht«, sagte sie, als erriete sie, was er dachte. »Lasst mich zuerst mein Kind zur Welt bringen. Ich flehe Euch an, ihm nichts zu tun. Wenn Ihr mich getötet habt, dann bringt ihn zu einer Familie in dem Dorf. Sagt ihnen nicht, woher Ihr ihn habt, nur dass er allein ist und jemanden braucht, der für ihn sorgt.«
Ihre Worte verunsicherten Jackson. Sie schien zu akzeptieren, was er als seine Pflicht ansah. Als sei ihr das eigene Schicksal gleichgültig, nicht aber das ihres Kindes. Und dennoch konnte er immer noch nicht wirklich glauben, dass es diese Frau war, die er suchte.
»Bist du eine Hexe?«
Ihre Augen wurden schmal. »Ihr wisst, dass ich eine bin«, erwiderte sie. »Deswegen seid Ihr schließlich hier, nicht wahr?«
Schmerz verdunkelte ihre Augen, bevor Jackson ihr eine Antwort geben konnte, und sie biss sich so fest auf ihre volle Unterlippe, dass Blut hervortrat. Ihr Bauch spannte und bewegte sich, und sie hob die Hüften an und presste – jedoch ohne Erfolg, wie Jackson sehen konnte.
»Er steckt fest«, keuchte sie schließlich, als sie auf das Strohlager zurücksank und nach Atem rang. »Das Kind muss gedreht werden. Lasst mich Eure Hände sehen.«
Wie benebelt – entweder durch den eigenen Blutverlust, durch das Wissen der Frau, dass er wegen ihr gekommen war, oder einfach nur, weil er mitansehen musste, wie eine Frau unter völlig anderen Umständen als den von ihm gewohnten ihre Beine spreizte–, zeigte Jackson ihr seine Hände.
»Das wird gehen«, keuchte sie. »Eure Finger sind lang und schlank und Eure Hände feingliedrig trotz Eurer Größe. Ihr müsst in mich hineingreifen und das Kind drehen, damit es seinen normalen Weg gehen kann.«
Jacksons Finger waren natürlich schon in einer Frau gewesen, doch niemals zu dem von ihr vorgeschlagenen Zweck. Ihre Bitte behagte ihm überhaupt nicht. Mit finsterer Miene blickte er auf sie hinab und schüttelte den Kopf. »Das kann ich nicht«, erklärte er. »Ich verstehe nichts von diesen Dingen.«
Als eine neue Wehe sie durchzuckte, tastete die Frau nach einem Stock und schob ihn zwischen ihre Zähne, bis der Schmerz verging. »Dann tut eben nichts«, keuchte sie. »Steht einfach nur da und seht zu, wie ich sterbe, und das Kind mit mir. Das wird leichter sein, als uns nachher umbringen zu müssen.«
Was sie sagte, stimmte. Jackson hatte noch nie in seinem Leben eine Hand gegen eine Frau erhoben. Dieser Gedanke hatte ihn während seiner gesamten Suche gequält – die tatsächliche Vernichtung der Feindin, der er gegenübertreten und die er besiegen musste, um den Fluch zu brechen. Er hatte gewusst, dass er sie, um als Sieger hervorzugehen, töten musste, aber was das Töten selbst anging, so hatte er sich bisher nicht einmal erlaubt, darüber nachzudenken … oder sich zu fragen, ob er dazu fähig war. Spielte das Schicksal ihm jetzt in die Hände? Doch wenn die Natur ihr das Leben nahm und nicht er, wäre der Fluch dann trotzdem noch gebrochen?
Jackson kam plötzlich der Gedanke, dass es, wenn es ein Kind gab, auch irgendwo einen Mann geben musste. Er schnupperte, nahm aber keinen Geruch von irgendjemand anderem als der Frau wahr, die das Haus bewohnte.
»Wo ist der Vater des Kindes?«, fragte er.
Sie starrte ihn aus großen Augen an. »Das wisst Ihr nicht? Er hat Euch nicht geschickt?«
Jackson schüttelte verwirrt den Kopf. »Nein. Ich bin gekommen, weil ich eigene Gründe habe, dich zu töten. Wegen dem, was du meiner Familie angetan hast … du selbst oder andere deinesgleichen.«
Falls sie eine Antwort darauf hatte, ging diese in der nächsten Wehe unter. Sie drückte den Rücken durch, ihr Bauch hob sich, und ein heftiges Erschauern durchlief sie. Ein leises Stöhnen entrang sich ihrem offenen Mund. Er sah, wie sie presste und presste, mit all ihrer Kraft, die nicht mehr sehr groß war, und wieder geschah nichts.
»Habt Ihr eine Waffe?«, keuchte sie.
Etwas betreten schüttelte er den Kopf.
Die Frau runzelte die Stirn, und ihr schmerzerfüllter Blick glitt über ihn. »Also hattet Ihr vor, mich mit bloßen Händen umzubringen.« Sie richtete sich auf die Ellbogen auf. »Dann tut es jetzt! Wenn Ihr schon nicht mit Euren Händen in mich hineingreifen wollt, dann legt sie mir wenigstens um den Hals und beendet diese Qual für mich. Ohne Eure Hilfe sind das Kind und ich sowieso verloren.«
Ein Gnadentod? Für Jackson klang das weitaus besser als ein kaltblütiger Mord. Sie hatte recht, er sollte ihre Qual beenden. Sie leiden zu sehen bereitete ihm kein Vergnügen, ja, verschaffte ihm nicht einmal Genugtuung. Es machte ihn nur krank. Aber sie umzubringen, um ihr Leiden zu beenden … damit könnte er doch leben, oder nicht?
Jackson schwankte ein wenig, ihm war schwindlig, als er sich langsam ihrer Strohmatratze näherte. Dabei wandte er den Blick von ihrer unteren Körperhälfte ab, die vor seinen Augen voll und ganz entblößt war, was ihn unter anderen Umständen zweifellos erfreut hätte, und kniete sich neben sie. Mit schmerzerfülltem Blick, doch frei von Furcht, blickte sie zu ihm auf. Verdammt, sie besaß mehr Courage als er selbst!
»Tut es«, drängte sie und legte den Kopf in den Nacken, um ihm besseren Zugang zu ihrer schlanken Kehle zu verschaffen. »Ich habe schon lange vermutet, dass ich wegen meines Andersseins eines Tages ein solches Ende finden würde. Ich habe mich mit meinem Schicksal abgefunden.«
Die Passivität der Frau empörte ihn. Wo blieb ihr Überlebenswille? Wo ihr Zorn darüber, dass ihr ein so völlig anderes Leben als allen anderen beschieden gewesen war? Warum bot sie ihm ihre Kehle an, wenn sie sich doch bis zum bitteren Ende gegen ihn hätte wehren müssen? Vielleicht verdiente sie es, zu sterben. Wenn sie dem Leben so wenig Wert beimaß, warum sollte er ihr dann nicht den Gefallen tun?
Ihre Haut war zart und warm, als er ihr die Hände um den Hals legte. Die Berührung ließ Funken sprühen, vibrierte wie die spannungsgeladene Luft vor einem Gewitter. Auch die Frau spürte es, denn ihre Augen, die sie vorher noch geschlossen hatte, öffneten sich jäh.
»Ihr seid auch anders«, flüsterte sie. »Ihr seid kein Mensch. Aber Ihr seid auch kein Tier. Ihr seid beides.«
Jackson sah keine Veranlassung, ihr zu widersprechen, obwohl es ihn ein wenig aus der Fassung brachte, dass sie ihn als das erkannte, was er war. Sein Gesicht hatte ihm bisher immer gute Dienste geleistet – es war eine hervorragende Tarnung, die seine dunklere Natur verbarg.
»Ich werde bald wieder ein Mensch sein«, versicherte er ihr. »Und nur ein Mensch, wenn du durch meine Hand dein Ende findest.«
Sie befeuchtete ihre Lippen, und er bemerkte, wie voll und weich sie waren, obwohl sie sie in ihrem Schmerz schon fast zerbissen hatte. »Aber was für eine Art Mensch werdet Ihr sein?« Ihre beunruhigenden, mandelförmigen, ja, fast schon katzenhaften Augen musterten ihn prüfend. »Einer, der danach noch mit sich leben kann?« Sie beugte sich vor und schnupperte an ihm. »Der Alkohol, den ich in Eurem Atem rieche, beantwortet mir meine Frage. Ihr werdet darin ertrinken. Am Ende werdet Ihr durch ihn noch weniger ein Mann sein, als Ihr es bislang seid.«
Jackson umklammerte ihren Hals noch fester. Ihre Worte trafen ihn. Die Wahrheit darin. Selbst heute Morgen hatte er gleich nach dem Aufstehen schon einen Schluck getrunken. Nur um die Kälte aus seinen Knochen zu vertreiben, hatte er versucht, sich einzureden. Er hatte sich eine Menge einzureden versucht, seit seine Neigung zu Alkohol und Frauen sein Leben bestimmte.
Die Frau vor ihm stöhnte auf vor Schmerz. Ihre Hände legten sich über seine, und sie presste seine Finger an ihren Hals. »Bitte«, wisperte sie.
Frauen hatten ihn schon oft um Gnade angefleht, aber immer nur in lustvoller Verzückung, nie im Schmerz. Jackson versuchte, sich dazu zu zwingen zuzudrücken. Aber seine Finger wollten ihm nicht gehorchen. Nur des Kindes wegen, sagte er sich. Die Hexe hatte recht. Das Kind in ihr trug nicht die Schuld an den Sünden seiner Mutter. Jackson zog seine Hände wieder von ihrem Hals zurück.
Aus tränenfeuchten Augen sah sie zu ihm auf. »Was immer Ihr auch seid, es ist nicht so schlimm wie das, wozu Ihr gerade werdet«, brachte sie hervor. »Wollt Ihr dasitzen und zusehen, wie wir für eine wie auch immer geartete Sünde leiden, die ich Eurer Meinung nach gegen Euch begangen habe?«
»Nein«, versicherte er ihr und ließ sich seufzend zwischen ihren Beinen nieder. Es war eine Stellung, die ihm normalerweise gar nicht fremd war, aber eine Sachlage, die sein Verständnis beinahe überstieg. »Sag mir, was ich tun soll.«
2. Kapitel
Lucinda war den Tränen nahe, als der Mann die Hände von ihrer Kehle nahm. Seine Weigerung, ihrem Leiden ein schnelles Ende zu bereiten, kam für sie nicht überraschend. Den Menschen, und besonders den Männern, schien es zu gefallen, wenn sie litt. Sie war eine Hexe, und sie versuchte nicht einmal, den Begriff zu umschreiben oder zu beschönigen, indem sie sich als Heilerin bezeichnete, obwohl sie auch ein gewisses Geschick auf diesem Gebiet besaß. Sie war dafür bezahlt worden, Menschen mit einem Zauber zu belegen, ihnen die Zukunft vorauszusagen und ihnen Geburtshilfe zu leisten. Ihre Mutter war eine Hexe gewesen, so wie es ihre Großmutter und all die anderen Frauen in ihrer Familie schon seit Jahrhunderten gewesen waren.
Die Menschen mieden sie im hellen Licht des Tages, doch im Schutz der Dunkelheit schlichen sie sich zu ihrem Haus im Dorf. Frauen baten sie um Zaubertränke, um anziehender zu wirken, sie holten sie zu einer schwierigen Geburt und einer Reihe anderer Dinge, aber Lucinda wusste nur zu gut, dass bei einer Missernte oder wenn das Wetter sich verschlechterte, sie die Erste war, der man die Schuld daran zuschrieb.
Und nun, wo alles voll Düsternis und Hoffnungslosigkeit gewesen war, begann sie plötzlich wieder neuen Mut zu fassen. Der Fremde würde ihr helfen … was wenig Sinn ergab, sofern er nach wie vor die Absicht hatte, sie zu töten. Selbst zu sterben machte Lucinda nicht viel aus, aber das Kind, das unschuldige Kleine, das durch eine schändliche Tat gezeugt worden war, während sie ohnmächtig im Haus des Grundherrn gelegen hatte, trug nicht die Schuld an ihren Sünden oder denen seines Vaters.
Sie hatte gedacht, dass Lord Cantley jemanden geschickt hatte, um sie zu töten – um sich ihrer und des Kindes zu entledigen, damit es nicht eines Tages eine Bedrohung für die Krone darstellte–, aber der Fremde hatte offenbar seine eigenen Gründe, ihren Tod zu wollen. Sie würde jetzt seine Hilfe annehmen und ihm später Fragen stellen.
»Schiebt Eure Hände in mich hinein, sucht das Kind und dreht es um. Ich vermute, dass er versucht, verkehrt herum auf die Welt zu kommen.«
Jackson warf einen Blick zwischen ihre Beine und erschauderte. »Meine Hände werden dort nicht hineinpassen.«
»Das werden sie«, beharrte sie. »Und sorgt Euch nicht wegen des Schmerzes, den Ihr mir vielleicht zufügt. Wenn ich sowieso sterben muss, wäre es doch sinnlos, vorsichtig zu sein. Es geht mir nur um das Kind. Ich will, dass er am Leben bleibt.«
Der Mann zog eine Braue hoch. »Er?«
»Es ist ein Junge«, versicherte sie ihm. »In dem Korb dort drüben in der Ecke liegt eine Flasche Alkohol. Reinigt damit Eure Hände – aber trinkt ihn nicht«, fügte sie hinzu, als käme ihr gerade erst dieser Gedanke. »Oder zumindest nicht, bis Ihr das Kind zur Welt gebracht und mich ermordet habt, während ich hier liege und zu schwach bin, mich zu wehren. Danach könnt Ihr dann Eure mutige Tat, eine hilflose Frau ins Jenseits befördert zu haben, von mir aus gern in aller Ruhe feiern.«
Der Mann blickte stirnrunzelnd auf sie hinab, ging dann aber zu der besagten Ecke und holte die Flasche aus dem Korb. Lucinda beobachtete, wie er seine Hände mit dem Brandy übergoss. Und sie sah auch, wie sehnsüchtig er die Flasche betrachtete, fast schon so begehrlich, wie ein Mann eine schöne Frau ansah. Schließlich stellte er sie aber wieder in den Korb und kam zu ihr zurück. Der Fremde legte seinen Rock ab, der sehr elegant und gut geschnitten war, wie sie bemerkte, und rollte dann die Ärmel seines nicht minder feinen Leinenhemdes hoch.
»Als ich dich hier fand, dachte ich zuerst, du wärst sehr tapfer«, sagte er. »Doch nun sehe ich, dass du einfach nur mit Dummheit geschlagen bist. So inständig um das Leben deines Kindes zu betteln, um mich dann im nächsten Atemzug derart herabzusetzen, ist deiner momentanen Lage nicht gerade förderlich.«
Lucinda hatte schon immer eine scharfe Zunge gehabt. Man hatte sie nie gelehrt, die Dinge zu beschönigen. Sie war keine hochwohlgeborene, wohlerzogene junge Dame, die gelernt hatte, für einen Mann zu erröten, um ihren Willen durchzusetzen. Lucinda sagte für gewöhnlich, was sie dachte, ohne Rücksicht auf die Konsequenzen. Es war ja schließlich nicht so, als ob die Leute eine gute Meinung von ihr haben müssten. Sie hatten schon seit dem Tag ihrer Geburt schlecht von ihr gedacht.
Der Schmerz riss sie aus ihren Überlegungen. »Jetzt!«, keuchte sie. »Greift in mich hinein, und dreht das Kind!«
Sie spürte, wie seine Hände sie erforschten, sanft zunächst, dann fester, als der Schmerz sie scharf die Luft einziehen und nach Atem ringen ließ. Er hatte allerdings recht gehabt; eine Hand von ihm war schon beinahe mehr, als sie ertragen konnte. Zwei Hände würden nie in sie hineinpassen.
»Ich fühle es«, sagte er. »Ich spüre den Kopf, aber er befindet sich nicht in der falschen Lage.«
Das verwirrte Lucinda. Sie hatte schon vielen Kindern auf die Welt geholfen und schon im zarten Alter von dreizehn Jahren mit Geburtshilfe begonnen. Sie war sicher, dass die Lage des Kindes das Problem sein musste. Aber dann kam ihr ein anderer Gedanke.
»Könnt Ihr seinen Hals ertasten? Hat sich vielleicht die Schnur darum verwickelt, und er kann sich deshalb nicht bewegen?«
»Die Schnur? Was für eine Schnur?«
»Versucht einfach, seinen Nacken zu ertasten«, beharrte sie. Der grauenhafte Schmerz überkam sie wieder, doch wenn es dem Mann gelänge, die Nabelschnur vom Hals des Kindes zu entfernen, könnte die Geburt normal vonstatten gehen. »Spürt Ihr dort etwas?«
»Ja«, antwortete er endlich. »Etwas Schnurähnliches, aber auch sehr Glitschiges.«
»Das ist sie«, keuchte sie. »Könnt Ihr sie lockern?«
»Ich werde es versuchen.«
Seine Versuche brachten sie fast um. Lucinda ergriff wieder den Stock und schob ihn erneut zwischen ihre Zähne, um nicht aufzuschreien. Der Mann würde vielleicht aufhören, wenn er wüsste, wie sehr er sie verletzte – doch andererseits, warum sollte er? Er wollte, dass sie starb. Er wäre wahrscheinlich nur nie auf die Idee gekommen, dass er sie auf diese Weise töten würde.
»Ich habe es geschafft!« Spürbare Aufregung klang in seiner Stimme mit. »Ich habe die Schnur vom Hals des Kindes gelöst.«
Und das keinen Augenblick zu früh. Der Drang zu pressen überkam Lucinda, und die natürlichen Instinkte ihres Körpers ließen sich nicht mehr steuern. Sie hatte so gut wie keine Kraft mehr, doch sie richtete sich auf die Ellbogen auf und presste, presste so fest sie konnte. Das Kind begann sich zu bewegen.
Sie spürte die Veränderung in sich, und das Wissen, dass sie nun eine gute Chance hatte, ihren Sohn zu retten, ließ in Lucinda eine Kraft aufwallen, die eigentlich schon längst hätte verbraucht sein müssen.
Für einen Moment legte sie sich zurück, um sich auszuruhen und auf den nächsten Schmerz zu warten. Er kam schnell, beinahe zu schnell, um auch nur tief durchzuatmen.
»Du musst fester pressen«, sagte der Mann.
Hätte Lucinda noch die Kraft dazu gehabt, hätte sie den Fremden mitten in sein gut aussehendes Gesicht getreten. Es ärgerte sie, dass ihr sein gutes Aussehen selbst unter den gegebenen Umständen nicht entgangen war. Aber sein attraktives Äußeres war ja auch wirklich kaum zu übersehen. Man müsste schon blind oder tot sein, dachte Lucinda, um unberührt von diesem Gesicht zu bleiben.
Doch ihr blieb keine Zeit mehr, über das bemerkenswert gute Aussehen des Fremden nachzudenken. Weder über die weizenblonden Strähnen in seinem Haar, die glatte, leicht gebräunte Haut, die samtig dunkle Farbe seiner Augen, noch über die erstaunlich langen Wimpern oder ausgeprägten Grübchen rechts und links an seinen Wangen. Lucinda musste wieder pressen, und sie versuchte es mit der allerletzten Kraft, die ihr geblieben war.
»Fester!«, befahl der Mann. »Streng dich an, oder du wirst nicht lange genug leben, um dein Kind zu sehen. Press, so fest du kannst, und ich verspreche dir, dass ich mich darum kümmern werde, dass der Kleine gut versorgt wird.«
Eine leise Hoffnung versuchte sich gegen ihre Verzweiflung durchzusetzen. Konnte sie dem Wort eines Mannes vertrauen, der offen zugegeben hatte, sie umbringen zu wollen? »Versprecht es mir«, flüsterte sie. »Versprecht mir, dass Ihr Euch um meinen Jungen kümmern werdet. Versprecht mir, dass er niemals Hunger leiden, frieren oder ohne ein Dach über dem Kopf sein wird.«
»Ich verspreche es«, sagte der Mann. »Und nun press endlich, verdammt!«
Als der nächste Schmerz kam, schloss Lucinda die Augen und presste mit aller Kraft.
»Ich kann schon den Kopf sehen!«, rief der Mann. »Er kommt!«
Lucinda presste weiter. Der Druck war so groß, dass sie das Gefühl hatte, innerlich auseinandergerissen zu werden. Fast schrie sie auf, aber sie wollte ihre Energie nicht umsonst verbrauchen und presste nur umso fester. Noch zweimal drückte und presste sie mit aller Macht, und schließlich glitt das Kind aus ihr hinaus.
»Ich habe den glitschigen kleinen Kerl – was soll ich jetzt mit ihm tun?«
Noch immer schwer nach Atem ringend, wies sie den Fremden an: »Haltet ihn an den Füßen hoch, und gebt ihm einen Klaps auf seinen Po.«
Sekunden später erfüllte der süßeste Laut, den sie je gehört hatte, die kleine Kate. Ein wutentbrannter Schrei. Ein Lebensschrei. Ihr Sohn war geboren. Auf die Ellbogen gestützt, sah Lucinda zu, wie der Fremde das Kind in seinen feinen Überrock einpackte. Mit einem Ausdruck des Erstaunens auf seinen gut aussehenden Zügen starrte der Mann auf ihren Sohn hinab, als hätte er Lucindas Existenz vergessen.
»Er ist perfekt«, flüsterte er.
»Hat er alles, was er haben sollte?«, veranlasste ihr Mutterinstinkt sie zu fragen.
Der Fremde zählte Fingerchen und Zehen. »Ja. Obwohl er, was seine männlichen Attribute angeht, vielleicht sogar ein bisschen zu gut bedacht ist.«
Ein irrationales Bedürfnis zu lachen überwältigte sie beinahe. Unter den gegebenen Umständen hätte Lucinda eigentlich nichts, was der Fremde sagte, lustig finden dürfen. »Das ist normal bei Neugeborenen«, erklärte sie. »Ich denke, sie wachsen in ihre männlichen Körperteile schnell genug hinein. Oder in einigen Fällen vielleicht sogar darüber hinaus.«
Der Fremde blickte auf. »Nicht in allen Fällen«, versicherte er ihr.
»Ihr müsst die Nabelschnur durchtrennen«, sagte sie. »Ich möchte ihn halten.«
Der Mann runzelte die Stirn. »Womit durchtrennen? Ich sagte doch schon, dass ich keine Waffe bei mir habe.«
Es war dumm, ihm zu vertrauen, doch was blieb Lucinda anderes übrig? Falls er tatsächlich vorhatte, sie zu töten, wollte sie wenigstens einmal ihren Sohn in den Armen gehalten haben, bevor es so weit war. »In dem Korb.« Sie nickte wieder zu der Ecke hinüber. »Dort ist alles, was wir brauchen, um meinen Jungen zu versorgen. Der Schmerz überkam mich so plötzlich, dass ich hinfiel und keine Zeit mehr hatte, den Korb zu holen.«
Der Fremde legte ihren Sohn behutsam auf den Boden, holte den Korb und kniete sich dann neben sie. Lucinda erklärte ihm, was er zu tun hatte, wie er die Nabelschnur verknoten und sie danach durchtrennen musste, damit der Säugling nicht verblutete. Es waren saubere Tücher in dem Korb, und während der Fremde den Säugling reinigte, betrachtete Lucinda ihren eigenen bedauernswerten Zustand.
Da ihr Kleid nicht mehr zu retten war, blieb ihr nichts anderes übrig, als dem Mann den Rücken zuzukehren und ihre blutigen Sachen auszuziehen. Sie griff in den Korb nach einem sauberen Kleid, frischer Unterwäsche und den dicken Lappen, die ihre Blutung stillen würden. Während der Fremde sich auf die Säuberung des Neugeborenen konzentrierte, kümmerte sie sich um ihre eigene Körperpflege. Sie hatte allerdings kaum Zeit, das saubere Kleid überzustreifen. Es stand vorne, wo die Knöpfe waren, noch immer offen, als er plötzlich bei ihr war und ihr den Säugling überreichte.
Der Anblick ihres Sohnes ließ Lucinda alles andere vergessen. Er war wunderschön. In jeder Hinsicht ganz und gar vollkommen. Dann sah Lucinda das Muttermal an seinem Schenkel, und das Blut gefror ihr in den Adern. Es war das Geburtsmal seines Vaters – ein kleiner roter Drache. Und es bedeutete das Todesurteil für ihr Kind. Der Graf von Cantley hatte verwandtschaftliche Beziehungen zur Krone. Er war der Cousin des Königs. Der Gutsherr würde niemals zulassen, dass ein Bastard eines Tages den englischen Thron bedrohte oder alles in Gefahr brachte, was er seinen legitimen Erben eines Tages zuteil werden lassen wollte. Das war der Grund, warum er ihren Tod befohlen hatte, noch bevor das Kind geboren war.
Nachdem sie bei zweien von Lord Cantleys legitimen Söhnen Geburtshilfe geleistet hatte, hatte Lucinda keine Mühe, das Geburtsmal zu erkennen. So wie jeder andere es erkennen würde, der es sähe. »Mein armer Kleiner«, flüsterte sie und drückte das Kind an ihre Brust. Das Neugeborene schrie, glitt suchend mit dem Mündchen über ihre Brüste und begann an einer ihrer Brustwarzen zu saugen. Vom ersten schwachen Zug an entspann sich ein Band zwischen ihnen.
Mit in Tränen schwimmenden Augen und einem solch überwältigenden Glücksgefühl, dass es ihr schier den Atem raubte, blickte Lucinda auf das Kind hinab. Und in dem Moment erwachte endlich auch wieder der Überlebenswille in ihr, ein wildes, leidenschaftliches Verlangen, dieses Kind vor allem Unrecht zu beschützen. Und nicht nur das Neugeborene, sondern auch sich selbst. Unter halb gesenkten Lidern betrachtete sie den Fremden. Doch er sah nicht sie an, sondern schien völlig fasziniert von dem Anblick des an ihrer Brust nuckelnden Kindes.
»Ich hatte vergessen, dass sie auch noch anderen Zwecken als meinem Vergnügen dienen«, bemerkte er gedehnt. »Vielleicht beginnt die Faszination eines Mannes für die Brüste einer Frau schon in dem Moment, in dem er geboren wird.«
Lucindas Blick glitt zu dem scharfen Messer, das er auf den Boden neben dem Strohsack gelegt hatte. »Wer seid Ihr?«, fragte sie nun endlich.
Den Blick noch immer auf das Kind gerichtet, antwortete er: »Lord Jackson Wulf.«
Seinen Namen, oder besser gesagt seinen Familiennamen, hatte Lucinda schon gehört. Sogar in den Dörfern war der Klatsch über die feinen Kreise der Londoner Gesellschaft ein sehr beliebtes Thema. Wahrscheinlich hätte sie aber auch ohne die Kenntnis seines Namens geahnt, dass er von hoher Geburt war. Seine Kleidung, seine Sprache, seine Manieren, all das sprach von einer höheren Stellung im Leben. Lucinda hatte von den wilden Wulfs von London schon gehört. Es hieß, sie wären verflucht und zum Wahnsinn verdammt. Aber so war das keineswegs, erkannte sie. Sie waren mit etwas weitaus Schlimmerem gestraft. Nur was hatte das alles mit ihr zu tun?
»Warum seid Ihr auf der Suche nach Vergeltung?«, fragte sie. »Ich kenne Euch nicht, und Ihr kennt mich nicht.«
Ihn an seine Absichten zu erinnern war nicht sehr klug, wie sie zu spät erkannte. Sein Blick glitt von dem Kind zu ihrem Gesicht hinauf, und in seinen Augen stand plötzlich ein Glühen, das da vorher nicht gewesen war. Zum ersten Mal bemerkte Lucinda nun auch seine Verletzung – das schon geronnene Blut, das die Schulter seines feinen Hemdes befleckte … ziemlich viel Blut, wie sie bemerkte.
»Ich kenne deinesgleichen«, erwiderte er bitter. »Es gibt da ein Rätsel. Ich muss mich meinem ärgsten Feind stellen und als Sieger hervorgehen. Es war eine Hexe, die meine Familie vor hundert Jahren verfluchte. Der Tod einer Hexe befreit uns vielleicht wieder von dem Fluch.«
Nicht alle von Lucindas Art waren schlecht und verfluchten Menschen. Sie selbst war eine weiße Hexe, wie ihre Mutter sie genannt hatte. Sie konnte keinen bösen Zauber durchführen oder Schaden mit ihrer Magie anrichten. Doch eine schlechte Tat blieb immer leichter in Erinnerung als eine gute. Lucinda versuchte, eine tapfere Miene aufzusetzen. »Ich verstehe«, sagte sie. »Ich muss ja ungemein gefährlich auf Euch wirken, wie ich hier halb tot vom Blutverlust vor Euch liege und ein kleines, unschuldiges Kind an meine Brust drücke. Wenn Ihr vorhabt, mich zu töten, worauf wartet Ihr dann noch?«
Aber er hatte den Blick von ihr abgewandt und schien nicht mehr zuzuhören. »Sie kommen.«
Verwirrt, weil Lucinda nichts als eine unheimliche Stille wahrnahm, fragte sie: »Wer kommt?«
Er hatte ein sehr ausdrucksvolles Profil. Alle seine Gesichtszüge waren nahezu vollkommen. Sogar sein starkes Kinn und die sinnlich vollen Lippen standen nicht im Gegensatz zueinander, sondern befanden sich in perfektem Einklang miteinander. Seine Augenbrauen und Wimpern waren dunkel im Vergleich zu seinem mit blonden Strähnen durchzogenen Haar. Selbst der Schatten seines Bartes war dunkel. Dunkelheit und Licht. Er war ein Mann der Gegensätze, und sie spürte, dass diese Merkmale nicht nur äußerlich präsent waren. Und doch hatte sein Gesicht noch nie Gewalt erfahren. Nicht einmal die kleinste Narbe verunzierte seine männlich schönen Züge.
Falls er ihre Musterung spürte, ließ er es sich nicht anmerken. Er saß völlig reglos da und schien sich auf irgendetwas zu konzentrieren, das sich Lucindas Verständnis vollkommen entzog. Während er solchermaßen abgelenkt war, bewegte Lucinda ihre Hand ganz langsam auf das Messer zu, bekam den Griff zu fassen und zog die Waffe näher.
»Die Dorfbewohner«, sagte er schließlich. »Sie machen Jagd auf mich. Sie hetzen mich, als wäre ich ein Tier.«
Lucindas Herz begann wild zu pochen. Die Dörfler waren hinter ihm her? Und er hatte sie zu ihrer Tür geführt? Lord Cantley hatte ein Kopfgeld auf sie ausgesetzt, um sicherzugehen, dass ihr niemand im Dorf Unterschlupf gewährte. Wenn Jackson Wulf sie jetzt nicht tötete, dann würde es zweifelsohne einer von Lord Cantleys Schergen tun, sobald sie ihm im Austausch gegen die Belohnung ausgeliefert worden wäre.
»Es wird dunkel.« Er sagte es leise, aber seine Stimme klang jetzt völlig anders als noch kurz zuvor. »Dir und deinem Kind droht Gefahr von mir, und denen da draußen auch.«
Seinem eigenen Eingeständnis nach war Lucinda schon von dem Moment an in Gefahr gewesen, als er die kleine Kate betreten hatte. Sie war gezwungen gewesen, sich in den letzten Monaten in dieser jämmerlichen Hütte zu verstecken. Die Lebensbedingungen hier waren sehr hart für sie gewesen. Sie hatte Angst gehabt, dass sie vielleicht sogar verhungern oder das arme Kind in ihr so klein zur Welt kommen würde, dass es keine Überlebenschance hätte.
»Sie werden jeden Moment hier sein.« Jacksons eigenartiger Blick wandte sich wieder Lucinda zu. »Die Dunkelheit bezwingt mich schneller, als die Füße dieser Narren sie hierher tragen können. Wenn ich dich jetzt töte, kann dieses Elend für meine Familie beendet sein.«
Da das Kind an ihrer Brust inzwischen eingeschlafen war, legte Lucinda den Kleinen vorsichtig beiseite und umklammerte das Messer in ihrer Hand noch fester. Jacksons glühende Augen beunruhigten sie. Seine Augen und die Art, wie sein Blick immer wieder zu ihren nackten Brüsten hinunterglitt. Kein Neugeborenes nuckelte dort noch. Und Jackson Wulf sah sie jetzt auf eine völlig andere Weise an. Er begehrte sie.
Wenn es sein musste, würde sie seine Schwäche gegen ihn benutzen, denn sie bezweifelte, dass sie ihn ohne das Überraschungsmoment auf ihrer Seite mit dem Messer töten könnte.
Es erforderte fast mehr Mut, als sie besaß, aber sie flüsterte: »Berührt sie. Berührt mich. Wenn ich schon sterben muss, dann schenkt mir Lust zusammen mit dem Schmerz.«
Wieder erhob er seine seltsam glühenden Augen zu ihrem Gesicht. Er berührte sie nicht, doch er beugte sich zu ihr vor. Sie war überrascht von dem Funken, der zwischen ihnen entflammte, als sein Mund den ihren streifte. Das unerwartete Gefühl ließ Lucinda zusammenfahren und vor ihm zurückweichen, aber dann holte sie tief Luft, beugte sich vor und presste ihre Lippen auf die seinen. Der Funke war noch da, überschattet nur von sehr viel dunkleren Gefühlen. Jackson legte eine Hand unter ihr Kinn und zwang sie sanft, den Mund zu öffnen.
Die streichelnde Berührung seiner Zunge in ihrem Mund brachte ihren Puls zum Rasen und ihren Magen vor Aufregung zum Kribbeln. Jackson benutzte seine Zunge, um sehr behutsam auch über die kleinen Bisswunden zu streichen, die sie an ihrer eigenen Unterlippe hinterlassen hatte. Sie hätte seinem Reiz vielleicht widerstehen können, wenn er das nicht getan hätte. Wenn er ihr nicht dieses kleine bisschen Mitgefühl entgegengebracht hätte. Mitgefühl war eine ebenso neue Erfahrung für sie wie die, einen Kuss zu geben, statt zu einem gezwungen zu werden. Die Hand des Fremden glitt unter ihr Haar, und er bewegte seinen Mund auf eine Weise, die sie einander irgendwie noch näher brachte und es ihm ermöglichte, noch tiefer in die warme Höhle ihres Mundes vorzudringen.
Das war zu viel für Lucindas normalerweise eher abgestumpften Sinne. Er war zu viel. Zu männlich. Zu erfahren. Zu gefährlich. Trotz allem, was sie schon erlitten hatte und er sie noch erleiden lassen wollte, stiegen Sehnsucht und Verlangen in ihr auf – beides Dinge, die sie noch nie bei einem Mann empfunden hatte, obwohl sie nun schon Mutter war.
Ihr Leben war keines mit behutsamer Werbung gewesen Es war derb und oft sogar vulgär. Alle Küsse, die ihr in der Vergangenheit abgerungen worden waren, waren immer gleich gewesen. Dieser Mann, dieses Tier, ihr möglicher Mörder, verstand es, eine Frau zu küssen. Wie konnten Lippen so fest und sanft zugleich sein? Süß wie Apfelkuchen, aber auch stark wie Apfelwein? Er hatte sie mit seinem Kuss in einen wahren Strudel gerissen, in dem sie nun, dem Wasser hilflos ausgeliefert, im Kreis herumwirbelte und keinen Boden mehr unter den Füßen fand.
Er überflutete sie mit unbekannten und unerwünschten Empfindungen, und wie eine Ertrinkende versuchte Lucinda, wieder an die Oberfläche zu gelangen und zu atmen. Ihre Arme glitten hoch und legten sich um seinen Nacken. Scheu berührte sie seine Zunge mit der ihren. Er gab einen Laut von sich, der tief aus seiner Kehle kam und sie bis ins tiefste Innere erbeben ließ. Sie verachtete ihn dafür, dass er ihr ein Gefühl abrang, und verachtete sich selbst, weil sie überhaupt keinen Hass auf diesen Mann verspürte, der die Absicht hatte, sie zu töten. Seine Augen waren geschlossen, sodass er das Messer in ihrer Hand nicht sehen konnte. Langsam hob Lucinda ihren Arm, brachte die Klinge in Position und stieß sie ihm in seinen Rücken.
3. Kapitel
Jackson spürte die Gefahr, bevor er wieder klar genug denken konnte, um zu reagieren. Die Klinge durchbohrte seine Haut, aber bei seinem jähen, scharfen Einatmen zögerte die Frau. Und ihr Zögern bewahrte ihn vor einer ernsthafteren Verletzung. Jackson fuhr zurück, entwand ihr das Messer und schleuderte es durch den Raum.
»Du wolltest mich umbringen!«, empörte er sich und war selbst überrascht, wie schwer er atmete, obwohl er doch nicht mehr getan hatte, als sie zu küssen.
»Ihr habt gesagt, Ihr wärt gekommen, um mich zu töten«, versetzte sie, und auch sie war völlig außer Atem.
»Aber so zu tun, als begehrtest du mich, ist niederträchtig.«
Sie schob ihr Kinn vor. »Nicht niederträchtiger, als eine Frau zu töten, nachdem sie gerade erst ihr erstes Kind zur Welt gebracht hat!«
Ihr Einwand hatte etwas für sich. Aber jetzt war keine Zeit, um Sünden zu vergleichen. Jacksons Haut hatte bereits zu jucken begonnen. Es war das Fell, das sich unter seiner Haut bildete. Das Fell, das seinen ganzen Körper überziehen und ihn mit dem Pelz eines Tieres – eines Wolfes – bedecken würde. Er stand schnell auf und zog sich aus. Wenn die Krallen aus seinen Fingerspitzen schossen, würde er seine Kleider durch die fieberhaften Bemühungen des Tiers, sie abzustreifen, ruinieren.
»Was tut Ihr da?«, flüsterte die Frau.
»Mich auf die Verwandlung vorbereiten«, antwortete er. »Nimm das Kind und geh. Ich werde dich ein andermal töten müssen.«
Für einen Moment sagte sie nichts. Dann gab sie ein sehr undamenhaftes, schnaubendes Geräusch von sich. »Das Kind nehmen und fliehen? Glaubt Ihr, ich hätte die Kraft, durch den Wald zu rennen? Ich habe gerade ein Kind zur Welt gebracht!«
Jackson kniete sich neben sie und brachte sein Gesicht ganz nahe an das ihre. »Wenn du leben willst und das Überleben deines Kindes sichern willst, wirst du diese Kraft finden, und zwar schnell!«
Sie hätte vielleicht noch weiter widersprochen, doch ein heftiger Schmerz durchzuckte plötzlich Jacksons Magen und zwang ihn, sich den Bauch zu halten.
»Was ist mit Euch?«, fragte sie.
Während er sich vor Schmerz vor- und zurückwiegte, erwiderte er: »Du meinst, außer der Kugel, die ein Loch in meine Schulter riss und jetzt auch noch der Stichwunde in meinem Rücken? Ich verwandle mich«, setzte er ernster hinzu. »Also verschwinde, solange du noch kannst.«
Jackson wusste, dass er binnen weniger Momente zu Boden fallen würde, weil der Schmerz dann unerträglich wurde. Er würde etwas Ähnliches wie sie zuvor erleben. Eine Geburt. Die Geburt des Wolfes. Solange er noch klar denken konnte, griff er nach seinen Stiefeln und zog sie aus. Da er nicht prüde war, dachte er sich nichts dabei, auch seine Hose abzustreifen. Falls er es schaffte, diese Nacht zu überleben, wollte er Kleider zum Anziehen haben, wenn er morgen nackt und vollkommen benebelt wieder zu sich kommen würde.
Die Frau, die noch immer auf dem Strohsack lag, drückte nun das Kind an ihre Brust und starrte Jackson offenen Mundes an.
»Nun geh schon!«, befahl er. »Und mach die Tür hinter dir zu. Vielleicht kann ich sie lange genug ablenken, damit ihr fliehen könnt.«
Sie schaute verwundert zu ihm auf. »Ihr wollt mich retten? Zuerst wollt Ihr mich töten, und nun wollt Ihr mich retten?«
Ein normales Gespräch zu führen war schwierig geworden. Jackson spürte, wie sich die Eckzähne in seinem Mund verlängerten. Vielleicht wäre es das Beste, sie der Frau zu zeigen, um sie aus ihrer Erstarrung aufzuscheuchen und in die Flucht zu schlagen. »Ich kann dich nicht von jemand anderem töten lassen«, erklärte er. »Das ist meine Aufgabe.« Wieder durchzuckte ihn ein wilder Schmerz und brachte ihn auf alle viere nieder. »Geh«, knurrte er. »Flieh, solange du noch kannst!«
Es war der Anblick seiner Zähne, der Reißzähne, die im dämmrigen Inneren der Kate aufblitzten, was Lucinda dazu bewegte, sich aufzurappeln und vor ihm zurückzuweichen. Sie hatte befürchtet, nicht die Kraft zu haben, sich von dem Strohsack zu erheben, aber sie hatte es getan, ohne auch nur einen Gedanken an ihre Erschöpfung zu verschwenden.
Ihre Beine waren schwach und zittrig unter ihrem Rock. Sie brauchte unbedingt ein Bad, doch dies war nicht der richtige Moment, um an Annehmlichkeiten zu denken. Nun durfte sie nur noch ans Überleben denken. An ihr eigenes und das ihres Sohnes, der ihr ohne eigene Wahl, ohne auch nur eine Erinnerung daran, wie sie ihn empfangen hatte, gegeben worden war.
Sie wich vor dem Mann zurück, der jetzt auf allen vieren auf dem Boden hockte. Viele hatten vergessen, dass die Welt ein Ort mit weißen Wundern und schwarzer Magie war. Doch die Dörfler klammerten sich noch immer an ihren alten Aberglauben. Und als Hexe, die sie war, hatte Lucinda sie darin sogar noch unterstützt. Der Anblick eines Mannes mit Reißzähnen und einem unter seiner Haut hervorsprießenden Fell irritierte sie zwar, aber er überraschte sie nicht.
Obwohl Lucinda von Natur aus neugierig war und allzu gern geblieben wäre, um die vollständige Verwandlung zu verfolgen, wusste sie, dass jedes längere Verweilen sie und auch ihr Kind das Leben kosten konnte. So bückte sie sich nach dem Korb, der ihre wenigen Besitztümer enthielt, und schlich vorsichtig, während Jackson Wulf sich weiter von der Gestalt eines Mannes in die eines Wolfes verwandelte, an den zerfallenden Mauern der Kate entlang zur Tür.
An der Schwelle hielt sie inne, und nur mit Mühe konnte sie einen Schrei unterdrücken, als sie einen Blick über die Schulter warf. Er befand sich jetzt auf allen vieren, alles Menschliche war vollständig verschwunden, und an seine Stelle war ein Wolf getreten. Seine Augen glühten in dem dämmrigen Inneren der Kate und musterten sie mit einem durchdringenden Blick. Wenn er sie tötete, während er in Wolfsgestalt war, könnte auch dann sein Fluch damit gebrochen sein?
Oder waren seine Behauptungen Unsinn? Wie konnte sie sein ärgster Feind sein, wenn sie sich bis heute noch nie begegnet waren? Sie hatte ihm nichts zuleide getan und keine Zaubersprüche über ihn verhängt. Doch er hatte ihr das Leben gerettet, ihr und ihrem Kind – konnte sie ihn dann guten Gewissens den Dörflern überlassen?
Das Kind in ihren Armen schrie leise auf, was Lucinda sehr bei ihrer Entscheidung half. Sie hatte jetzt nicht nur an ihr eigenes, sondern auch noch an ein weiteres Leben zu denken. Dieser Mann-Wolf – oder was immer er auch war – würde ihr auf den Fersen bleiben, wenn er überlebte. Männer waren nie ein angenehmer Teil ihres Lebens gewesen. Sie hatte ihren eigenen Vater nie gekannt und besaß nicht einmal einen Familiennamen. Und auch ihr armes Kind würde keinen haben. In einem Moment der Schwäche hatte der Fremde ihr geholfen; sie durfte im Gegenzug dazu jetzt nicht ebenfalls Schwäche zeigen.
Leise schlüpfte sie aus der Hütte und zog die Tür hinter sich zu. In der Ferne hörte sie das Geschrei der jagenden Männer. Die Nacht war schon hereingebrochen, aber Lucinda kannte sich gut aus in diesem Wald, nachdem sie sich hier monatelang versteckt gehalten hatte. Sie eilte in die entgegengesetzte Richtung, aus der die Jäger kamen. Ihre Beine zitterten noch immer, aber irgendwie fand sie die Kraft in sich, weiterzulaufen, einen Fuß vor den anderen zu setzen und so viel Abstand wie nur möglich zwischen sich und die kleine Hütte zu bringen.
Hinter ihr ertönte ein Heulen, das ihr eine Gänsehaut über den Rücken jagte. Mit dem Kind in ihren Armen und dem Korb mit ihren wenigen Habseligkeiten hastete sie weiter. Ihr Haus im Dorf war viel schöner gewesen. Sie hatte Dinge besessen, die sie mit dem Geld all derer gekauft hatte, die gute Zaubersprüche und Geburtshilfe von ihr gewollt hatten. Aber dann hatte ihr eigener Fluch alles zerstört, wofür sie ihr Leben lang gearbeitet hatte. Ihres hübschen Aussehens wegen war der Gutsherr auf sie aufmerksam geworden. Als es Lucinda abgelehnt hatte, sich von einem verheirateten Mann den Hof machen zu lassen, hatte dieser Mann sich nicht gescheut, einen ihrer eigenen Zaubertränke gegen sie einzusetzen.
Lucinda hätte mit gutem Recht alle Männer hassen müssen. Sie hatten ihr nichts als Ärger eingebracht. Trotzdem verlangsamte sie den Schritt und drehte sich zu der Richtung um, in der die kleine Bauernkate lag. Sie hörte Schreie, dann Musketenschüsse. Der Lärm ließ sie zusammenfahren. Viel schlimmer aber war der plötzliche Geruch von Rauch, den sie wahrnahm. In der Ferne loderten Flammen auf. Die Männer aus dem Dorf hatten die aus Lehm und Stroh erbaute Hütte offenbar in Brand gesetzt.
Irgendwo tief in ihrem Innersten verspürte sie für einen Moment ein Gefühl des Verlusts, ja, fast sogar der Trauer. Sie wusste nicht, warum, und ihr blieb auch keine Zeit, darüber nachzudenken. Jackson Wulf, egal, wie gut aussehend und anziehend er war, hatte vorgehabt, sie umzubringen und ihr das sogar klipp und klar gesagt. Sein Tod musste eigentlich eine Erleichterung für sie bedeuten. Er würde sie nicht mehr verfolgen, und er würde sie auch nie wieder bedrohen.
Lucinda blinzelte, um die verräterischen Tränen zu verdrängen, die hinter ihren Lidern brannten, und wandte den Blick von dem rötlich glühenden Nachthimmel in der Ferne ab. Ihr schoss plötzlich durch den Kopf, dass sie nirgendwohin konnte, dass sie und ihr kleiner Junge nicht einmal mehr das erbärmliche Hüttendach über dem Kopf hatten. Jackson Wulf hatte versprochen, für das Kind zu sorgen. Er hatte Verantwortung übernommen, zumindest mit Worten. Sie konnte natürlich nicht wissen, ob er ihnen auch mit Taten beigestanden hätte.
Er hatte Familie. Die Brüder Wulf waren sehr bekannt. Und obschon sie gesellschaftlich geächtet waren, waren sie doch reich. Sollte sie zu ihnen gehen? Sie über den Tod ihres Bruders informieren? Vielleicht würden diese Leute sich ihr dann verpflichtet fühlen. Vielleicht würden sie sie sogar für das Überbringen der Neuigkeit bezahlen … doch es bestand natürlich auch die Möglichkeit, dass sie sie töten würden.
4. Kapitel
London, drei Monate später
Das Bett war viel zu groß für eine Frau allein. Aber es war weich und frisch bezogen. Lucinda räkelte sich wie eine zufriedene Katze. Sie schlief in einem Nachtgewand aus feinster Baumwolle, das am Ausschnitt mit seidenen Bändchen durchzogen war. Lucinda hatte noch nie Seide an ihrer Haut gefühlt. Im Kamin brannte ein Feuer, das seine angenehme Wärme in dem großen Schlafzimmer verbreitete. Zum ersten Mal in ihrem Leben fühlte sie sich sicher und zufrieden.
In dem Zimmer nebenan weinte leise ihr kleiner Sohn. Im ersten Moment erhob sich Lucinda fast, um zu ihm zu laufen, bevor sie sich erinnerte, dass die Amme sich um Sebastian kümmern würde. Lucindas Milch war nur einen knappen Monat nach der Geburt ihres Sohns versiegt, was ihr eine große Hilfe bei der mutigen Entscheidung gewesen war, die sie gefällt hatte, als sie in London eingetroffen war.
Buchstäblich mit einem Schlag war aus der armen Hexe ohne Familiennamen eine feine Dame geworden. Lucinda ließ sich auf das Bett zurücksinken und seufzte wieder vor Zufriedenheit. Ihr Sohn war jetzt still, wahrscheinlich saugte er zufrieden an Marthas großen Brüsten. Hawkins, der Butler der Familie, hatte diese Frau als Amme eingestellt. Jetzt hatte Lucinda keine Sorge mehr auf dieser Welt … zumindest nicht, bis die Besitzer dieses eleganten Stadthauses nach London zurückkehrten.
Aber darüber mochte Lucinda gar nicht nachdenken. Die vergangenen drei Monate waren wie der Himmel auf Erden gewesen. Sie hatte ein schönes Dach über dem Kopf, einen immer gut gefüllten Magen und Kleider zum Anziehen, die unendlich viel eleganter waren als alles, was sie je besessen hatte. Hawkins hatte ihr versichert, dass Lady Wulf nichts dagegen haben würde, wenn sie sich in ihrer Abwesenheit aus ihren prall gefüllten Kleiderschränken bediente. Lucinda fragte sich, ob die Dame wohl nackt auf Wulfglen, dem Landgut der Familie, herumspazierte – zu dem sie und der Hausherr sich zu ausgedehnten Flitterwochen hinbegeben hatten, wie Lucinda von Hawkins erfahren hatte.
Es war geradezu unvorstellbar für Lucinda, dass eine Frau so viele Kleider brauchte, wie sie sie im Kleiderschrank der Hausherrin vorgefunden hatte. Aber von all diesen und anderen Annehmlichkeiten einmal abgesehen, war Lucinda vor allem ausgesprochen dankbar, dass ihr Sohn in Sicherheit war und nicht irgendwo auf der Straße verhungern musste.
Lord Cantley käme nie auf die Idee, sie hier zu suchen. Vermutlich waren in London schon jede Menge Gerüchte über sie in Umlauf, schließlich waren Dienstboten bekannt dafür, zu tratschen, aber Lucinda war es gewöhnt, der Gegenstand von Klatsch zu sein. Und deshalb würde sie dieses Haus keine Sekunde eher verlassen, als sie musste, und sie wollte sich auch nicht den Kopf darüber zerbrechen, was geschehen würde, wenn ihre angeblichen Verwandten zurückkehrten und von Jackson Wulfs Tod und der jungen Frau und dem Sohn des Toten erfuhren.
Lucinda Wulf. Zum ersten Mal hatte sie einen Familiennamen, auch wenn es nur einer war, den sie sich einfach angeeignet hatte, und kein Name, der ihr von Rechts wegen zugestanden hätte. Aber sie wollte sich deswegen nicht schuldig fühlen. Was hätte sie denn sonst tun können? Jackson Wulf hatte zugegeben, dass er sie hatte töten wollen – und er hatte versprochen, für Sebastian zu sorgen. Was er nun in gewisser Weise ja auch tat.
Eingelullt von der Wärme des munter brennenden Feuers und dem Gefühl, dass ausnahmsweise einmal alles in Ordnung war in ihrer Welt, kuschelte Lucinda sich noch tiefer unter ihre Decke und döste wieder ein.
*
Das Nachgeben der Matratze weckte Lucinda kurze Zeit später. Ihr blieb nicht einmal mehr Zeit, richtig zu sich zu kommen, bevor sie spürte, wie ein warmer Körper sich an ihren schmiegte. Lucinda versteifte sich im selben Moment wie der Körper neben ihr. Es war der Körper eines Mannes. Eines schamlos nackten Mannes. Lucinda begann zu schreien.
»Was in Herrgotts Namen …?«
Die Tür flog auf. Lucinda krabbelte aus dem Bett. Das nächtliche Kaminfeuer war heruntergebrannt und glimmte nur noch schwach, sodass sie Mühe hatte, das Gesicht des Unholds zu erkennen, der sich in das Haus und in ihr Bett geschlichen hatte.
»Eine Bewegung, und du bist ein toter Mann!«
»Hawkins.« Lucinda atmete erleichtert auf und lief zu dem Bediensteten hinüber, der eine Pistole in der Hand hielt.
»Steig langsam aus dem Bett, und komm ins Licht, wo ich dich sehen kann«, befahl Hawkins.
Das Rascheln von Bettzeug war zu hören; dann tat der Mann, wie ihm geheißen, und erhob sich wie ein dunkler Schatten in dem düsteren Schlafzimmer. Langsam ging er auf das Glimmen des kleinen Feuers zu, das im Kamin flackerte. Sein Gesicht lag noch im Schatten, aber der Feuerschein flimmerte über seine nackte, sonnengebräunte Haut, und Lucinda konnte gar nicht anders, als ihn anzustarren. Gott, wer immer er auch war, er hatte einen wundervollen Körper!
Eine Erinnerung regte sich in den tiefsten Winkeln ihrer Gedanken. Hatte sie den nackten Körper dieses Mannes nicht schon einmal gesehen? Die Antwort durchfuhr sie nur Sekunden, bevor er noch näher an das Feuer trat und das schwache Licht sein gut aussehendes Gesicht erhellte.
»Lord Jackson«, sagte Hawkins mit seiner ausdruckslosen Stimme. »Wir dachten, Ihr wärt tot.«
Lucinda war noch nie in ihrem Leben ohnmächtig geworden, aber jetzt war sie gefährlich nahe daran. Ihre Knie versagten ihr fast den Dienst. Vor ihr, in seiner ganzen nackten Schönheit, stand der Mann, den sie als tot zurückgelassen hatte. Der Mann, dessen Namen sie sich angeeignet hatte. Der Mann, der sie hatte töten wollen. Der Mann, der mehr als nur ein Mann war … der Mann, der sich vor ihren Augen in einen Wolf verwandelt hatte!
»Wir, Hawkins?«
Der Butler deutete auf Lucinda. »Eure bezaubernde junge Frau und ich.«
»Meine Frau?«
Lucindas sichere Welt brach völlig über ihr zusammen. Doch da sie eine Hexe und Geächtete war, hatte sie schon früh lernen müssen, sich im Leben durchzuschlagen. Und deshalb tat sie das Einzige, was ihr unter den gegebenen Umständen einfiel. Mit einem gespielten Freudenschrei lief sie zu Wulf und umarmte ihn stürmisch.
»Du lebst!«, rief sie Hawkins’ wegen aus. »Ich kann es fast nicht glauben!«
Der Feuerschein tanzte in Jacksons Augen, als er ernst auf sie hinabschaute. »Und ich kann nicht glauben, dass ich, nachdem ich dich drei Monate vergeblich gesucht habe, schließlich aufgegeben habe und heimkomme, nur um dich wartend hier in meinem Bett zu finden.«