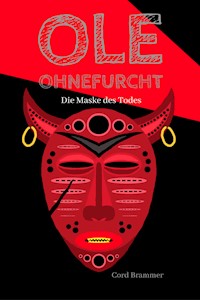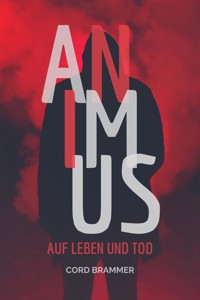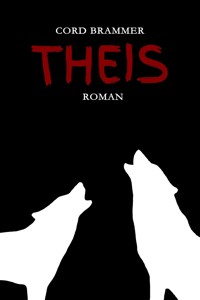
3,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Theis ist Hirte. Als Einzelgänger streift er mit seinen Tieren durch dunkle Wälder, stets darauf bedacht, den Kontakt mit Dorfbewohnern zu meiden. Eines Tages lernt er Woland kennen, der ihm dabei hilft, eines seiner Schafe aus dem Moor zu befreien. Woland ist Holzhändler. Er lebt im Totengrund auf einem weit abgelegenen Hof. Theis erhält von ihm das Angebot, den Winter dort verbringen zu können. Er lässt sich darauf ein, muss aber schnell feststellen, dass sich ein Leben in einer Gemeinschaft schwer gestaltet. Die Situation spitzt sich schließlich zu, bis Theis eines Morgens in einer Gefängniszelle aufwacht, ohne zu wissen, wie er an diesen Ort gelangt ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
THEIS
Cord Brammer
IMPRESSUM
THEIS
1. Auflage, 2020
Text: Copyright © 2020 Cord Brammer
Cover: Copyright © 2020 Cord Brammer
Impressum: Cord Brammer, Dorfstraße 6, 29362 Hohne,
www.cordbrammer.de
www.facebook.de/cord.brammer
www.twitter.com/cordbrammer
www.instagram.com/cord_brammer
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die vollständige oder auszugsweise Verwendung jeglicher Art bedarf der schriftlichen Zustimmung des Autors. Dies gilt insbesondere für die Verbreitung, die Vervielfältigung, die Übersetzung und die Einspeicherung in elektronische Systeme.
WENN DIE ZUKUNFT ZUR VERGANGENHEIT WIRD
KAPITELÜBERSICHT
PROLOG
SOMMER
KAPITEL 1
KAPITEL 2
KAPITEL 3
KAPITEL 4
KAPITEL 5
KAPITEL 6
KAPITEL 7
HERBST
KAPITEL 8
KAPITEL 9
KAPITEL 10
KAPITEL 11
KAPITEL 12
KAPITEL 13
KAPITEL 14
KAPITEL 15
KAPITEL 16
KAPITEL 17
KAPITEL 18
KAPITEL 19
KAPITEL 20
WINTER
KAPITEL 21
KAPITEL 22
KAPITEL 23
KAPITEL 24
KAPITEL 25
KAPITEL 26
KAPITEL 27
EPILOG
PROLOG
Mein Name ist Theis.
In welchem Jahr ich geboren wurde, kann ich nicht mit Gewissheit sagen. Mein Alter wird auf fünfzehn geschätzt, obwohl ich bestimmt schon mehr Sommer hinter mir habe. Wenn ich ehrlich sein soll, spielt es für mich keine Rolle, wie alt ich bin, denn ich muss mir über wichtigere Dinge den Kopf zerbrechen. Woher ich etwas zu essen bekomme, an welchem Ort ich die Nacht verbringe oder wie ich meine Tiere versorgen kann. Diese Fragen bestimmen meinen Alltag.
Ich bin einer von unzähligen Schafhirten, die versuchen, unsichtbar durch die Lande zu ziehen. Bin ich doch dazu gezwungen, in eines der Dörfer zu gehen, die weit verstreut in den tiefen Talschluchten liegen, werden mir häufig böse Blicke zugeworfen. Für die Bewohner bin ich nichts weiter als ein Wilder, der aus den unheimlichen Wäldern heraustritt, von denen ihre Dörfer umgeben sind. Ich führe ein ganz anderes Leben als sie, das zwar auch wie das ihre vom Einklang mit der Natur bestimmt wird, aber abgeschieden von dörflichen Gemeinschaften stattfindet. Ich kann verstehen, dass ich daher nicht gerade vertrauenswürdig auf sie wirke, doch viele geben mir nicht einmal den Hauch einer Chance, sie davon zu überzeugen, wie harmlos ich bin.
Ich führe ein sehr einsames Leben, habe oft wochenlang keinen Kontakt zu anderen Menschen. Dieser Umstand gefällt mir an manchen Tagen, doch die meiste Zeit bin ich deswegen zutiefst betrübt. Wenn ich wenigstens jemanden an meiner Seite hätte, mit dem ich mich unterhalten könnte. Dann würde ich mich weniger allein fühlen und müsste nicht alles mit mir selbst ausmachen. Ich würde mich mit dem anderen absprechen, wie meine Eltern es immer getan haben, wenn es um wichtige Entscheidungen ging. Doch ich mag gar nicht an die beiden denken, da mir sofort wieder ihr qualvoller Tod ins Gedächtnis gerufen wird. Das nicht enden wollende Nasenbluten, der plötzlich einsetzende Gewichtsverlust und die furchtbar anzusehenden Wahnvorstellungen.
Der letzte Weltkrieg hat die Bevölkerung der Erde mehr als halbiert und unsere Lebensweise in die Zeit des Mittelalters zurückgeworfen. Es gibt kaum ausgebildete Ärzte, geschweige denn ausreichend gute Medizin. Als meine Eltern krank wurden, wie viele junge Erwachsene, gab es keine Hoffnung auf Genesung, denn für die Infizierten war der Tod gewiss. Während ich wie durch ein Wunder verschont geblieben bin, fielen meine Eltern der letzten großen Pandemie zum Opfer.
Seit meiner Kindheit schlage ich mich nun schon alleine durch. Selbst für meinen Lebensunterhalt zu sorgen, stellt mich immer wieder vor große Herausforderungen, die ich häufig mit leerem Magen bewältigen muss. Dabei bleibt mir nichts anderes übrig, als den Kontakt zu Dorfbewohnern zu suchen, um mit ihnen einen Tauschhandel einzugehen.
Für das wertvolle Fell meiner Schafe erhalte ich die verschiedensten Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände, ohne die ich völlig aufgeschmissen wäre. Kleidung, die ich wegen meiner zwei linken Hände nicht nähen kann, Fleisch, das ich ohne Salz nicht haltbar machen kann, und Brot, das ich ohne einen Ofen nicht backen kann. Ich habe aber nicht allein das Fell meiner Schafe anzubieten, sondern darüber hinaus meine Kenntnisse in der Heilkunst, die ich von meinem Vater übernommen habe.
Ich verfüge über ein beachtliches Wissen, was die Wirkung von Kräutern angeht. Manchmal biete ich den Dorfbewohnern meine Dienste an, um ihre Schmerzen zu lindern oder ihre Tiere von Krankheiten zu befreien. Obwohl ich damit mehr Güter einfordern könnte als mit Schaffellen, dränge ich mich den Menschen nicht auf. Denn sollte ein Tier an einer Krankheit sterben, obwohl es von mir dagegen behandelt wurde, könnte man mich dafür verantwortlich machen. Uns Hirten wird nämlich nachgesagt, dass wir nicht nur heilen, sondern auch schädigen können, wenn wir es darauf anlegen. Dazu zählt nicht zuletzt, bei einem Tier den Tod herbeiführen zu können.
Dieses Hirngespinst hat sich in den Köpfen der Menschen festgesetzt, weil viele Hirten nicht nur als Heiler auftreten, sondern sich auch als Segner ausgeben. Sie bieten den Bauern für hohe Gegenleistungen an, ihre Tiere zu segnen, um sie damit angeblich vor Krankheiten zu schützen. Die meisten Bauern glauben fest an diesen Unfug, denn der Verlust eines einzigen Tieres kann ihre Existenz bedrohen. Da viele Bauern diese Dienste aber nicht bezahlen können, werden sie häufig von den Segnern in die Enge getrieben. Sie drohen den Bauern damit, eine Krankheit in den Tieren hervorzurufen oder Wölfe aus den tiefen Wäldern auf sie zu hetzen, sollten sie nicht ihre Dienste in Anspruch nehmen. Segner sind für mich nichts weiter als feige Erpresser.
Als Heiler werde ich von vielen Menschen mit den Segnern in eine Schublade gesteckt. Mir wird nachgesagt, wie sie Schäden herbeiführen zu können. Daher muss ich überaus vorsichtig sein, denn Segner werden von der Kirche und dem Staat verfolgt. Man sieht sie als Gotteslästerer an und bringt sie mit schwarzer Magie in Verbindung. Ihnen wird ein Pakt mit dem Teufel zugeschrieben, das höchste aller Vergehen innerhalb der Kirche, weswegen schon viele Prozesse stattgefunden haben, an deren Ende auf einem Scheiterhaufen das Urteil vollzogen wurde.
Wie diese Segner will ich nicht enden.
SOMMER
KAPITEL 1
Abgeschieden gelegene Lichtungen sind meine Lieblingsorte, denn auf ihnen kann ich der Finsternis entfliehen, die immer in den dichten Wäldern herrscht. Vor allem nach einem langen Winter wie dem letzten, mit nur wenigen strahlend hellen Tagen, erfreue ich mich daran, in der Sonne zu stehen und ihre Wärme auf meiner Haut zu spüren. Dann vergesse ich alle Sorgen, die in meinem Kopf ständig auf sich aufmerksam machen, und genieße einfach nur den Augenblick.
Ganz anders verhält es sich, wenn ich auf eine von vielen Menschen bewohnte Lichtung komme. Die Lautstärke der Sorgenstimmen in meinem Kopf steigt dann an, je nachdem, wie viele Menschen in dem Dorf leben, das ich besuche. Sie raten mir zur Vorsicht, warnen mich vor direktem Blickkontakt mit den Bewohnern und fordern mich dazu auf, das Weite zu suchen, um bloß nicht in Schwierigkeiten zu geraten.
Dennoch wage ich spät abends den Schritt aus dem Wald hinaus, hinauf auf die Lichtung, um meine neuen Schuhe abzuholen, die ich in Auftrag gegeben habe. Meine alten sind seit Wochen verschlissen und werden nur noch von dünnen Streifen aus Rinde zusammengehalten, die ich täglich austauschen muss, manchmal sogar mehrmals. Das raubt mir meine überaus kostbare Zeit, die ich eigentlich allein dafür benötige, um mich ausreichend um meine Schafe kümmern zu können.
Die Herde lasse ich grasend am Waldrand zurück, wo ich sie gut im Auge behalten kann. Sie verhält sich ruhig, weshalb ich mich mit gutem Gefühl von ihr entferne. Mein Anlaufpunkt ist das Haus des Schusters, das etwas abseits des Ortes liegt. Ich klopfe an die Tür, obwohl es einen Klingelschalter gibt, den ich drücken könnte, doch die Stromversorgung ist seit Jahren zusammengebrochen, ohne bisher wiederhergestellt worden zu sein.
»Ich komme schon«, ruft mir Ulrich Huber genervt entgegen, als habe ich nach seinem Empfinden zu häufig geklopft. Als er die Tür öffnet und mich vor sich stehen sieht, kommentiert er seinen abfälligen Blick: »Du bist es … Wenn du nicht bezahlen kannst, mach dich gleich wieder aus dem Staub … Oder hast du das Geld dabei?«
Ich nicke ihm zu.
»Dann komm rein.« Wie einen Hund am Halsband zieht er mich am Hemdskragen ins Haus. Bevor er danach die Tür hinter sich ins Schloss wirft, lässt er seinen Blick über den Platz vor seinem Haus schweifen, der völlig verlassen daliegt.
Ich folge ihm durch einen dunklen Flur, bis wir in seiner hellen Werkstatt stehen, in die durch ein Fenster das Sonnenlicht hereinflutet. Wie beim letzten Mal fallen mir sofort die vollen Regale auf, in denen Schuhleisten mit verschiedenen Größen lagern. Sie dienen als Vorlagen für die Herstellung von Schuhen, sind sozusagen perfekte Abdrücke der einzelnen Kundenfüße. Auch meine werden zwischen ihnen sein.
In einem weiteren Regal stehen die fertigen Schuhe, die geduldig darauf warten, abgeholt zu werden. Herr Huber holt meine hervor und stellt sie auf die Werkbank, mit den Worten: »Wie findest du sie?«
»Sie sind sehr schön geworden«, antworte ich zufrieden, da ich endlich wieder heile Schuhe an den Füßen haben werde, die mir auch noch gefallen. Von den Mustern, die auf der Fensterbank stehen, habe ich mir das ausgesucht, welches mir am meisten zugesagt hat.
»Zieh sie an und geh ein paar Schritte«, fordert Herr Huber mich auf. Schon schlüpfe ich in meine neuen Schuhe hinein. Die alten verstaue ich in meinem Rucksack. Ich werde sie tragen, wenn ich zum Baden in einen Fluss gehe, um mir nicht die Fußsohlen an spitzen Steinen aufzureißen. Das ist mir schon mehrmals passiert. Zum Glück weiß ich, wie man solche Wunden behandelt.
Kurz darauf laufe ich unter strenger Beobachtung von Herrn Huber über den dunklen Flur bis zur Haustür und kehre dann zu ihm in die helle Werkstatt zurück.
Beinahe teilnahmslos fragt er mich: »Und?«
»Ich finde, sie sind sehr bequem«, sage ich.
»Gut, es bleibt beim alten Preis«, bemerkt Herr Huber mit ausgestreckter Hand, in die ich das Geld legen soll. Während ich den mühsam gesparten Betrag aus meinem Geldbeutel hole, bin ich einfach nur froh darüber, dass er mich nicht wie viele andere Handwerker über den Tisch zieht. Auch wenn er es sich in keiner Weise anmerken lässt, meint er es gut mit mir. Das dachte ich schon, als ich die Schuhe vor Wochen in Auftrag gegeben habe. Denn er ließ sich darauf ein, nicht sein eigenes Leder bei der Herstellung zu verarbeiten, sondern das von mir mitgebrachte Leder, welches von einem meiner Schafe stammt, das ich leider wegen zwei gebrochener Beine schlachten musste. Nur deshalb kann ich mir die Schuhe überhaupt leisten.
Ich gebe ihm das Geld. Er steckt es sich in die Hosentasche und geht in den Flur. Ich folge ihm ohne ein Wort. Als wir an der Haustür ankommen, schaut er durch das daneben liegende Fenster, bevor er die Tür öffnet und mich hinauslässt. »Bis zum nächsten Mal.«
»Ja, machen Sie es gut«, entgegne ich höflich, doch schon fällt die Tür lautstark ins Schloss, sodass meine Schafe davon aufgescheucht werden. Sie haben sich längst von dem Schreck erholt, als ich zu ihnen zurückgekehrt bin, um mit ihnen in den Schutz des Waldes einzutauchen. Ich zähle sie durch, was nicht sehr lange dauert, da es nur dreiunddreißig Schafe sind. Sie sind vollzählig. Also mache ich mich auf den Weg, verschwinde wieder in meine Welt, in die mir meine Schafe gehorsam folgen.
Als ich mich tief im Wald befinde, höre ich plötzlich eine Frauenstimme meinen Namen rufen. Zuerst denke ich an ein Hirngespinst, denn wenn man so gut wie immer alleine ist, bildet man sich häufig die Anwesenheit anderer Menschen ein. Aber die Frauenstimme scheint echt zu sein, denn sie verlangt nach wie vor nach mir, was mich innehalten lässt. Da ich sie nun besser hören kann, fällt mir auf, dass mir ihr Klang bekannt vorkommt.
»Theis?«, meldet sie sich ein weiteres Mal.
»Ja«, mache ich mich bemerkbar. »Hier bin ich.«
In diesem Moment taucht in einiger Entfernung eine Gestalt zwischen den Baumstämmen auf, verschwindet wieder hinter ihnen und wird dann endgültig für mich sichtbar. Sie strauchelt beinahe in meine Richtung, da sie etwas in ihren Armen hält, das eine gewaltige Last zu sein scheint. Bei genauerem Hinsehen erkenne ich, dass es sich dabei um ein Ziegenlamm handelt, welches mit aller Macht versucht, sich aus ihrem festen Griff zu befreien. Mit letzter Kraft schafft die Frau es bis zu mir, legt das Lamm auf den Boden und drückt es mit ihren Knien ganz leicht in das weiche Moos, damit es sich nicht davonmacht. Das Lamm wehrt sich weiterhin, kann aber nicht entkommen.
»Was machen Sie denn hier draußen, Frau Vogler?«
»Du sollst mich doch Anna nennen«, schnauft sie.
»Ja, entschuldige«, entgegne ich, und ich ärgere mich darüber, dass ich immer wieder vergesse, sie beim Vornamen anzusprechen. »Ist etwas mit dem Lamm?«
»Schau dir selbst die Verletzung an«, meint Anna mit vor Anstrengung verzerrtem Gesicht, während sie nach einem Bein des Lamms greift und es in die Länge zieht. Vom Knie bis zum Huf klafft eine fleischige Wunde, die wirklich übel aussieht und bereits sehr viel Eiter gebildet hat. Entsetzt schaue ich Anna an. Mein Blick scheint zu fragen, wie es dazu gekommen ist.
»Das Lamm ist im Stacheldraht hängen geblieben«, erklärt sie, »als es seiner Mutter gefolgt ist, die gerade ausbrechen wollte. Du weißt doch, wie das ist … Ich habe nun die Befürchtung, dass sich die Wunde weiter entzünden könnte, wenn sie nicht richtig versorgt wird. Eigentlich würde ich das selbst machen, aber bei diesem Ausmaß traue ich mir das nicht alleine zu. Du weißt viel besser als ich, was gemacht werden muss, damit sie schnell verheilt. Ich kann dir nur nicht viel dafür zahlen.«
»Mach dir deswegen mal keine Sorgen«, beruhige ich sie mit einer beschwichtigenden Geste. »Behalte dein Geld für dich und deine drei Kinder.«
»Theis«, sagt Anna auffordernd und sucht dabei meinen Blick, »das ist sehr nett von dir. Ich weiß das wirklich zu schätzen. Aber wenn ich irgendwann dazu in der Lage sein sollte, werde ich dich für alles bezahlen, was du bisher für mich getan hast. Hast du mich gehört?«
»Ja, aber ich helfe dir wirklich gern, ohne eine Gegenleistung zu erwarten«, stelle ich noch mal klar und sehe mir die Wunde nun genauer an. Da sie teilweise verdreckt ist, kann der erste Schritt zu ihrer Behandlung nur der sein, dass wir sie reinigen. »Dort drüben ist ein kleiner Bach. Bitte sei so nett und hol ein wenig Wasser.«
»Mache ich«, sagt Anna entschieden, da sie mir unbedingt behilflich sein möchte. Sie nimmt einen metallenen Becher von mir entgegen, den ich immer am Rucksack bei mir trage, und zieht sofort los. In der Zwischenzeit versuche ich, das Ziegenlamm ruhig zu halten, denn trotz seiner Verletzung steckt es voller Energie. Nur mit Mühe schaffe ich es nebenbei, Verbandszeug aus meinem Rucksack zu holen, das ich ebenfalls stets bei mir habe, falls sich eines meiner Tiere verletzen sollte.
Vorsichtig kommt Anna mit einem randvollen Becher zurück, der bei ruckartigen Bewegungen kleine Mengen Wasser verliert. Mit dem Rest soll sie den Dreck aus der Wunde holen, doch sie äußert Bedenken bezüglich der Sauberkeit des Bachwassers. Ich kann ihr aber versichern, dass es genauso rein ist wie das Trinkwasser aus dem Dorfbrunnen, da es ebenfalls untersucht wurde, nachdem die Wasserversorgung vor Jahren komplett zusammengebrochen war. In den umliegenden Dörfern hob man daher die vor Jahrhunderten zugeschütteten Brunnen aus, deren Lage man anhand alter Zeichnungen ermitteln konnte, die in den Gemeindearchiven lagerten. An den Böden dieser Brunnen fand sich absolut reines Grundwasser, das mit gutem Gewissen getrunken werden kann.
Während Anna nun wieder dem Lamm die Stirn bieten muss, suche ich in der Umgebung nach Schafgarbe, was ein vielseitig einsetzbares Heilkraut ist, das ich häufig zur Wundheilung einsetze. Zu dieser Jahreszeit wächst es außerhalb des Waldes überall, sodass man regelrecht darüber stolpert. Am Waldrand werde ich schnell fündig. Auf dem Rückweg sammele ich trockenes Holz vom Boden auf und fülle den Becher wieder mit Wasser. Anna hat bereits die Hände frei, um das Lamm zu streicheln. Es liegt nun ruhig vor ihr, atmet ganz flach und ist kurz davor einzuschlafen. Es scheint verstanden zu haben, dass wir ihm nichts Böses, sondern nur Gutes wollen.
»Wir müssen die Schafgarbe für kurze Zeit in kochendes Wasser legen, damit die Inhaltsstoffe freigesetzt werden und sie ihre Wirkung entfalten können«, beschreibe ich das weitere Vorgehen. »Kannst du dich um das Lamm kümmern, bis ich ein Feuer angezündet habe?«
»Ja, natürlich.«
Seit einigen Tagen habe ich keine Streichhölzer mehr, weswegen ich das trockene Moos zwischen den aufgestapelten Holzstücken wie früher anzünden muss. Mit einem Stück Eisen, das ich gegen einen scharfkantigen Feuerstein schlage, lasse ich dicht am Holz schnell verglühende Funken entstehen, die sich auf das Moos legen. Als ich zwischendurch leicht dagegen puste, steigt erster Rauch zu mir herauf. Dann ist auch schon eine kleine Flamme zu sehen, die sich ausbreitet, bis das gesamte Moos Feuer gefangen hat. Es setzt das trockene Holz in Brand, über das ich nun auf eine Halterung den Becher mit Wasser stelle, damit es darin zu brodeln beginnt.
Als die Schafgarbe im Wasser kocht, verbinde ich mit einer ersten Schicht das Bein des Lamms, das nach wie vor ruhig schläft. Ich hole die Schafgarbe aus dem Wasser, drücke sie ganz leicht mit den Fingern aus und lege sie noch warm auf die Binde, direkt über die Wunde. Das Lamm zuckt kurz zusammen, doch es wacht nicht auf. Nun muss ich die Schafgarbe in den restlichen Verband einbinden, was noch ein wenig dauern wird. Dabei erkläre ich Anna, wie sie die Verletzung weiter behandeln sollte: »Die Wunde wird bald aufgehört haben zu eitern, wenn du den Verband täglich wechselst und immer neue Schafgarbe auf die Wunde legst. Solltest du beobachten, dass sich die Wunde zusammenzieht, kannst du den Verband entfernen und die gekochte Schafgarbe direkt auf die Wunde legen. Danach wird es nicht mehr lange dauern, bis sie verheilt ist.«
Anna legt ihre Hand auf meine Schulter und schaut mich durchdringend an. »Theis, du bist ein wirklich guter Junge. Obwohl du von vielen verstoßen wirst, bist du überaus hilfsbereit. Gerade diese Eigenschaft rechne ich dir sehr hoch an, denn es gibt in diesen schweren Zeiten nur wenige, die auch an andere denken. Ich freue mich schon darauf, dich bald wiederzusehen.«
Ich schaue verlegen zu Boden, um Anna nicht sehen zu lassen, dass meine Augen glasig sind. Die aufkommenden Tränen kann ich gerade noch unterdrücken, indem ich mich stark zusammenreiße. Dennoch bleibt ein Kloß in meinem Hals stecken, mir fehlen die Worte, weshalb ich nur einen geflüsterten Dank herauskriege.
»Nein, ich habe dir zu danken«, sagt Anna und nimmt mich in den Arm. »Du warst mir ein weiteres Mal eine große Hilfe. Und ich weiß immer noch nicht genau, wie ich das alles wieder gutmachen soll.«
»Wie ich schon zu dir gesagt habe, du stehst in keiner Weise in meiner Schuld«, wiederhole ich und löse die Umarmung. Da es mir unangenehm ist, schon wieder über eine Bezahlung zu sprechen, was Anna zu merken scheint, da sie nicht weiter nachhakt, lösche ich das Feuer und packe meine Sachen zusammen. »Es wird gleich dunkel. Du solltest zurück ins Dorf gehen. Außerdem muss ich nach einem Platz suchen, an dem ich mit meinen Schafen die Nacht verbringen kann.«
»Ich habe deine wertvolle Zeit schon viel zu lange in Anspruch genommen«, bemerkt Anna und beugt sich dann zu ihrem Lamm hinunter.
»Lass mich dir helfen«, sage ich zu ihr und bitte sie, ein Stück zur Seite zu treten. Ich hebe das schwere Lamm für sie hoch und überreiche es ihr.
»Danke schön«, sagt sie abschließend und verabschiedet sich. Über den unebenen Waldboden strauchelt sie in Richtung des Dorfes fort. Ich schaue ihr nach, bis sie endgültig hinter den dicken Baumstämmen verschwunden ist. Ein weiteres Mal wird mir unmissverständlich meine Einsamkeit vor Augen geführt. Dieses Gefühl verstärkt sich, da ich nun auch noch vom letzten Tageslicht allein gelassen werde. Die Sonne wird gleich untergegangen sein.
In die Stille der Dämmerung platzt plötzlich lautes Glockengeläut, das nur von dem Kirchturm des Dorfes stammen kann, in das Anna gerade zurückkehrt. Schließlich würde keine andere Kirchturmglocke bis hierher zu hören sein, da die nächste Siedlung kilometerweit entfernt liegt. Doch warum ertönt sie zu so später Stunde?
Sekunden später mischt sich Geschrei in die hellen Klänge der Glocke. Zuerst nur von wenigen Menschen, doch es werden schnell mehr, bis nur noch ein schriller Ton zu vernehmen ist, aus dem aber ein Warnruf immer wieder hervorsticht: »Wölfe!«
KAPITEL 2
Wegen des Nahrungsmittelmangels gehen die Menschen vermehrt in den Wäldern auf die Jagd und treten den Wölfen damit bei der Nahrungssuche als Konkurrenten gegenüber. Seither haben die Angriffe der Wölfe auf die Dörfer stark zugenommen. Dabei wurden nicht nur Nutztiere gerissen, sondern in seltenen Fällen auch Menschen verletzt, die sich den Wölfen in den Weg gestellt haben, um ihre Tiere zu schützen. Sogar von Toten habe ich gehört.
Ich möchte den Dorfbewohnern eigentlich gerne zur Seite stehen, doch mich plagen gerade gemischte Gefühle. Auf der einen Seite sollte ich mich vom Dorf fernhalten, da Wölfe in ihm ihr Unwesen treiben, durch die meine Schafe gefährdet wären. Ich würde sie den hungrigen Wölfen schutzlos ausliefern, wie auf einem Silbertablett. Auf der anderen Seite wäre es leichtsinnig von mir, nicht ins Dorf zurückzukehren, da die Bewohner in ihrem Aberglauben nach einem Schuldigen suchen werden, der ihnen die Wölfe auf den Hals gehetzt hat, wofür ein Hirte wie ich besonders infrage kommt. Die Bewohner würden mich allein aufgrund meiner Anwesenheit unter Generalverdacht stellen.
Dass Anna mich verrät, kann ich ausschließen, doch bei Herrn Huber habe ich meine Bedenken. Nur weil ich heute bei ihm war, könnte er meinen Namen ins Spiel bringen, ohne sich dafür zu schämen, mich als Kunden zu haben. Dies würde ihm von den anderen Dorfbewohnern allein aufgrund der Tatsache verziehen werden, weil er mich als den möglichen Übeltäter entlarvt hätte. Daraufhin würden sie nach mir suchen, regelrecht eine Jagd auf mich veranstalten, wenn nicht sogar ein Kopfgeld auf mich aussetzen. Das hört sich vielleicht nach einer Übertreibung an, aber es wäre nicht das erste Mal in dieser Gegend.
Ich darf es nicht dazu kommen lassen, sondern muss mich dieser schwierigen Situation stellen, indem ich mich zur gleichen Zeit wie die Wölfe zeige. Lediglich auf diese Weise werde ich möglichen Anschuldigungen entgegenwirken können, und wenn ich es nur schaffen sollte, sie zu entkräften, wäre das schon ein Erfolg. Auf das Leben meiner Schafe kann ich deshalb keine Rücksicht nehmen, mit möglichen Verlusten muss ich rechnen.
Die Schreie der Dorfbewohner sind nach wie vor zu hören, dennoch muss ich mich beeilen, da Angriffe von Wölfen schnell vonstattengehen. Alles könnte gleich vorbei sein, denn wenn sie erst mal ihre Beute gemacht haben, ziehen sie sich schnell zurück, um nicht selbst zum Opfer zu werden. Also renne ich auf das Dorf zu, meine Schafe jagen hinter mir her. Als ich mit ihnen an den Waldrand gelange, halte ich sie mit einem Zeichen auf, das sie auf der Stelle stillstehen lässt. Ich entscheide, sie an diesem Ort zu lassen, um sie vor einem Blickkontakt mit den Wölfen zu schützen. Ohnehin sind sie bereits sehr aufgewühlt, was ich an ihrer Körpersprache ausmachen kann. Ihr natürlicher Instinkt lässt sie die Gefahr spüren.
Die Wölfe befinden sich bereits auf dem Rückzug. Auf der gegenüberliegenden Seite der Lichtung ziehen sich die ersten in den Wald zurück, worüber ich wegen meiner Herde überaus froh bin. Ihre Zahl kann ich nur schwer schätzen, da sie wild durcheinander laufen, um ihre Beute in Sicherheit zu bringen, die sie blutig in ihren Mäulern tragen. Aber ich nehme an, dass es nicht mehr als zehn Stück sind, die vor den Menschen mit ihren brennenden Fackeln flüchten. Darüber hinaus werden sie mit spitzen Heugabeln vertrieben, die erfolglos wie Speere eingesetzt werden.
Ich schließe mich den Männern an, die entschieden das Dorf verteidigen. Auf dem Weg zu ihnen greife ich nach einer Mistgabel, die an einen Stall lehnt. Mit den Zinken nach vorne gerichtet, schleudere ich sie im hohen Bogen von mir weg, genau auf das Rudel zu. In der Dämmerung kann ich kaum ausmachen, ob sie einen der Wölfe erwischen wird. Ich erlange erst Gewissheit darüber, als ein schmerzverzerrter Aufschrei in meine Ohren dringt, eindeutig der eines Wolfes.
Welcher es ist, erkenne ich nun, denn er springt vor Schmerzen davon, um die in seiner Schulter steckende Mistgabel abzuschütteln. Dies gelingt ihm nach kurzer Zeit, sodass er den anderen Wölfen in den Wald folgen kann. Dabei fällt ihm ein zerfleischtes Tier aus dem Maul, welches er wieder aufzunehmen versucht, dann aber liegen lässt, weil wir immer näher auf ihn zu rücken. Als letzter taucht er humpelnd zwischen den Bäumen ab.
»Das war ein guter Wurf«, sagt einer der Männer zu mir und klopft mir dabei von hinten auf die Schulter. Als er um mich herumgeht, lächelt er zuerst noch, dann verfinstert sich sein Blick. »Du bist doch dieser Hirtenjunge. Kannst du mir sagen, was du hier machst?«
Die anderen Männer werden dadurch auf mich aufmerksam, es sind ungefähr fünfundzwanzig an der Zahl. Sie umstellen mich, als wollten sie verhindern, dass ich wie die Wölfe davonlaufe. Sie erwarten eine schnelle Antwort von mir, die ich ihnen sogleich nüchtern vortrage: »Ich war gerade in der Nähe und habe die Glocken läuten hören. Und weil das für diese Uhrzeit ungewöhnlich ist, war mir auf der Stelle klar, dass etwas Schlimmes vor sich geht. Ich bin sofort losgelaufen, um euch zu helfen.«
»Du wolltest uns also helfen …«, lacht der Mann, mit dem ich noch nie etwas zu tun hatte, den ich aber vom Sehen kenne. Er sucht Blickkontakt zu den anderen Männern, die ebenfalls zu lachen beginnen. »Das nehme ich dir nicht ab. Das sollen wir dir glauben?«
»Genau, was hast du davon?«, wirft ein anderer ein.
»Muss man denn immer etwas davon haben?«, halte ich dagegen. »Kann man nicht auch helfen, ohne etwas dafür zu verlangen, ohne einen Hintergedanken zu haben?«
»Natürlich ist das möglich, aber du bist ein Hirte«, fährt der Mann fort. »Du musst doch ganz genau wissen, was die meisten Menschen über euch denken.«
»Ihr seid Betrüger«, ruft jemand.
»Verdammte Halsabschneider sind das.«
»Nein, nichts weiter als Erpresser«, meint einer.
»Da hörst du, was sie von dir halten«, sagt der Mann nun. Mir fällt wieder ein, dass es sich bei ihm um den Bürgermeister handelt, weswegen er wahrscheinlich das Reden übernimmt. »Warum bist du hier in der Gegend?«
Ich überlege kurz, ob ich den Schuster erwähnen soll, denn ich möchte zu seinem Schutz eigentlich verhindern, dass man ihn mit mir in Verbindung bringt. Doch mir fällt so schnell nichts ein, was ich stattdessen erzählen könnte, da zu viele Augenpaare auf mich gerichtet sind, die mich nervös werden lassen: »Ich war beim Schuster, weil ich neue Schuhe brauchte, da meine alten Schuhe hin sind.«
Der Bürgermeister schaut mich fest an und erwartet einen Beweis: »Dann wird es dir sicher nichts ausmachen, uns deine neuen Schuhe zu zeigen.«
»Keinesfalls«. Ich hebe mein rechtes Bein und halte ihm den Schuh hin. Um ihn besser sehen zu können, bittet er die Männer, den Kreis um uns zu vergrößern, damit mehr Licht einfällt. Schließlich wird ihm eine Fackel gereicht, die ihn erkennen lässt, dass die Schuhe nagelneu sind und von dem Dorfschuster stammen könnten. Wie ich im flackernden Licht sehe, ähneln seine Schuhe meinen.
»Ist der Huber auch hier?«, fragt er nun.
»Ja, hier bin ich«, antwortet dieser und drängelt sich durch die Menge nach vorn, bis er direkt an meiner Seite steht. Schweißperlen glänzen auf seiner Stirn.
»Stimmt es, was er sagt?«, fragt der Bürgermeister in einem scharfen Ton, als würde er ein Verhör durchführen. »Hast du ihm die Schuhe verkauft?«
Herr Huber zögert einen Moment, schaut in die Gesichter der anderen Männer, als sei es ihm unangenehm, vor ihnen ein Geständnis abzulegen, bis er sich endlich zu einer Antwort überreden kann. »Ja, die Schuhe stammen aus meiner Werkstatt.«
»Das wollte ich nicht wissen«, schiebt der Bürgermeister hinterher. »Die Frage lautete, ob du ihm die Schuhe verkauft hast.«
»Ja«, rückt Herr Huber nun mit der Sprache raus. »Vor einigen Wochen bat er mich darum, ihm neue Schuhe zu fertigen. Diesen Wunsch konnte ich ihm nicht abschlagen, weil ich das Geld dringend brauchte. Heute Abend tauchte er dann auf, um die Schuhe abzuholen. Bist du nun zufrieden?«
Der Bürgermeister schaut zwischen dem Schuster und mir hin und her. In seinem Blick erkenne ich, dass ihm nicht gefällt, was er gerade hören musste. »Hat er sie dir denn wenigstens bezahlt? Oder kam es wegen des Geldes zu einem Streit?«
Da ich genau weiß, dass nach einem Grund dafür gesucht wird, warum die Wölfe in das Dorf eingefallen sind, schaue ich zu Herrn Huber hinüber und hoffe auf eine ehrliche Antwort. »Nein, wir hatten keinen Streit. Er gab mir das Geld, nahm die Schuhe in die Hand und ging wieder aus dem Haus. Er war vielleicht zehn Minuten bei mir. Länger auf keinen Fall.«
Mir fällt ein Stein vom Herzen, doch ich habe mich offensichtlich zu früh gefreut, denn nun ruft der Bürgermeister in die Runde: »Gibt es einen anderen unter euch, der in irgendeiner Sache schon mal mit diesem Hirten aneinandergeraten ist? Wurdet ihr vielleicht von ihm bedroht?«
Die Männer schauen sich gegenseitig an, doch keiner von ihnen meldet sich zu Wort, weil niemand von ihnen einen Grund dazu hat. Die meisten dürften mich nicht kennen, denn ich kenne kaum einen von ihnen. Sie warten stumm darauf, wie der Bürgermeister fortfahren wird. Ihre Blicke sind nun wieder auf ihn gerichtet, was er augenscheinlich bemerkt: »Also gut, du scheinst dir bei niemandem etwas zu Schulden kommen lassen zu haben, was dich aber nicht davon freispricht, die Wölfe auf unser Dorf gehetzt zu haben.«
»Die Wölfe werden selbst darauf gekommen sein, euer Dorf anzugreifen, weil ihr ihnen die Nahrung wegschießt«, gebe ich zu bedenken. »Sie haben doch gar keine andere Wahl, als sich bei euch etwas zu holen.«
»Werde bloß nicht frech«, warnt mich der Bürgermeister. »Du versuchst, von dir abzulenken, uns die Schuld dafür in die Schuhe zu schieben, dass die Wölfe in unser Dorf einfallen, unseren Kindern Angst einjagen und unser Vieh zerfleischen.«
»Das stimmt nicht«, verteidige ich mich ruhig. »Ich wollte euch nur darauf hinweisen, dass die Wölfe einen triftigen Grund dafür haben, euch das anzutun. Sie wollen ihren Hunger stillen, folgen dabei ihren Instinkten und gehen den Weg des geringsten Widerstands. Bevor sie lange im Wald nach Nahrung suchen, bedienen sie sich lieber dort, wo ihnen die Beute wie auf einem Präsentierteller serviert wird. Ihr Verhalten lässt sich also ganz einfach erklären, ohne dass ein anderer dafür verantwortlich sein muss. Wie du eben erfahren hast, gibt es für mich keinen Grund, euch einen Schaden zuzufügen. Also erhebe mich nicht zu eurem Sündenbock, sondern lass mich bitte einfach dorthin zurückkehren, wo ich hergekommen bin.«
»So leicht kommst du mir nicht davon«, wirft er mir verächtlich an den Kopf. »Du stehst weiterhin unter Verdacht, weil du ein unglaubwürdiger Hirte bist.«
»Hast du mir denn eben gar nicht zugehört?«, möchte ich von ihm wissen. Obwohl ich unschuldig bin, fühle ich mich mittlerweile verantwortlich für das, was in diesem Ort gerade passiert ist. Und das nur aufgrund der Tatsache, dass man es mir einzureden versucht. Doch ich muss dagegen angehen, für mich selbst einstehen, bevor die Bewohner endgültig davon überzeugt sind, den Übeltäter vor sich stehen zu haben. Ich bringe weitere Argumente vor, die gegen mich als Verbrecher sprechen, und ich muss darauf achten, dass ich dabei nicht ausfallend werde: »Glaub mir doch, ich habe wirklich nichts damit zu tun. Außerdem habe ich euch sogar dabei geholfen, die Wölfe zu vertreiben. Du hast mich dafür eben sogar noch gelobt. Warum hätte ich sie also vorher auf euch hetzen sollen?«
»Vielleicht um von dir abzulenken«, hält der Bürgermeister sofort dagegen, als habe er für alles eine Erklärung. »Um es so aussehen zu lassen, dass du es nicht warst, obwohl du eigentlich dahintersteckst. In meinen Augen bist du ein schlauer Kerl, da du dich mit Argumenten zu verteidigen weißt, und weshalb ich dir den Versuch zutraue, auf diese Weise deine Unschuld beweisen zu wollen. Doch damit kommst du nicht durch.«
»Und was ist mit meinen Schafen?«
»Was soll schon mit deinen Schafen sein?«
»Da ich mit ihnen zu euch gelaufen bin, habe ich nicht nur mich in Gefahr gebracht, sondern vor allem sie«, erinnere ich mich an meine schwierige Entscheidung. »Wenn die Wölfe sie gewittert hätten, wären sie höchstwahrscheinlich über sie hergefallen. Zum Glück ist es nicht dazu gekommen, aber es hätte durchaus passieren können. Ich bin also ein verdammt hohes Risiko für euch eingegangen. Nicht zuletzt habe ich damit meine Existenz für euch aufs Spiel gesetzt.«
»Und wo sollen diese Schafe sein, von denen du sprichst?«, fragt der Bürgermeister und dreht sich halb im Kreis. »Ich kann nirgendwo welche sehen.«
»Sie sind dort drüben im Wald«, sage ich in der Hoffnung, dass sie sich auch wirklich dort befinden und nicht davongelaufen sind. Die Herde ist der letzte Beweis für meine Unschuld, den ich noch vorweisen kann.
»Gut, dann führe mich mal zu ihnen«, fordert der Bürgermeister mich auf. Er bittet zwei kräftige Männer, mit uns zu kommen, damit sie ein Auge auf mich werfen. Die anderen sollen sich mit den Frauen und Kindern an einem Sammelpunkt einfinden, damit überprüft werden kann, ob noch alle Dorfbewohner anwesend sind.
Als ich meine drei Begleiter auf die andere Seite des Dorfes bringen will, kommt uns im Dunkeln eine Gestalt entgegen, die ich erst erkenne, als sie unmittelbar vor uns steht. Es ist Anna. Ich bin froh, dass ihr nichts zugestoßen ist. Mit hochrotem Kopf stellt sie sich dem Bürgermeister entgegen und möchte wissen: »Theis, was ist hier los? Was habt ihr mit dem armen Jungen vor?«
Ich komme nicht dazu, ihre Frage zu beantworten.
»Anna, das geht dich nichts an«, bekommt sie vom Bürgermeister zu hören. »Kümmere dich um deine Angelegenheiten.«
»Ihr wollt ihm den Angriff der Wölfe anhängen, habe ich recht?« Anna schaut dem Bürgermeister tief in die Augen, auf der Suche nach einer Antwort. Er weicht ihrem Blick aus, woraufhin sie sagt: »Wusste ich es doch. Ihr wollt euch mal wieder daran weiden, einen unschuldigen Hirten zu misshandeln. Aber nur weil ihr mit eurer ständigen Langeweile nicht umzugehen wisst, müssen andere noch lange nicht darunter leiden … Und damit das klar ist, das hier geht mich doch etwas an, da ich nämlich weiß, dass der Junge nichts mit der Sache zu tun hat. Denn ich war bei ihm, bis die Wölfe kamen.«
»So ist das also«, grinst der Bürgermeister. »Hast du ihm dein Schlafzimmer gezeigt?«
Anna verdreht die Augen und schlägt mit Worten zurück: »Du denkst auch an nichts anderes, als würde dir genau das in deinem Leben fehlen. Aber das geht wohl allen Männern so, denen die Frau weggelaufen ist.«
Dem Bürgermeister sind ihre letzten Sätze sichtlich unangenehm, vor allem vor den beiden anderen Männern. Daher weiß er sich nicht anders als mit einer Drohung zu helfen: »Lehn dich nicht zu weit aus dem Fenster. Manche Leute sind dabei schon herausgefallen.«
»Mach dir um mich keine Sorgen. Ich halte mich sehr gut am Rahmen fest«, sagt Anna unbeeindruckt, woraufhin sich der Bürgermeister geschlagen gibt. Mir kommt es vor, als habe er bei früheren Auseinandersetzungen ebenfalls den Kürzeren gezogen, woraus er gelernt haben dürfte. Und Anna scheint genau zu wissen, wie sie mit ihm umzugehen hat, um sich gegen ihn durchzusetzen. Sie lenkt die Unterhaltung wieder in die vorherige Richtung. »Zurück zu dem Jungen … Er hat mir dabei geholfen, eines meiner Lämmer zu behandeln.