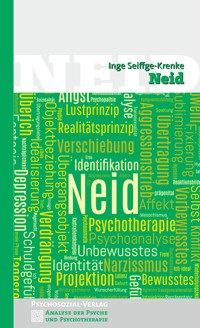34,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Psychotherapeuten begegnen zunehmend Patienten mit Identitätsproblemen: - jüngeren, deren Identität noch nicht entwickelt ist oder - älteren, deren bislang stabile Identität durch den Verlust ihrer Arbeitsstelle oder durch die Trennung von ihrem Partner verloren gegangen ist, und die sich neue Identitätsentwürfe erarbeiten müssen. War früher die Wiederherstellung der Autonomie eines Patienten das vordringliche Therapieziel, so rückt heute verstärkt die Identitätsarbeit in den Vordergrund; dies bedeutet konkret, dass nicht (mehr) zusammenhängende Identitätsfragmente wieder zusammengefügt werden müssen. Die Zahl der Fälle dieser »Identitätsdiffusion« nimmt gegenwärtig zu, da sich Familie und Arbeitswelt – die eigentlichen Ankerpunkte für eine solide Identitätsausbildung – im Umbruch befinden und ihre althergebrachten Funktionen immer seltener erfüllen. Die Autorin analysiert diese Entwicklungen und ihre Ursachen und beschreibt, wie die therapeutischen Konsequenzen aussehen können. Aus dem Inhalt: - Lebensphasen und Identitätsentwicklung (Überblick über den gesamten Lebenslauf) - Entwicklung und Identität (besonders Kindes- und Jugendalter) - Identität und Beziehung (Beispiel: Frauen, die sich über die Beziehung zu ihrem Partner identifizieren) - Identität, Geschlecht, Migration (Warum beispielsweise viele Migranten Probleme haben, ihre ausländische Identität um deutsche Anteile zu erweitern; Geschlechtsidentitäten, z. B. Männer in Frauenkörpern und umgekehrt) - Identität und neue Medien (angenommene Identitäten in sozialen Netzwerken) - Konsequenzen für die Therapie - Erfahrene und renommierte Autorin - Neue therapeutische Antworten Dieses Buch richtet sich an: - Alle Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten, vor allem tiefenpsychologisch/ psychodynamisch orientierte - Kinder- und Jugendlichentherapeuten - EntwicklungspsychologInnen
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 393
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Impressum
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Besuchen Sie uns im Internet: www.klett-cotta.de
Klett-Cotta
© 2012 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle Rechte vorbehalten
Cover: Roland Sazinger, Stuttgart
Unter Verwendung eines Fotos von © Robert Kneschke/fotolia.com
Die Abbildungen auf den Seiten 45 und 46 wurden uns freundlicherweise von Frau Gabriele Stephan zur Verfügung gestellt.
Trotz sorgfältiger Recherchen konnten nicht alle Rechteinhaber der verwendeten Abbildungen einwandfrei ermittelt werden. Falls eine Abbildung ungewollt widerrechtlich verwendet wurde, bitten wir um Nachricht und honorieren die Nutzung im branchenüblichen Rahmen.
Datenkonvertierung: Koch, Neff & Volckmar GmbH, KN digital – die digitale Verlagsauslieferung Stuttgart
Printausgabe: ISBN 978-3-608-94730-4
E-Book: ISBN 978-3-608-10299-4
Inhalt
1. Einleitung
2. Lebensphasen in Bewegung: Identität früher und heute
Nie erwachsen: Was sind die Indikatoren?
Ein Blick zurück: Historische Belege für eine verlängerte Identitätsexploration
Eriksons Theorie und Identitätsentwicklung heute: Was hat sich wirklich geändert?
Lebensphasen in Bewegung und »Vermischung« der Generationen
Überlegungen für Beratung und Therapie
3. Entwicklung und Identität
Wie werden Kinder selbst-bewusst?
Identitätsentwicklung im Jugendalter: Relationale Identität und Identitätsexploration
Körper und Identität
Geschlecht macht einen Unterschied: Männliche und weibliche Identitätsentwürfe
Körper und Identität im Erwachsenenalter und die Bedeutung von Krankheit
Identität verändert sich: Kohärenz, Stabilität und Veränderung über die Zeit
Überlegungen für Beratung und Therapie
4. Identität und Beziehungen: Der Einfluss der Familie
Identität aus Beziehungen
Kreative Hilfen bei der Identitätsentwicklung im Beziehungskontext
Was haben Eltern mit der Identitätsentwicklung ihrer Kinder zu tun?
Längere Beelterung: Konsequenzen für die Identitätsentwicklung?
Risiken und Störfaktoren für die Identitätsentwicklung in Familien
Überlegungen für Beratung und Therapie
5. Identität und Intimität in Partnerbeziehungen
Intimität in Partnerbeziehungen: Männer individuieren anders, Frauen auch
Identität und Intimität in Partnerbeziehungen: Wie ähnlich müssen Partner einander sein und wie wird Intimität kommuniziert?
Gefahr für die Intimität durch verzögerte Identitätsentwicklung?
Partnerbeziehung und Identität: Gefährliche Symbiosen und Isolation
Virtuelle und reale Partner: Einflüsse auf Identität und Intimität
Überlegungen für Beratung und Therapie
6. Identität, Geschlecht und Kultur
»Sohn ihres Vaters«: Geschlecht und Identität als soziale Kategorien
Sexuelle Diversität bei Eltern und Kindern: Gefahren für die sexuelle Identität?
Identität und Kultur: Gesundheitsprobleme von Migranten
Leben zwischen den Kulturen: Bikulturelle Identität
Identität und Akkulturation: Anpassungsstrategien in Familien und Paarbeziehungen
Überlegungen für Beratung und Therapie
7. Identität und therapeutische Beziehung
Wandel in der therapeutischen Identität: Vom klassischen Ansatz über das Containing zur Struktur
Krankheitsbilder, bei denen die Identität besonders betroffen ist
Diagnostische Hilfen: Differenzierung zwischen Identitätskrise, Identitätsdiffusion und Identitätskonflikt
Veränderungen in der Behandlungstechnik, die für die Identitätsentwicklung und Identitätsprobleme relevant sind
Spezifische identitätsbezogene Interventionen
Nochmals: Die Veränderung der therapeutischen Identität im »unmöglichen Beruf«
Abbildungsnachweis
Literatur
Informationen zur Autorin
1. Kapitel Einleitung
Der Begriff der Identität bezieht sich auf die einzigartige Kombination von persönlichen unverwechselbaren Daten eines Individuums, ganz allgemein gesprochen nämlich der Name, das Geschlecht, Alter und Beruf, so wie es auch in der carte d’identité, dem Personalausweis, festgehalten ist. In einem engeren psychologischen und psychoanalytischen Sinn verstehen wir darunter die einzigartige Persönlichkeitsstruktur einer Person, die aus den Beziehungen zu wichtigen anderen im Laufe des Lebens entstanden ist. Dieses Empfinden der Kohärenz und Kontinuität im Kontext der sozialen Bezogenheit prägt das Leben und wird Identität genannt (Ermann, 2011). Die Identität enthält viele Komponenten, u. a. die Geschlechtsidentität, die ethnische Identität, die zeitliche Kontinuität des Selbsterlebens, die realistische Wahrnehmung des Selbst im Raum, über die Zeit und in unterschiedlichen sozialen Bezügen. Den meisten Menschen gelingt es trotz des Experimentierens mit verschiedenen Rollen, die Kontinuität des Selbst und die Wahrnehmung von anderen über die Zeit und in verschiedenen Situationen zu integrieren – eine bemerkenswerte Leistung.
Schon in einem der ersten Bücher, die in der wissenschaftlichen Psychologie geschrieben wurden, in William James’ 1890 publizierten Principles of Psychology, wird vermutet, dass der Mensch das einzige Tier ist, das sich mit sich selbst unterhält. Tagtäglich kommentiert das Me, unser Selbst, das I, unseren Bewusstseinsstrom, der wesentlicher Bestandteil unserer Identität ist – was wir fühlen, denken, schmecken. Freud (1923/2000) hat später das Ich in das Spannungsfeld zwischen triebhaften Bedürfnissen und gesellschaftlichen Normen und Erwartungen gestellt. Er hat auch die enorme Bedeutung des Eltern-Kind-Verhältnisses für die Entwicklung des Ichs betont. Die Selbstpsychologie und die Objektbeziehungstheorie haben dann unser Wissen über die Erschaffung des Selbst aus frühen sozialen Erfahrungen erweitert. Mit Selbst bezeichnet man die Vorstellung von der eigenen Person, also eine psychische Repräsentanz. Erikson (1959/1971, S. 123) führte dann den Begriff der Ich-Identität in die psychoanalytische und sozialwissenschaftliche Betrachtungsweise ein. Damit ist »ein spezifischer Zuwachs an Persönlichkeitsreife …, den das Individuum am Ende der Adoleszenz der Fülle seiner Kindheitserfahrungen entnommen haben muss, um für die Aufgaben des Erwachsenenlebens gerüstet zu sein«, gemeint. Identität nimmt nach alldem Bezug auf das Selbst in einem bestimmten Kontext. Identität und Selbst sind also miteinander verquickt, aber sie sind nicht dasselbe (Bohleber, 1992).
Das Interesse an der Identitätstheorie von Erikson hält in der Psychoanalyse unvermindert an. 2010 hat Peter Conzen die psychoanalytische Identität für Forum Psychoanalyse aufbereitet. Rasch voranschreitende Prozesse der Individualisierung, Pluralisierung und Globalisierung eröffnen den Individuen heute neue Spielräume des Selbsterlebens und der Selbstdarstellung. Allerdings stellt die Veränderung bzw. der Ausfall nahezu aller haltgebenden Strukturen in der gegenwärtigen Gesellschaft für viele heute lebenden Menschen eine Überforderung dar. Immer häufiger haben es Psychotherapeuten mit verwirrten, isolierten und ausgebrannten Menschen zu tun, die sich nach festen Bindungen sehnen und gleichzeitig davor zurückschrecken, die sich von immer neuen Ersatzbefriedigungen treiben lassen und keinen Sinn in ihrem Dasein finden, die sich an so viele Rollen anpassen, dass sie kaum noch wissen, wer sie überhaupt sind. Es ist bedenkenswert, wie Conzen (2010) ausführt, dass die Psychoanalyse sich mit Identität zu beschäftigen begann, nämlich um 1950, als diese in besonderer Weise problematisch geworden war. Er zieht eine Parallele zu der Beschäftigung mit Sexualität, die zu Freuds Zeiten das vordringliche Thema war.
Wir blicken mittlerweile auf 100 Jahre Theorie und Forschung im Bereich der Identität zurück (Goldenberg & Shackelford, 2005), die viel Interessantes erbracht haben. Wir wissen inzwischen ziemlich genau, wie sich Identität entwickelt, welche Rolle der Körper dabei spielt, in welchem Umfang Identität aus sozialen Beziehungen zu wichtigen anderen stammt und wie sich die Identitätsentwürfe von Jungen und Mädchen, von Männern und Frauen unterscheiden. Während die Psychoanalyse vor allem die innere Sicht herausgearbeitet hat, also die Phantasien und die Bildung innerer Objekte und Selbstrepräsentanzen, hat die Entwicklungspsychologie die spezifische Dynamik der frühen identitätsbezogenen Lernprozesse aufgezeigt, den Einfluss des Entwicklungskontexts auf die Möglichkeiten zur Selbstexploration nachgewiesen und die kulturellen Determinanten von Identität dargelegt. Beide Perspektiven ergänzen einander gut und entsprechen unserer heutigen Sicht, wonach innere und äußere Bedingungen im therapeutischen Kontext gleichermaßen zu beachten sind. Wenn Identität das Empfinden von Kohärenz und Kontinuität im Kontext der sozialen Bezogenheit bedeutet, dann ist es plausibel, dass Brüche in der Beziehung zum sozialen Umfeld Labilisierungen des Identitätserlebens bewirken.
Da Identitätsentwicklung ein lebenslanger Prozess ist und wir zunehmend zu einer multikulturellen Gesellschaft geworden sind, müssen auch diese Veränderungen ihren Niederschlag in der Behandlungstechnik finden. Im therapeutischen Kontext ist es darüber hinaus wichtig, Rahmendaten für die Identitätsentwicklung zu haben, um eine Entscheidung treffen zu können, ob eine Entwicklung als normal oder pathologisch gelten soll. Handelt es sich im Falle eines Patienten oder einer Patientin um eine krankheitswertige Störung oder vielmehr um eine allgemeine Gesetzmäßigkeit, von der viele Menschen in einem deutlich veränderten Lebenskontext betroffen sind? Die Beantwortung dieser Frage ist in den letzten zehn Jahren deutlich schwieriger geworden. Es gibt zwar schon seit einigen Jahrzehnten Beobachtungen über einen Krankheitswandel, aber erst in jüngster Zeit ist das ganze Ausmaß deutlich geworden, hat man den gesellschaftlichen Kontext als eine Ursache für veränderte psychische Befindlichkeit anerkannt. Die veränderten Lebensbedingungen und, damit im Zusammenhang stehend, die veränderte Identitätsentwicklung der heute lebenden Menschen in ihrem multikulturellen Kontext machen auch neue therapeutische Antworten notwendig.
Dieses Buch basiert auf der in Lindau 2010 gehaltenen Vorlesung »Identität im Wandel – therapeutische Herausforderungen« und hat sich zum Ziel gesetzt, einen Beitrag zur Lösung der geschilderten Probleme zu leisten. Es arbeitet die Ursachen für die veränderte Identitätsentwicklung auf, die letztendlich auch zu veränderten Beziehungen geführt haben, und reflektiert die Konsequenzen für die therapeutische Arbeit. Die psychoanalytische Identität ist schon immer Gegenstand von Diskussionen gewesen, was zum einen Teil mit der Geschichte der Psychoanalyse und ihrer starken Anfeindung von außen, zum anderen Teil aber mit den Abgrenzungen innerhalb der psychoanalytischen Bewegung zu tun hat. Die Entwicklung der professionellen Identität erfolgt über einen langen Zeitraum, von frühen Identifizierungen und Rollenvorbildern über die langjährige therapeutische Ausbildung bis zur Zugehörigkeit zu einer bestimmten Schule oder Richtung. Hier müssen wir uns der Frage stellen, wie es um unsere analytische Identität heute bestellt ist.
2. Kapitel Lebensphasen in Bewegung: Identität früher und heute
»Identität, das ist der Schnittpunkt zwischen dem, was eine Personsein will, und dem, was die Umwelt ihr gestattet.«
(Erikson, Identität und Lebenszyklus, 1959/1971)
Ich hatte vor einiger Zeit ein Zulassungsinterview für die Ausbildung zum Kinder- und Jugendlichentherapeuten mit einem älteren Iraner (46 Jahre), der mehrere Berufsausbildungen, Studiengänge und berufliche Tätigkeiten angefangen und nicht abgeschlossen hatte (u. a. Elektriker, Wirtschaftswissenschaften, Pflegehelfer für Behinderte, dann Studium der Pädagogik mit Abschluss Magister, Arbeit an der Tankstelle). Er bekannte, dass er schlecht unter Autoritäten arbeiten könne, an allem etwas zu kritisieren habe, sich leicht verfolgt fühle und deswegen am liebsten selbständig arbeiten würde. Das war vermutlich richtig. Auf meine Frage hin, was er sich denn – außer als Kinder- und Jugendlichentherapeut zu arbeiten – noch für eine selbständige Arbeit vorstellen könnte, schwebte ihm das Eröffnen eines Lebensmittelgeschäftes oder Ähnliches vor. Daraufhin konnte ich nur trocken konstatieren: »Und warum machen Sie das nicht?«
Dieser Mann ist ein Extrembeispiel von, wie er sich charmant ausdrückte, »sehr breiten Interessen«. Es fällt schwer, eine kohärente berufliche Identität und stabile, emotional verbindliche Beziehungen in seinem Lebenslauf zu erkennen, in dem er, in der zweiten Generation in Deutschland aufgewachsen, möglicherweise noch durch Kriegserfahrungen seiner Eltern geprägt war. Aber wir finden auch bei jungen Erwachsenen mit weniger belasteten Biographien ähnliche Verläufe: Sie arbeiten in ganz unterschiedlichen Bereichen, und das zum Teil mit großer Flexibilität; dabei ist es schwierig, eine kohärente, sich auf ein bestimmtes Interesse verpflichtende Identität auszumachen, und häufig existieren keine verbindlichen langfristigen Beziehungen. Die Frage, was Identität eigentlich ist, wird uns im Laufe dieses Kapitels im Detail beschäftigen. Nun geht es zunächst um die Fragen, wie typisch dieses Verhalten ist und welche Hinweise wir für unsere heutige Zeit auf gravierende Veränderungen in der Identitätsentwicklung haben.
Nie erwachsen: Was sind die Indikatoren?
Klare Strukturen und Altersmarkierungen für die kindliche Entwicklung sind im therapeutischen Kontext hilfreich, jedoch ist der Verlauf der kindlichen Entwicklung, der Anfang und das Ende bestimmter Entwicklungsphasen, die für frühere Generationen so vertraut waren, inzwischen alles andere als klar zu bestimmen. Mehr noch, die gesamten Lebensphasen haben sich ineinander verschoben und die Generationsgrenzen sind stark verwischt. Diese Entwicklung betrifft alle Altersphasen, aber besonders die jüngeren Altersgruppen. Geschichtlich gesehen ist es schon immer so gewesen, dass die starken gesellschaftlichen Veränderungen bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen am ehesten zu beobachten waren bzw. von diesen auch verstärkt aufgegriffen und zu Anstößen für weitere gesellschaftliche Umwälzungen wurden. Das sieht die Psychoanalyse positiv: »Unreife ist eine Kostbarkeit des Jugendalters. Sie bringt die aufregendsten Formen geistiger Kreativität, neue und unverbrauchte Gefühle und Lebenspläne mit sich. Die Gesellschaft muss von den Wünschen und Hoffnungen der Nicht-Verantwortlichen aufgerüttelt werden« (Winnicott, 1971/2010, S. 165). Es bleibt allerdings die Frage, ab wann das Erwachsenenalter mit Selbstverantwortlichkeit zeitlich zu verorten ist.
Entdecken einer neuen Lebensphase
Vor einigen Jahren wurde eine neue Entwicklungsphase entdeckt, die zwischen Jugendalter und Erwachsenenalter steht: das sogenannte »emerging adulthood«, die Periode zwischen 18 und 25 bzw., bei akademischer Ausbildung, 30 Jahren (Arnett, 2004). Der Ansatz schließt an ältere Konzepte wie Postadoleszenz oder pathologisch prolongierte Adoleszenz (Blos, 1954) an. Charakteristisch ist, dass es zum einen Verschiebungen in objektiven Markern des Erwachsenenalters wie Heirat, Berufseintritt und Familiengründung gibt, aber auch die psychologischen Kriterien des Übergangs zeigen, dass sich junge Menschen heute oftmals noch nicht wirklich erwachsen fühlen. Besonders deutlich ist seit etwa zehn Jahren, dass junge Menschen länger zu Hause wohnen, seltener und später heiraten und vor dem 30. Lebensjahr oftmals noch keinen festen Vollzeitjob haben. Diese Veränderungen sind auf der Folie von gesellschaftlichen Veränderungen wie verlängerte Schul- und Ausbildungszeiten und höherer Arbeitslosigkeit zu sehen, jedoch gibt es auch Hinweise darauf, dass unsichere Bindungsmuster und eine zu lange elterliche Unterstützung Kinder zu Nesthockern oder Spätausziehern machen (von Irmer & Seiffge-Krenke, 2008).
Für diese Entwicklungsphase, das »emerging adulthood«, ist eine große Lernfähigkeit und ein sehr starker Selbstbezug charakteristisch. Diejenigen, die sich eher als Erwachsene fühlen, sind weniger selbstfokussiert und in ihren Partnerbeziehungen schon fester gebunden (McNamara Barry et al., 2009). Zugleich kann man eine große Diversität bemerken: Ein sehr breites Spektrum gilt als »normal« – von der berufstätigen Mutter zweier Kinder bis zum »ewigen Studenten«. Diese Diversität und das Ausprobieren neuer Identitätsentwürfe in Bezug auf Beruf und Partnerschaft werden auch gesellschaftlich anerkannt.
»Generation vielleicht«: Lieber Kind bleiben als Kinder kriegen
Auffällig ist, dass nur etwa 25 % der jungen Leute zwischen 18 und Ende 20 sich als erwachsen betrachten (Papastefanou et al., 2004; Arnett, 2004). Ihre Eltern sind übrigens derselben Meinung (Seiffge-Krenke, 2010a). Arnett (2006) fand heraus, dass die Identitätskrise, die für Erikson noch zentral für die Adoleszenz war, sich in den letzten Jahren zeitlich nach hinten verlagert hat und in der neuen Entwicklungsphase des »emerging adulthood« stattfindet. Wer sie sind und wer sie sein wollen, ist also vielen jungen Leuten noch sehr unklar, und das sehen ihre Eltern genauso.
Vor einigen Jahrzehnten wurden von Havighurst (1953) drei wichtige Entwicklungsaufgaben als für das junge Erwachsenenalter relevant erachtet, nämlich die Etablierung eines eigenen Haushalts, die Entwicklung fester Partnerschaften und der Einstieg in den Beruf. Das streben junge Leute auch heute noch an (Seiffge-Krenke & Gelhaar, 2006), aber die Zeiten bis zur Erreichung dieser Ziele haben sich stark ausgedehnt. In unserer eigenen Längsschnittstudie, in der wir Familien jährlich untersuchten, und zwar vom 14. bis zum 30. Lebensjahr der Kinder, wurde sehr deutlich, dass die Zahl der Kinder, die aus dem Elternhaus ausziehen, in der Altersstufe 21 bis 25 Jahre stark ansteigt (von 54 auf 81 %), aber auch, dass ein relativ großer Prozentsatz spät oder gar nicht auszieht. Während des gleichen Zeitraums waren die jungen Leute sehr engagiert in Partnerschaften. Zwischen 54 % und 62 % waren im Alter von 20 bis 25 Jahren in Partnerschaften. Im Alter von 25 Jahren haben erst 17 % gearbeitet, 40 % waren noch in der Lehre und 43 % studierten.
Diese Ergebnisse entsprechen recht gut dem Mikrozensus, beispielsweise von 2009, dem zufolge noch jeder dritte Deutsche nach dem 25. Lebensjahr bei den Eltern wohnt. Eindrucksvoll ist auch die Ausdehnung der Ausbildungs- und Studienzeiten. Das durchschnittliche Alter eines Auszubildenden liegt heute bei 20 Jahren, im Jahr 1970 lag es bei 16,5 Jahren. Die durchschnittliche Semesterzahl beträgt gegenwärtig 14 Semester, 1993 betrug sie 12 Semester, 1960 nur 10 Semester. Im Alter zwischen 21 und 27 Jahren sind – auf der Basis von Mikrozensusdaten – jeweils etwa 40 % der Alterskohorte berufstätig.
Auch das Heiratsalter hat sich deutlich nach oben verlagert. Während in der Kohorte von 1950 noch 50 % mit 24 Jahren verheiratet waren, waren im Jahre 2009 in diesem Alter erst 8 % verheiratet. Die Elternschaft, wenn überhaupt, findet um das 30. Lebensjahr statt. Chisholm & Hurrelmann (1995) sprechen, was Heirat und den Übergang zur Elternschaft angeht, von einer sozialen Retardierung. Einige Familiensoziologen setzen das Ereignis der Geburt des ersten Kindes generell mit dem Beginn des Erwachsenenlebens gleich, was letztlich zur Konsolidierung und Gewöhnung an die neue Rolle und deren Integration in die Identität führt. Elternschaft gilt auch aus der Sicht der jungen Leute als der Marker für das Erwachsensein. In unserer Längsschnittstudie waren im Alter von 27 Jahren nur 5 % verheiratet und 4 % hatten Kinder. Fast alle in dieser Altersgruppe waren schon länger berufstätig. Die Phase, in der man Geld verdient, mit einem Partner zusammenzieht und Kinder bekommt, verschiebt sich also immer mehr nach hinten. Viele junge Leute fürchten sich vor dem, was die Zukunft bringt. Sie wird, im Gegensatz zum Elternhaus und der eigenen Kindheit, als unsicher empfunden.
Nur »fun and flexibility«? Oder doch »prolongierte Adoleszenz«?
Im jungen Erwachsenenalter ist ein Ausprobieren und Durchspielen verschiedener Alternativen im beruflichen und partnerschaftlichen Bereich möglich und gesellschaftlich akzeptiert. Menschen in dieser Lebensphase stehen, so Arnett, mehr Freiheiten und Möglichkeiten offen als zu jedem anderen Zeitpunkt im Leben – diese Lebensphase sei durch »fun and flexibility« gekennzeichnet.
Aber ist dies wirklich der Fall? Natürlich ist es ein Zugewinn an Freiheit, wenn man die Möglichkeit hat, durch eine längere Schulausbildung, eine entsprechende Berufsausbildung, ein Studium, ein Aufbaustudium usw. möglichst unterschiedliche berufliche Bereiche zu explorieren, aber dies tut man auch nicht ganz freiwillig, sondern es ist u. a. aus dem Wunsch geboren, sich möglichst hoch und umfassend zu qualifizieren, um in jedem Falle vor Arbeitslosigkeit geschützt zu sein – eine Sorge, die insbesondere junge Menschen in südeuropäischen Ländern mit hoher Arbeitslosigkeit haben. Die Proteste der jungen Erwachsenen in Spanien, Griechenland und England (in Ländern mit einer Arbeitslosenquote von 30 bis 40 %) gingen mehrfach im Sommer 2011 durch die Presse. Es gibt inzwischen junge Menschen, die es trotz ernsthafter Bemühungen nicht schaffen, eine berufliche Identität zu finden, weil die gesellschaftlichen Verhältnisse es einfach nicht zulassen (»Generation Praktikum«, Süddeutsche Zeitung, 16.8.2011). Erikson hat schon vor 50 Jahren erkannt, dass die berufliche Identität zentral ist: »In general, it is primarily the inability to settle upon an occupational identity which disturb young people« (Erikson, 1964, S. 252).
Fassen wir zusammen, was wir bisher erörtert haben, so ist hervorzuheben, dass die zentralen Entwicklungsaufgaben des jungen Erwachsenenalters zwar nach wie vor den meisten jungen Leuten als erstrebenswert erscheinen, aber eine »Retardierung« in einigen Bereichen auffällig ist. Mehr noch, die Realisierung von bestimmten Entwicklungsaufgaben wie Elternschaft scheint blockiert, weil die notwendigen Voraussetzungen, etwa die sichere finanzielle Basis, fehlt. Man muss zugleich sehen, dass junge Menschen heute vor einer Vielzahl neuer Situationen stehen und viel lernen, dass ihnen gleichzeitig aber seitens der Gesellschaft wenig Lern- und Entscheidungshilfen angeboten werden.
Die in diesem Kapitel vorgestellten Zahlen, die verdeutlichen, dass sich für einen erheblichen Prozentsatz der jungen Leute die Schul- und Ausbildungszeiten verlängern und der Eintritt in Beruf und Elternschaft später erfolgt, zeigen insgesamt, dass wir umdenken müssen – auch therapeutisch. Es ist nicht länger sinnvoll, von einer pathologisch prolongierten Adoleszenz zu sprechen, wie sie Peter Blos (1967) für junge Leute in den 1960er und 1970er Jahren beschrieben hat, als es kürzere Ausbildungszeiten und Vollbeschäftigung gab und Möglichkeiten des vorehelichen Zusammenlebens tabuisiert waren. Die in den letzten Jahren eingetretenen gesellschaftlichen Veränderungen haben gegenwärtig zu einer normativen Phase des »emerging adulthood« (Arnett, 2004) geführt, in der sich der Zustand zwischen ›noch nicht erwachsen sein‹ und ›Privilegien und Kindheitsvorrechte genießen‹ bis in die Endzwanziger hinein verschiebt. Damit ist auch die therapeutisch bedeutsame Frage verbunden: Welche Zeitgrenzen sind noch als normativ anzusehen, und ab wann wird es pathologisch?
Ein Blick zurück: Historische Belege für eine verlängerte Identitätsexploration
Für die Generation der heute lebenden älteren Erwachsenen, die unter historisch ganz anderen Bedingungen aufgewachsen sind, scheint kein Ende des Entwicklungsprozesses der jungen Erwachsenen in Sicht. So scheint die Frage angebracht: »Wie ging es eigentlich jungen Leuten früher? Wie klar und gefestigt war deren Identität?« Wenn wir heute beispielsweise die eindrucksvollen Berichte von Radebold (2000) über die Nachkriegsgeneration lesen, wird sehr deutlich, dass diese Generation eine kurze Kindheit hatte, schnell erwachsen werden musste und früh Verantwortung übernahm – teilweise auch für die Elterngeneration, denn die Väter kamen oftmals zerstört und gebrochen aus dem Krieg zurück oder fehlten gänzlich. Immerhin ein Drittel der Väter starb im Krieg oder an den Folgen des Krieges, und die Mütter waren mit dem Aufbau beschäftigt. Der Entwicklungskontext scheint also sehr stark mitzubestimmen, wie viel Zeit und welche Möglichkeiten einem Individuum für die Entwicklung seiner Identität bleiben.
Die Frage der Identitätsentwicklung und ihrer gesellschaftlichen Verankerung ist bis heute mit dem Namen von E. H. Erikson verbunden, der von Rattner (1995) den Psychoanalytikern der dritten Generation zugeordnet wird.
Erikson wurde 1902 in Frankfurt geboren. Seine Mutter trennte sich von seinem Vater und heiratete später einen Kinderarzt. Nach seinen Schuljahren in Karlsruhe geriet Erikson in eine psychische Krise, konnte sich für keinen Beruf entscheiden und unternahm eine Wanderung durch Europa. Er begann eine Bildhauerausbildung, die ihm nach zwei Studienjahren in Florenz einige Erfolge einbrachte. 1927 wurde er Privatlehrer an jener Schule in Wien, die Dorothy Burlingham für Kinder amerikanischer Eltern gegründet hatte, und kam so mit der Psychoanalyse in Berührung. Er begann 1928 eine Therapie bei Anna Freud und nahm auch an ihrem Kinderseminar teil. 1933 emigrierte er über Dänemark in die USA, wo er sich in Boston niederließ. Er hatte zuvor Forschungsaufträge an der Harvard University; einen regulären Doktortitel erwarb er jedoch nicht – künstlerische und philosophische Interessen bedeuteten ihm mehr. Durch seine Feldforschung an Indianern wurde ihm deutlich, wie sehr man Gefahr läuft, die eigene Kultur zu verabsolutieren. Als Ergebnis dieser Überlegungen entstand 1950 sein Buch Kindheit und Gesellschaft, durch das Erikson weit über Fachkreise hinaus bekannt und berühmt wurde. Er erhielt einen Ehrendoktor der Universität Berkeley und wurde 1956 nach Frankfurt eingeladen, um den Festvortrag zur 100. Wiederkehr von Freuds Geburtstag zu halten. 1960 gab Erikson seine therapeutische Arbeit auf und befasste sich im Rahmen seiner erneuten Professur an der Harvard University mit der Ausarbeitung psychoanalytischer Biographien bedeutender Persönlichkeiten, in denen er deren Identitätsentwicklung nachzeichnete (Der junge Mann Luther, 1958; Ghandis Wahrheit, 1969).
Erikson kam also nach einer Zeit der Wanderung und des persönlichen Suchens zur Psychoanalyse und zu seiner Theorie der Identität. Er hat die Identitätsfrage sehr breit gestellt: »Wer bin ich? Was werde ich in meinem Leben tun? In welcher Weise bin ich anders als andere? Wie kann ich etwas selbständig machen?« (Santrock, 2007) Von herausragender Bedeutung war jedoch – und damit ging er über die zum damaligen Zeitpunkt noch sehr stark vertretene Ein-Personen-Psychologie hinaus – seine Sicht der gesellschaftlichen Determiniertheit von Entwicklung. Folgerichtig ist auch die Identitätsentwicklung gesellschaftlich bestimmt. Von Erikson stammt das Zitat: »Identität, das ist der Schnittpunkt zwischen dem, was eine Person sein will, und dem, was die Umwelt ihr gestattet«. Sein eigenes Leben verdeutlicht übrigens ebenfalls den starken Einfluss des Entwicklungskontexts auf die Identitätsbildung.
»Fun and exploration« früher: Ein Privileg für wenige
Zwei eindrucksvolle Beispiele dafür, dass es schon immer Personen gegeben hat, die ihre Identitätsentwicklung vorangetrieben und ihre Umwelt zur Stützung ihrer Identitätsentwürfe herangezogen haben, sind Aby Warburg und Marcel Proust.
Von Aby Warburg, geboren am 13.06.1873, stammt der Satz: »Wir leben nicht, wie wir wollen, sondern wie wir sollen« (Michels, 2007, S. 43). Aby Warburg verstand es allerdings, sein Leben so zu leben, wie er wollte. Als Ältester von fünf Brüdern eines reichen jüdischen Bankhauses in Hamburg verzichtete er auf sein Erstgeburtsrecht unter der Bedingung, dass ihn seine Brüder in seinem weiteren Leben bezüglich seiner Studien alimentierten. Aby Warburg gilt als der Begründer der Kulturgeschichte und Ikonologie und war einer der Ersten, der es verstanden hat, interdisziplinäre Ansätze auf einem hohen wissenschaftlichen Niveau zu integrieren. Er hat über Botticellis Primavera promoviert und Rufe an verschiedene Universitäten erhalten, z. B. nach Halle, die er jedoch nie angenommen hat. Stattdessen widmete er sich seiner Bibliothek und seinen Studien, die so umfangreiche und verschiedenartige Dinge umfassen wie die Analyse der mittelalterlichen Teppiche in Burgund, die Kultur der Hopi in New Mexico und eben Botticelli. Er beschäftigte sich mit der antiken Götterwelt und mit der Götterwelt von Indianerkulturen. Dabei fand er, dass Menschen Mythen als Reaktion auf Phänomene entwickeln, die sie nicht verstehen und bei ihnen starke Affekte erzeugen. Schon in seiner Dissertation hat er den Grundstein für die fundamental neue Methode gelegt – die Ikonologie, in der alle Kulturformen auf Gemeinsamkeiten hin zu befragen sind. Dazu brauchte er eine Handbibliothek, und das war der Beginn seiner umfangreichen Sammlung von Büchern. Seine Brüder haben ihn großzügig gefördert. Schon als Student hat er enorme Geldsummen für den Kauf von Büchern verbraucht. Die riesige Bibliothek umfasste 18000 Bücher. Er ließ den Lesesaal in einer elliptischen Form bauen, weil er der Überzeugung war, dass nur in der Ellipse die Spannung aufrechterhalten wird (»In kreisförmigen Lesesälen schlafe ich regelmäßig ein«). Die Bibliothek und sein Lebenswerk wurden 1933 nach London transferiert.
Die Brüder zahlten für den Lebensunterhalt seiner 5-köpfigen Familie und natürlich auch für seine Studienreisen etwa nach Florenz oder New Mexico. Allein in New Mexico blieb er 1885 insgesamt vier Monate und stellte fest, dass die Hopi auf einer Kulturstufe standen, die der der heidnischen Antike entsprach. Warburg arbeitete sich zwar mit anhaltender Begeisterung durch die Florentiner Bibliotheken und Archive – hier leistete er »beim Herausbuddeln der bisher unbekannten Einzeltatsachen Trüffelschweindienste« (Michels, 2007, S. 56) –, er hat aber kaum umfangreiche Werke verfasst. Auch die schriftliche Ausarbeitung vieler Vorträge erfolgte leider nicht. Er litt unter einer Schreibhemmung, die sich mit der Zeit noch verstärkte. Er hat immer wieder auf Vorträgen deutlich gemacht, dass man ein Kunstwerk nur auf der Folie seiner Zeit verstehen kann, dass es aber zugleich in der Ikonologie Ideen aufnimmt, die schon wesentlich älter sind und die sich bis in die archaischen Kulturen zurückverfolgen lassen.
Von »Fun and Exploration« kann man bei Warburgs Identitätsentwicklung nur in Grenzen sprechen. Es ist richtig, dass er bezüglich seiner beruflichen Interessen alle Möglichkeiten der Exploration in die Breite, bei dennoch erheblicher Tiefe in sehr verschiedenen Bereichen, wahrnahm und dabei konsequent die Unterstützung seiner Familie einforderte. Seine Bindung an seine Frau und drei Kinder blieb stabil und schaffte den emotionalen und materiellen Rahmen für eine sorglose Exploration. Die Katalogisierung seiner Bibliothek nach unterschiedlichen Gesichtspunkten (Fach, Originalschrift etc.) war im wahrsten Sinne des Wortes eine irrsinnige Leistung, denn damals standen die technischen Möglichkeiten wie heute noch nicht zur Verfügung. Er musste es sozusagen alles »im Kopf behalten«. Dies hatte auch schwerwiegende gesundheitliche Konsequenzen. Warburg, der Zeit seines Lebens unter Depressionen litt, verbrachte insgesamt sechs Jahre in Sanatorien in Hamburg, Jena und schließlich in der Schweizer Privatklinik von Ludwig Binswanger, wo man eine manisch-depressive Psychose diagnostizierte. In der vor einigen Jahren publizierten Krankengeschichte wurde deutlich, dass Binswanger, wie er Freud gegenüber äußerte, wenig Hoffnung auf Heilung für Warburg hatte: »Es ist jammerschade, dass er aus seinem riesigen Schatz an Kenntnissen und seiner immensen Bibliothek voraussichtlich nicht mehr wird schöpfen können« (Binswanger, 2007, S. 7).
Ein anderes Beispiel für jemand, der lebte, wie er wollte, und der sich die Freiheit nahm, seine Interessen zu verfolgen und dabei auf die familiäre Unterstützung setzte, war Marcel Proust.
Marcel Proust, geboren am 10. Juli 1871, starb am 18. November 1922. Er hat also fast zeitgleich mit Aby Warburg gelebt; er stammte mütterlicherseits aus einer Familie, die aus dem Elsass kam, aus der Familie Weil. Die Weils waren kulturell und musisch außerordentlich interessiert und mit den Marx in Trier verwandt. Sein Vater, Adrien Proust, war ein berühmter Medizinprofessor (Hygieniker), der zwei Jahre nach Marcel geborene Bruder Robert wurde ebenfalls ein berühmter Mediziner, ein Chirurg. Die knapp zwei Jahre auseinanderliegenden Brüder haben sich vollständig unterschiedlich entwickelt. Der zarte Marcel entwickelte schon früh Asthma, lebte in einer sehr engen Beziehung zu seiner Mutter. In seinem Werk Auf der Suche nach der verlorenen Zeit wird mehrfach geschildert, wie er auf den Gutenachtkuss seiner Mutter wartete, die unten noch mit Abendgesellschaften beschäftigt war. Der Beginn dieses berühmten Werkes, das sieben Bände umfasst, steht in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Tod seiner geliebten Mutter. Einige Biographen vermuten, dass erst dies ihm den Raum zum Schreiben und zur Realisierung seines ungewöhnlichen Lebensstils gab.
Marcel Proust hat keine Berufsausbildung absolviert, sondern sich ganz dem Beobachten und Schreiben gewidmet. Dies war durch das enorme Vermögen möglich, welches Jeanne Weil in die Familie brachte. Aber auch sein Vater, der viel im Ausland war und Vorträge über Hygiene hielt, hat nicht unwesentlich zur Absicherung eines sehr hohen finanziellen Standards und Marcels Lebensunterhalts beigetragen. Die letzten 15 Jahre seines Lebens lebte Marcel Proust vollständig von der Umwelt zurückgezogen in einer großen Wohnung am Boulevard Haussmann in Paris, betreut von seiner Zugehfrau Celeste Albaret. Er widmete sich ausschließlich dem Schreiben, was er in den frühen Morgenstunden erledigte, wenn er gegen ein oder zwei Uhr von Abendgesellschaften nach Hause kam. Grundsätzlich ging er erst gegen Abend aus und verbrachte den Tag schlafend in seinem Zimmer, das ganz mit Kork ausgeschlagen war, um weitere Asthmaanfälle zu verhindern. Das, was er auf diesen Abendgesellschaften erlebt hat – die Toilette der Damen, die Gespräche, das, was es zu essen gab –, hat er dann in seinen Büchern verarbeitet. Seine Werke verdeutlichen sein psychisches Einfühlungsvermögen und seine enorme Beobachtungsgabe.
Marcel Proust hat sich nachhaltig geweigert, sich an die moderne Zeit anzupassen: Er besaß kein Telefon, er trug bis zum Lebensende die steifen Kragen und offiziellen Sakkos und Smokings, die Jahrzehnte zuvor Mode gewesen waren, und er setzte durch viele Initiativen und unter Zuhilfenahme von vielen Helfern (Celeste Albaret, ihrem Mann Odilon, der Fahrer bei Proust war, und anderen »hilfreichen Geistern«) alles daran, die frühere Zeit wiederzufinden – die Zeit, die vergangen war. Die Gegenwart erschien ihm nicht sehr lebenswert. Er wurde von Zeitgenossen als hoffnungslos altmodisch, lebensuntüchtig und noch mit 52 Jahren »als eingefroren in der Phase des Jünglings« beschrieben, mit altmodischer Frisur, altmodischer Kleidung, mit Gebärden und Zitaten, die aus einer vergangenen Zeit herrührten.
Die Haushälterin Prousts, Mme. Albaret, war noch sehr jung, als er im Jahre 1922 starb. Sie berichtete erst mit 82 Jahren, kurz vor ihrem eigenen Tod, über ihr Leben mit Proust (Albaret, 1974). Das Buch ist voller Idealisierungen. Es ist ein Altar für Proust, aber auch sehr aufschlussreich im Hinblick auf den Versuch Prousts, sein Leben so zu leben, wie er wollte. Mme. Albaret sah bei Proust eine enge Verbindung zwischen Krankheit und der Realisierung seines ganz persönlichen Identitätsentwurfs: »In Wirklichkeit hat er sich, glaube ich, der Außenwelt gegenüber sogar seiner Krankheit bedient, um sich noch mehr in seinem Einsiedlerleben und seiner Arbeit zu vergraben. Ich bin sicher, dass er sich bei Anderen für kränker ausgab als mir gegenüber: Das war sozusagen ein Mittel, in Frieden gelassen zu werden, wenn er es wünschte; nur auszugehen, wenn ihm der Sinn danach stand, und zwar immer aus demselben Bedürfnis heraus – etwas nachzuprüfen, eines der Vorbilder für eine Person in seinen Büchern wieder zu sehen –, oder nur diejenigen zu empfangen, die er sehen wollte« (Albaret, 1974, S. 75).
Kein Zufall: Männerschicksale!
Es ist natürlich kein Zufall, dass diese Biographien der beiden fast gleich alten Männer sich auch in den äußeren Rahmenbedingungen für den jeweiligen Identitätsentwurf sehr gleichen, nämlich in Bezug auf ein reiches Elternhaus und das Privileg, die eigenen Interessen zu verfolgen. Bei Proust kam noch hinzu, dass der sekundäre Krankheitsgewinn sehr stark war und er verstanden hatte, dass die Krankheit ihm ein Leben ermöglichte, das ohne sie so nicht möglich gewesen wäre, sich nämlich ganz seinem Werk, dem Schreiben und Beobachten zu widmen.
Die Freiheit zur Realisierung des eigenen Identitätsentwurfs war also an einen ganz bestimmten großbürgerlichen finanziellen Hintergrund geknüpft und an die Toleranz der Familie, diese Ideen und Lebensplanung zu unterstützen – besonders deutlich in dem selbstlosen Angebot der übrigen vier Brüder von Aby Warburg zu erkennen, ihren ältesten Bruder bei seinen Studien und später beim Aufbau seiner Bibliothek zu unterstützen sowie Warburg, seine Frau und seine drei Kinder während der gesamten Lebenszeit zu finanzieren. Aby Warburg hat, wie auch Proust, selbst nie Geld verdient.
Zwar zeigt das Beispiel von Jane Austen, dass dies auch für Frauen der gehobenen Bürgerschicht in seltenen Fällen möglich war, bei ihr war es jedoch mit dem Verzicht auf Kinder und Familie und teilweise auch gesellschaftlicher Ächtung verbunden, während sowohl Proust als auch Warburg gesellschaftlich anerkannt waren. Man kann aus heutiger Sicht eigentlich nur staunen, in welchem Umfang Männern Freiheit für ihre Selbstverwirklichung zugestanden wurde, obwohl sich noch gar nicht abzeichnete, dass sich daraus ein Genie entwickeln könnte.
Man mag die Frage aufwerfen, ob die Entstehung der Phase »emerging adulthood«, die sich zwischen die Phase des Jugendalters und das Erwachsenenalter geschoben hat – ein Phänomen, das inzwischen in vielen westlichen Industrieländern gefunden wurde –, tatsächlich etwas Neues ist oder ob sie nicht schon immer existierte, und zwar für die privilegierte Oberschicht. Auch heute noch müssen junge Leute der Unterschicht die Entwicklungsphasen in einem kürzeren Zeitraum durchlaufen. Sie müssen früher Verantwortung übernehmen, es bleibt weniger Zeit für die Exploration verschiedener Identitätsentwürfe – das müssen wir auch therapeutisch beim Umgang mit Patienten bedenken. Dennoch gilt, dass – aufgrund von höherer wirtschaftlicher Stabilität und finanzieller Unterstützung durch Eltern oder Staat – heute insgesamt mehr junge Leute die Möglichkeit zu »fun and exploration« haben. Die Shell-Studie (2006) zeigt eindeutig an einer sehr großen Gruppe von deutschen Befragten der Altersstufen bis 24 Jahre, dass ihnen Spaß einerseits sehr wichtig ist, andererseits aber viel zur Abwendung der potentiell drohenden Arbeitslosigkeit getan wird. Auch die beruflichen und partnerschaftlichen Ziele werden mit gleicher Ernsthaftigkeit angestrebt und haben eine hohe Wertigkeit.
Eriksons Theorie und Identitätsentwicklung heute: Was hat sich wirklich geändert?
Wie bereits geschildert, begann Erikson nach einer Zeit der Wanderung und des persönlichen Suchens 1928 eine psychoanalytische Therapie bei Anna Freud; nach Abschluss seiner Ausbildung als Erwachsenen- und Kinderanalytiker und emigrierte er 1934 in die USA. Bereits in seinem ersten Werk, das insgesamt in zwölf Sprachen übersetzt wurde, stellte er sein Modell der acht Phasen der psychosozialen Entwicklung vor, das über Jahrzehnte hinweg bis heute einflussreich ist und zahlreiche Forscher zur Überprüfung der Annahmen Eriksons angeregt hat. Für Erikson fand die Identitätskrise im Jugendalter statt, sieht sich der Jugendliche zwischen den Polen Identitätssynthese (Integration von früheren Identitätsaspekten und Identifikationen aus der Kindheit) und Identitätskonfusion (Unfähigkeit, das Ganze zu einer kohärenten Identität zu integrieren). Allerdings hat Erikson auch darauf hingewiesen, dass die Identitätsentwicklung sich über das ganze Leben erstreckt und immer Veränderungen unterliegt, d. h. eine Weiterentwicklung erfolgt. Dies ist auch der Grund, weshalb im Folgenden Eriksons Konzeption der psychosozialen Entwicklung über die gesamte Lebenspanne dargestellt wird.
Eriksons Konzeption der psychosozialen Entwicklung
In Kindheit und Gesellschaft (1965) legte Erikson eine Einteilung des menschlichen Lebenslaufs vor, die sich an psychosozialen Krisen orientiert. In jeder der acht Entwicklungsphasen muss das Individuum eine solche Reifungskrise bewältigen. Sie ergibt sich, weil das Individuum durch neue Beziehungen, Aufgaben oder gesellschaftliche Anforderungen gezwungen wird, seine Wahrnehmung der Realität zu verändern und sich dieser anzupassen. Diese Krisen oder Dilemmata geben der jeweiligen Phase ihren Namen, und davon, ob es gelingt, sie zu bewältigen, hängt der erfolgreiche Ausgang aller nachfolgenden Phasen ab. Bei der Auseinandersetzung mit der psychosozialen Krise jedes einzelnen Stadiums kommt Ich-Funktionen der Person eine besondere, aktive, adaptive Funktion zu. Hier merkt man deutlich, dass Erikson ein Schüler Anna Freuds war.
Die ersten Stufen, die Erikson in diesem Schema beschreibt, beziehen sich auf die Baby- bzw. Kleinkindzeit. So beschreibt er etwa auf Stufe 1 den Konflikt zwischen Urvertrauen und Misstrauen, d. h. die Tatsache, dass der Säugling erst einmal eine liebevolle und vertrauensvolle Beziehung zu einer primären Bezugsperson entwickeln muss. Andererseits besteht, wenn dies nicht gelingt, ein hohes Risiko für ein andauerndes Misstrauen in Beziehungen. Diese These wurde durch die Bindungsforschung später umfangreich belegt und zeigte die langfristigen Auswirkungen von Arbeitsmodellen unsicher gebundener Kinder auf die weitere Beziehungsentwicklung.
Die darauf folgenden Stufen beschreiben relativ ähnliche Themen, bei denen es um Kompetenzen in alltäglichen Anforderungen geht, wobei die Entwicklungsdynamik durch die Entstehung des Über-Ichs und damit der Fähigkeit zu Schuldgefühlen befördert wird, während zugleich immer stärker der soziale Vergleich mit anderen hervortritt. Auf Stufe 2, Autonomie vs. Scham und Zweifel, wird die typische Reifungskrise der Altersstufe von 2 bis 3 Jahren beschrieben. Das Kind entwickelt physische Kompetenzen. Es lernt Kontrolle über körperliche Funktionen auszuüben, kann aber auch Schamgefühle entwickeln, wenn es nicht adäquat in seiner Entwicklung unterstützt wird oder in seinem eigenen Erleben inkompetent ist. Auf Stufe 3 betrifft die Reifungskrise das Thema Initiative vs. Schuldgefühl. Es wird deutlich, dass das Kind im 4. bis 5. Lebensjahr immer kompetenter im Umgang mit seiner Umwelt wird und immer mehr Initiative entwickelt. Gleichzeitig hat es auf der Grundlage eines Über-Ichs auch schon ein Gespür dafür, dass es manchmal andere verletzt, was Schuldgefühle mit sich bringt. Auf Stufe 4 (6. bis 12. Lebensjahr), Leistung vs. Minderwertigkeit, geht es wiederum um Anforderungen, und zwar dieses Mal um die neuen Anforderungen an ein Schulkind (Lesen, Schreiben etc.) oder aber, wenn es diesen nicht entsprechen kann, um ein basales Gefühl der Minderwertigkeit.
Abbildung 1: Phasen der psychosozialen Entwicklung nach Erikson
Die Stufen 5 und 6 sind besonders eng in ihrer Entwicklungsdynamik verbunden und werden uns in ihrer von Erikson gedachten Konsequenz bezüglich der partnerschaftlichen Intimität auf der Basis einer reifen Identität noch verstärkt in Kapitel 5 beschäftigen. Auf Stufe 5, Identität vs. Rollendiffusion, muss der Jugendliche im Alter zwischen 13 und 18 in verschiedenen Bereichen ein Gefühl der Identität für sich erarbeiten, sowohl in Bezug darauf, wer er (oder sie) ist, als auch darauf, was er (oder sie) in der Zukunft sein wird. Dies schließt auch die Aufgabe ein, eine persönliche Ideologie, bestimmte Werte und Ziele zu erarbeiten. Hinzu kommt, dass gesellschaftlich erwartet wird, dass Jugendliche sich von der »Hier-und-jetzt«-Orientierung des Kindes distanzieren und eine zukunftsorientierte Haltung entwickeln. Neben der Frage »Wer bin ich?« wird zusätzlich die Frage bedeutsam: »Wer werde ich und wer will ich sein?«
Auf der 6. Stufe, Intimität vs. Isolation, kann der junge Erwachsene (19. bis 25. Lebensjahr) auf der Basis einer entwickelten Identität beginnen, intime Beziehungen aufzubauen. Wenn dies nicht gelingt, besteht die Gefahr einer relativen Isolation. Stufe 6 baut also auf dem zuvor entwickelten Gefühl der Ich-Identität des jungen Erwachsenen unmittelbar auf. Die letzten beiden Stufen sind dem mittleren und hohen Erwachsenenalter gewidmet. In der Altersstufe 25 bis 65, also einer recht breiten Alterspanne, siedelt Erikson Stufe 7 mit dem Thema Generativität vs. Stagnation an. Der Erwachsene muss einen Weg finden, generative Motive zu befriedigen, aus sich selbst herauszutreten und sich der Gemeinschaft zuzuwenden. Generativität ist nach Erikson »v. a. das Bemühen, die neue Generation zu fördern und zu führen« (1959/1971, S. 267), und umfasst Zeugungsfähigkeit, Produktivität und Kreativität. Die Sorge für Kinder und deren Aufzucht stellt sicherlich eine zentrale Aufgabe dar, in der viele Menschen generativ aktiv werden, dies ist jedoch nicht der einzige Weg. Andere Möglichkeiten sind die Übernahme von Mentoren-Diensten für jüngere Kollegen, von karitativen Arbeiten und ein vergleichbares soziales Engagement. Gelingt Generativität nicht, so führt dies nach Erikson oft zu Selbstbezogenheit und Gefühlen der persönlichen Stagnation. So wies er in einem seiner letzten Interviews auf eine besonders tragische Form der Stagnation hin, als er beschrieb, dass Menschen, die kinderlos blieben, in ihren mittleren Jahren oft eine Krankheit entwickeln, die mehr und mehr zum zentralen Lebensinhalt wird und einen Großteil der vitalen Kräfte bindet (Erikson, 1983).
Im Alter von 65 Jahren und danach, auf Stufe 8, siedelt Erikson schließlich Ich-Integrität vs. Verzweiflung an, was bedeutet, dass sich ein Gefühl der Akzeptanz entwickelt, wenn alle vorangegangenen Entwicklungsschritte hinreichend gut bewältigt wurden. Der Mensch akzeptiert sich als der, der er geworden ist, bzw. ist verzweifelt aufgrund von verpassten Entwicklungschancen und nicht gelebten Identitätsentwürfen. Sehr eindrucksvoll ist mir noch die Mutter eines israelischen Kollegen, Shmuel Shulmans, in Erinnerung, die nach einem entsagungsreichen und sehr belasteten Leben kurz vor ihrem Tod resümierte: »Ich hatte ein gutes Leben.«
Aus heutiger Sicht war Eriksons Bemühen wegweisend, das analytische Paradigma der frühkindlichen Determiniertheit des Menschen hinter sich zu lassen und explizit post-ödipale Entwicklungsphasen (Rattner, 1995) in seiner Theoriebildung mit einzubeziehen. Er stellte darüber hinaus – trotz seiner Bewunderung für Freuds Person und Werk – dem Freudschen Libidobegriff eine neue kontextuelle Terminologie entgegen und beschrieb das, was sich zwischen Eltern und Kindern abspielt, in Begriffen sozialer Interaktionen. Insofern greift er Ideen auf, die für Objektbeziehungstheoretiker eine große Rolle spielen. Man kann in seinem Schema zwar noch die anale, orale, phallische und ödipale Phase der Entwicklung erkennen, doch sie wurden zu kontextabhängigen menschlichen Reifungsschritten umformuliert. Auffällig ist, dass Erikson die Kindheit und Jugend stark differenziert (in 5 Stufen), das Erwachsenenalter aber weniger beachtet hat (3 Stufen) und dort relativ breite Alterspannen angibt.
Überprüfung von Eriksons Identitätskonzept: Entpathologisierung des verlängerten Übergangs zum Erwachsenenalter
Für Erikson (1959, 1968) erfolgte zwar die Identitätsentwicklung das ganze Leben lang, er hat sie aber schwerpunktmäßig in der Adoleszenz verankert. Gegenwärtig arbeiten – in Europa und Nordamerika – von Eriksons Ideen ausgehend verschiedene Gruppen an der Erforschung der Identität, etwa Wim Meeus in den Niederlanden, Luc Goossens und Koen Luyckx in Belgien, Jane Kroger in Norwegen und James Marcia in Kanada. Sie haben eindrucksvolle Forschungsbefunde zusammengestellt, die teilweise Eriksons Theorie bestätigen, aber auch zu einer Erweiterung und einer Adaptierung an die gegenwärtigen Lebensumstände geführt haben. Auffällig ist, dass alle heutigen Identitätskonzeptionen zwischen den beiden Dimensionen Exploration und Commitment unterscheiden – eine Unterscheidung, die im Grunde das empirisch umsetzt, was Erikson zunächst nur andeutete: dass auf eine Phase der Exploration und Erkundung letztlich auch eine Verpflichtung auf einen bestimmten Identitätsentwurf, ein Commitment, folgen muss. Beide Dimensionen, die Exploration und das Commitment, gelten für den beruflichen und den partnerschaftlichen Bereich der Identität. Ein weiteres wichtiges Ergebnis dieser zahlreichen Forschungsaktivitäten ist die Entpathologisierung eines zeitlich verlängerten Übergangs zum Erwachsenenalter.
James Marcia (1966; Marcia et al., 1993) setzte als Erster Eriksons Idee empirisch um. Am Beginn seiner Forschungsarbeiten zum Identitätsstatus standen unstrukturierte Interviews mit männlichen Collegestudenten zur Identität in den Bereichen Arbeit, Karriere und Ideologie. Dabei stieß er bereits in den ersten Interviews auf das Merkmal Commitment, ein Begriff, der schlecht ins Deutsche zu übersetzen ist und am ehesten Bedeutungen wie »Überzeugung«, »Verpflichtung« oder »sich einsetzen für eine bestimmte Sache« abdeckt. Commitment wurde schon früh durch eine weitere Dimension erweitert, nämlich Exploration, d. h. die Suche nach Alternativen.
Die Statusdiagnostik nach Marcia (1966) unterscheidet vier verschiedene Identitätsstatus, die sich aus verschiedenen Mischungsverhältnissen von Exploration und Commitment ergeben. Jungen Menschen, die eine Phase des Ausprobierens durchlaufen und sich dann hinterher beispielsweise zum beruflichen Engagement in einem bestimmten Bereich entschließen, wurde von ihm eine achieved identity (erarbeitete Identität) zugeschrieben. Eine andere Gruppe, die sehr stark exploriert, sich aber nicht festlegen möchte, befindet sich seiner Meinung nach im »Moratorium«. Eine dritte Gruppe exploriert kaum, sondern legt sich häufig relativ schnell und ohne nach Alternativen zu suchen auf einen Beruf fest, der schon im Elternhaus vertreten war (foreclosure). Eine vierte Gruppe schließlich, der eine »diffuse Identität« zugesprochen wird, exploriert nicht und kann sich auch auf nichts festlegen.
Wie bereits dargestellt ist ein wichtiger Aspekt in Marcias Taxonomie die große Bedeutung explorativer Prozesse für eine gelingende psychosoziale Entwicklung. In seinen ersten Arbeiten sprach Marcia davon, dass zum Erreichen einer erarbeiteten Identität erst eine Moratoriumssequenz durchlaufen werden muss, und verwies damit – ähnlich wie Erikson, Blos und andere analytische Autoren – auf die große Bedeutung regressiver Phänomene für eine gelingende Persönlichkeitsentwicklung. Wichtig ist, dass die regressiven Prozesse nur dann wachstumsfördernd und adaptiv sein können, wenn sie nicht zu viel Angst hervorrufen und sich auf der Basis einer ausreichenden Ich-Stärke abspielen.
Tatsächlich wissen wir in der Ich-Psychologie schon seit langem, dass kurzzeitige regressive Phänomene für eine gelingende psychosoziale Entwicklung wichtig sein können. Das Fehlen einer gewissen Krise oder Exploration deutet möglicherweise darauf hin, dass relativ schnell eine vorgefundene Weltsicht übernommen wird, ohne sie zu hinterfragen. Dies könnte sich langfristig als maladaptiv herausstellen, insbesondere unter heutigen Bedingungen. Es stellt sich also die Frage, ob unter heutigen Bedingungen eine übernommene Identität (foreclosure) noch angemessen ist und ob nicht in jedem Fall eine längere Phase der Exploration wichtig und sinnvoll ist. Interessant an dem Ansatz von Marcia ist auch, dass er Lebensbereiche und Identitätsthemen herausgearbeitet hat, so z. B. Beruf, Beziehungen und persönliche Ideologie. Untersuchungen im Kulturvergleich zeigten dann später, dass in einzelnen Bereichen doch sehr große Unterschiede auftreten können (vgl. Kap. 6, S. 152) und dass es nicht sinnvoll ist, einen globalen Identitätsindex zu verwenden.
Marcia fand in seinen späteren Forschungsarbeiten (Marcia et al., 1993) bei Studenten eine Zunahme an diffuser Identität von 10 auf 26 % seit den 1970er Jahren. Dies könnte ein Hinweis auf veränderte Lebensbedingungen bereits für die 1990er Jahre sein, ein Wandel, der insgesamt zu einer Verunsicherung beigetragen hat. Noch deutlicher wird der Einfluss der veränderten Lebensbedingungen auf die Identitätsentwicklung in einer Metaanalyse, die Jane Kroger 2010 publizierte und worin sie 124 Studien zum Identitätsstatus nach Marcia einschloss, die in den Folgejahrzehnten durchgeführt und aufgrund ihrer hohen Qualität aus gegenwärtig über 500 existierenden Studien über das Marcia-Paradigma ausgewählt wurden. Bemerkenswert ist zunächst, dass sich das Stadium des Moratoriums über alle Studien hinweg noch bei 42 % aller untersuchten jungen Leute im Alter von 20 Jahren fand. Der Vergleich der Altersgruppen um die 20 und Mitte 30 zeigte aber dann eine deutliche Weiterentwicklung, und zwar in Richtung auf eine Zunahme an achieved identity und eine Abnahme an foreclosure und diffusion. In Bezug auf die erarbeitete Identität (achieved identity) fand sich eine Zunahme von 34 % im Alter von 22 Jahren auf 47 % im Alter von 36 Jahren. Dies bedeutet zwar, dass bis zum Alter von 36 Jahren erst knapp die Hälfte einen Status achieved identity hatte, man muss sich jedoch vergegenwärtigen, dass die erarbeitete Identität ein sehr anspruchsvolles Kriterium ist, das beispielsweise von Jugendlichen deutlich seltener erreicht wurde (14 % im Alter von 17 Jahren), und dass über alle Studien hinweg Progression mehr als zweimal so wahrscheinlich war wie Regression. Die meisten jungen Leute veränderten sich vom Moratoriumsstadium um die 20 zu einer reifen, erarbeiteten Identität mit Mitte 30. Diese Befunde tragen wesentlich zu einer Entpathologisierung des verlängerten Übergangs zum Erwachsenenalter bei und verdeutlichen insgesamt eine sehr positive Entwicklung.
Exploration in die Tiefe und Breite, fehlendes Commitment und ruminative Exploration
In weiteren Forschungen wurde offenkundig, dass die Konstrukte der Exploration und des Commitment weiter zu differenzieren sind, wenn man die Identitätsentwicklung der heute lebenden jungen Leute angemessen beschreiben will, und dass diese Differenzierungen auch therapeutisch relevant sind. Luyckx, Schwartz, Goossens, Soenens und Beyers (2008) haben auf den Unterschied zwischen einer Exploration in die Tiefe und einer Exploration in die Breite hingewiesen. Während früher eher berufliche Spezialisierungen (Explorationen in die Tiefe) charakteristisch waren, versuchen junge Leute heute, möglichst breit und universell einsetzbar zu sein. Diese Entwicklung in die Breite ist nicht unproblematisch, wie wir an dem zu Beginn dieses 2. Kapitels abgedruckten Interview verdeutlicht haben.
Auch die für eine reife Identität so wichtige Verpflichtung, das Commitment, ist ein Prozess mit mehreren Komponenten (Luyckx et al., 2011). Nach einer Entscheidung und der Identifikation mit ihr sucht man Bestätigung durch signifikante andere (Kerpelman et al., 2008) und modifiziert seine Identität auch in Abhängigkeit von Urteilen anderer. Luyckx und Mitarbeiter unterschieden zwischen commitment making (eine Entscheidung treffen) und identification with commitment (Identifizierung mit der getroffenen Wahl). Das bedeutet, dass der Identitätsprozess für jemanden noch nicht ganz beendet ist, auch wenn er bereits eine Wahl getroffen hat. Man wird wahrscheinlich weiter nach Informationen suchen, die diese Entscheidung bestätigen, möglicherweise in die Tiefe explorieren, ob die Wahl die richtige war, und sich schließlich mit der Entscheidung identifizieren. Ist sie nicht »passend«, wird nochmals eine Exploration in die Breite eingesetzt, um nach Alternativen zu suchen – es handelt sich also um einen sehr komplexen Prozess.
Diese Differenzierungen sind wichtig, wenn wir als Therapeuten Patienten begleiten, die sich mit Identitätsfragen beschäftigen bzw. regelrecht quälen. Wie deutlich geworden ist, ist das Prozesshafte, sind die Suchbewegungen ein Stück weit Teil einer gesunden und adaptiven Identitätsentwicklung. Problematisch sind nach diesen Forschungen nicht adaptive Explorationen, sondern die ruminative Exploration, bei der Patienten beispielsweise Schwierigkeiten haben, zufriedenstellende Antworten auf die Identitätsfrage zu finden: Sie fragen sich immer dasselbe, ohne mit der Antwort zufrieden zu sein; sie treten, ähnlich wie man dies von depressiven Krankheitsbildern kennt, auf der Stelle. Dies führt zu psychischen und psychosomatischen Symptomen. Schon in den frühen Studien wurden übrigens