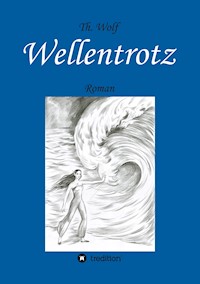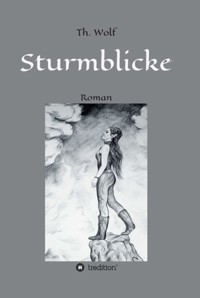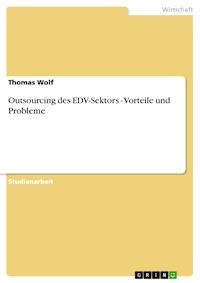14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Schwarzkopf & Schwarzkopf
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Im Gefängnis hat Thomas Wolf begonnen, seine Geschichte aufzuschreiben. Eindrücklich schildert er, wie er zusammen mit seinem Halbbruder in schwierigen Verhältnissen aufwächst. In der Familie findet er keinen Halt, Vorbilder fehlen, Wurzeln kann er nirgends schlagen. Irgendwann dann beginnt seine kriminelle Laufbahn mit ersten Diebstählen, Kontakten zum Drogenmilieu, Dealereien, Autoaufbrüchen. Aus den kleineren Delikten werden schnell größere: Einbrüche, systematische Automatenaufbrüche, Autodiebstähle. Und irgendwann überfällt er die erste Bank. Es sollen noch viele weitere folgen bis zur letzten Festnahme 2009. In der außergewöhnlichen Autobiografie 'Outside in' erzählt Thomas Wolf von seinem Leben zwischen Gefängnis und Flucht, immer in der Angst, dass jeder Tag in Freiheit der letzte sein könnte. Mal poetisch, mal spannend, immer authentisch und offen, ohne Pathos, ohne Selbstmitleid und ohne Beschönigung. So spürt der Leser Stück für Stück den Punkt auf, an dem es im Leben des Thomas Wolf in die falsche Richtung lief, und beginnt zu begreifen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 790
Ähnliche
Thomas Wolf
OUTSIDE IN
Die Autobiografie des bekanntesten Bankräubers Deutschlands
VORWORT
»SCHREIBEN SIE AUF, WIE ES TATSÄCHLICH WAR!«
Als ich im Sommer 2009 mit der Arbeit an diesem Buch begann, gab es vieles zu bedenken. Ich hatte im Laufe meines Lebens einigen Menschen Verletzungen beigebracht, nicht nur körperliche, auch seelische. Indem ich sie in Situationen brachte, die sie, ohne Kenntnis der wahren Umstände, als für sie lebensbedrohlich empfanden. Sie waren zu Opfern geworden – und ich war der Täter. Dieser Sachverhalt musste stets erkennbar bleiben und durfte an keiner Stelle relativiert oder gar verharmlost werden. Denn ich war nicht »harmlos«. Keinesfalls. Im Gegenteil. Diejenigen, die mir im Zusammenhang mit meinen Straftaten begegneten, empfanden mich teilweise als äußerst bedrohlich.
Ich kann nichts von dem, was sie mit mir erlebt haben, ungeschehen machen. Nur getreulich wiedergeben, was ihnen widerfahren ist, und so erkennbar machen, wie sie ohne eigenes Zutun zu Leidtragenden wurden. Dafür möchte ich mich bei ihnen entschuldigen. Aus ehrlichem Herzen. Besonders gilt das für die Entführung von Frau Eilert. Ich habe sie und ihre gesamte Familie in Angst und Schrecken versetzt. Dessen bin ich mir erst heute voll bewusst. Dafür möchte ich alle, die unter meinem Handeln gelitten haben, um Verzeihung bitten.
*
Was bewegt einen Menschen dazu, seine Lebensgeschichte aufzuschreiben? Diese Frage stellte sich mir, bevor ich mit der Arbeit an diesem Buch begann. Unter aus dem Rahmen fallenden Bedingungen. Mein Arbeitsgerät damals war ein Knastkugelschreiber und das Papier stammte vom selben Lieferanten. Ich befand mich in Haft. Genauer, in Isolationshaft, in der JVA Weiterstadt, nur wenige Kilometer südlich von Frankfurt. Dort hatte ich zuvor fast zehn Jahre lang gelebt. Zusammen mit Katharina, meiner treuen Gefährtin. Die aus allen Wolken fiel, als eines Abends die Polizei vor unserer Wohnungstür stand und nach mir fragte. Nach einem Mann, dessen Name ihr völlig fremd war, den sie zuvor noch nie gehört hatte. Wie auch? Schließlich kannte sie mich als David van Dijk, geboren in Düsseldorf, aufgewachsen in Rotterdam. Eine Legende, mit der ich so fest verwachsen war, dass ich mich an meinen richtigen Namen kaum noch erinnerte.
Im Gegensatz zum Bundeskriminalamt, das mich ein Jahrzehnt lang auf seiner Top-Ten-Liste führte. Als Katharina dies erfuhr, hatte ich es sogar auf die Pole Position geschafft. Ich war »Germany’s most wanted«. Der Titel war mit einem stattlichen Preisgeld verbunden, das allerdings nicht ich kassieren sollte, sondern derjenige, der Angaben über meinen aktuellen Aufenthaltsort machen konnte. 100.000 Euro! So stand es fettgedruckt auf meinem Steckbrief, in knalligem Rot. Das Fünfzigfache dessen, was man für die Ergreifung eines Mörders zahlte. Ich hatte niemanden ermordet. Nicht einmal verletzt. Scharfe Waffen gehörten nicht zu meinen Equipment. Ich lehnte sie ab. Aus vielerlei Gründen. Meine Waffe war der Bluff! Auf den ich mich verstand, nicht nur bei der Geldbeschaffung. Was mir beim BKA keine Sympathiepunkte einbrachte. Natürlich wusste ich, dass es in Wiesbaden residiert. Irgendwann hatte ich es mir sogar mal angesehen. Von außen selbstverständlich, das musste reichen. Dass ich Ende März 2009 ausgerechnet in Wiesbaden die Ehefrau eines leitenden Bankangestellten entführte, beruhte auf einer Verkettung nicht vorhersehbarer Umstände und sollte sich für mich doppelt als böser Missgriff erweisen. Später, beim Prozess.
Zunächst jedoch lief alles nach Plan. Während die Bank, gegen die sich die Erpressung richtete, die Geisel in höchster Gefahr wähnte, ging ich mit ihr in aller Öffentlichkeit spazieren und erzählte ihr dabei meine Lebensgeschichte. Zehn Stunden später war die Frau wieder bei ihrer Familie – und ich auf der Flucht, mit vierzig Kilo Bargeld, insgesamt 1,8 Millionen Euro. Dann brach um mich herum die Hölle los.
Die Medien, angefeuert von der Pressestelle der Frankfurter Polizei, setzten untereinander einen Wettstreit um das stärkste Adjektiv in Gang. Bereits Tage später kürten sie mich fast einstimmig zum »gefährlichsten Verbrecher Deutschlands«. Was im Frankfurter Polizeipräsidium, bei der »Soko Wolf«, sicher heftiges Kopfnicken auslöste. Dort war man nämlich äußerst verstimmt, als man erfuhr, dass ich fast ein Jahrzehnt lang nur einige Fahrradminuten von ihrem Hauptquartier entfernt wohnte. Es hatte sich einfach so ergeben. Für die Leute, die dort ihrer Arbeit nachgingen, war ich ein Albtraum gewesen. Zielfahnder, so hieß es, seien bei der Jagd auf mich vor der Zeit gealtert. Nun schöpften sie neuen Mut. Sie sorgten dafür, dass ich nicht mehr aus den Schlagzeilen herauskam, um ihre Jahre der Erfolglosigkeit vergessen zu machen. Zwei Monate lang. Dann war die Hatz zu Ende. Das Endspiel fand in Hamburg statt, ausgerechnet auf der Reeperbahn. Am helllichten Tag. Ich hatte keine Chance. Es war vorbei. Game over!
Im LKA, wo ich zunächst landete, hörte ich erstmals nach zehn Jahren wieder meinen Namen aus dem Mund eines anderen Menschen. Zehn Tage lang schmorte ich danach in einem Hamburger Horrorknast. Dann holten mich die Hessen zurück in die Heimat. Nicht heimlich, still und leise – sondern als Medienspektakel inszeniert. Was von da an methodisch erfolgte. Man brachte mich in der JVA Weiterstadt unter, dreißig Kilometer südlich von Frankfurt. Dort sollte ich auf meinen Prozess warten, der in Wiesbaden stattfinden sollte.
Auf der Fahrt kam ich mit einem der SEK-Beamten ins Gespräch, der den Transport von Hamburg nach Weiterstadt durchführte. Wir redeten über alles Mögliche. Auch über den Schwachsinn, den seine Behörde teilweise über mich verbreitet hatte. Er wusste, wovon ich sprach, und lachte. »Völlig normal«, meinte er, alltägliche Polizeiarbeit. Es ginge darum, die Medien zu mobilisieren und die Öffentlichkeit zu »sensibilisieren«, wie er es nannte. In meinem Fall wäre man ohne Hinweise aus der Bevölkerung nicht weitergekommen. Es gab keine Spur von mir, die man hätte verfolgen können. Mich konnte man nicht einfach »einsammeln«, wie andere, die sich in Puffs, Bars und Spielhöllen herumtrieben. Man wusste, dass ich nicht dazu neigte, derartige Örtlichkeiten mit meiner Anwesenheit zu beehren. Ich solle mir aber keine Gedanken machen, die Leute hätten ein kurzes Gedächtnis. Und, fügte er hinzu, es stünde mir ja frei, alles aufzuschreiben. So wie es sich wirklich zugetragen hatte. Diesen Satz merkte ich mir!
Das Schreiben umfangreicher Texte war nichts gänzlich Neues für mich. Schon Jahre zuvor hatte ich einen sechshundert Seiten starken Roman verfasst. Ebenfalls in Haft. Kaum war er fertig, befand ich mich wieder auf der Flucht. In Weiterstadt, in der Isolationshaft, blieb mir ausreichend Zeit, gründlich über die Worte dieses SEK-Mannes nachzudenken. »Schreiben Sie auf, wie es tatsächlich war!«
Da war einiges! Ein ganzer Berg, dessen Gipfel die Entführung bildete. Das restliche Massiv bestand aus Banküberfällen, mal mit, mal ohne Bombenattrappen. Am Fuße des Berges stapelten sich Autos, dutzendweise, die ich ergaunert und verscherbelt hatte. Drumherum jede Menge Geröll. Scheckfälschungen, Drogenhandel und was weiß ich noch. Je länger die Liste wurde, umso tiefer reichte sie in mein Leben hinein, in den Stollen, der gleich neben dem Berg senkrecht in die Erde hinabführte. Ich ahnte, was dort unten lag. Konnte es aber nicht sehen. Es war zu dunkel in dem Stollen. Ich musste hinabsteigen. Als ich unten ankam und meine Augen sich an die Dunkelheit gewöhnt hatten, sah ich in einer besonders finsteren Ecke einen Scherbenhaufen liegen. Er war mit Staub überzogen, er lag schon lange dort. Ohne nachzudenken wusste ich, wer ihn hinterlassen hatte, meine ehemals Erziehungsberechtigten. Ich wusste auch, dass es mir nicht guttun würde, darin herumzuwühlen. Schließlich siegte die Neugier, ich griff mit bloßen Händen hinein und obwohl ich mich vorsah, zog ich mir dabei ein paar Schnitte zu. Die Scherben gehörten zu einem Spiegel, den ich Stück für Stück wieder zusammensetzte. Einige der Scherben waren nicht mehr zu gebrauchen. Fast schien es so, als hätte man sie mit Absicht zertreten.
Heraus kam ein Spiegel, der von Rissen und Brüchen durchzogen war. Als ich hineinschaute, zeigte mir jede der Scherben ein anderes Bild, darunter Menschen, Ereignisse, Augenblicke, die ich längst aus meinem Gedächtnis verbannt geglaubt hatte. Zusammengenommen die Collage eines jungen, zersplitterten Lebens. Der Basisstein, auf dem der Berg darüber ruhte. Sie gehörten zusammen. Der eine war ohne den anderen nicht denkbar. Ich habe versucht, diese Bilder wieder sichtbar zu machen, gleichsam zum Leben zu erwecken, in meiner Sprache. Ohne Sentimentalität, ohne Kitsch. Und aus dem Gefühl der Zeit heraus, in der diese Bilder entstanden. Ich hoffe, es ist mir gelungen. Aufzuschreiben, wie es wirklich war.
»EIN BIZARRES LEBEN«
Weiterstadt in Südhessen. Ein Ortsname. Er wird Ihnen nichts sagen. Es sei denn, Sie verfügen über ein gutes Gedächtnis. Anfang der Neunziger legte dort ein »Sprengtrupp« der damals noch aktiven RAF einen gerade erbauten Knast in Trümmer. Den Nutzen hatte allein der Bauunternehmer. Der Knast wurde neu errichtet und bald darauf in Betrieb genommen. Woher ich das weiß? Ganz einfach. Ich sitze dort ein. Seit dem 10. Mai 2009. Anfang 2009 war ich acht Wochen lang die Nummer eins auf der Fahndungsliste des Bundeskriminalamts. Mein Steckbrief hing an jeder Ecke. Dann wurde ich festgenommen.
Mein Name ist Thomas Wolf. Ich habe Banken beraubt. Eine Unart, ohne jeden Zweifel. Die mir aber nicht in die Wiege gelegt wurde, als ich 1953 als Sohn eines halbwegs ehrbaren Kaufmanns in Düsseldorf das Licht der Welt erblickte. Wir lebten in respektablen Verhältnissen. Eine Kinderfrau, ein Relikt aus den Fünfzigerjahren, begleitete mich bis zur Einschulung. Während dieser ersten Jahre meines Lebens war Vater meist beruflich unterwegs. Ich sah ihn selten. Ein Gast, der kam und wieder ging.
Mutter war eine recht umtriebige Person und ein Vierteljahrhundert jünger als mein Vater. Außer einem Sohn, Hubert hieß der Knabe, hatte sie nichts Erwähnenswertes mit in diese Ehe gebracht. Hubert war vier Jahre älter als ich. Wir aßen beide am selben Tisch. Ansonsten verband uns nicht viel.
Mutter erzählte jedem, ich sei ein Wunschkind gewesen. Mit stets guten Manieren und freundlich zu jedermann. Nehmen wir zu meinen Gunsten an, diese Auskünfte seien zutreffend. Fragen können wir sie nicht mehr. Sie ist tot. Wie Vater, den sie milde lächelnd unter die Erde gebracht hatte. Hubert habe ich seit dreißig Jahren weder gesehen noch gesprochen, ohne darunter zu leiden. Eine lange Zeit. Die ich ausschließlich in der Illegalität verbracht habe. Oder im Knast. Je nach Lage der Dinge. Eine Existenzform, die Ihnen sicher fremd ist. Wollen Sie trotzdem wissen, wie sich ein solch bizarres Leben anfühlt? Und wie es zu einem solchen Leben kommt? Dann hören Sie einfach zu. Ich erzähle es Ihnen.
Thomas Wolf
KAPITEL 1
KINDHEIT UND JUGEND
1963 – 1969
FAMILIEN-BANDE
Es war eisig kalt im Februar 1963, damals, als man die Jahreszeiten noch am Thermometer ablesen konnte. Ich war gerade zehn Jahre alt geworden. Eine durchaus magische Zahl – erstmals zweistellig! Meine Schule, Volksschule nannte man sie noch, lag im Düsseldorfer Stadtteil Oberbilk. Hier lebten Arbeiter und kleine Angestellte, jedenfalls mehrheitlich. Durchaus keine Armeleutegegend. Aber auch nicht das Hochglanz-Düsseldorf, das auf den Plakaten zu finden war. Meine Schule war ein streng katholisch geführtes Unternehmen. Mit Rektor Wacker als Chef. Meine erste Lehrerin war Fräulein Kowalski. Sie war prägend für mein späteres Frauenbild. Nie sah ich sie schlecht gelaunt oder gar zänkisch. Ihr Lächeln war nicht von dieser Welt. Gut, ich hatte nur Mutters als Vergleich. Wenn die lächelte, was sie selten tat, erinnerte mich das an eine ausgehungerte Katze vor dem Vogelkäfig. Nein, viel gemeinsam hatten die beiden nicht. Ich machte meiner Lehrerin nicht allzu viel Mühe, lernte gern und schnell. Zielstrebig bereitete ich mich darauf vor, nach dem letzten Jahr bei ihr auf das Gymnasium zu wechseln.
Zwischenzeitlich war Mutter dahintergekommen, dass Vater – biologisch betrachtet – auch ihr Erzeuger hätte sein können. Dies muss ihr bei ihrem hektischen Wechsel vom Hausmeister Ernst, Huberts Vater, hin zum Kaufmann Heinrich glatt entgangen sein.
Das erklärte ihr dann Jan, dem seine Mutter den etwas sperrig klingenden Namen »Ioanis« gegeben hatte, 1939 in Kavala, Griechenland. Er war ein strammer Bursche, wohl in jeder Hinsicht. Mutter fand gleich Gefallen an ihm. Tula darf nicht verschwiegen werden, Jans Ehefrau, mit der er ein gemeinsames Töchterchen hatte, Evelyn. Die drei wohnten in unserer Nachbarschaft. Was Mutter wohl nicht als Nachteil ansah. Im Rahmen der Völkerfreundschaft, wie sich von selbst verstand. Man kam sich schnell näher. Das alles wusste ich natürlich damals noch nicht.
An einem klaren, sonnigen Märztag, ich kam vom Fußballspielen nach Hause, sah ich Vater mit fremden Leuten, einem Mann und einer Frau, auf der Terrasse vor unserem Haus stehen. Ihm war das Techtelmechtel zwischen Mutter und dem jungen Griechen nicht verborgen geblieben. Kurzerhand hatte er sie vor die Wahl gestellt. Entweder ein Umzug, weg von Düsseldorf und somit von ihrem Verhältnis, oder die Trennung. Soweit es ihn betraf, ein tollkühnes Unternehmen.
Ein paar Jahre zuvor, Ende der Fünfziger, war sein Betrieb in erhebliche Turbulenzen geraten. Nach Jahren kreativer Buchführung war ihm das Gefühl für Brutto und Netto abhandengekommen, bis er am Ende Einnahmen und Gewinne nicht mehr zuverlässig auseinanderhalten konnte. Das Finanzamt erklärte ihm den Unterschied. In seiner Verzweiflung suchte er anwaltlichen Rat. Es ging um alles. Der Advokat ersann ein abenteuerliches Konstrukt. Mein Vater bezichtigte sich des Ehebruchs – es galt noch das Schuldprinzip – und ermöglichte es Mutter dadurch, sich umgehend von ihm scheiden zu lassen. Gleich darauf überschrieb er ihr seinen gesamten Besitz! Das Finanzamt, das einen langen Prozess scheute, ließ sich zu einem Deal bewegen. Vaters Konten, die nun Mutters waren, wurden vollständig leergeräumt, was wehtat, aber immer noch erträglicher war, als sämtliche Immobilien zu verlieren. Naiv wie Vater in diesen Dingen war, träumte er sich zurecht, dass das Ganze nur formellen Charakter hätte, was Mutter, die ihr Glück kaum fassen konnte, grundlegend anders sah. Sie stand nun als Eigentümerin im Grundbuch, nicht er. Ihr waren ein Grundstück von dreitausend Quadratmetern, drei Häuser und eine immer noch funktionierende Firma in die Hände gefallen.
Um wieder flüssig zu werden, verkaufte sie einen Teil des Grundstücks, bestes Bauland, in Düsseldorf. Damit lagen sie erst einmal wieder vorn. Um in Zukunft angemessen mobil zu sein, gönnte sich Mutter auf die Schnelle noch ein hübsches Ford Cabrio, rot, mit weißen Ledersitzen. All dies lag mittlerweile drei Jahre zurück. Als ich nun die Terrasse betrat, waren sich Vater und die fremden Leute bereits einig. Er hatte ihnen unsere Wohnung vermietet und damit Fakten geschaffen. Bereits zwei Wochen später sollte es losgehen. In ein Sechshundert-Seelen-Dorf, irgendwo im Nordschwarzwald. Würzbach hieß der Gulag. Dass das Dorf von der Viehwirtschaft lebte, brauchte man nicht zu wissen. Man roch es bereits Kilometer vor dem Erreichen des Ortsschilds. Es war der Gestank der Misthaufen. Berge von Kuhscheiße, meterhoch, vor beinahe jedem Haus. Überall waberte es durch die Luft, dass es einem die Tränen in die Augen trieb. Wie um alles in der Welt konnten an diesem Ort Menschen leben? Sicher wurden sie nicht sehr alt oder waren missgebildet. Es gab einen Edeka-Laden und, zentral gelegen, einen Zigarettenautomaten. Aber noch keine Telefonzelle. Mit der Außenwelt war man durch eine Buslinie verbunden. Drei Mal täglich konnte man so, binnen einer guten Stunde, in die fünfzehn Kilometer entfernt gelegene Kreisstadt gelangen, nach Calw. Unser Haus lag gleich am Waldrand, wodurch zumindest die Versorgung mit Sauerstoff gewährleistet war.
Schon am zweiten Tag meldete Mutter mich in der Dorfschule an. Mich empfing eine Horde Bauernlümmel, deren kurze Hosen und kahlrasierte Schädel mir Schweißperlen auf die Stirn trieben. Da hockte es also, mein neues soziales Umfeld. Mich, in Jeans und T-Shirt, anstarrend, als sei ich ein Außerirdischer. Mein Banknachbar kaute ständig an seinen Fingernägeln herum. Dies schien dort zur Folklore zu gehören. Außerdem roch er etwas streng und verständigte sich in einem Dialekt, den ich nicht verstand. Es sei noch erwähnt, dass alle in meiner Klasse evangelisch waren. Gott, so schien es, hatte mich endgültig aufgegeben.
Nur mit einem hatte er sich einen noch schlimmeren Scherz erlaubt. Mit meinem Freund Dragan. Seine Mutter stammte aus dem Kaff und war Mitte der Fünfziger in die Vereinigten Staaten ausgewandert, nach Chicago. Als Ehefrau eines U.S. Soldiers, der bei Stuttgart stationiert war und später bei einem Militäreinsatz fiel. Daraufhin war sie mit ihrem Sohn zurückgekehrt. Dragi war ein paar Monate älter als ich. Mit traurigem Gesicht erzählte er, dass er zurück wolle, nach Hause, nach Chicago. Stolz zeigte er mir Fotos. Er und sein Dad am Lake Michigan, an dem diese Riesenstadt lag. Mit Wolkenkratzern, höher als unsere Fernsehtürme. Die Beatles hatten gerade ihren musikalischen Siegeszug um die Welt angetreten. Dragi übersetzte mir die Texte. Ohne ihn wäre ich dort zum Killer mutiert.
Vater begann, sein Geschäft – er vertrieb Friseurartikel – nach und nach aufzulösen. Ihm saß noch immer der Schreck in den Gliedern und die bloße Nennung des Wortes »Finanzamt« löste bei ihm Allergien aus. Er arbeitete nun allein, betreute seinen alten Kundenstamm und verdiente auch damit ganz anständig. Er zahlte sogar Steuern. Mutter hatte oft in Düsseldorf zu tun, wohin sie stets mit ihrem Wagen fuhr, ohne Vater natürlich. Schließlich war sie Hausbesitzerin, was Verpflichtungen mit sich brachte. Dass man Jan, im Gegensatz zu mir, nicht aus der Stadt vertrieben hatte, nahm sie gern in Kauf. Somit war es Vater immerhin gelungen, zwischen sich und den nach wie vor stattfindenden Ehebruch sechshundert Autobahnkilometer zu legen. Und dafür hatte er uns in die Pampa verschleppt! Mutter wird sich krankgelacht haben. Im Sommer 1965 war dieses Kapitel beendet und unser Lebensmittelpunkt verschob sich vor die Tore Kölns, nach Ruppichteroth. Auch nicht die Hölle, aber man sprach rheinisch. Unser Haus, das von außen etwas duster wirkte, war innen sehr groß und freundlich. Davor lag ein schöner Garten. Es gab einen Fußballverein und auch die Schule nervte nicht mehr. Die Jungs dort waren wie ich. Ruppichteroth, das ging schon klar.
Bei Mutter und Vater häuften sich die Merkwürdigkeiten. Sie schienen immer mehr nebeneinanderher als miteinander zu leben. So war zu beobachten, dass sie, die früher stets gemeinsam auf der Couch vor dem Fernseher gesessen hatten, nun plötzlich schweigend jeder in seinem Sessel hockten. Zwei Wochen vor Weihnachten begleitete ich Mutter an einem Samstag nach Düsseldorf. Wir besuchten Oma. Es war früh am Abend, als ich die Haupteinkaufsstraße in unserem Viertel langging. Da Adventszeit war, hatten die meisten Geschäfte noch geöffnet. Plötzlich sah ich Mutter auf der gegenüberliegenden Straßenseite aus einem Lokal kommen. Trotz der bereits einsetzenden Dämmerung trug sie ihre Sonnenbrille und ihr welliges braunes Haar steckte unter einem Kopftuch. Es schien fast so, als wolle sie nicht erkannt werden. Das Lokal, aus dem sie kam, war das »Café Mazedonia«, eine Griechenkneipe mit zweifelhaftem Ruf. Dann erschien Jan auf der Bildfläche. Er war nicht größer als Mutter, etwas stämmiger. Auf seinem kurzen Hals ruhte ein viereckiger Schädel, mit kurzgeschorenen dunklen Haaren darauf.
Ich kannte ihn gut. Meine Eltern hatten jeden Sommer ein Gartenfest gegeben, zu dem auch Jan und Tula eingeladen waren. Tula, das wusste ich, hasste das »Mazedonia«. Es sei eine üble Spielhölle, in der man den Männern das Geld abluchste. Sogar Türken solle man dort bereits angetroffen haben. Für Tula ein Grund, sich drei Mal hintereinander zu bekreuzigen. Was hatte Mutter dort verloren? Und Jan? Sicher, sie kannte ihn. Aber war das ein Grund, mit ihm diese Spelunke zu besuchen?
Ich vermutete nichts Ehrenwertes und ging hinter einem geparkten Wagen in Deckung. Sie sollten mich nicht sehen. Beide gingen auf Mutters Wagen zu, der nur wenige Meter entfernt am Bordstein parkte. Ich beobachtete, wie sie ihm etwas in die Hand drückte. Es waren die Wagenschlüssel. Denn als sie den Ford erreichten, war er es, der sich hinters Steuer setzte. In diesem Augenblick musste ich an Tula, Jans Frau, denken. Nicht als betrogene Ehefrau, so weit war ich noch nicht. Sie war ein paar Zentimeter größer als er, mit einer wilden schwarzen Löwenmähne und einem beeindruckenden Vorbau. Irgendwie beruhigte mich der Gedanke an sie. Mit dieser Frau hätte ich mich ohne Waffe in der Hand nicht anlegen wollen. Wahrscheinlich hatte Mutter ihn nur im »Mazedonia« aufgesammelt und nun fuhren sie gemeinsam in die Stadt, um ein paar Geschenke zu kaufen. Was wusste ich. Sicher durfte er gleich hinter ihr herlatschen und ihr die Tüten schleppen. Dafür fand sie immer einen Idioten.
Am nächsten Tag, ich war allein in Omas Wohnung, klingelte das Telefon. Es war Jan. Er vermisste sein Feuerzeug. Ein teures Dupont. Tula hatte es ihm geschenkt, nun nervte sie. Ich solle Mutter fragen, ob die vielleicht helfen könne. Man habe gestern einen Kaffee zusammen getrunken. Ich bemerkte gleich, wie er herumdruckste, versprach aber, seine Frage weiterzuleiten. Als Oma mit Mutter nach Hause kam, plapperte ich gleich drauflos. Mit verkniffenem Mund stand sie da und sah mich an, als müsse sie sich ihre Antwort gut überlegen. Um ihrem Gedächtnis auf die Sprünge zu helfen, erwähnte ich die Sache mit dem Wagen. Sofort keifte sie mich an. »Wieso mein Wagen? Was hat der damit zu tun? Spinnst du?« Erschrocken sah ich Oma an, deren Miene sich schlagartig verdüstert hatte. Was auch Mutter auffiel. Sofort giftete sie in deren Richtung. »Was guckst du? Was weiß ich denn, wo mein Sohn diesen Blödsinn herhat!«
Es reichte. »Ich hab nur gesehen, wie ihr beide aus dem ›Mazedonia‹ gekommen und in deinen Wagen eingestiegen seid, mehr nicht.«
Sie stand da, als hätte man sie beim Klauen erwischt. Den Kopf schüttelnd, wedelte sie mit beiden Armen ziellos in der Luft herum. »Ja und? Soll ich mich jetzt aufhängen, oder was?« Oma war eine blitzgescheite Frau, der man nicht mit Dönekes kommen durfte. Da konnte sie fuchsteufelswild werden. Sie stand kurz davor, kniff die Augen zusammen und sah Mutter von unten herauf an. »Jetzt hör mir mal genau zu, Töchterchen. Ich habe es dir oft genug gesagt – und jetzt sage ich es dir zum letzten Mal. Treib es nicht zu bunt!«
Ich hörte aufmerksam zu. Der Ton, den Oma anschlug, war deutlich. Was den Inhalt ihrer Worte anging, blieb einiges unklar. Was genau meinte sie? Dass Mutter etwas mit Jan hatte?! Ich schämte mich für den Gedanken. Mutter war verheiratet, sie hatte Kinder! Es blieben Zweifel. Mir wurde heiß. Falls an der Geschichte, die noch nicht erwiesen war, etwas dran sein sollte, war ich ab sofort Mitwisser! Eine äußerst beunruhigende Vorstellung. An diesem Abend redeten Mutter und ich kein Wort mehr miteinander. Ich beobachtete sie nur. Was immer Oma gemeint haben mochte, es hörte sich auf jeden Fall bedrohlich an. Schon am nächsten Tag fuhren wir nach Ruppichteroth zurück. Mutter redete wieder mit mir, allerdings auf eine recht merkwürdige Art. Einerseits schien es, als wolle sie mir den Sachverhalt erklären, andererseits wurde ich den Eindruck nicht los, dass sie mit allen Mitteln verhindern wollte, dass ich später mit jemandem darüber sprach.
Das folgende Jahr zog sich wie ein alter Kaugummi. Mutter stand bei mir längst unter Generalverdacht und konnte nicht mehr nach Düsseldorf fahren, ohne bei ihrer Rückkehr von mir schief angesehen zu werden. Was ihr spürbar unangenehm war. Sie machte es sich zur Angewohnheit, mir Geschenke mitzubringen. Legosteine meist, oder teure Bausätze von Fischertechnik. Vater gegenüber erklärte sie ihre plötzliche Generosität damit, dass es schließlich mein Wunsch sei, später einmal Architekt zu werden. Was richtig war. Obwohl ich mich dafür verachtete, nahm ich ihre Wohltaten gnädig an.
KEIN EHRENWERTES HAUS
Im November 1966 musste Vater für eine Woche in die Klinik nach Düsseldorf. Er hatte die letzten Monate geasselt wie ein Verrückter und sich dabei ein Furunkel am Hintern herangezüchtet. Mutter bot sich an, ihn hinzubringen, aber er bestand darauf, mit dem eigenen Wagen zu fahren.
Wenige Tage danach, es war schon spät am Nachmittag, lag ich inmitten von Legosteinen auf dem dicken Wollteppich in meinem »Büro«, wie ich mein Zimmer nannte, und tüftelte wieder einmal an einer kühnen Brückenkonstruktion, als vor dem Haus ein Auto vorfuhr. Vaters Wagen war es nicht, dessen Klang kannte ich. Dies musste ein VW sein, dem hellen Sirren des Motors nach. Ich stand auf, ging ans Fenster und schaute durch die Gardine hindurch auf die Straße runter. Mir gefror das Blut in den Adern. Ich hatte mich nicht geirrt, es war ein VW. Aber nicht irgendeiner. Was da vor unserer Garage stand, war Jans altersschwacher Käfer. Regungslos beobachtete ich, wie er ausstieg. Schon erschien Mutter auf der Bühne. Mit wehendem Haar schwebte sie die Treppe zur Garage runter und begrüßte ihn beiläufig. Sie hatte ihn also bereits erwartet. Wie konnte dieser Kerl es wagen, bei uns aufzutauchen? Er fing an, Einkaufstüten aus seiner Rostlaube zu zerren. Eine ganz und gar unwirkliche Szene, die sich für alle Zeit in meine Erinnerung eingebrannt hat. Zusammen gingen sie die Treppe hoch. Sie lachten. Wie ein gefangenes Tier lief ich in meinem Zimmer auf und ab. Ich stand an der halb geöffneten Zimmertür und lauschte nach unten. Die Haustür wurde geöffnet, Einkaufstüten raschelten, dann fiel die Tür wieder zu. Leise, damit Mutter nicht auf mich aufmerksam wurde, schloss ich meine Zimmertür und setzte mich auf die Bettkante. Meine Hände umklammerten den hölzernen Rahmen, bis die Finger schmerzten.
Ein Jahr war vergangen. Ein Jahr voller Zweifel. Die nun ausgeräumt waren. Meine dunkelsten Ahnungen hatten sich erfüllt. Es war nicht länger zu leugnen. Auch ich, sein Sohn, hatte Vater betrogen. Um die Wirklichkeit. Ich schaute auf den Teppich, auf dem verstreut die Legosteine herumlagen. Mein Judaslohn! Ich schämte mich. Wie hatte ich es zulassen können, dass diese Frau mich kaufte? Jan war nicht zufällig nach Ruppichteroth gekommen, so viel stand fest. Seine Spionin vor Ort hatte ihn gerufen, ihn informiert, dass der Burgherr malade sei und nicht anwesend. Sie konnten sich ihrer schändlichen Sache völlig sicher sein.
Ich hielt es nicht länger aus, ging zur Tür und öffnete sie einen Spalt weit. Was machten die zwei da unten? Wieso hörte man nichts? Wieder musste ich an Vater denken. Es wurde Abend und er lag ahnungslos im Krankenhaus. Ausgeschlossen, dass er heute noch nach Hause kam. Außerdem hätte er angerufen. Es durchfuhr mich. Mutter wusste das – und Jan wusste es auch! Ich biss mir auf die Unterlippe. Nein, das war nicht vorstellbar. Er würde einen Kaffee trinken und dann nach Düsseldorf zurückfahren. Ganz sicher. Ich bemerkte gar nicht, dass ich schon wieder im Zimmer umherlief, und schreckte plötzlich auf. Da waren Schritte auf der Treppe. Ich setzte mich wieder auf die Bettkante und starrte auf die Tür. Mir wurde heiß. Die Tür öffnete sich einen Spalt weit und Mutters Kopf erschien. Sie lächelte. Ein Trick? Ihre Stimme wollte mich locken.
»Was ist los mit dir? Willst du nicht mal runterkommen und nachschauen, wer da ist?« Ihre Freundlichkeit konnte mich nicht täuschen. Ich blieb, wo ich war, und verkrallte mich noch fester im Bettrahmen. »Ich hab sein Auto gesehen. Was macht der hier?«
Ich kannte den gekünstelten Ton, den sie nun anschlug. »Na hör mal. ›Der‹! Ihr kennt euch doch schon ewig.« War sie wirklich so doof? Oder war sie nur dreist? Möglicherweise war sie irre geworden. Das machte die Sache auch nicht besser, aber dann hätten wir einen Grund, sie in der Klapse abzugeben, wo sie keinen Schaden mehr anrichten konnte. Der Gedanke stabilisierte mich. Fortan würde ich sie wie eine behandeln, die nicht mehr alle Tassen im Schrank hat. Und diesen Jan ebenfalls. Wer mit meiner Mutter umherzog, konnte nicht ganz dicht sein. Langsam kam ich in Fahrt.
Jan! Vor nicht allzu langer Zeit hatte er zu Hause in Kavala noch in einer primitiven Lehmhütte gehaust. Als er mit ein paar Kumpels nach Deutschland kam, wohnten sie im Männerwohnheim, wo sie ihren Salat in der Toilettenschüssel wuschen. Sie glaubten tatsächlich, dafür wäre sie da. Diese Geschichten hatte er uns erzählt! Und vor diesem Neandertaler sollte ich mich fürchten? Ein Gefühl überrannte mich, von dem ich bis vor wenigen Minuten noch gar nicht gewusst hatte, dass es existierte. Zum ersten Mal in meinem Leben verspürte ich den Wunsch, einen Menschen zu vernichten. Wo war dieser Penner? Ich wollte ihn auffressen! Roh! An Mutter vorbei schoss ich die Treppe hinunter und gleich weiter in die Küche hinein. Da stand er. Seine schmierigen Griffel in die Rückenlehne von Vaters Stuhl gekrallt, grinste er mich blöde an.
Ich gab ihm keine Chance, auch nur einen Ton von sich zu geben, und zischte ihn gleich an wie eine Klapperschlange. »Wenn du den Stuhl von meinem Vater loslässt, pass auf, dass du nicht umfällst.« Zu meinem Ärger beeindruckte Jan meine Entschlossenheit kaum. Wahrscheinlich konnte er sich gut verstellen. Er war ja selbst mal Soldat gewesen, in Griechenland. Und die hatten immerhin die Türken aus dem Land gehauen. Außerdem war er fast doppelt so schwer wie ich, was sicher auch ein Nachteil für mich war. Er grinste mich weiter an, nahm aber schon mal die Finger von der Lehne, was ich als ersten kleinen Sieg verbuchte. Mittlerweile war auch Mutter erschienen und parkte mit verschränkten Armen und fragendem Gesichtsausdruck im Türrahmen. Da meldete Jan sich zu Wort. »Na, Junge, wie isses? Gehts dir gut?« Ohne ihn anzusehen, zeigte ich auf die Einkaufstüten, die er angeschleppt hatte. »Was machst du eigentlich hier? Bei uns hat niemand Geburtstag.«
Mutter schaute mich vorwurfsvoll an und seufzte. Was hatte sie erwartet? Dass ich dem Kerl um den Hals falle? Ich war warmgelaufen und wollte ihn noch ein wenig piesacken, bevor er sich wieder Richtung Düsseldorf verabschiedete. »Na gut, die Sachen sind jetzt da. Wenn du nach Hause kommst, grüße Tula schön von uns. Weiß sie, dass du hier bist?« Erstmals zeigte er Wirkung – und machte prompt einen Fehler. Einen Scherz, oder was er dafür hielt, der voll auf Kosten seiner Frau ging. »Tula ist in Griechenland, Tomaten pflücken.« Niemand lachte, auch Mutter nicht. Jetzt erlebte sie mal, was für ein Arsch das war. Ich tat überrascht. »Tomaten? Im November. Wie interessant. Na ja, in Griechenland vielleicht. Ich frag sie mal, wie es war, wenn wir das nächste Mal bei Oma sind.«
Sein Grinsen existierte nicht mehr. Hilflos schaute er zu Mutter rüber, die nur die Schultern hochzog und sich eine Zigarette anzündete. Eigentlich war es nun höchste Zeit für sie, ihn ganz schnell vor die Tür zu setzen und darauf zu hoffen, dass mir der Vorfall nicht wichtig genug war, um mich morgen noch daran zu erinnern. Ich grinste ihn an. »Ach ja, noch was: Pass gut auf dein Auto auf. Sobald es dunkel wird, klauen die hier wie die Raben. Besonders gern Schrottkäfer. Die fahren sie dann platt, einfach gegen den nächsten Baum. Nur so, aus Spaß.« Ohne ein weiteres Wort drehte ich mich um und ließ ihn einfach stehen. Noch nie zuvor hatte ich so mit einem erwachsenen Mann gesprochen. Als ich an Mutter vorbeikam, hätte ihr Blick mich warnen müssen. Der war böse. Nicht genervt, wie ich ihn sonst kannte. Böse! Euphorisch erreichte ich mein Zimmer und feierte meinen Sieg. Nun konnte es sich nur noch um Minuten handeln, bis er endlich die Kurve kratzte. Plötzlich Geräusche. Geschirrgeklapper? Was ging da vor? Ein leiser Duft zog zu mir hoch. Sie kochte. Kein Zweifel, Mutter kochte für ihn! Ich fasste es nicht. Diese Frau war total von Sinnen! Eben erst hatte ich sie vor dem Schlimmsten bewahrt und nun kochte sie. Für ihn! Verwirrt, ratlos hockte mich wieder auf die Bettkante und starrte vor mich hin. In diesem Haus war noch nie für Fremde gekocht worden. Wenn Mutter kochte, dann kochte sie für uns, für ihre Familie. Der Essensduft hatte sich so weit verdichtet, dass er einer bestimmten Speise zuzuordnen war. Rouladen! Ausgerechnet Rouladen. Vaters Lieblingsessen.
Ich sprang auf und lief wie ein gestresster Tiger im Zimmer auf und ab. Mir kam eine Idee. Das hatten sie sich so gedacht. Vaters Rouladen fressen. Euch würde ich die Tour vermasseln. Raus aus dem Zimmer. Am Treppenabsatz blieb ich noch einmal kurz stehen, um die Lage zu peilen. Geschmeidig wie ein Kater glitt ich lautlos die Treppe hinunter in die Diele. Hinter einer Klappe in der Wand befanden sich die Sicherungen. Blitzschnell drehte ich die für den Herd heraus und steckte sie ein. Klappe zu – Affe tot. Noch bevor irgendein Alarm losging, war ich bereits wieder auf meinem Zimmer, öffnete das Fenster und warf die Sicherung raus auf die Straße, in die bereits heraufziehende Nacht hinein. Weit genug weg hörte ich den Aufschlag. Als technisch begabter Junge wusste ich natürlich, dass es sich um eine Hochamperesicherung gehandelt hatte. Und schon ging unten in der Diele das Theater los.
Zunächst hörte ich Mutter, verhalten noch, dann aufgeregt. Schritte kamen die Treppe hoch. Es waren ihre, die kannte ich. Aufs Bett werfen, unschuldig gucken. Schon stand sie in der Tür und wischte sich an ihrer Schürze die Hände ab. Die Stimme, die aus ihrem schmalen Mund kam, klang gereizt. »Jetzt pass mal auf. Das finde ich überhaupt nicht lustig. Was soll der Blödsinn? Wo ist die Sicherung?«
Ich schaute ihr fragend ins Gesicht, schürzte die Lippen und spielte den Ahnungslosen. Wie sie dastand. Wie ein Schnellkochtopf mit Schürze, kurz bevor der Deckel fliegen ging. »Welche Sicherung? Ich habe keine Sicherung. Fehlt denn eine?« Die Frage servierte ich der Köchin in einem Tonfall, in dem man ausschließlich mit Irren redete. Womit ich ja nicht falsch lag.
Auch Jan lebte noch. Sein Organ schallte zu uns hoch. »Liane?« Auf dem Bett liegend, den linken Arm unter dem Kopf, zeigte ich mit spitzem Zeigefinger auf die offene Zimmertür, in der sie stand und bebend vor Zorn von einem Fuß auf den anderen wippte. In meiner Stimme lag der blanke Hohn. »Ich weiß nicht, ruft dich da nicht jemand?« Da war es so weit! Sie machte zwei hastige Schritte in mein Zimmer hinein, auf mein Bett zu, aus dem ich blitzschnell herausfederte. Du nicht, war mein einziger Gedanke, als sie zitternd und mit wutverzerrtem Gesicht vor mir zum Stehen kam. Uns trennte kein Meter. Mit braunen Augen funkelte sie mich zornig an. Ich wartete nur darauf, dass sie mich angriff. Dann konnte ich es ihr endlich heimzahlen. Hier und jetzt. Mein Gott, wie hässlich sie war. Etwas an mir muss sie gewarnt haben, diese Grenze auch noch zu überschreiten. Wortlos machte sie kehrt und rauschte die Treppe hinunter. Wie der Rest des Abends für sie weiter verlief, weiß ich nicht. Vielleicht hat Mutter Jan Schnittchen gemacht. Gegen zweiundzwanzig Uhr kam endlich Hubert nach Hause. Wie meist, verzog er sich gleich auf sein Zimmer. Er musste Jans Wagen vor der Garage gesehen haben. Anscheinend war ihm alles egal. Es ging ja nicht um seinen Vater.
Am nächsten Morgen stand ich absichtlich früh auf. Ich wollte Mutter und Jan aus dem Weg gehen. Sie hatten wohl die gleiche Idee gehabt. Denn als ich runter in die Küche kam, saßen sie bereits am Tisch vor ihren Kaffeebechern. Er hatte tatsächlich in unserem Haus übernachtet. In welchem Bett, wollte ich schon gar nicht mehr wissen. Hubert, der bei einem Lebensmittelgroßhändler im Nachbarort arbeitete, war schon aus dem Haus. Anscheinend hatte Jan etwas gelernt. Er saß an der Längsseite vom Tisch, Mutter gegenüber. Ich nahm auf Vaters Stuhl Platz. Jan war handwerklich geschickt und hatte eine herkömmliche Sicherung so mit Alufolie umwickelt, dass sie den Herd notdürftig wieder in Gang brachte. Das musste er am Morgen fabriziert haben. Das vergeigte Rouladenmenü vom Vorabend stand jedenfalls noch unangetastet auf der Herdplatte. Sprechen wollte niemand mehr darüber.
Es gab Rührei. Für alle. Sogar für mich. Auch ich tat so, als sei alles in bester Ordnung, und beobachtete die beiden aus dem Augenwinkel. Wie sie da hockten, die Unschuldslämmer. Mutter wirkte blass. Um ihren Blutdruck in Schwung zu bringen, stützte ich mich wie ein Assi mit beiden Ellenbogen auf der Tischplatte ab, las in meinem Technikmagazin und schaufelte dabei die Eierpampe provokativ lustlos in mich hinein. Sie sagte nichts, nur an ihren zusammengekniffenen Augen sah ich, wie sie innerlich kochte. Erst jetzt fiel mir auf, dass Mutter bereits in vollem Ornat war. Wir hatten tags zuvor verabredet, nach Siegburg zu fahren, sobald ich aus der Schule kam. Sie wollte zu Quelle und ich brauchte eine neue Fahrradkette. Was sollte der Aufzug morgens um sieben? Spielte sie »Lady of the House«? Eine Show für ihren Jan? Wenns ihn glücklich machte.
Nun fing sie auch noch zu reden an. Der krampfhafte Versuch, ein Gespräch in Gang zu bringen. Nicht mit mir, mit ihm natürlich. Oh Gott, diese nervende Stimme. Wie ein Ruderer erhöhte ich die Schlagzahl meiner Gabel. Als der Teller endlich leer war, zog ich mich sofort auf mein Zimmer zurück, wo es noch ein paar Sachen für die Schule zu sortieren gab. Ich war gerade damit fertig geworden, da rief sie nach mir. »Thomas … kommst du mal bitte?« Sie hatte tatsächlich »bitte« gesagt. »Pass mal auf, ich habe dir etwas Geld auf den Tisch gelegt. Wenn du nachher unbedingt nach Siegburg willst, dann nimm doch bitte den Bus, ja? Ich weiß noch nicht genau, wann wir zurück sind heute Abend.« Wovon redete sie? Welchen Bus sollte ich nehmen? Weil sie nicht wusste, »wann wir zurück sind«? Was war das denn? Um mir die Tour nach Siegburg nicht zu vermasseln, bemühte auch ich mich um einen zivilen Ton. »Wie? Ich hab das jetzt nicht verstanden. Wieso den Bus? Ist was mit deinem Auto?« Sie atmete tief durch:. »Nicht wir fahren … also nicht wir beide. Ich muss mit Jan nach Düsseldorf … und weil ich nicht weiß wann …« Weiter kam sie nicht. Ich schrie sie an. »Du blöde Kuh! Bist du jetzt ganz durchgeknallt? So eine Scheiße!« Sie hatte mich endgültig an den Punkt gebracht, an dem ich nicht mehr weiterwusste. Wie auch? Ich war dreizehn. Es fiel kein weiteres Wort, wir sahen uns nur an. Ich versuchte, etwas in ihren Augen zu erkennen, doch da war nichts. Ich konnte sie nicht mehr erreichen. Wir nahmen Abschied voneinander. Endgültig. Sie erklärte meine Kindheit, auf der sie die letzten vier Jahre sowieso nur noch herumgetrampelt hatte, für beendet. Ohne den Blick von mir zu wenden, fuhr sie mit beiden Händen durch ihr Haar, als müsste sie etwas Lästiges daraus entfernen. Dabei warf sie den Kopf in den Nacken, nicht beiläufig – herausfordernd. Ich hatte verstanden. Sie würde mich in Zukunft mit anderen Augen betrachten.
Ich drehte mich um und ging auf mein Zimmer zurück, hin zum Fenster. Es hatte zu regnen angefangen, der Straßenbelag glänzte bereits mattschwarz. Unten fuhr ein Auto am Haus vorbei. Alles schien wie immer, was natürlich Unsinn war. Nichts war wie immer. Ich musste an Vater denken. Der sich wie ein Junkie Tag für Tag mit Arbeit betäubt hatte, um nicht mitkriegen zu müssen, wie alles um ihn herum auseinanderfiel. Vorrangig seine Ehe mit dieser Frau, meiner Mutter, die ständig auf der Suche war nach etwas, von dem sie annahm, dass das Leben es ihr schulden würde. Ohne Gegenleistung. Wie weit sie sich doch voneinander entfernt hatten. Irgendwo, auf dem weiten Feld dazwischen, standen ich und Hubert, von dem ich weniger wusste als von jedem beliebigen Klassenkameraden. Eigentlich gab es ihn gar nicht. Ich war dreizehn Jahre alt und schon dabei, aus der Kurve zu fliegen.
Unten klang es nach Aufbruch. Regungslos stand ich neben der halb offenen Zimmertür und lauschte. Ohne sich von mir zu verabschieden, verließen sie das Haus. Ich ging zurück ans Fenster und sah Mutter in Jans Käfer einsteigen. Bis gestern hatte sie immer noch einmal zu mir hochgeschaut, bevor sie losfuhr. Heute nicht. Auch Jan stieg ein, startete gleich den Motor und fuhr los. Durch die Gardine sah ich den Wagen verschwinden. Es war völlig still im Haus. Ohne Ziel begann ich, durch die Zimmer der ersten Etage zu wandern, alles noch einmal betrachtend. Einige kleinere Möbelstücke stammten noch aus unserer »richtigen« Wohnung, wie ich sie nannte. In Düsseldorf, in unserem Haus, in dem ich geboren und aufgewachsen war. Auf einige der Bilder an den Wänden hatte ich schon als Baby geschaut. Langsam wurde die Stille um mich herum greifbar, bis ich sie am Ende als leises Rauschen hören konnte. Ich ging die Treppe hinunter. Da war Vaters Stuhl. Der einzige am Tisch mit Armlehnen. Fast ein Thron. War der König bereits gestürzt und sein Krieg verloren? Hatte er überhaupt gekämpft? Auf dem Tisch lag Mutters Geld, dem man ansah, dass sie es aus allen Ecken und Winkeln zusammengekratzt hatte. Ein schmutziger Haufen Münzen, ohne Struktur, ungezählt, und gerade noch dazu taugend, es mir achtlos vor die Füße zu werfen wie einem struppigen Köter einen Knochen. Es verletzte mich so sehr, dass ich beschloss, dass dies ihre letzte Unverschämtheit gewesen sein sollte.
Der Weg zur Schule führte an einer Telefonzelle vorbei, zu der ich nun hin wollte. Minuten später schon stand ich davor. Ein letztes Mal überlegte ich. Was ich vorhatte, beinhaltete keine Möglichkeit, es noch einmal rückgängig zu machen. In der Hosentasche spielten meine Finger mit den Münzen, die mir Mutter gegeben hatte. Wäre es ein Schein gewesen, wer weiß. Vielleicht hätte die Geschichte einen anderen Verlauf genommen. Ich zog die Tür der Telefonzelle auf, trat ein und holte einen Stift aus meiner Schultasche. Es war ein Ferngespräch, es konnte teuer werden. Also warf ich ausreichend Münzen in den dafür vorgesehenen Schacht und wählte 118, die Nummer der Auskunft. Dort erhielt ich die Telefonnummer, die ich brauchte, und wählte gleich neu. Es meldete sich eine Frauenstimme. »Medizinische Einrichtungen der Universität Düsseldorf. Wie kann ich Ihnen helfen?« Mit einem Kloß im Hals antwortete ich. »Guten Morgen. Ich hätte gern meinen Vater gesprochen. Er heißt Heinrich Wolf und ist seit einer Woche bei Ihnen.« Durch die Leitung kam ein langgezogenes »Hmmmm«. »Na, da haben wir es doch. Soll ich dich gleich auf sein Zimmer durchstellen?« »Ja, machen Sie das bitte. Und vielen Dank.« Es klackte ein paar Mal in der Leitung. Ich wagte kaum noch zu atmen. Dann hörte ich seine Stimme. Ich zuckte zusammen. »Papa? Ich bins. Wie geht es dir?«
Es dauerte ein paar Sekunden, bis er antwortete. Er schien überrascht und ein wenig ungehalten. »Sag mal, musst du nicht in der Schule sein? Wo bist du?« »Hier bei uns. In der Telefonzelle.« Meine Hand zitterte ein wenig und ich fragte mich, ob es nicht vielleicht doch besser gewesen wäre, von zu Hause anzurufen. »Die Telefonzelle hier bei uns, in Ruppichteroth.«
Er wurde immer ungeduldiger. »Ja, und was machst du da? Wo ist deine Mutter?« Er machte es mir leicht. »Die ist in Düsseldorf. Mit Jan. Der hat letzte Nacht bei uns geschlafen.« Am anderen Ende der Leitung – Stille. Auf meiner Stirn bildeten sich Schweißperlen. Vater sprach nun leise und schien überhaupt nicht aufgeregt. »Hör mir jetzt ganz genau zu. Du gehst nicht in die Schule. Du wartest vor dem Haus auf mich. Vor dem Haus, hast du das verstanden?« »Ja.« Mehr bekam ich nicht heraus. Er fragte weiter. »Wo sind die, sagst du?« »Die sind weg … nach Düsseldorf. Mit Jans Auto.« Seine Stimme klang tonlos, als er weitersprach. Er machte mir Angst. »Tu, was ich dir gesagt habe. Ich bin in einer Stunde da.« Dann hängte er auf.
Da stand ich nun. Schweißgebadet und mit dröhnendem Kopf. In einer engen, stickigen Telefonzelle. Mir wurde die Luft knapp. Vor der Tür schlug mir ein Schwall kalte, mit Regen durchsetzte Luft ins Gesicht. Ich begann, die Straße hinunterzulaufen, wobei mir die Schultasche dauernd gegen die Beine schlug. In völlig unnötiger Eile rannte ich zum Haus zurück, durch den Regen, der stärker geworden war und auf meiner Haut zu verdampfen schien. Was hatte ich bloß getan? Er würde Mutter umbringen. Ach was. Er würde sie beide umbringen! Und ich, sein einziger Sohn, hatte fortan mit der Schuld zu leben, dass mein Vater zum Mörder geworden war. Dies waren meine Gedanken. Dass Mutter tot sein würde, wühlte mich weit weniger auf. Was mit Jan geschah, interessierte mich sowieso nicht.
Außer Atem und japsend wie ein kleiner, nasser Hund, erreichte ich das Haus, das sich wie eine Prophezeiung drohend vor mir in den dunkelgrauen Himmel reckte. Nichts auf der Welt hätte mich dazu bewegen können, es jetzt zu betreten. Es war entweiht und es hatte uns kein Glück gebracht. Weit genug entfernt, im Garten, stand eine Bank gleich neben dem Kirschbaum. Auf ihrem weißen Lack schimmerte das Regenwasser. Es war mir gleichgültig. Ich setzte mich hinein und spürte sofort, wie sich die kalte Nässe auf meiner Hose breitmachte.
Oft sind es merkwürdige Dinge, banale, unwichtige, an die man sich sein Leben lang erinnert. Oder man erinnert sich an gar nichts. Wie in diesem Fall. Alles, was mir in Erinnerung geblieben ist, hat mit dem strömenden Regen zu tun, in dem ich mir während der nächsten Stunde beinahe den Tod geholt hätte. Ich sprang erst wieder hoch, als endlich Vaters Wagen auftauchte, wagte es aber nicht, mich von der Stelle zu rühren. Ein paar Meter vom Haus entfernt hielt er seinen Kombi an und stieg sofort aus, ohne den Eindruck von Eile zu verbreiten. Er musste mich gesehen haben, aber er beachtete mich nicht. Als er aufs Haus zuging, erkannte ich, dass er etwas in der Hand trug. Es war eine Axt! Er musste sie auf dem Weg beschafft haben. Die Panik, die in mir hochstieg, schnürte mir den Hals zu. Was um alles in der Welt hatte er vor? Schon war er an der Haustür, öffnete sie und trat in die Diele. Es durchflutete mich eiskalt, als die Tür laut hinter ihm ins Schloss fiel. Der Knall, der kurz darauf folgte, ließ mich zusammenzucken. Es begann ein Klirren und Scheppern, das sich bald zu einem Inferno steigerte. Es krachte und rumste in einer Tour. Als säße ich unter einer Glocke, dröhnten die Schläge in meinen Ohren. Obwohl ich ihn nicht sah, stand sein Bild deutlich vor mir. Das eines Mannes, der, auf das Allerschändlichste betrogen, wie von Sinnen alles in Stücke schlug, was er einst in bester Absicht aufgebaut hatte. Ich saß auf der äußersten Kante der Bank, massierte mit beiden Händen meine eiskalten Knie und wünschte mich in einen wirklichkeitsfreien Raum, der mir alles, was ich gerade erlebte, nur vorspielte. Tränen liefen mir über das Gesicht und wurden vom Regen gleich wieder weggewaschen.
Derweil nahm nun auch Vater Abschied von mir. Auf seine Weise. Sein Wüten nahm plötzlich ein Ende. Die Stille, die folgte, hatte etwas Unwirkliches, als gehöre sie nicht zu diesem Ort. Somehow eerie. Kein einziges Geräusch kam mehr aus dem Haus. Völlig verkrampft und halb erfroren saß ich auf der Bank, darauf wartend, dass noch etwas passierte. Irgendetwas. Wo war Vater? Lebte er noch? Hatte er sich in seiner Verzweiflung etwa umgebracht? Mit einem leisen Kratzen öffnete sich von innen das Garagentor. Mutters Wagen sprang an und stand wenig später mitten auf der Straße. Vater stieg aus. Da ihn der Wagen verdeckte, war nicht zu sehen, was er dort trieb. Immer wieder beugte er sich in den Innenraum hinein, bis er plötzlich ein paar Schritte zurücktrat. Ein leises, dumpfes Geräusch war zu hören. Ich sah Flammen, die sich schnell im Wagen ausbreiteten und sich bald schon durch das Stoffdach des Cabrios fraßen. Er hatte mit Farbverdünner nachgeholfen. Eine dunkle Rauchsäule stieg in den kaum weniger dunklen Himmel. Es stank erbärmlich nach verbranntem Kunststoff. Vater rief mich zu sich.
»Thomas! Los, hierher.« Ich hatte die ganze Zeit nur auf das brennende Auto gestarrt und daran gedacht, dass Mutter und ich heute damit nach Siegburg fahren wollten. Seine Stimme erschreckte mich. Mit hängenden Schultern und eingezogenem Kopf schlich ich auf ihn zu. Am Arm baumelte meine Schultasche. Mir war kalt. Jetzt erst, beim Gehen, spürte ich, dass nicht eine trockene Faser mehr an mir war. Ich erreichte Mutters Wagen. Die Hitze schlug mir ins Gesicht. An einigen Stellen auf der Motorhaube warf der Lack bereits Blasen. Jetzt sah ich, dass Anwohner unserer ansonsten so friedlichen Straße bereits in sicherer Entfernung beieinanderstanden und tuschelten. Es waren mehrheitlich Frauen, zwei davon kannte ich gut. Mütter von Schulkameraden. Bei ihnen hatte ich Kuchen gegessen und Kakao getrunken, zusammen mit ihren Söhnen, die jetzt im Klassenzimmer saßen, während wir dieses Schauspiel aufführten. Heißer als das Feuer brannten ihre Blicke auf meinem Gesicht. Vater zeigte auf seinen Kombi. »Ins Auto!« Es war entsetzlich. Krampfhaft zu Boden schauend, starb ich fast vor Scham. Was nur boten wir diesen Leuten? Was mochten sie über uns reden, jetzt, in diesem Augenblick! Vater saß bereits im Wagen, als ich einstieg. Er fuhr sofort los. Vorbei an den Leuten, denen ich nicht ins Gesicht schauen konnte. Nie zuvor in meinem Leben hatte ich mich so gedemütigt gefühlt. Verstört und halb erfroren, so verließ ich Ruppichteroth. Es sollte Jahre dauern, bis ich es wiedersehen würde.
DÜSSELDORF RELOADED
Schweigend fuhren wir das Bröltal runter Richtung Siegburg. Vater fuhr nicht besonders schnell, was mir ein wenig die Angst nahm. Trotzdem. Langsam dämmerte mir, dass auch er irgendwie nicht normal war! Ich stammte von zwei Irren ab! Da mir nichts anderes einfiel, dachte ich an das Haus und wie es wohl darin aussah. Mein Zimmer! Ob er es verschont hatte? Ich hätte ihn fragen können, ließ es aber sein, als ich sein Gesicht betrachtete. Eine Maske, starr, ohne jede Regung darin. Es ging nach Düsseldorf. »Zu Hause« angekommen, setzte Vater mich vor Omas Haus ab. Er stieg nicht aus und wies mich an, vorläufig dort zu bleiben. Er wolle sich melden. Die Schultasche in der Hand, schaute ich seinem Wagen hinterher. Meine Rückkehr nach Düsseldorf hatte ich mir anders vorgestellt. Omas Haus lag unserem Anwesen direkt gegenüber. Ich klingelte an der Tür. Sie war gar nicht zu Hause. Die Heizung im Wagen hatte mich leidlich getrocknet und aufgewärmt. Und hier regnete es nicht. Wenigstens etwas. Durch das Gartentor betrat ich unser Grundstück. Ich stellte die Schultasche ab und begab mich auf einen Inspektionsgang, auf eine Gedankenreise durch die Vergangenheit. Es war die schmuddelige Jahreszeit und alles wirkte ein wenig vernachlässigt. Höchste Zeit, dass wir uns wieder selbst darum kümmerten. Und nicht dieser Hausverwalter, den Vater vor unserem Umzug in den Schwarzwald beauftragt hatte.
Hier, wo mir jeder Baum, jeder Stein eine Geschichte erzählte, fühlte ich mich wieder sicher und vergaß für einen Augenblick, dass sich meine Familie, mein ganzes bisheriges Leben, aufzulösen begann. Als läge es in meiner Macht, die Zeit zurückzudrehen, fantasierte ich mich Stück für Stück weiter in die Vergangenheit hinein, die mit diesem Ort untrennbar verbunden war. Jedes Mal im Frühling wurde dieser Garten aufs Neue zu einem kleinen Paradies. Keine Pflanze, keine Blume, die hier nicht wuchsen und gediehen. An allem herrschte Überfluss. Sogar einen Rasenplatz gab es, den Vater extra für mich angelegt hatte, zum Fußballspielen. Konnte nicht noch einmal alles so werden wie damals? Ich erreichte die Nordseite des Grundstücks. Hier, auf der anderen Seite des Zauns, lebte einst Familie Armarci. Sie stammten aus Udine, einer wunderschönen Provinzstadt nördlich von Triest, schon in den Alpen gelegen. Es gab einen Sohn, Silvio hieß er, ein Jahr älter als ich. Wir hatten uns gleich angefreundet. Was war bloß aus uns geworden! Unsere Wohnung lag in Trümmern, Vater machte mit seiner Axt Jagd auf meine Mutter, die mit ihrem Liebhaber auf der Flucht war, und Hubert, der von alledem noch nichts wusste, stapelte arglos Kisten auf seiner Arbeitsstelle. Wer dachte eigentlich an ihn? Und was mich betraf, ich sollte in der Schule sitzen und mich darauf freuen, nachher mit Mutter nach Siegburg zu fahren. Anscheinend war die Welt um mich herum verrückt geworden. Immerhin hatte ich meine Schultasche gerettet.
Oben an der Straße hörte ich einen Wagen vorfahren und schaute nach. Es war Oma, in einem Taxi. Ich öffnete die Tür und half ihr aus dem Wagen. Als sie mich sah, wurde sie hektisch und vergaß beinahe das Wechselgeld. Sie war noch nicht ganz ausgestiegen, da löcherte sie mich bereits. »Thomas! Was machst du hier? Wo ist dein Vater?«
Während sie mit fahrigen Händen ihr Kostüm glattstrich, antwortete ich. »Papa hat mich hergefahren, ist dann aber gleich wieder los. Er will nachher vorbeikommen. So lange soll ich bei dir bleiben.« Während wir auf die Treppe zur Haustür zugingen, hielt sie sich mit der linken Hand an meinem Arm fest. In der Rechten hielt sie den Hausschlüssel. Sie schien aufgeregt. »Ja und? Weiter? Was sollst du hier? Hast du keine Schule?« Als müsste sie mich vor einem Bombenangriff schützen, zog sie mich ins Haus. »Jetzt komm erst mal rein. Runter von der Straße.« Ihre Wohnung lag im ersten Stock. Als wir dort ankamen, hielt sie mich mit beiden Händen an der Schulter fest und schaute mir in die Augen. Das Tageslicht spiegelte sich in ihren Brillengläsern. »Ich frage dich jetzt noch einmal. Wo ist dein Vater? Wenn du es weißt, sag es mir. Es ist sehr wichtig!« Ich schaute zu ihr herab. Sie war einen Kopf kleiner als ich. »Ich weiß es doch nicht. Er ist gleich wieder losgefahren.«
Später erfuhr ich, dass Vater sie noch aus der Klinik angerufen und nach Mutter gefragt hatte. Und dabei hatte er erwähnt, dass Jan in unserem Haus geschlafen hatte. Da wusste Oma, dass sich ihre Tochter in höchster Gefahr befand. Sie ahnte, wo die beiden sich aufhielten, und war mit dem Taxi hingefahren, um sie zu warnen. Vater erzählte sie nichts davon. Tatsache war, gleich nachdem Oma Alarm gegeben hatte, war Jan mit Mutter zur Wohnung eines befreundeten Griechen gefahren. Dort hockte sie nun fest und konnte in Ruhe darüber nachdenken, wie sie aus dieser Nummer wieder herauskam. Da wusste sie noch nichts von dem, was Vater in Ruppichteroth angerichtet hatte. Für sie war zunächst wichtig, dass sie sich in Sicherheit befand. Als Vater realisierte, dass Mutter nicht auffindbar war, begab er sich zu Jans Wohnung und setzte Tula ins Bild. Die war seit der Geschichte mit dem verlorenen Feuerzeug – das sich tatsächlich in Mutters Wagen befunden hatte – ausreichend misstrauisch geworden, um Vaters Schilderungen keine Sekunde in Zweifel zu ziehen. Umgehend machte sie Jans Entmannung zu ihrer Herzensangelegenheit. Es beruht sicher nicht auf Zufall, dass schon in der Mythologie Athenes Töchter niemals im Ruf standen, demütige Opfer zu sein. Tula reichte umgehend die Scheidung ein und ging mit ihrer Tochter zurück nach Kavala.
Da hockte ich nun in Omas barocker Wohnung und langweilte mich. Wenn ich schon wieder in Düsseldorf war, wollte ich auch raus, in die Stadt. Oder einfach nur nachschauen, ob vielleicht einer meiner alten Freunde aufzufinden war. Außerdem brannte noch Geld in meiner Tasche. Doch meine Proteste blieben erfolglos. Oma ließ nicht mit sich reden. Solange sie nicht mit Vater gesprochen hatte, blieb ich in der Wohnung. Da war jede Diskussion überflüssig. Wem es vergönnt war, diese Frau kennenzulernen, der versteht sofort, was ich meine. Ihre Autorität war angeboren, nicht anerzogen oder angelernt, schon gar nicht aufgesetzt. Dazu war sie viel zu klug.
Drei ihrer Geschwister lebten ebenfalls in unserer Straße. Tante Lene, die Toughe, Tante Anna, die Heilige, und, zum Leidwesen der drei Schwestern, Onkel Willi, das stets unrasierte, schwarze Schmuddelschaf im Stall. Obendrein das jüngste. Dem sie nahezu täglich begegneten, was wegen der räumlichen Nähe nur schwer zu vermeiden war. Bei jedem fröhlichen Umtrunk im näheren Umkreis traf man ihn an. Aber auch nüchtern neigte er dazu, mit seinem Vokabular – das selbst Gutmeinende als gewöhnungsbedürftig beschrieben – jedes weibliche Wesen aus der Fassung zu bringen. In ihm erkannte Tanta Anna, eine zutiefst gläubige Frau, ihre tägliche Prüfung. Die ihr der Herrgott persönlich auferlegt hatte und die sie deshalb in Demut auf sich nahm. Weshalb ihr, davon war sie nicht abzubringen, ein fester Platz im Himmel zustand. Ihr Bruder Willi war das Fegefeuer, das es auf dem Weg dorthin zu durchschreiten galt. Da war Tante Lene schon robuster. Unter ihr, so hieß es, hatte Onkel Willi von Kindesbeinen an zu leiden gehabt. Alles, was die beiden verband, waren eine lebenslange gegenseitige Ablehnung sowie eine gewisse Fettleibigkeit. Die bei ihm eindeutig vom Saufen herrührte, bei ihr vom Essen. Ihre dreistöckigen Buttercremetorten waren Legende. Auf gar keinen Fall darf ich Tante Grete unterschlagen. Margarete – worauf sie nach dem dritten oder vierten Piccolöchen zuverlässig bestand. Sie hatte in zweiter Ehe nach Frankfurt geheiratet. Einen Koch und Metzgermeister. Gleich nach dem Krieg sicher nicht die schlechteste Wahl. Tante Grete war eine Diva, Onkel Otto ein Arbeitstier. Gemeinsam betrieben sie in Höchst eine Gaststätte. Wir besuchten sie regelmäßig zu Ostern, wo ich dann auf dem Schlossplatz oder unten am Mainufer spielte. Noch einen kurzen Nachtrag, Omas Verhältnis zu ihrem Bruder Willi betreffend. Den sie zeitlebens nie für voll und, wenn es herstellbar war, nicht zur Kenntnis genommen hatte. Er hatte seinen Sohn, immerhin Omas Neffe, »Jimmy« getauft. Den Namen fand er toll. Innerhalb unserer Familie ein ausgesprochen singuläres Phänomen. Weshalb hatte er nie ganz begriffen. Aber danach war seine Schwester Eva mal wieder längere Zeit nicht für ihn zu sprechen gewesen. So ging es zu bei uns. Damals.
Das Telefon klingelte. Es war Hubert. Die Polizei hatte ihn ausfindig gemacht und über die Geschehnisse informiert. Ich beobachtete Oma, die sich krampfhaft am Hörer festzuhalten schien, während Hubert ihr die Einzelheiten mitteilte. Man konnte förmlich sehen, wie die Farbe immer mehr aus ihrem nicht mehr jungen Gesicht wich. Dauernd schaute sie zu mir rüber, fragend, sorgenvoll. Als sie den Hörer zurücklegte, stand sie noch eine ganze Weile regungslos da. Als müsse sie nachdenken, wie sie nun mit mir umgehen solle. Sie wusste ja nicht, was ich mitbekommen oder ob ich überhaupt etwas mitbekommen hatte.
Damit sie sich nicht quälen musste, winkte ich zu ihr rüber. »Ist schon in Ordnung. Ich war dabei, als es passiert ist.« Erschrocken legte sie die Hand vor den Mund und eilte auf mich zu. »Um Gottes willen, was hat der Mann da nur getan? Stimmt das alles, was Hubert mir da erzählt hat?« Nun wusste ich nicht, was er ihr erzählt hatte, und fasste das Wesentliche in einem Satz zusammen. »Wird wohl. Erst hat er mit der Axt die Wohnung zerlegt und danach Mutters Cabrio abgefackelt.« Oma konnte nicht mehr und musste sich auf die Couch setzen. Sie war am Boden zerstört. Was mich ein wenig überraschte. Ihre eigene Wohnung war schließlich heil geblieben! Was sollte ich denn erst sagen? Plötzlich stand sie auf und ging zurück zum Telefon. Im »Café Mazedonia« erkundigte sie sich nach Jan. Da niemand wusste, wo er war, hinterließ sie eine Nachricht für ihn. Er solle sofort anrufen. Es sei dringend! Hubert hatte sich in Ruppichteroth erst einmal ein Bild von dem verschafft, was nach Vaters Auftritt von der Wohnung noch übrig geblieben war. Erst gegen Abend kam er mit einer Reisetasche voller Klamotten bei Oma an. Auch für mich hatte er ein paar frische Sachen zum Wechseln mitgebracht. Was er uns erzählte, klang grauenhaft. Die Wohnung war ein einziges Trümmerfeld. Nur die Kinderzimmer waren verschont geblieben. Mutters Garderobe war nur noch ein Haufen Stoffmüll. Sie war ihr halber Stolz gewesen, die andere Hälfte hatte ihr Cabrio beansprucht. Danach war er aufgebraucht.
Niemand von uns wusste so recht, wie es weitergehen sollte. Erinnere ich mich an diesen Abend, fällt mir ein, dass es mir beinahe schon egal war, wer in Zukunft warum mit wem, was nun oder später oder auch gar nicht – sollten sie machen, was immer sie für richtig hielten. Solange sie mich dabei in Ruhe ließen. Während Oma und Hubert mit todernsten Gesichtern am Küchentisch saßen und die Lage debattierten, saß ich vor dem Fernseher und langweilte mich demonstrativ! Wenn ich schon nachdachte, dann dachte ich an Vater und ob er Mutter bereits erlegt hatte mit seiner Axt. Wenn ja, würde er uns sicher Bescheid geben, wegen der Beerdigung. Ansonsten ging ich davon aus, dass wir von nun an wieder in Düsseldorf bleiben würden. Mir fiel ein, dass ich mich gleich morgen im Fußballverein anmelden musste. Das mit Mutter wurde ja wohl nichts mehr. Die lebte jetzt mit Jan zusammen. Sollte der sie doch ertragen und durchfüttern. Falls es ihnen gelang, Vater zu entkommen. Was nicht sicher war. Zur Not, falls er ins Gefängnis kam, konnte ich immer noch bei Oma wohnen. Das Telefon klingelte. Zu meiner großen Überraschung war Mutter am Apparat. Und wie es schien, war sie sogar noch am Leben. Sonst hätte sie sich schwerlich bei Oma melden können. Die versuchte – vergeblich –, leise zu sprechen. Sie war außer sich. Wie es sich anhörte, wusste sie längst Bescheid über das Treiben ihrer dem Leben zugewandten Tochter. Und nun hatten sich ihre schlimmsten Befürchtungen bewahrheitet. Vater erwähnte sie mit keinem Wort.